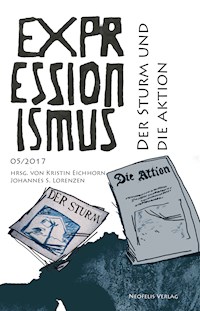Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Klartext
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am Ende der Weimarer Republik war die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) eine weitgehend undemokratische und bürokratische Partei, ihre politische Linie wurde aus Moskau vorgegeben. Doch das war nicht immer so. Vielmehr erlebte die KPD im Lauf der zwanziger Jahre einen fundamentalen Wandel. Nicht alle Kommunisten ließen diesen Prozess, der als "Stalinisierung“ bezeichnet wird, widerspruchslos über sich ergehen. Im linken Parteiflügel entstanden verschiedene Gruppen und Fraktionen, die sich gegen die Entdemokratisierung wehrten und für eine Rückkehr zur "alten KPD“ kämpften. Später engagierten sich die Oppositionellen auch gegen die immer stärker werdenden Nationalsozialisten. Denn anders als die KPD-Führung hatten sie sehr früh die Gefahr erkannt, die von Hitler für die deutsche Arbeiterbewegung ausging. Die KPD-Linken hatten zeitweilig zehntausende Anhänger. Darunter befanden sich bekannte Parteimitglieder wie Ruth Fischer, Karl Korsch oder Werner Scholem. Trotzdem verloren sie den Kampf um ihre Partei - nicht zuletzt, weil ihre Kritik vielen als unaufrichtig erschien. Denn an der Entdemokratisierung der KPD hatten sie selbst einen wichtigen Anteil. Anhand bislang unbekannter Quellen hat Marcel Bois erstmals eine Gesamtdarstellung der linken KPD-Opposition geschrieben. Er stellt knapp ein Dutzend verschiedene Gruppen vor, wie den Leninbund oder die bislang kaum erforschte Weddinger Opposition. Dabei untersucht er ausführlich deren Sozial- und Organisationsgeschichte und gibt so einen lebendigen Einblick in das Innenleben einer weitgehend vergessenen Strömung des deutschen Kommunismus. "Kommunisten gegen Hitler und Stalin“ wurde mit dem Wissenschaftspreis 2015 der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen ausgezeichnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1167
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcel BoisKommunisten gegen Hitler und Stalin
Marcel Bois
Kommunisten gegenHitler und Stalin
Die linke Opposition der KPDin der Weimarer Republik
Eine Gesamtdarstellung
Gedruckt mit freundlicher Unterstützung durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung.
D83Zugl.: Berlin, Technische Universität, Diss., 2014
1. Auflage, November 2014
Satz & Gestaltung: Griebsch & Rochol Druck GmbH & Co. KG, Hamm
Umschlaggestaltung: Volker Pecher, Essen
Titelabbildung: Herbert Anger: Revolution, Titelblatt zu „Die Aktion“, IX. Jahr, hrsg. v.
Franz Pfemfert, Nr. 45/46, Sonderheft „Revolution“, 15. November 1919, Holzschnitt
„Bürgerstiftung für verfolgte Künste Else-Lasker-Schüler-Zentrum – Kunstsammlung Gerhard Schneider“ im Kunstmuseum Solingen
ISBN 978-3-8375-1282-3eISBN 978-3-8375-1421-6
© Klartext Verlag, Essen 2014
Alle Rechte vorbehalten
www.klartext-verlag.de
In Erinnerung an Lothar Bois (1949–2012)
Vorbemerkung zu Orthografie und Schreibweisen
Dieses Buch ist in neuer Rechtschreibung verfasst. Zitate aus der Sekundärliteratur und den Quellen habe ich aus Gründen der besseren Lesbarkeit angeglichen und offensichtliche orthografische Fehler stillschweigend korrigiert. Einzig Textstellen, bei denen es mir auch darum ging, den altertümlichen Duktus darzustellen, habe ich in der Originalschreibweise belassen. Ebenfalls unverändert geblieben ist die Schreibweise von Personennamen und Buchtiteln in den bibliografischen Angaben. Hier kann es also durchaus vorkommen, dass ein Autor in unterschiedlichen Schreibweisen erscheint (beispielsweise: Leo Trotzki, Leo Trotzky oder Leon Trotsky). Bei der Darstellung russischer Namen wird in der Regel die im Deutschen geläufige Schreibweise der wissenschaftlichen Transliteration vorgezogen (Bolschewiki statt Bol’ševiki). Ebenfalls aus Gründen der Lesbarkeit habe ich darauf verzichtet, zu „gendern“ (Kommunisten statt KommunistInnen), jedoch, wo es möglich war, geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet.
Inhalt
Vorbemerkung zu Orthografie und Schreibweisen
Danksagung
1. Einleitung
1.1 Gegenstand des Buchs
1.2 Forschungsstand und Quellenlage
1.3 Methodik: Sozial- oder Politikgeschichte?
1.4 Leitfragen und Aufbau
2. Die Vorgeschichte der linken Opposition
2.1 Russische Revolution und Aufstieg des Stalinismus
2.2 Auswirkungen auf die Komintern
2.3 Die Stalinisierung der KPD
3. Linksradikalismus in der frühen KPD
3.1 Begriffsklärung: Linksradikalismus und Linkskommunismus
3.2 Die erste linke Opposition (1919-1920)
3.3 Die „ultralinke“ KPD: Offensivtheorie und Märzaktion (1920-1921)
3.4 Gegenreaktion: Die Phase der Einheitsfrontpolitik (1921-1923)
3.5 Der Deutsche Oktober (1923)
3.6 Die Linke im Parteivorstand (1924-1925)
4. Linke Opposition gegen die Stalinisierung
4.1 Die KPD zwischen Einheitsfront und Entdemokratisierung
4.2 Zersplitterte Opposition gegen die Stalinisierung (1925-1926)
4.3 Die russische Frage: Der „Brief der 700“ (1926)
4.4 Die Zerschlagung der Opposition (1926-1927)
4.5 Opposition außerhalb der Partei
4.6 Eine gemeinsame Organisation: Der Leninbund (1928-1930)
4.7 Vergessene Kommunisten (1928-1930)
4.8 Weitere Zersplitterung und Aufbauerfolge (1930-1933)
5. Der Kampf gegen den Faschismus
5.1 Unterschiedliche Konzepte
5.2 Exkurs: So nah und doch so fern – Thalheimer und Trotzki
5.3 Umsetzung
5.4 Ausblick: Linke Kommunisten im Widerstand
6. Sozialgeschichte der Linken Opposition
6.1 Sozialstruktur
6.2 Regionale Unterschiede
6.3 Organisatorische Entwicklung
6.4 Politische Betätigungsfelder
6.5 Internationale Beziehungen
7. Fazit: Die Geschichte einer gescheiterten Alternative
Anhang
„Stammbaum“ der KPD-Linken
Glossar: Linke Gruppen in der Weimarer Republik
Quellen- und Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Personenverzeichnis
Verzeichnis der linken Oppositionsgruppen
Zum Autor
Danksagung
In jedem Ende liegt ein neuer Anfang. So lautet ein chinesisches Sprichwort, das mir am 23. November 2012 nun wahrlich nicht in den Sinn kam. Es war der Tag, als der Vorstand des Verlagshauses Gruner und Jahr vor die Belegschaft trat und das Aus der „Financial Times Deutschland“ verkündete. Seit vielen Jahren arbeitete ich damals in deren Redaktion. Nun sollte ich also, genau wie 350 Kolleginnen und Kollegen, meinen Arbeitsplatz verlieren.
Zwei Jahre später kann ich sagen: Es wurde tatsächlich ein neuer Anfang daraus. Eigentlich hatte ich bei der „Financial Times Deutschland“ gearbeitet, um mein Dissertationsprojekt zu finanzieren. Doch je länger ich dort war, desto mehr wurde die wissenschaftliche Betätigung zum „Nebenjob“. Erst das Ende der Zeitung gab mir den Freiraum, mich endlich wieder intensiv meiner Doktorarbeit zu widmen und sie zügig abzuschließen: Im März 2014 habe ich sie an der Fakultät I der Technischen Universität Berlin eingereicht und am 14. Juli 2014 ebendort verteidigt. Hiermit liegt sie nun als Buch vor.
Ich begann die Dissertation zunächst an der Universität Hamburg, wo Prof. Dr. Klaus Saul sie betreute. Er hatte mich dankenswerterweise dazu ermutigt, meine Magister- zur Doktorarbeit auszubauen. Leider konnte er mich aufgrund gesundheitlicher Probleme schon bald nicht mehr unterstützen. Prof. Dr. Stefanie Schüler-Springorum bot daraufhin freundlicherweise an, die Betreuung zu übernehmen. Seitdem stand sie mir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite – und bewahrte mich davor, das Forschungsvorhaben ins Uferlose auszudehnen. Für ihre Unterstützung möchte ich ihr ganz herzlich danken. Ebenfalls ein großes Dankeschön geht an Prof. Dr. Mario Keßler. Er hat diese Arbeit – nicht nur aufgrund seiner fachlichen Expertise – weitaus intensiver betreut, als das vermutlich für einen Zweitgutachter üblich ist.
Einen wichtigen Anteil am Entstehen dieses Buches hatte auch Dr. Florian Wilde. Wir promovierten zeitgleich und führten dementsprechend zahlreiche Gespräche und Diskussionen über Fragen der Historischen Kommunismusforschung. Deren Ergebnisse sind nicht nur in gemeinsame Artikel und Vorträge eingeflossen, sondern auch in diese Arbeit. Ebenfalls intensiv über die Geschichte der Weimarer KPD durfte ich mich mit Sebastian Zehetmair austauschen. Er war darüber hinaus so nett, einzelne Kapitel meiner Dissertation kritisch zu begutachten. Das gilt auch für Stefan Bornost und Daniel Friedrich, die jeweils mit dem Blick des „Nichtexperten“ Teile der Arbeit gelesen und sehr hilfreiche Anmerkungen gemacht haben. Ihnen allen bin ich zu großem Dank verpflichtet.
Das gesamte Manuskript auf Fehler bei Interpunktion und Orthografie durchgeschaut hat Alicia Solzbacher. Ich bin ihr unendlich dankbar dafür, dass sie dieses umfangreiche Unterfangen neben Familie und stressigem Job auf sich genommen hat. Einzelne Kapitel hat zudem Marie-Theres Langer Korrektur gelesen. Auch ihr möchte ich herzlich danken. Sie möge mir verzeihen, dass ich nicht jedes Komma vor einem erweiterten Infinitiv gelöscht habe.
Mit vermeintlichen Marginalien habe ich in den vergangenen Jahren zahlreiche Kolleginnen und Kollegen belästigt. Zu nennen sind hier: Gleb Albert, Dr. Frédéric Cyr, Dr. Cornelia Domaschke, Wilfried Dubois, Dr. Horst Helas, Andreas Herbst, Dr. Ralf Hoffrogge, Prof. Dr. Klaus Kinner, Dr. Norman LaPorte, Ottokar Luban, Wolfgang Lubitz, Dr. Ulla Plener, Dr. Hans-Rainer Sandvoß, Dr. Hans Schafranek, Felix Strangfeld, PD Dr. Reiner Tosstorff und Dr. Rüdiger Zimmermann. Ob es um verschollene Literatur, kleinere inhaltliche Fragen oder biografische Informationen zu wenig bekannten Kommunisten ging: Sie alle haben mir freundlich und kompetent weitergeholfen und so kleine, aber wichtige Hinweise geliefert, das teilweise sehr verworrene Geflecht des deutschen Linkskommunismus zu entwirren. Das gilt auch für Heinz-Jörgen Kunze-von Hardenberg, der sein Wissen über Iwan Katz mit mir teilte, für Johannes Wöllfert vom Verein für Brunsbütteler Geschichte, der mich mit Informationen über den lokalen Linkskommunisten Peter Umland versorgte, und vor allem für Wilfried Harthan vom „Heinrich Czerkus BVB-Fanclub“, der mir das Leben des Kommunisten und ehemaligen Platzwarts von Borussia Dortmund ein wenig näher brachte. Ihnen allen möchte ich vielmals danken.
Dieses Buch wäre nicht denkbar gewesen ohne umfangreiche Literatur- und Quellenrecherchen. Daher sei an dieser Stelle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller im Anhang erwähnten Archive gedankt. An den stellvertretenden Leiter des Stadtarchivs Ludwigshafen, Dr. Klaus-Jürgen Becker, geht ein besonders großer Dank. Er hat sich während meines Aufenthalts in der Pfalz äußerst hilfsbereit gezeigt, mir umfangreiche Informationen und Tipps gegeben und mich sogar sein Privatarchiv nutzen lassen. Mindestens genauso hilfsbereit war Angelika Voß-Louis vom Archiv der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Sie hat mir dankenswerterweise die Sammlung zur KPD (Opposition) zu einem Zeitpunkt zugänglich gemacht, als diese noch gar nicht vollständig erschlossen war. Auch dem Stadtarchivar Dr. Axel Metz aus Bocholt möchte ich dafür danken, dass er mir wertvolle Hinweise über Joseph Schmitz und die Gruppe Kommunistische Politik in seiner Heimatstadt zukommen ließ.
Ein besonders häufiger Gast war ich während der Arbeit an diesem Buch in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt mein besonderer Dank, namentlich Dörte Eggers, Dr. Dieter Ludwig und nicht zuletzt Sarah Unrau. Unzählige Male hat sie mich vor davor bewahrt, mein Benutzerkonto zu überziehen, oder mir unkompliziert jeden noch so ausgefallenen Literaturwunsch erfüllt.
Einen großen Beitrag dazu, dass dieses Buch erscheinen konnte, lieferte die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie unterstützte mein Promotionsprojekt nicht nur mit einem Stipendium und finanzierte meine Forschungsaufenthalte in Amsterdam und Cambridge, sondern bezuschusste auch die Druckkosten. Dafür möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Studienwerks herzlich danken. Ein Dank geht auch an den Klartext-Verlag, vor allem an Dr. Ludger Claßen für die Entscheidung, dieses Buch ins Verlagsprogramm aufzunehmen, und an Lektorin Stefanie Döring für die freundliche und geduldige redaktionelle Betreuung.
Nicht unerwähnt bleiben soll die Unterstützung, die ich durch Freunde und Bekannte erfahren habe. Zu nennen sind hier an erster Stelle meine ehemaligen Mitbewohner Markus Barton, Johanna Kölzer und Katrin Rückert, die über einen langen Zeitraum dieses Projekt begleitet haben. Ihnen möchte ich für viel Zuspruch, noch mehr Kaffee und die manchmal dringend notwendige Ablenkung danken. Markus Barton gebührt zudem Dank für seine häufigen Botengänge in die Bibliothek. Ebenfalls ein herzliches Dankeschön geht an Sarah Gottschalk – für ihre moralische Unterstützung, diverse Übersetzungen aus dem Französischen und vor allem für die umfangreiche Zuarbeit während meines Forschungsaufenthalts an der Harvard University. Bei Carla Assmann möchte ich mich für ihre Archivrecherchen in München bedanken und bei Yaak Pabst dafür, dass er den „Stammbaum“ der KPD-Linken im Anhang gestaltet hat. Ihm ist es tatsächlich gelungen, meine Handzeichnung in eine vorzeigbare Grafik zu verwandeln.
Zu großem Dank bin ich auch jenen Freundinnen und Freunden verpflichtet, die mir während meiner Archivreisen einen Schlafplatz zu Verfügung stellten. Zu nennen sind hier Nils Böhlke, David und Claudia Devinck, Alicia Solzbacher und Martin Hommel, sowie vor allem Simon Japs und Elisabeth Furtwängler. Bei ihnen war ich, aufgrund zahlreicher Forschungsaufenthalte in Berlin, besonders häufig zu Gast und konnte mich stets auf „mein“ Zimmer freuen.
Einen sehr speziellen Dank möchte ich Janne Grote aussprechen – für eine intensive, anstrengende, aber auch ungeheuer spannende Zeit, die wir zum Ende der „Financial Times Deutschland“ gemeinsam durchlebten. Sie hat gewissermaßen die Grundlage für meinen „Dissertations-Endspurt“ gelegt. Ebenfalls danken will ich meiner damaligen Vorgesetzten, Cosima Jäckel. Sie sorgte dafür, dass ich – obwohl bereits freigestellt – mein Büro behalten durfte. So konnte ich über Monate in Ruhe meiner Forschung nachgehen, während um mich herum im wahrsten Sinne des Wortes ein Betrieb abgerissen wurde.
Abschließend möchte ich von ganzem Herzen meiner Familie danken – etwa meiner Schwester Michelle, die immer ein offenes Ohr für mich hatte, oder meinen Schwiegereltern Bärbel und Ralf Dierig für ihre Hilfe im Vorfeld der Disputation. Der Dank, den ich an meine Lebensgefährtin Claude richten möchte, lässt sich nur schwer in Worte fassen. Sie hat oft Geduld aufgebracht, mir viel Zuspruch zuteilwerden lassen und mir unendlich viel Unterstützung gegeben. Vor allem seit der Geburt unseres Sohnes Nelio schuf sie mir die Freiräume, die es ermöglichten, dass ich sprichwörtlich auch mein zweites „Baby“ auf die Welt bringen konnte.
Ein riesiges Dankeschön geht auch an meine Eltern, Lothar und Evi Bois. Sie haben meinen Weg immer bedingungslos und auf vielfältige Weise unterstützt. Umso mehr bedauere ich es, dass mein Vater das Ende dieses Weges nicht mehr miterlebt hat. Seinem Gedenken ist dieses Buch gewidmet.
1. Einleitung
1.1 Gegenstand des Buchs
Moskau, August 1939: Frida van Oorten ist seit Jahren eine linientreue Kommunistin, kämpfte im Untergrund gegen die Nazis. Lange Zeit arbeitete sie für den sowjetischen Geheimdienst. Doch nun gerät sie selbst in dessen Visier. Als sie in den Kellern des Innenministeriums verhört wird, bricht es schließlich aus ihr heraus. „Er!“, ruft sie und deutet auf das Stalin-Gemälde. „Er ist der Verräter!“
Es ist nur eine kleine Sequenz in Leander Haußmanns Spielfilm „Hotel Lux“.1 Doch in ihr kommt die Tragik einer ganzen Generation mitteleuropäischer Kommunisten zum Ausdruck. Inspiriert von der Oktoberrevolution in Russland wurden sie Kämpfer für eine bessere Welt. Sie engagierten sich für die Überwindung des Kapitalismus, gingen zu Tausenden in den antifaschistischen Widerstand und flüchteten schließlich in ihr „gelobtes Land“, die Sowjetunion. Allerdings hatte sich dort der Sozialismus, für den sie jahrelang gekämpft hatten, mittlerweile in sein Gegenteil verkehrt: Arbeiter wurden ausgebeutet, Andersdenkende in Arbeitslager gesteckt und dissidente Kommunisten politisch verfolgt. All das ließ sich noch irgendwie rechtfertigen: Es sei notwendig für den Aufbau einer neuen Gesellschaft und im Kampf gegen innere und äußere Feinde des jungen Sowjetstaats.
Doch ein Ereignis konnte sich kaum mehr ein Kommunist schönreden, erst recht nicht, wenn er aus Nazi-Deutschland geflüchtet war: den „Hitler-Stalin-Pakt“, ein deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt, der am 23. August 1939 unterzeichnet wurde. Dieser Bündnisschluss, an dessen Vorabend „Hotel Lux“ spielt, ließ Tausende Kommunisten sprichwörtlich vom Glauben abfallen. Fassungslos mussten antifaschistische Widerstandskämpfer mitansehen, wie sich der Mann ihres Vertrauens mit ihrem größten Feind verbündete. Hitler hatte sie verfolgt, Tausende ihrer Genossen inhaftieren und ermorden lassen. Mit ihm, dem wahrscheinlich gefährlichsten Antikommunisten des Kontinents, schloss der sowjetische Generalsekretär nun also einen Staatsvertrag.
Etliche Kommunisten brachen daraufhin mit ihrer Bewegung. Stellvertretend für sie steht der langjährige Kominternfunktionär Willi Münzenberg. Im September 1939 verfasste er einen anklagenden Artikel, für den er ähnliche Worte wählte wie die fiktive Figur van Oorten: „Heute stehen in allen Ländern Millionen auf, sie recken den Arm, rufen, nach dem Osten deutend: ‚Der Verräter, Stalin, bist du‘.“2
Nicht für alle zeitgenössischen Beobachter kam dieser Verrat überraschend. Infolge der Oktoberrevolution von 1917 hatten die russischen Kommunisten zwar den Versuch unternommen eine sozialistische Gesellschaft zu errichten, eine Gesellschaft ohne Armut, Hunger und Unterdrückung. Doch ein Jahrzehnt später klaffte eine deutliche Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Der Staat, der aus der Revolution hervorgegangen war, nannte sich zwar „Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken“ (UdSSR) – doch dieser Name hatte nicht mehr viel mit der Realität zu tun. Die einzelnen Teilstaaten waren Ende der 1920er Jahre ebenso wenig sozialistisch wie sie Räterepubliken waren. Auch von einer Union, also einem freiwilligen und gleichberechtigten Zusammenschluss, konnte keine Rede mehr sein. Stattdessen entwickelte sich im Land zunehmend eine Ein-Parteien-Herrschaft mit der Stalin-Clique an der Spitze.
Zugleich gerieten die ausländischen kommunistischen Parteien immer mehr in Abhängigkeit vom stalinistischen Regime und entfernten sich von ihren ursprünglichen Idealen. Allen voran galt dies für die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD). Sie war um die Jahreswende 1918/19 von Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und anderen bekannten Köpfen der deutschen Linken gegründet worden, zu einer Zeit, als im ganzen Land eine politische Aufbruchsstimmung zu spüren war. Eine Massenbewegung von Arbeitern und Soldaten hatte gerade den Ersten Weltkrieg beendet, die Monarchie gestürzt und weitreichende soziale Verbesserungen erkämpft. Eine parlamentarische Demokratie wurde installiert und die Weimarer Republik entwickelte sich in den 1920er Jahren zu einer der liberalsten Gesellschaften der damaligen Zeit. Doch die Republik konnte einige gesellschaftliche Widersprüche nicht auflösen, allen voran die soziale Ungleichheit. Nicht zuletzt deswegen konnte die KPD zur größten kommunistischen Partei außerhalb der Sowjetunion heranwachsen.
Doch während die Partei nach außen unnachgiebig Krise, Krieg und Kapitalismus kritisierte, war im Inneren das emanzipatorische Feuer aus der Zeit Rosa Luxemburgs längst erloschen. Die KPD durchlief einen Wandlungsprozess, der heute von der Forschung als „Stalinisierung“ bezeichnet wird.3 Parallel zum Aufstieg Stalins in der Sowjetunion geriet sie materiell und ideologisch in immer stärkere Abhängigkeit von ihrer russischen Schwesterpartei. Unter der Führung Ernst Thälmanns verwandelte sie sich in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre von einer eigenständigen kommunistischen Partei in ein Instrument der russischen Außenpolitik. Zunehmend orientierte sie sich an der stalinisierten sowjetischen Partei, an dem Ideal einer militärisch disziplinierten, straff hierarchischen Organisation – einer Kultur, die im starken Kontrast zum Parteileben der Gründungsjahre stand. Interne Diskussionen wurden weitgehend unterbunden, Konflikte nicht politisch, sondern organisatorisch, also durch Ausschlüsse und Repressalien „gelöst“. Kritiker belegte das Thälmann-ZK mit Redeverboten oder entfernte sie kurzerhand aus der Partei. Insgesamt herrschte eine enorme Fluktuation unter den Mitgliedern und sogar innerhalb der Parteiführung: Beispielsweise befanden sich im Jahr 1929 von den 16 Spitzenfunktionären der Jahre 1923 und 1924 nur noch zwei im Politischen Büro (Polbüro), dem höchsten Führungsgremium. Nicht weniger als elf waren hingegen aus der KPD ausgeschlossen worden.4 Mit diesem personellen Aderlass ging eine ideologische Erstarrung einher, die politischen Positionen der KPD wurden immer dogmatischer – oder wie es die Historikerin Sigrid Koch-Baumgarten ausdrückte: Die Sowjetunion wurde „zum heiligen Land stilisiert, Marx, Engels, Lenin […] wie Religionsstifter verehrt“.5 Zugleich entwickelte sich der Parteivorsitzende Ernst Thälmann als „unfehlbare[r] Führer“ zu einer „deutsche[n] Kopie“ Stalins.6
Die Parteiführung bezeichnete diesen Prozess, durch den die Partei ab 1924 vereinheitlicht werden sollte, als „Bolschewisierung“. Ziel war es, eine „geistig absolut monolithe“ Organisation zu schaffen, wie es später hieß.7 Doch zunächst geschah das Gegenteil. Die Wandlung der KPD stieß auf massiven Widerspruch unter den Mitgliedern, die Partei differenzierte sich aus.8 Verschiedene innerparteiliche Strömungen wehrten sich gegen die bürokratische Entwicklung und setzten sich für eine Rückkehr zur „alten KPD“ ein. Vereinfacht lassen sich hier drei innerparteiliche Oppositionsrichtungen ausmachen: Die „Rechten“, die „Linken“ und die Mittelgruppe, die sogenannten „Versöhnler“.
Die quantitativ größte Strömung war die Linke. Mitte der 1920er Jahre repräsentierte sie einen erheblichen Teil der kommunistischen Basis. Dennoch ist sie heute nahezu unbekannt. Sie vorzustellen, ihre politischen Ansichten darzulegen und ihre Entwicklung zu untersuchen, ist das Ziel dieses Buches. Auf diese Weise soll ein Beitrag dazu geleistet werden, das gelegentlich gezeichnete Bild der KPD als einer nahezu monolithischen Partei zu korrigieren. Denn die Existenz der Linken verdeutlicht, dass ein alternativer Entwicklungsweg des deutschen Kommunismus zumindest denkbar war. Wie zu zeigen sein wird, war auch diese Strömung keineswegs frei von „Irrungen und Wirrungen“. Zum Teil vertrat sie Ansichten, die geradewegs dazu geeignet waren, die KPD in die gesellschaftliche Isolation zu katapultieren.
Linke Opposition in einer linken Partei? Das klingt nach Tautologie. Tatsächlich ist diese Begrifflichkeit keineswegs besonders aussagekräftig.9 Da es sich jedoch um eine zeitgenössische Selbst- und Fremdbezeichnung handelt, soll sie auch hier verwendet werden – trotz aller Probleme, die sich daraus ergeben. Beispielsweise ist es schwierig, die KPD-Linke inhaltlich zu bestimmen. Der Grund dafür ist, dass es nicht die eine linke Opposition gab. Anders als die halbwegs homogenen Strömungen der Rechten10 und der Versöhnler11 war die Linke extrem zersplittert. Insgesamt gliederte sie sich in knapp ein Dutzend verschiedene Gruppen auf. Einige davon standen syndikalistischen Positionen nahe, andere rätekommunistischen und wieder andere bezeichneten sich als trotzkistisch.
Was die KPD-Linke bei aller Heterogenität zumindest in den ersten Jahren ihrer Existenz einte, war ihre kritische Haltung gegenüber den freien Gewerkschaften und die Ablehnung jeglicher Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie, später dann die entschiedene Gegnerschaft gegen die Stalinisierung der KPD. Zum Alleinstellungsmerkmal der Linksoppositionellen wurde schließlich die fundamentale Kritik an den Entwicklungen in der damaligen Sowjetunion. Die möglichen Folgen des Aufstiegs Stalins erkannten sie deutlich und warnten eindringlich vor einer Degeneration des sozialistischen Experiments.
In den letzten Jahren der Weimarer Republik wurde dann auch die Beschäftigung mit den immer stärker werdenden Nationalsozialisten zu einem zentralen Element in der Politik der Linken Opposition. Schon früh erkannte sie die Gefahr, die von den Nazis für die deutsche Arbeiterbewegung ausging. Während die KPD-Führung den Aufstieg Hitlers in seiner Tragweite keineswegs erfasste, stattdessen die Sozialdemokraten als „Sozialfaschisten“ diffamierte und zum „Hauptfeind“ erklärte, warnten die Linken eindringlich vor einem möglichen Sieg des Faschismus. Nun gaben sie sogar ihre SPD-kritische Haltung auf: Dort, wo sie über die personellen Ressourcen verfügten, bemühten sie sich darum, Bündnisse von Gewerkschaftern, Sozialdemokraten und Kommunisten zur Abwehr der Nationalsozialisten aufzubauen.
Stalinismus und Faschismus: Der Kampf der KPD-Linken gegen diese beiden sehr unterschiedlichen Bewegungen steht also im Zentrum dieses Buches. Deshalb trägt es den Titel „Kommunisten gegen Hitler und Stalin“.12
1.2 Forschungsstand und Quellenlage
„Kommunisten gegen Hitler und Stalin“ möchte die Geschichte einer gescheiterten Alternative zum stalinisierten Kommunismus erzählen – einer alternativen Strömung in der deutschen Arbeiterbewegung, die heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Es haben sich zwar einige prominente kommunistische Persönlichkeiten im Lauf der 1920er Jahre der Linken Opposition angeschlossen, etwa die Ex-Parteivorsitzende (Ruth Fischer), ein ehemaliger thüringischer Justizminister (Karl Korsch) oder ein bekannter Historiker und späterer Autor einer viel beachteten Geschichte der Weimarer Republik (Arthur Rosenberg). Dennoch: Die linke, anti-stalinistische Opposition der KPD ist vollkommen aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Selbst vielen Historikern sagt diese Strömung nichts mehr. Das unterscheidet sie auch von der „rechts“-oppositionellen KPO (Kommunistische Partei Deutschlands-Opposition), die zumindest Kennern der KPD-Geschichte ein Begriff ist.
Für das Vergessen der Linkskommunisten kommen verschiedene Gründe in Betracht. In der DDR wurde diese Richtung entweder öffentlich verunglimpft oder schlichtweg ignoriert.13 Ihre ehemaligen Mitglieder waren, wie alle Oppositionellen, staatlicher Repression ausgesetzt. Diejenigen, die nach dem Krieg der KPD/SED beitraten, wurden bald wieder ausgeschlossen.14 Ab den frühen 1950er Jahren begann dann das Ministerium für Staatssicherheit etliche Linksoppositionelle der Weimarer Zeit zu observieren.15 In der alten Bundesrepublik erfuhr die Linke Opposition zumindest durch die Studentenbewegung der späten 1960er Jahre eine gewisse Beachtung. Auf der Suche nach Alternativen zwischen westlichem Kapitalismus und dem Staatssozialismus des „Ostblocks“ wurden ihre Theoretiker – vor allem Karl Korsch – wiederentdeckt und neu gelesen.16 Die Aufmerksamkeit der Studierenden galt jedoch vor allem jenen früheren linken Strömungen wie den Rätekommunisten, die komplett mit der KPD gebrochen hatten. Deutlich weniger rezipiert wurden oppositionelle Kräfte, die sich innerhalb der Kommunistischen Partei für einen Kurswechsel einsetzten.
Im Wissenschaftsbetrieb kam das zarte Interesse an der linken KPD-Opposition durch zwei Publikationen zum Ausdruck: Ende der 1970er Jahre erschien mit Rüdiger Zimmermanns Monografie über den Leninbund das bis heute gültige Standardwerk zu dieser Organisation.17 Einige Jahre später widmete sich Otto Langels im Rahmen seiner Dissertation den „ultralinken“ Gruppierungen (Entschiedene Linke, Gruppe „Kommunistische Politik“) der Jahre 1924 bis 1928.18 Darüber hinaus wurden in dieser Zeit noch drei universitäre Abschlussarbeiten verfasst: eine über die Entstehungsphase der KPD-Linken,19 eine weitere über die Hochphase der Opposition20 und eine dritte über die Ideologie des Leninbundes.21 Seitdem sind lediglich zwei Aufsätze und eine Studienarbeit hinzugekommen.22 Die Erforschung der linken KPD-Opposition der zweiten Hälfte der 1920er Jahre ist also bis heute nicht besonders weit fortgeschritten. Im Gegenteil: Eine Gruppe, die nach dem Berliner Bezirk benannte „Weddinger Opposition“, wurde bislang sogar nahezu vollständig von der Forschung ignoriert.23 Bestenfalls werden die Weddinger in Abhandlungen zur KPD-Geschichte am Rande erwähnt.24 Das ist erstaunlich, stellten sie doch zeitweise eine der stärksten innerparteilichen Fraktionen dar. Bis heute gilt, was Hans Schafranek bereits vor 25 Jahren konstatierte: „Nach wie vor stellt die durchgängige und systematische Erforschung der Weddinger Opposition […] ein Desiderat der zeitgeschichtlichen Forschung über linksoppositionelle Strömungen in Deutschland dar.“25 Diese Forschungslücke zu füllen, ist eines der Anliegen dieses Buches.
Über die Frage, weshalb die Geschichtswissenschaft gerade die Weddinger vernachlässigt hat, kann nur spekuliert werden. Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass sich kein Mitglied der Gruppe durch theoretische Schriften einen Namen gemacht hat. Ein anderer Grund könnte sein, dass sie keine über das Ende der Weimarer Republik hinausreichende politische Traditionslinie begründet hat. Für diese These spricht, dass jene Gruppen, die auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiter bestanden, heute als recht gut erforscht gelten können – nicht selten, weil aus den eigenen Reihen heraus wissenschaftliche „Traditionspflege“ stattgefunden hat. Dies ist sowohl bei der rechtskommunistischen KPO der Fall als auch bei der zum linken Parteiflügel zählenden trotzkistischen Opposition.26
Letztere stellt damit eine große Ausnahme in der Historiografie des deutschen Linkskommunismus dar. Bereits seit den späten 1950er Jahren sind kontinuierlich Arbeiten zu dieser Strömung erschienen.27 Den Anfang markierte die Promotionsschrift von Siegfried Bahne über den „Trotzkismus in Deutschland“ vor 1933.28 Im Zentrum dieser Arbeit stehen hauptsächlich die politischen Analysen Leo Trotzkis und seiner deutschen Anhänger. Eine erste Darstellung der organisatorischen Entwicklung der entsprechenden Gruppen hat Wolfgang Alles im Jahr 1978 im Rahmen seiner Diplomarbeit vorgelegt.29 Kurze Zeit später erschien hierzu in französischer Sprache die Dissertation von Maurice Stobnicer.30 Auf gewisse Weise waren beide Arbeiten jedoch schnell „veraltet“. Denn ihre Autoren konnten nicht den umfangreichen Nachlass Trotzkis auswerten, der erst im Jahr 1980, kurz nach Erscheinen ihrer Werke, freigegeben wurde.31 Hier befindet sich ein ausführlicher Briefwechsel zwischen dem russischen Revolutionär und den deutschen Linkskommunisten. Zugriff auf einen Teil dieser Dokumente hatte Annegret Schüle.32 In ihrer Ende der 1980er Jahre erschienenen Arbeit untersucht sie vor allem die Bemühungen der verschiedenen Ortsgruppen der trotzkistischen „Linken Opposition der KPD – Bolschewiki/Leninisten“ lokale Einheitsfront-Bündnisse gegen die Faschisten zu initiieren. Insgesamt hat sich die Forschung zum deutschen Vorkriegstrotzkismus spezialisiert. Zuletzt sind vor allem kürzere Regionalstudien entstanden. So behandeln zwei Aufsätze und eine Abschlussarbeit die Gruppen in Leipzig, Köln und im Rhein-Main-Gebiet.33 Über die Trotzki-Anhänger an Rhein und Ruhr hat Peter Berens eine Monografie veröffentlicht.34 Vor wenigen Jahren ist zudem eine Arbeit von Barbara Weinhold über eine trotzkistische Bergsteigertruppe in der Sächsischen Schweiz erschienen.35 Berens und Weinhold behandeln jedoch die Entwicklung in der Weimarer Republik nur am Rande. Der Schwerpunkt ihrer Untersuchungen liegt auf der Widerstandstätigkeit während der NS-Zeit.36 Dennoch kommt Berens das Verdienst zu, auf die bislang wenig beachteten personellen Kontinuitäten zwischen der frühen (ultra-)linken Opposition in der KPD und den späteren Trotzkisten hingewiesen zu haben.
Eine Gesamtdarstellung der antistalinistischen Linken in der KPD während der Weimarer Republik, die diese Kontinuitätslinie aufzeigt, existiert bislang nicht. Dass in der Vergangenheit stattdessen nur einzelne Gruppen untersucht worden sind, lässt sich unter anderem aus deren starker Zersplitterung erklären, auf die Mario Keßler – nicht ohne eine gewisse Ironie – hingewiesen hat: „Die Uneinigkeit sogar innerhalb der antistalinistischen kommunistischen Opposition könnte Thema einer eigenständigen Abhandlung sein.“37
Eine weitere Ursache ist möglicherweise in der Quellenlage zu suchen. Diese war in der Vergangenheit für Forschungen zur Geschichte linkskommunistischer Strömungen insgesamt nicht besonders gut. So klagte Wolfgang Alles Ende der 1970er Jahre: „Haupthindernis für das Zustandekommen einer Arbeit über die trotzkistische Bewegung in Deutschland ist die Schwierigkeit, zeitgenössisches Quellenmaterial zu beschaffen.“38 Ein anderes Problem jener Zeit benannte Zimmermann: „[…] soweit Spuren von Personen oder leicht lokalisierbare Druckerzeugnisse im geografischen Bereich der DDR gesucht werden mussten, ist dem Untersuchenden kaum Unterstützung zuteil geworden; in vielen Fällen wurde sogar die Ausleihe von Material verweigert.“39
Diese Schwierigkeiten sind mittlerweile Geschichte. In den Jahren nach dem Zusammenbruch des „Ostblocks“ sind zahlreiche wichtige Archive geöffnet worden, die der Historischen Kommunismusforschung die Möglichkeiten zu neuen quellengestützten Erkenntnisgewinnen bieten.40 In Bezug auf die Geschichte der linksoppositionellen Fraktionen innerhalb der Weimarer KPD wurden diese Möglichkeiten bislang jedoch kaum wahrgenommen. Alle einschlägigen Monografien zu den entsprechenden Gruppen sind vor 1990 erschienen.41
Somit hat keiner der Autoren die umfangreichen Bestände des ehemaligen Zentralen Parteiarchivs (ZPA) der KPD auswerten können. Dieses befindet sich heute in der Sammlung der Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR (SAPMO) im Berliner Bundesarchiv und stellt den wichtigsten Quellenbestand zur Geschichte der linkskommunistischen Strömungen dar. Es umfasst zahlreiche Rundschreiben, Briefe und Protokolle der verschiedenen oppositionellen Gruppen. Darüber hinaus existieren umfangreiche Bestände zu den einzelnen KPD-Bezirken und Ortsgruppen. Diese ermöglichen es, die innerparteiliche Opposition auch auf lokaler Ebene aufzuspüren. Zudem findet sich hier eine ausführliche, von der Parteiführung zusammengestellte Materialsammlung über die Aktivitäten der Opposition in den Jahren 1925 und 1926.42 Für den Historiker als Quellenmaterial ein Glücksfall, liefert diese Chronik doch ein erschreckendes Beispiel dafür, wie die kommunistische Bewegung bereits Mitte der 1920er Jahre den „Feind in den eigenen Reihen“ überwachte. Tatsächlich initiierte Moskau schon früh den Aufbau von Geheimdienststrukturen innerhalb der ausländischen kommunistischen Parteien. Ab Mitte der 1920er Jahre begann auch der Nachrichtendienst der KPD mit der Beobachtung von „Abweichlern“.43
Auch von staatlichen Stellen ist die KPD-Opposition observiert worden. So liefern die Akten des Reichskommissars für die Überwachung der öffentlichen Ordnung im Bundesarchiv ebenso relevante Erkenntnisse wie die Dokumente polizeilicher Überwachung aus den Staatsarchiven Bremen und Münster.44 Die umfangreichsten Quellenbestände für die Entwicklung der Linkskommunisten in den letzten Jahren der Weimarer Republik finden sich in der Houghton Library an der Harvard University in Cambridge, Mass. (USA). Hier ist der Nachlass Leo Trotzkis beherbergt, der einen umfangreichen Briefwechsel umfasst. Teil davon ist auch eine etwa 1.000 Briefe umfassende Korrespondenz mit deutschen Oppositionellen, hauptsächlich aus den Jahren 1929 bis 1933.45 Ebenfalls brauchbare Materialien aus der Spätphase der Opposition liefert das Archiv des Internationalen Instituts für Sozialgeschichte (IISG) in Amsterdam, vor allem in Form von Materialien der Internationalen Linken Opposition. Zur Erforschung der Weddinger Opposition lohnt sich ein Besuch im Stadtarchiv Ludwigshafen, wo sich einige interessante Quellen über deren Pfälzer Gruppe finden. Außerdem sei noch auf die Bestände des Hauptstaatsarchives Düsseldorf verwiesen. In den dortigen Gestapo-Akten finden sich zahlreiche biografische Hinweise zu in der NS-Zeit verfolgten Linkskommunisten.
All diese für die Erforschung der Opposition relevanten Archive habe ich besuchen und die dort befindlichen Quellen auswerten können. Darüber hinaus nahm ich Einsicht in die Bestände des Staatsarchivs Hamburg, der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin und des Trotzkismus-Archivs in der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn. Auch einzelne Quellen aus dem Stadtarchiv Speyer und dem Archiv des Instituts für Zeitgeschichte in München habe ich ausgewertet. Hinzu kam noch das KPO-Archiv in der Hamburger Forschungsstelle für Zeitgeschichte, das einige Materialien über das Verhältnis von „linken“ und „rechten“ Oppositionellen in der KPD bereithielt. Angesichts dieser Quellenmenge habe ich auf eine Reise nach Moskau verzichtet, um die Bestände des Russischen Staatlichen Archivs für soziale und politische Geschichte einzusehen. Hier habe ich mich mit jenen Beständen begnügt, die online in den „Comintern Electronic Archives“ abrufbar sind.46
Neben den Archivbeständen dienen als weitere Primärquellen zur Geschichte linksoppositioneller Kommunisten die von ihnen herausgegebenen Publikationen und Periodika. Diese sind leicht zugänglich, da sie größtenteils in den einschlägigen Archiven und Bibliotheken einzusehen sind (vor allem im Bundesarchiv Berlin sowie in den Bibliotheken der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn und des Instituts für soziale Bewegungen in Bochum).47Nur einige Zeitschriften wie „Der Pionier“ – das Organ der Pfälzer Gruppe der Weddinger Opposition – sind gar nicht mehr oder nur noch in Einzelexemplaren erhalten.48
Insgesamt hat sich die Quellenlage in den letzten zwei Jahrzehnten also deutlich verbessert. Nur in einem Punkt waren Historiker, die vor der Öffnung der Archive die linke Opposition erforscht haben, im Vorteil: Sie hatten die Möglichkeit, Zeitzeugen zu befragen – ein Privileg, das sowohl Alles als auch Schafranek und Zimmermann ausgiebig genutzt haben.49 Das ist heute leider nicht mehr möglich.50 Glücklicherweise haben zumindest einige oppositionelle Kommunisten Memoiren hinterlassen. Zu nennen sind die Lebenserinnerungen von Oskar Hippe und Karl Retzlaw. Materialreich ist auch die Zusammenstellung verschiedener Texte von Georg Jungclas zu einer Dokumentation seines politischen Lebens.51 Ebenfalls nützliche Quellen zur Thematik stellen der von Peter Lübbe herausgegebene Briefwechsel Ruth Fischers mit ihrem Kampf- und Lebensgefährten Arkadij Maslow sowie die vor wenigen Jahren veröffentlichten Schriften und Briefe Karl Korschs dar.52 Mit Vorsicht zu betrachten ist hingegen Fischers umstrittenes, autobiografisch geprägtes Werk „Stalin und der deutsche Kommunismus“.53 Nicht nur Otto Wenzel warnt: „Ihr Buch stellt eine einzige Glorifizierung der Politik der ‚linken‘ Kommunisten und Rechtfertigung ihrer damaligen Haltung dar, wobei ihre damaligen politischen Gegner manchmal in geradezu beschämender Weise herabgesetzt werden.“54
Einige führende Linkskommunisten sind zudem zum Gegenstand biografischer Forschungen geworden. Vor allem Mario Keßler hat sich hier hervorgetan, indem er Arbeiten über Ruth Fischer, Arthur Rosenberg und Arkadij Maslow veröffentlichte.55 Zuletzt erfreute sich Werner Scholem besonderer Beliebtheit. So sind zeitgleich mit dieser Untersuchung zwei Arbeiten über den Bruder des bekannten Religionshistorikers Gershom Scholem entstanden.56 Auch das im Dunstkreis der linken Opposition agierende Künstlerehepaar Franz Pfemfert und Alexandra Ramm-Pfemfert ist in Form biografischer Arbeiten und Dokumentationen gewürdigt worden.57 Darüber hinaus existieren kleinere Studien über Anton Grylewicz, Guido Heym, Katharina Roth, Joseph Schmitz, Wilhelm Schwan, Maria Sevenich und Hugo Urbahns.58 Aufgrund ihrer Detailfülle unbedingt hervorzuheben ist die von Hans Schafranek verfasste Biografie des österreichischen Kommunisten Kurt Landau, der sich am Ende der Weimarer Republik als Gesandter Trotzkis einige Jahre in Deutschland aufhielt.59 Als nützliches Nachschlagewerk dient zudem das von Hermann Weber und Andreas Herbst veröffentlichte Handbuch deutscher Kommunisten. Bereits die erste Auflage aus dem Jahr 2004 umfasste etwa 1.400 Kurzbiografien. Im Jahr 2008 erschien eine zweite Auflage, in welcher der Fundus noch um 275 Personenskizzen erweitert wurde. Darunter befinden sich etliche Linksoppositionelle.60
1.3 Methodik: Sozial- oder Politikgeschichte?
Im Gegensatz zu der relativ überschaubaren Anzahl von Darstellungen über die Linke Opposition ist es nahezu unmöglich, die gesamte Literatur zur Geschichte der Weimarer KPD zu erfassen.61 Dennoch sind vor allem zwei Werke hervorzuheben, die über Jahrzehnte den Blick der Wissenschaftsgemeinde auf die Geschichte der Partei geprägt haben. Dies war zum einen Ossip K. Flechtheims bereits 1948 veröffentlichte Pionierarbeit „Die KPD in der Weimarer Republik“ – lange Zeit die einzige Gesamtdarstellung zur Geschichte der Partei –, zum anderen die 1969 erschienene Dissertationsschrift von Hermann Weber über „Die Wandlung des deutschen Kommunismus“.62 Beide Autoren verfolgten in ihren Arbeiten einen eher politik- und ideengeschichtlichen Ansatz: Sie nahmen vor allem die Politik der Parteiführung, ihre ideologischen Auseinandersetzungen und den Einfluss der Sowjetunion auf die Entwicklung der KPD in den Blick. Diese Betrachtung der Parteigeschichte „von oben“ war über Jahrzehnte die herrschende methodische Herangehensweise in der Historiografie des deutschen Kommunismus.
Diese Methodik fundamental in Frage gestellt hat Klaus-Michael Mallmann in seiner im Jahr 1996 erschienenen, sozialhistorisch orientierten Habilitationsschrift „Kommunisten in der Weimarer Republik“.63 Er kritisiert, dass die „Geschichte des deutschen Kommunismus […] überwiegend noch die eines Dogmas ohne Menschen, einer Apparatherrschaft ohne Subjekte“ sei.64 Der politikgeschichtliche Ansatz Flechtheims und Webers könne „zwar scheinbar per se ein repräsentatives Ergebnis vorweisen“, er lasse „jedoch die – in der Regel nicht gestellte – sozialhistorische Frage nach der praktischen Relevanz unbeantwortet.“65 Mallmann will dem eine Geschichte „von unten“ entgegensetzen: Anstatt die zunehmende Abhängigkeit der KPD von der Komintern oder die Fraktionsauseinandersetzungen innerhalb der Partei zu untersuchen, stellt er den Widerspruch zwischen dem Avantgardeanspruch der KPD-Führung und der Milieuverwurzelung der Parteibasis ins Zentrum seiner Arbeit. Er geht dabei von einer starken regionalen Autonomie der einzelnen Parteigliederungen aus und vertritt die Ansicht, dass die Entwicklung des deutschen Kommunismus vor allem durch nationale Faktoren beeinflusst worden sei.
Wie später zu zeigen ist, überspannt Mallmann in seiner Abhandlung den Bogen deutlich und kommt teilweise zu fragwürdigen Ergebnissen.66 Zudem ignoriert er die Tatsache, dass sowohl Flechtheim als auch Weber durchaus sozialstrukturelle Methoden in ihre Arbeiten einfließen ließen.67 Jens Becker und Harald Jentsch bezeichnen sein Werk also nicht von ungefähr als einen „polemischen Rundumschlag […], der den Granden der westdeutschen KPD-Forschung schlicht die Kompetenz absprach, mit ihrem politik- und organisationszentrierten Ansatz […] adäquat die reale Geschichte der kommunistischen Bewegung und ihrer Mitglieder erklären zu können“68 Dennoch muss man konstatieren, dass Mallmann in seiner Arbeit auch innovative Ansätze verfolgt und wichtige Fragen aufwirft. So war es nur folgerichtig, dass in den vergangenen Jahren weitere sozialhistorisch ausgerichtete Arbeiten erschienen sind.69 Jedoch ist in dieser Zeit eine unnötige Konfrontation zwischen Sozial- und Politikgeschichte entstanden – oder, wie Till Kössler es ausdrückte: Die Einschätzung, „ob eher die Abhängigkeit von der kommunistischen Führung in Moskau oder eine Verwurzelung in lokalen sozialistischen Traditionen und sozialdemokratischen Milieus die Entwicklung der KPD erklären kann“ hat sich zwischenzeitlich „zu einer Art Gretchenfrage der deutschen Kommunismusforschung entwickelt“.70
Dabei ist es wenig zweckdienlich, die Perspektiven „von oben“ und „von unten“ gegeneinander auszuspielen. Zu Recht hat schon Klaus Weinhauer in einer Besprechung von Mallmanns Buch „eine Synthese“ eingefordert, „die Organisations- und Sozialgeschichte zusammenführt“. Es sei „notwendig, die Partei als soziale Organisation im doppelten Spannungsfeld zwischen äußeren Einflüssen (Stalin, KI) und Milieuverankerung zu analysieren.“71 In jüngster Zeit ist dieser Anforderung Norman LaPorte nachgekommen. In seiner Arbeit über die sächsische KPD betont er zum einen den Einfluss nationaler und internationaler Entscheidungen auf die regionalen Parteigliederungen und stellt damit Mallmanns These von der Autonomie der unteren Parteiebenen in Frage. Zum anderen argumentiert er jedoch, dass regionale politische Traditionen und sozioökonomische Faktoren durchaus Einfluss auf die Haltung der lokalen Gruppen gehabt haben.72 So ist es ihm auf plausible Art und Weise gelungen den vermeintlichen Gegensatz zwischen Kommunismusforschung „von unten“ und „von oben“ aufzuheben. Er präsentiert einen Ansatz, der sich durchaus als wegweisend für künftige Arbeiten über die Geschichte der KPD herausstellen könnte.
Auch für die Erforschung der innerparteilichen Opposition erscheint diese Herangehensweise als sinnvoll. Bislang war in der Historiografie des Linkskommunismus der Blick „von oben“ vorherrschend. In eher politikwissenschaftlich orientierten Untersuchungen zur Geschichte der KPD wurden diese Strömungen häufig ausführlich gewürdigt. Sozialhistorische Arbeiten haben dagegen die Opposition – wenn überhaupt – nur als Randerscheinung betrachtet. Mallmann, der den Hauptwiderspruch in der Partei zwischen Basis und Parteiführung ausmacht, meint sogar: „Dem in der Kommunismus-Forschung überstrapazierten Denkbild der Fraktion sollte aus sozialhistorischer Perspektive eher misstrauisch begegnet werden.“ Dieses „entsprang eher dem pathologischen, verschwörungsorientierten Weltbild der Avantgarde, bot ihr Schubladen, in die sie die Wirklichkeit stopfte, war ein Instrument, mit dem man Gruppen konstruieren, Sündenböcke personifizieren und Abweichungen fixieren konnte. Als Erklärungsmodell der innerparteilichen Frontlinien an der Basis taugt es nichts […].“73 Dementsprechend spielten die oppositionellen Gruppen in seiner Arbeit keine Rolle.
Umgekehrt haben sich die Autoren der bisherigen Studien zur Geschichte der Linksopposition nicht an die sozialgeschichtliche Methodik gewagt. Im Zentrum dieser Werke standen stets die Auseinandersetzungen mit der Parteiführung und die organisatorische Entwicklung der jeweiligen Gruppen.74 Selbst Falk Engelhardt, der sich bei seiner Arbeit über die Linksopposition in Leipzig stark auf LaPortes Untersuchung stützen konnte, ist nicht vom klassischen politikgeschichtlichen Weg abgewichen.75 Dies verwundert nicht, denn diese Herangehensweise war und ist durchaus sinnvoll. Die Herausbildung der Opposition stellte schließlich eine Reaktion auf den Aufstieg des Stalinismus in der Sowjetunion und die zugleich stattfindende Stalinisierung der KPD dar. Die einzelnen Fraktionen entstanden in der Auseinandersetzung mit der Parteiführung, ihre Positionen wurden zumeist von bekannten Kommunisten formuliert und richteten sich hauptsächlich gegen die politische Orientierung der Partei. Insofern ist der politikgeschichtliche Ansatz unabdingbar, um die Entstehung und Entwicklung der linkskommunistischen Strömung in der Weimarer Republik darzustellen.
Eine Untersuchung, die ergänzend auch sozialgeschichtlich vorgeht, kann den Blickwinkel jedoch erweitern. Sie kann beispielsweise aufzeigen, wer die sozialen Träger der Opposition waren und erklären, weshalb die verschiedenen Strömungen über bestimmte regionale Hochburgen verfügten – wie LaPortes Arbeit ja bereits am Beispiel Sachsen deutlich gemacht hat. Sie kann des Weiteren die Bedeutung von verschiedenen sozialen Gruppen innerhalb der Parteilinken bewerten. Spielten Frauen eine wichtigere Rolle als in der Gesamtpartei? War die Opposition tatsächlich, wie häufig dargestellt, vor allem eine Intellektuellen-Bewegung? Darüber hinaus kann ein solcher methodischer Ansatz neue Antworten auf die Frage liefern, weshalb die Opposition in ihrem Kampf um die Partei gescheitert ist: Warum hat die durchaus überzeugende Kritik an der Stalinisierung so wenig Anhänger gefunden – vor allem in einer Partei, die gemeinhin sehr autoritätenkritisch war?
Insofern möchte ich hier eine Synthese der Blickweisen „von oben“ und „von unten“ bei der Untersuchung der Geschichte der linken Opposition in der Weimarer KPD versuchen. Unter Berücksichtigung der Entwicklung der internationalen kommunistischen Bewegung und unter Heranziehung neuer Quellenbestände soll so ein umfassendes Bild dieser zum Teil vergessenen Bewegung gezeichnet und die erste Gesamtgeschichte der Linken Opposition der KPD in der Weimarer Republik geschrieben werden.
1.4 Leitfragen und Aufbau
Peter Berens hat darauf hingewiesen, dass die bisherige Geschichtsschreibung des Linkskommunismus stark von der Darstellung interner Debatten geprägt gewesen sei: „Dies war bei den materialreichen Standardwerken […] geradezu unvermeidlich. Sie bestärken jedoch ungewollt das Vorurteil, dass Linkskommunisten […] meist mit internen ‚Streitigkeiten‘, d. h. mit sich selbst beschäftigt waren.“ Auch in diesem Buch wird sich dieser Eindruck nicht vermeiden lassen, schließlich gab es diese Auseinandersetzungen tatsächlich. Zugleich möchte ich mich aber Berens’ Plädoyer für eine „andere Sichtweise“ anschließen. Demnach sollen die Linkskommunisten „als nach außen gerichtete, praktisch tätige Menschen“ dargestellt werden, „die den Lauf der Geschichte verändern wollten.“76 Ich möchte untersuchen, wie die einzelnen Strömungen die Entwicklungen in der Sowjetunion und die Stalinisierung der KPD eingeschätzt haben. Ich werde analysieren, wie sie versucht haben, ihrem Ziel – der Reform der Partei – näherzukommen. Und schließlich möchte ich herausfinden, warum sie gescheitert sind. Hierbei betrete ich in mehrfacher Hinsicht Neuland:
1.) Erstmalig werden für eine Studie über den deutschen Linkskommunismus die umfangreichen Bestände des ehemaligen KPD-Parteiarchivs ausgewertet.
2.) Erstmalig wird der Linkskommunismus in der Weimarer Republik anhand einer Synthese aus Politik- und Sozialgeschichte dargestellt.
3.) Erstmalig wird die Geschichte der bislang „vergessenen“ Weddinger Opposition systematisch untersucht.
4.) Erstmalig wird die Entwicklung der linken Opposition der KPD als Gesamtgeschichte geschrieben. Bisherige Untersuchungen haben sich stets auf einzelne Gruppen gestützt.
Insgesamt werde ich also das breite Spektrum des Linkskommunismus in der Weimarer Republik darstellen. Doch es bleiben auch Lücken: Beispielsweise kann ich die Entwicklung der Gruppe Bolschewistische Einheit aufgrund mangelnder Quellen nicht ausführlich analysieren, sondern lediglich knapp skizzieren. Zudem behandele ich einige Gruppierungen nur am Rande oder gar nicht, die sicherlich auch unter dem Begriff „Linkskommunismus“ subsummiert werden könnten. Zu nennen ist beispielsweise die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands (KAPD), immerhin eine Organisation von mehreren Zehntausend Mitgliedern. Genau wie bei anderen linken Gruppen stammten viele ihrer Mitglieder aus der KPD. Dass ihr trotzdem keine eigene systematische Darstellung gewidmet ist, liegt daran, dass ich mich auf jene Kräfte konzentriere, die sich gegen die Stalinisierung der KPD engagierten. Die KAPD wurde jedoch schon 1920 gegründet, also lange vor Einsetzen dieses Prozesses, und hat auch später nicht versucht, auf eine Reform der KPD hinzuwirken. Letzteres gilt auch für eine andere Gruppe, die hier kaum thematisiert wird: die Chemnitzer Linke. Sie fällt zwar unter das Label „linkskommunistisch“ und war zudem im Rahmen der KPD aktiv, verhielt sich aber dem Thälmann-ZK gegenüber im Wesentlichen loyal.77
Obwohl ich hier eine Synthese aus Politik- und Sozialgeschichte liefern möchte, werden diese beiden methodischen Ansätze dennoch getrennt voneinander angewandt. Das ist meines Erachtens notwendig, da nur die politikgeschichtliche Betrachtung hinreichend erklären kann, warum es überhaupt zur Herausbildung der Opposition kam: Der Kampf gegen die Stalinisierung war schließlich die Reaktion auf politische Entscheidungen und Entwicklungen. Sozialgeschichtliche Fragestellungen können auf diesem Analyserahmen jedoch aufbauen. Mit ihrer Hilfe lassen sich verschiedene Aspekte der Entwicklung der kommunistischen Linksopposition untersuchen, die bei einer rein politikgeschichtlichen Betrachtungsweise untergehen würden. Trotz dieser formalen Trennung fließen selbstverständlich an verschiedenen Stellen sozialhistorische Aspekte in die politikgeschichtliche Darstellung ein – und umgekehrt.
Mit Kapitel 2 beginnt die Geschichte der linken Opposition, aber keineswegs in Berlin, Bruchsal oder Bielefeld, sondern in Petrograd. Denn wenn sich die deutschen Linkskommunisten gegen die Stalinisierung der KPD engagierten, dann kämpften sie in erster Linie gegen die Auswirkungen eines Prozesses, der sich in Sowjetrussland abspielte. Darauf hat auch schon Günter Wernicke hingewiesen: „Trotz aller deutschen, historisch bedingten Besonderheiten ist die Genesis der linken kommunistischen Opposition nur vor dem Hintergrund der innerparteilichen Machtkämpfe in der Sowjetunion in den zwanziger Jahren zu verstehen und in die internationalen Zusammenhänge einzuordnen.“78 Dementsprechend bildet die Russische Revolution den Ausgangspunkt dieses Buches. Hier zeigte sich für kurze Zeit das Ideal einer Gesellschaft, für welche sich die Linkskommunisten bis zuletzt einsetzten. Zugleich löste deren Negation in gewisser Weise die Geburt der Opposition aus. Die bald beginnenden Fraktionsauseinandersetzungen innerhalb der KPdSU wurden zu einem wichtigen Bezugspunkt für die deutsche Linke. Sinowjew, Kamenew und Trotzki standen in Opposition zu Stalin – und waren damit Gesinnungsgenossen der deutschen Linken. Des Weiteren behandelt Kapitel 2 die globalen Implikationen, die der Aufstieg des Stalinismus mit sich brachte. Gemeint ist die Stalinisierung der Komintern und ihrer deutschen Sektion, der KPD. Dies darzustellen ist nicht zuletzt deswegen notwendig, weil das Konzept „Stalinisierung“ mittlerweile nicht mehr unumstritten in der historischen Kommunismusforschung ist.
Der Linkskommunismus hatte durchaus eigenständige Wurzeln in der deutschen Arbeiterbewegung. Das ist die Hauptthese des dritten Kapitels. Als zunächst unorganisierte Strömung existierte er schon seit der Gründung der KPD um die Jahreswende 1918/19. In den frühen Jahren wirkte er maßgeblich auf die politische Entwicklung der KPD ein. Diese schwankte damals permanent zwischen linksradikalen Haltungen und einem Einheitsfrontansatz, also verschiedenen Politikstilen, die sich vor allem darin unterschieden, ob die Partei bereit war, Bündnisse mit der Sozialdemokratie einzugehen oder nicht. Bereits im Jahr 1920 verließ eine „erste Generation“ des deutschen Linkskommunismus die KPD. Doch schon kurze Zeit später entwickelte sich in den Auseinandersetzungen um die Parteilinie eine neue Strömung, die viele der inhaltlichen Positionen der „alten“ linken Opposition übernahm. Im Jahr 1924 gelangte dieser Flügel schließlich in die Parteiführung. Zu dieser Zeit stand er nicht in Opposition zur Sowjetführung. Im Gegenteil: Unter der Parteivorsitzenden Ruth Fischer wurde nun die „Bolschewisierung“ der KPD eingeleitet. In dieser Zeit kam es zur ersten Spaltung der linken Strömung: Werner Scholem, Iwan Katz, Arthur Rosenberg und andere stellten sich nun gegen „ihre“ Parteiführung. Die Darstellung dieser Entwicklungen schließt das dritte Kapitel ab.
Im November 1925 kam es doch zum Bruch mit der Sowjetführung: Auf deren Betreiben wurden Fischer und ihre Anhänger aus dem Zentralkomitee entfernt und im Laufe des Jahres 1926 nahezu alle prominenten Vertreter der Parteilinken aus der KPD ausgeschlossen. Kapitel 4 zeigt auf, wie unter dem neuen Parteivorsitzenden Ernst Thälmann diese groß angelegte „Säuberung“ der Partei begann – und welche Rolle die Kominternführung dabei spielte. Zeitweilig führten diese Repressionen wieder zu einer Annäherung der zerstrittenen linken Oppositionsgruppen. Ende des Jahres 1926 gingen sie mit einer „Erklärung zur russischen Frage“ an die Parteiöffentlichkeit. Hier solidarisierten sie sich mit der russischen Opposition, prangerten die Entdemokratisierung der KPD an und forderten eine offene Diskussion über die Entwicklung in der Sowjetunion ein. Mehrere hundert Parteifunktionäre unterzeichneten die Resolution, die unter der Bezeichnung „Brief der 700“ bekannt wurde. Diese Entwicklungen werden ebenfalls in Kapitel 4 nachgezeichnet, ebenso wie die bald darauf folgende erneute Zersplitterung der Parteilinken. Alle linksoppositionellen Gruppierungen, die nun entstanden oder bereits existierten, sollen in diesem Kapitel vorgestellt werden. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Katz-Gruppe, die Entschiedene Linke, die Weddinger Opposition, die Fischer/Urbahns-Gruppe, den Spartakusbund der linkskommunistischen Organisationen, die Gruppe Kommunistische Politik, den Leninbund, die Kötter/Vogt-Gruppe, die Bolschewistische Einheit, die Vereinigte Linke Opposition der KPD, die Landau-Gruppe und die Linke Opposition der KPD. Jeder dieser Oppositionsströmungen ist mindestens ein Unterkapitel gewidmet. Hier sind leider Zeitsprünge unvermeidlich, die der eigentlich chronologischen Darstellungsweise des Kapitels entgegenlaufen. Doch es wäre nahezu unmöglich gewesen, die Geschichten diverser, zeitgleich existierender Gruppierungen zu einem Narrationsstrang zu vereinen. Und selbst die hier gewählte parallele Erzählstruktur stellt den Leser vor hohe Anforderungen. Denn nicht immer ist es leicht, der verworrenen Entwicklung der KPD-Linken zu folgen, die sich immer wieder spaltete und zu neuen Gruppen vereinigte. Schon Zeitgenosse Werner Scholem erklärte im Jahr 1926 seinem Bruder, „die eigenartige Scholastik, mit welcher die Streitigkeiten in unserer Partei geführt werden“, verhindere oft „für den Außenstehenden“ deren Kern zu begreifen.79 In diesen Auseinandersetzungen war bis zum Jahr 1927 der ehemalige Komintern-Vorsitzende Grigori Sinowjew Bezugspunkt der deutschen Linken. Doch als Sinowjew unerwartet vor Stalin „kapitulierte“, mussten diese sich einen neuen Verbündeten in der Sowjetunion suchen und fanden ihn in Leo Trotzki. Dieser galt eine ganze Weile als „Unperson“ innerhalb der KPD. Wie sich das änderte und welche Rolle dabei „Aktions“-Herausgeber Franz Pfemfert spielte, ist ebenfalls Thema von Kapitel 4.
In den Jahren vor der Machtübergabe an Hitler gelang es den Linksoppositionellen kaum noch, Einfluss auf die stalinisierte KPD auszuüben. Dass eine Beschäftigung mit ihnen und ihren Ansichten in den letzten drei Jahren der Weimarer Republik trotzdem lohnenswert ist, zeigt Kapitel 5. Denn die Linken warnten nun eindringlich vor den immer stärker werdenden Nationalsozialisten. Dabei stützten sie sich vor allem auf die Analysen Trotzkis. Diese werden hier ebenso dargestellt wie die Einschätzungen von SPD und KPD. Um den Aufstieg der Nazis zu verhindern, forderte Trotzki eine Rückkehr zur Einheitsfrontpolitik der frühen KPD-Jahre. Damit lag er auf einer Linie mit August Thalheimer von der KPO. Der Frage, warum es trotzdem zu keiner Zusammenarbeit zwischen Thalheimers Partei und Trotzkis Anhängern kam, widmet sich ein Exkurs innerhalb des fünften Kapitels. Anschließend werden die Versuche der Linkskommunisten beleuchtet, in verschiedenen Orten Einheitsfronten zu initiieren. Doch letztendlich waren sie nicht erfolgreich, die Nazis kamen an die Macht. Mit einem Ausblick auf die Aktivitäten der Linkskommunisten im antifaschistischen Widerstand endet sowohl dieses Kapitel als auch die politikhistorische Darstellung der linken KPD-Opposition.
Ihrer Sozialgeschichte widmet sich Kapitel 6. Hier folgt die Darstellung nun keiner Chronologie mehr, sondern bestimmten thematischen Feldern. Das Kapitel ist in fünf Abschnitte unterteilt. Im ersten Teil wird die soziale Zusammensetzung der deutschen Linkskommunisten, ihre Altersstruktur und politische Herkunft untersucht. Quellenbasis sind hier die Personendaten von mehr als 1.200 Linkskommunisten, die Analyse erfolgt nach statistischen Methoden. Darüber hinaus werden idealtypische Lebenswege der Akteure nachgezeichnet und die Rolle von Frauen und Jugendlichen in den Reihen der Linksopposition untersucht. Der zweite Abschnitt des Kapitels widmet sich den lokalen Hochburgen der Linken und versucht zu erklären, unter welchen Bedingungen sich diese in bestimmten Orten etablieren konnten. Einen Überblick über verschiedene Aspekte der Organisationsentwicklung gibt der folgende Teil des Kapitels. Hier wird die Mitgliederentwicklung der einzelnen Gruppen ebenso beleuchtet wie deren Finanzen. Zudem werden die linkskommunistische Presse und ihre Literatur einer ausführlichen Analyse unterzogen. Im Zentrum des vierten Abschnitts stehen die politischen Betätigungsfelder der Linksoppositionellen. Es wird systematisch aufbereitet, welcher Methoden sie sich bedienten, um den Kampf um die KPD zu führen. Darüber hinaus werden ihre öffentlichen Veranstaltungen untersucht und die Rolle, die sie in Wahlen und Wahlkämpfen spielten. Zeitweilig verfügten die Linken über Abgeordnete im Reichstag, in den Landtagen und Kommunalparlamenten. Deren Arbeit ist der abschließende Teil dieses Abschnitts gewidmet. Am Ende des Kapitels steht die globale Perspektive des antistalinistischen Widerstands. Die Linkskommunisten verstanden sich als Teil einer internationalen Bewegung. Ein wichtiger Aspekt ihrer diesbezüglichen Aktivitäten waren Solidaritätskampagnen für sowjetische Oppositionelle. Sie sollen hier ebenso dokumentiert werden wie die Versuche, Bündnisse mit kommunistischen Oppositionsgruppen aus anderen Ländern zu schließen. Damit schließt die sozialhistorische Analyse. Es folgt eine abschließende Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Publikation.
Im Anhang befindet sich zudem ein Glossar zu den verschiedenen linken Gruppen der Weimarer Republik. Es umfasst auch Organisationen, die hier nicht behandelt werden, und soll der schnellen Orientierung des Lesers dienen. Selbiges gilt auch für den „Stammbaum der linken Opposition“, einer grafischen Darstellung der Entwicklung der einzelnen Gruppen. Aus Platzgründen habe ich darauf verzichtet, Kurzbiografien der mir bekannten Linksoppositionellen abzudrucken. Hier sei auf das bereits erwähnte Handbuch deutscher Kommunisten verwiesen.
Der zeitliche Rahmen dieser Untersuchung umfasst also sehr genau die Jahre, in denen die Weimarer Republik existierte. Den Beginn markiert die Gründung der KPD um die Jahreswende 1918/19, als erstmalig eine diffuse linke Opposition innerhalb der Partei auftrat. Als Endpunkt der Abhandlung habe ich den 30. Januar 1933 gewählt, jenen Tag, an dem Hitler Reichskanzler wurde. Wie für alle Organisationen der Arbeiterbewegung bedeutete dies auch für die linksoppositionellen Kommunisten einen tiefen Einschnitt. Sie wurden fortan verfolgt, mussten in die Illegalität oder ins Exil gehen. Hitler führte also in gewisser Weise Stalins Werk fort.
2. Die Vorgeschichte der linken Opposition
2.1 Russische Revolution und Aufstieg des Stalinismus
Die Sophiensäle in Berlin-Mitte waren ein wichtiger Ort für die revolutionäre Linke der Weimarer Republik. Karl Liebknecht hielt hier im Vorfeld der Novemberrevolution flammende Reden, Wilhelm Pieck sprach bei der ersten öffentlichen Versammlung des Spartakusbundes und später diente das Haus als Versammlungsort des 5. Parteitages der KPD. Noch heute erinnert eine Gedenktafel am Gebäude an diese Ereignisse. Nicht erwähnt wird eine Veranstaltung, die dort am 4. November 1927 stattfand. Es war eine öffentliche Versammlung anlässlich des zehnten Jahrestages der russischen Oktoberrevolution, organisiert von den Linken Kommunisten. Auf der Titelseite ihrer Zeitung, der „Fahne des Kommunismus“, bewarben sie die Veranstaltung mit einer ganzseitigen Abbildung: Ein auf einer Weltkugel stehender Proletarier, Gewehr in der linken und rote Fahne in der rechten Hand. Ihm zu Füßen liegend ein um Gnade flehender Kapitalist. Über all dem wachend: der Genosse Lenin.80 Nicht nur in ihrer Bildsprache überhöhten die Linkskommunisten die Ereignisse von 1917: Auch bei der sehr gut besuchten Veranstaltung benannte Referent Hugo Urbahns die Oktoberrevolution als „größtes Ereignis unserer Epoche“.81
Zu diesem Zeitpunkt war die linke Opposition in Deutschland bereits weitgehend aus der Partei gedrängt, in der Sowjetunion der Stalinismus auf dem Vormarsch. Das dortige Gesellschaftssystem beäugten die deutschen Linkskommunisten mit Skepsis. Wahlweise bezeichneten sie es als „Staatskapitalismus“ (Hugo Urbahns/Werner Scholem), als „offen kapitalistisch“ (Iwan Katz) oder gar als „roten Imperialismus“ (Karl Korsch).82 Trotzdem – oder: gerade deshalb – feierten sie die Oktoberrevolution. Denn anders als viele zeitgenössische Kritiker, die ihre seit der Revolution bestehenden Vorbehalte nur bestätigt sahen, verstanden die Linksoppositionellen die Herrschaft Stalins nicht als Fortsetzung von 1917, sondern als eine radikale Abkehr von den „gewaltigen Errungenschaften der russischen Oktoberrevolution“, wie Urbahns in seiner Rede betonte.83
Eine Darstellung der linken Opposition in der KPD der Weimarer Republik muss dementsprechend im Russland des Jahres 1917 beginnen. Hier blitzte für kurze Zeit das Ideal einer Gesellschaft auf, für das sich die Linkskommunisten so vehement einsetzten – als Gegenentwurf zu Armut, Ausbeutung und Ausgrenzung, die sie in der Weimarer Republik erfuhren. Der Niedergang der Oktoberrevolution und aller Ideale, für die sie gestanden hatte, führte schließlich dazu, dass sich die deutsche linke Opposition als eigenständige Strömung konstituierte. Zunächst konnte sie sich noch innerhalb der Kommunistischen Partei engagieren, später dann gezwungenermaßen außerhalb. Ihr Bezugspunkt blieb aber stets der junge Sowjetstaat – und diejenigen, die dort gegen den Stalinismus kämpften.
2.1.1 Russland 1917: Das gelobte Land
Petrograd im Frühjahr 1917: Der Erste Weltkrieg dauert nun schon fast vier Jahre an. Die Versorgungslage ist katastrophal, in den Städten hungern die Menschen. Im Stadtteil Wyborg gehen deshalb Arbeiterinnen einer Textilfabrik auf die Barrikaden. Sie verlangen nach Brot. Bald schließen sich Beschäftige aus anderen Fabriken der Hauptstadt dem Protest an. Der Aufstand weitet sich schnell zum Generalstreik aus und schließlich läuft ein großer Teil des Militärs zu den Aufständischen über. Mit ihren Demonstrationen entfachten die Textilarbeiterinnen einen Sturm, der, so Manfred Hildermeier, „das Gebäude der Autokratie zusammenbrechen ließ wie ein Kartenhaus“.84 Ende Februar85 muss Zar Nikolaus II. abdanken, die über 450 Jahre alte zaristische Monarchie ist Geschichte.86 Die Russische Revolution hat begonnen.87
In diesen Tagen des Aufruhrs stellten die Menschen in Russland die althergebrachten Institutionen des Zarenreiches in Frage. Beispielsweise entwickelten sie eine neue Art, das öffentliche Leben zu organisieren. Ausgehend von Petrograd gründeten Arbeiter, Soldaten und Bauern im ganzen Land Komitees und Räte (Sowjets). In Fabriken, Stadtbezirken, aber auch in Dörfern oder Militäreinheiten wählten sie Vertreter ihres Vertrauens in diese Gremien. Die Zahl der Sowjets ging schon wenige Wochen nach dem Februaraufstand in die Hunderte. Ende März, Anfang April fand in Petrograd eine erste allrussische Konferenz der Räte statt.88 Die dominierenden Kräfte in den Versammlungen waren zunächst die sozialdemokratischen Menschewiki89 und die stark in der Bauernschaft verankerten Sozialrevolutionäre.
Während die Räte die Kontrolle über die Betriebe ausübten, entstand in den Tagen der Februarrevolution ein weiteres Machtzentrum: die Provisorische Regierung. Ihre Mitglieder kamen aus der besitzenden Elite oder aus dem Adel.90 Ministerpräsident in der neuen Regierung wurde der liberale Fürst Georgi Jewgenjewitsch Lwow. Mitglieder der Arbeiterund Soldatenräte beteiligten sich nicht an dieser Regierung.91
Das Nebeneinander von Räten und Provisorischer Regierung im Jahr 1917 haben sowohl Zeitgenossen als auch die Forschung mit dem Begriff „Doppelherrschaft“ beschrieben. Die Provisorische Regierung besaß formal die Macht über den Staatsapparat. De facto verfügten aber die Sowjets über den größeren Einfluss im Land, wie Helmut Altrichter schreibt: „In der Regel konnte manches ohne, aber nichts gegen den Rat geschehen.“92 Anfangs unterstützten die Räte das Kabinett Lwow. Doch schon bald wuchs der Unmut unter den Arbeitern und Bauern. Entgegen ihren Hoffnungen beendete die Regierung weder den Krieg, noch löste sie die Land- und Versorgungsfrage. In den Städten mussten die Menschen weiter hungern. Dies änderte sich auch nicht, als im Mai Sozialrevolutionäre und Menschewiki in die Provisorische Regierung eintraten oder als im Juli der Sozialrevolutionär Alexander Kerenski neuer Premierminister wurde. Nur die Unzufriedenheit wuchs weiter: Soldaten verweigerten Befehle oder führten Sabotageakte durch.93 Die Bauern warteten nicht mehr auf Maßnahmen der Regierung, sondern begannen, sich das Land selbst anzueignen.94 Und unter den Arbeitern nahm im Lauf des Jahres die Streikbereitschaft deutlich zu.95
Auf dieser Unzufriedenheit konnten die Bolschewiki um den im April aus dem Exil zurückgekehrten Lenin aufbauen. Anders als die Menschewiki und auch Teile seiner Partei war dieser nicht der Ansicht, dass in Russland zunächst ein bürgerlich-kapitalistisches System errichtet werden müsse.96 Vielmehr meinte Lenin, der Kapitalismus könne die grundlegenden Probleme des Landes nicht lösen. Ein marktwirtschaftliches System würde weder das Bedürfnis der Bauern nach Land befriedigen noch die dringendsten Nöte der Arbeiter beheben können. In seinen berühmten „April-Thesen“ forderte Lenin daher, dass alle Macht an die Sowjets übergehen solle.97 Schnell konnte er die Mehrheit seiner Partei für diese Position gewinnen.
Die Bolschewiki stellten sich mit dem Slogan „Land, Brot, Frieden“ hinter die Forderungen der Arbeiter, Soldaten und Bauern. Zudem spielten sie im August eine wichtige Rolle in der Bewegung, die einen Putschversuch des Generals Lawr Kornilow gegen die Regierung Kerenski vereitelte.98 Auf diese Weise wuchs binnen kurzer Zeit ihr Rückhalt in der Bevölkerung.99 Im Oktober stellte die Partei schließlich die absolute Mehrheit der Delegierten des 2. Allrussischen Rätekongresses.100 Gleichzeitig wuchs die Zahl ihrer Mitglieder rasant an. Lag sie Anfang 1917 noch bei etwa 20.000, so waren es im Oktober bereits 400.000.101
Vor diesem Hintergrund besetzten am 25. Oktober Arbeiter und Soldaten alle wichtigen Ämter, Telefonzentralen und den Regierungspalast in Petrograd. Generationen von Historikern hat dieses Ereignis zu kontroversen Debatten provoziert. Dabei erhielt es viele verschiedene Namen, wie Dietrich Geyer zusammenfasst: „Coup d’état, Aufstand, Umsturz oder ‚Große Sozialistische Oktoberrevolution‘; Verschwörung einer Minderheit oder ‚Zehn Tage, die die Welt erschütterten‘; action directe einer Handvoll entschlossener Täter oder der ‚Rote Oktober‘.“102 Stellte sie für die einen Historiker die „Tragödie eines Volkes“ oder „die Geburtsstunde des totalitären Zeitalters“ dar, so war sie für die anderen der „Kulminationspunkt einer großartigen Massenbewegung“.103 Wie auch immer man die Geschehnisse des Oktober 1917 nennen und bewerten mag, unbestritten ist: Die Provisorische Regierung wurde gestürzt und die Macht ging auf die Sowjets über. Edward Hallett Carr fasst zusammen: „Es war ein unblutiger Handstreich: Die Provisorische Regierung brach widerstandslos zusammen, einige ihrer Minister wurden verhaftet, Ministerpräsident Kerenski floh ins Ausland.“104 Noch am selben Tag beschloss der 2. Allrussische Rätekongress, eine revolutionäre Räteregierung – den „Rat der Volkskommissare“ – einzuberufen. Die Räteregierung wurde von den Bolschewiki und linken Sozialrevolutionären gestellt. Lenin wurde ihr Vorsitzender.
Auch unter Zeitgenossen sorgten die russischen Ereignisse für große Kontroversen.105 Die liberalen „Bremer Nachrichten“ sahen in ihnen etwa den „völligen Ausbruch der Anarchie“,106 der Sozialdemokrat Mark Lewin gar einen „konterrevolutionäre[n] Pogrom […], der unter dem Namen Kommunismus veranstaltet wird.“107 Anderseits ließen sich Millionen Menschen weltweit von der Oktoberrevolution und dem jungen Sowjetstaat inspirieren. In Deutschland erfolgte der Massenzustrom zur Kommunistischen Partei ab 1920 „nicht zuletzt wegen der Sympathie vieler linker Arbeiter und Intellektueller zur russischen Revolution“, meinen Weber und Herbst.108 Oskar Hippe erinnert sich: „Die Wirkungen der Oktoberrevolution waren in der gesamten Arbeiterklasse spürbar.“ Auch „viele sozialdemokratische Arbeiter begrüßten den Sieg der russischen Proletarier“.109 Wolfgang Abendroth weiß von der „zündende[n] Wirkung der Oktoberrevolution auf das Deutsche Reich“ zu berichten, die er als Jugendlicher erlebte.110 Der linke Sozialdemokrat Wilhelm Dittmann erinnert sich, dass der Zusammenbruch des Zarenregimes eine enorme „unmittelbare psychologische Wirkung auf die Stimmung in der deutschen Arbeiterschaft“ gehabt habe, „auch bei den Anhängern der alten Sozialdemokratischen Partei“.111
Ulrich Eumann schätzt, dass gerade für diejenigen, die in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre zur KPD stießen, sowjetische Literatur und Filme „von besonderer Bedeutung“ waren: „Der ‚Panzerkreuzer Potemkin‘ dürfte insgesamt mehr Menschen langfristig für die KPD gewonnen haben, als so mancher erfolgreiche Werbeeinsatz tausender Genossen.“112 Ab 1925 organisierte die KPD jährlich Reisen von Arbeiterdelegationen in die Sowjetunion. Die Teilnehmer berichteten nach ihrer Rückkehr keineswegs nur vor Kommunisten. Oft wurden sie auch von SPD-Ortsvereinen oder Ortskartellen des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) eingeladen, ihre Reiseimpressionen zu teilen.113 Auch linke Intellektuelle wie Lion Feuchtwanger, Oskar Maria Graf und Egon Erwin Kisch besuchten das Land, um sich ein eigenes Bild von dem sozialistischen Experiment zu machen.114
Für die deutschen Kommunisten wurde die Sowjetunion, so Klaus-Michael Mallmann, zum „gelobten Land“. Sie besaß „als Gegenentwurf zur Weimarer Republik eine beträchtliche Werbewirksamkeit in der Arbeiterschaft“. Mallmann führt die Anziehungskraft des „fernen Arbeiterparadieses“ vor allem auf eine Propagandalüge der Kommunisten zurück. Gerade weil die Sowjetunion „ein ferner Mythos“ gewesen sei, habe sie sich „als Projektionswand aller proletarischen Wünsche einsetzen und gewissermaßen als kommunistisches Disneyland präsentieren“ lassen, „wo sich all jene Hoffnungen erfüllten, die die deutsche Revolution nicht eingelöst hatte“. Mit einer „Mischung aus Verharmlosung, Blindheit und Idealisierung“ hätten KPD- und Kominternführung „das Bild einer biederen, fürsorglichen Tugenddiktatur“ gezeichnet, in der das Proletariat seine Heimat gefunden habe.
Zu Recht stellt Mallmann dabei die maßlose Überhöhung des neuen Staates und die „Ausblendung des Streikverbots, des außerökonomischen Zwangs, des Gulag“ durch die kommunistischen Funktionäre – vor allem ab Ende der zwanziger Jahre – heraus.115 Viele Maßnahmen der Räteregierung sind bis heute umstritten – etwa die Einschränkung der Pressefreiheit oder die Auflösung der verfassungsgebenden Versammlung.116 Trotzdem hatte die Anziehungskraft der Sowjetunion auf Arbeiter in anderen Ländern durchaus auch eine reale Basis. In den Wochen und Monaten nach der Oktoberrevolution veränderte sich das Land, das bis dahin als der „Hort der Reaktion“ galt, in einer nie gekannten Intensität.
Schon nach der Februarrevolution hatte sich die bis dahin noch in halbfeudalen Strukturen steckende Nation rasch demokratisiert – oder um es mit Orlando Figes auszudrücken: „Russland wurde praktisch über Nacht in ‚das freieste Land der Welt‘ verwandelt.“117
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: