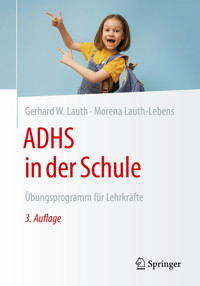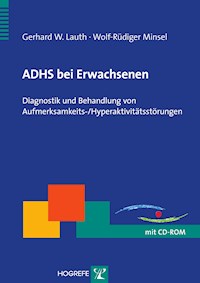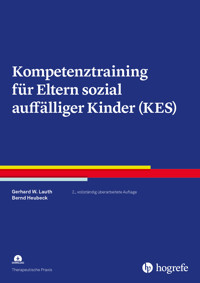
52,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Zusammenleben mit sozial auffälligen Kindern hält viele Belastungen für ihre Eltern bereit: Die Hausaufgaben werden zur Qual, elterliche Anweisungen treffen auf taube Ohren etc. Die Stimmung in den Familien verschlechtert sich, die Belastung nimmt zu und die Beziehung wird angespannt. Das vorliegende Training beruht auf einem stress- und ressourcentheoretischen Ansatz. Danach entstehen die elterlichen Erziehungsschwierigkeiten nicht aus einer allgemeinen Unfähigkeit, sondern aus Überlastung und ungenutzten Verhaltensmöglichkeiten. Die Eltern werden angeleitet, wie sie ihr "schwieriges Kind" besser anleiten können. Sie lernen ihre eigenen Stärken zu sehen, genaue Anweisungen zu geben, das Kind durch Lob und Tadel zu lenken und die Hausaufgaben nach einem vorgegebenen Plan machen zu lassen. Schließlich werden sie darin beraten, wie sich die Familie neu und besser zusammenfinden kann. Das Buch schildert den theoretischen Hintergrund des Konzeptes und gibt eine genaue Anleitung zum Training in Form von Manualen für das Einzel- und Gruppentraining. Die Arbeitsmaterialien können nach erfolgter Registrierung von der Website des Hogrefe Verlags heruntergeladen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gerhard W. Lauth
Bernd Heubeck
Kompetenztraining für Eltern sozial auffälliger Kinder (KES)
2., vollständig überarbeitete Auflage
Thomas A. Otte, Judith Dücomy und Marco Walg
Prof. Dr. Gerhard W. Lauth, geb. 1947. 1974–1979 Studium der Psychologie an der Universität Mainz. 1979 Promotion, 1984 Habilitation. 1992 Professur für Rehabilitationspsychologie an der Universität Dortmund. 1997 Professur für die Psychologie Universität Köln. 2014 Emeritierung; Arbeitsschwerpunkte: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS); Elterntraining, Lernstörungen, Verhaltensstörungen und Verhaltenstherapie.
Bernd Heubeck, PhD, geb. 1951. 1974–1980 Studium der Psychologie in Kiel. 1978–1979 Training am Institut für Kinderpsychotherapie und Elterntraining, Kiel. 1980–1982 Psychologe am Liverpool Area Health Center, Sydney, Australien. 1982–1988 Klinischer Psychologe und 1988–1990 „Senior Clinical Psychologist“, South West Sydney Area Health Service. 1990 Berater für Psychologische Dienste am South West Sydney Area Health Board. 1991–1997 Direktor für Klinische Psychologie und Klinische Praktika an der Australischen National Universität (ANU), Canberra. Seit 1998 „Senior Lecturer“ in der Klinischen Psychologie an der ANU. 2001 PhD Dissertation ANU. Arbeitsschwerpunkte: Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter, Schul- und Familienpsychologie, Klientenzentrierte Problemlösungstherapie, Verhaltenstherapie, Familientherapie, Lehrertraining.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar
Format: EPUB
2., vollständig überarbeitete Auflage 2024
© 2006, 2024 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3185-7; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3185-8)
ISBN 978-3-8017-3185-4
https://doi.org/10.1026/03185-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Überblick
Teil 1 – Expansive Verhaltensauffälligkeiten
Kapitel 1 „Schwierige Kinder“ und ihre Familien
1.1 Schule/Familie
1.2 Eltern-Kind-Interaktionen
Kapitel 2 Einordnung in Diagnose-/Klassifikationssysteme
2.1 Hyperkinetische Störungen (HKS)
2.1.1 Subtypen in der ICD-10 bzw. DSM-5
2.1.2 Differenzierung nach Schweregraden
2.2 Störungen des Sozialverhaltens (SSV)
2.2.1 Subtypen in der ICD-10
2.2.2 Störungsmerkmale der SSV gemäß DSM-5
2.3 Diagnostik
Kapitel 3 Prävalenz, Komorbidität und Verlauf
3.1 Verbreitung und Verlauf von HKS/ADHS
3.1.1 Komorbidität bei HKS
3.1.2 Verlauf der hyperkinetischen Störungen (F90.-)
3.2 Verbreitung und Verlauf von Störungen des Sozialverhaltens (F9,-; ICD-10)
3.2.1 Verbreitung
3.2.2 Geschlecht
3.2.3 Komorbidität bei Störungen des Sozialverhaltens
3.2.4 Verlauf der Störungen des Sozialverhaltens (F91.-)
3.2.5 Langzeitfolgen
3.2.6 Prädiktoren
Kapitel 4 Bedingungsmodell zu HKS und Störung des Sozialverhaltens
4.1 Genetik und Hirnstruktur
4.1.1 Genetische Veranlagung
4.1.2 Verhaltensgenetische Disposition des Kindes
4.1.3 Hirnstruktur und Hirnreifung
4.2 Informationsverarbeitung und zentralnervöse Aktivierung
4.2.1 Unzureichende Reizverarbeitung
4.2.2 Kortikale Aktivierungsschwäche
4.2.3 Ruhezustandsnetzwerk
4.2.4 Unzureichende Vigilanz
4.3 Soziale Stressoren
4.3.1 Belastung der Familie
4.3.2 Sozioökonomische Faktoren
4.3.3 Mangel an Wärme und Interesse
4.3.3.1 Elterliche Wärme
4.3.3.2 Interesse an und anregende Beschäftigung mit dem Kind
4.3.4 Fehlen von Schutzfaktoren
4.3.4.1 Risikofaktoren in der kindlichen Entwicklung
4.3.4.2 Schutzfaktoren in der kindlichen Entwicklung
4.4 Abträgliche Eltern-Kind-Interaktion
4.4.1 Belastende familiäre Standardsituationen
4.4.2 Uneinfühlsames, rigides Erziehungsverhalten der Eltern
4.4.3 Verstärkerfalle
4.5 Einschränkungen in der Selbststeuerung
4.5.1 Einschränkungen in der Selbststeuerung
4.5.2 Exekutive Funktionen
4.5.2.1 Mangelnde Inhibitionskontrolle
4.5.2.2 Unzureichendes Arbeitsgedächtnis
4.5.2.3 Planungsaktivitäten
4.5.3 Motivationale Orientierung
4.6 Eingeschränkte Anpassung (Poor fit)
4.6.1 Eingeschränktes Regellernen
4.6.2 Schulverhalten und Schulleistungen
4.6.3 Soziale Beziehungen
4.6.4 Mangelnde Emotionsregulierung
Kapitel 5 Kognitiv-behaviorales Elterntraining
5.1 Methoden im Elterntraining
5.2 Elterntraining in den Behandlungsleitlinien
5.3 Wirksamkeit von Elterntraining
5.3.1 Bestätigende Ergebnisse
5.3.2 Differenzierende Ergebnisse
5.3.2.1 Niedrige Effekte
5.3.2.2 Vorübergehende Wirksamkeit
5.3.2.3 Bericht vs. Beobachtung
5.3.2.4 Soziale Situation der Eltern
Kapitel 6 Einzel- oder Gruppenformat
6.1 Einzelformat
6.2 Gruppe
6.3 Vergleiche zwischen Einzel- und Gruppenformat
6.4 Kombination von Einzel- und Gruppentraining
Teil 2 – Das KES-Training
Kapitel 7 Das Einzeltraining
7.1 Steckbrief
7.2 Aufbau des Trainings/der Trainingseinheiten
7.3 Methoden/Materialien
7.3.1 Aufgaben des Therapeuten
7.3.2 Arbeitsmaterialien
Kapitel 8 Vorbereitende Diagnostik
8.1 Erstkontakt und Interview zur Teilnahmebereitschaft (Commitment)
8.2 Verhaltensanalyse
8.3 Erhebung familiärer Belastungssituationen
Kapitel 9 Das Training mit einzelnen Eltern
9.1 Trainingseinheit 1: Was soll sich ändern? Was kann so bleiben?
9.1.1 Die aktuellen Schwierigkeiten in der Familie (insgesamt ca. 25 Minuten)
9.1.2 Rollenspiele zum Problemverhalten (ca. 40 Minuten) [optional]
9.1.3 Festlegen der Trainingsziele (ca. 20 Minuten)
9.1.4 Wochenaufgabe (3 Minuten)
9.1.5 Eigene Stärken finden (3 Mininuten)
9.2 Trainingseinheit 2: Eine emotionale Basis haben – positive Spielzeit
9.2.1 Auswertung der Wochenaufgabe (5 Minuten)
9.2.2 Die positive Spielzeit erklären (ca. 15 Minuten)
9.2.3 Die positive Spielzeit planen (15 Minuten)
9.2.4 „Fallstricke“ bei der „positiven Spielzeit“ (ca. 8 Minuten)
9.2.5 Wochenaufgabe (4 Minuten)
9.2.6 Eigene Stärken finden (3 Minuten)
9.3 Trainingseinheit 3: Eigene Gefühle und Gedanken wahrnehmen
9.3.1 Auswertung der Wochenaufgabe
9.3.2 Gedanken (Bewertungen) und Gefühle (10 Minuten)
9.3.3 Das ABC der Gefühle (ca. 15 Minuten)
9.3.4 Mit dem ABC-Modell arbeiten (insgesamt ca. 15 Minuten)
9.3.5 Wochenaufgabe (3 Minuten)
9.3.6 Eigene Stärken finden (3 Minuten)
9.4 Trainingseinheit 4: Abläufe ändern
9.4.1 Auswertung der Wochenaufgabe (ca. 10 Minuten)
9.4.2 Abläufe ändern (insgesamt ca. 30 Minuten)
9.4.3 [optional] Hausaufgabenstrukturierung (ca. 10 Minuten)
9.4.4 Abläufe unterstützen: DOs! und DON’Ts! (8 Minuten)
9.4.5 Zwei Wochenaufgaben (5 Minuten)
9.4.6 Eigene Stärken – Welche Abläufe haben sich bei uns bewährt? (3 Minuten)
9.5 Trainingseinheit 5: Durch positive Konsequenzen anleiten
9.5.1 Auswertung der Wochenaufgabe „Abläufe ändern“
9.5.2 Kleines Einmaleins des Verstärkens (ca. 15 Minuten)
9.5.3 Der Punkte-Plan als systematische Verstärkung (ca. 15 Minuten)
9.5.4 Wochenaufgabe (5 Minuten)
9.5.5 Eigene Stärken finden (3 Minuten)
9.6 Trainingseinheit 6: Wirksame Aufforderungen und hemmende Konsequenzen
9.6.1 Auswertung der Wochenaufgabe
9.6.2 Die Positive Spielzeit weiterführen? (3 Minuten)
9.6.3 Wirksame Aufforderungen (insgesamt ca. 20 Minuten)
9.6.4 [optional] Rollenspiele zu den Themen „Effektiver auffordern“, „Erwartungen äußern“ und „nein-sagen/Grenzen setzen“ (ca. 15 Minuten)
9.6.5 [optional] „Verhandeln“ (ca. 10 Minuten)
9.6.6 Hemmende Konsequenzen (insgesamt ca. 15 Minuten)
9.6.7 Persönliches Konsequenz-Schema (12 Minuten)
9.6.8 Wochenaufgabe (3 Minuten)
9.6.9 Eigene Stärken finden (2 Minuten)
9.7 Auffrischungssitzung: Ein Blick zurück – auf dem Weg nach vorn
9.7.1 Begrüßung und Vorstellung des begleitenden Familienmitglieds [optional]
9.7.2 Auswertung der Wochenaufgabe
9.7.3 Ein Blick zurück …: Rückschau auf bisher Erreichtes (insgesamt ca. 20 Minuten)
9.7.4 … auf dem Weg nach vorn: Belastungen in der Familie & Verhaltensverträge (insgesamt ca. 25 Minuten)
9.7.5 Offene Fragen und Verabschiedung (5 Minuten)
Kapitel 10 Vorkehrungen für eine möglichst reibungslose Durchführung
10.1 Teilnahmebereitschaft der Eltern unterstützen
10.2 Die Wochenaufgaben erledigen
10.3 Fortschritte im Alltag
10.4 Rollenspiele mitmachen
10.5 Aktive Mitarbeit
10.6 Zeitmanagement
10.7 Bei Gruppen: Die Möglichkeiten der Gruppe nutzen
Kapitel 11 Evaluation
11.1 Klinische Erprobung (clinical trial) in vier Kinderpsychiatrien (Einzeltraining, Gruppentraining, Kontrollgruppe; Otte, 2011)
11.1.1 Fragestellung
11.1.2 Stichprobe
11.1.3 Abhängige Variablen
11.1.4 Auswertung
11.1.5 Schlussfolgerung
11.1.6 Weitere Auswertung der Studie auf Ebene der Familiensituationen (Heubeck, Welvaert & Richardson, 2023)
11.2 Vergleich mit Alternativbehandlung (randomiserte Zuweisung; Lauth, Grimm & Otte, 2007)
11.2.1 Fragestellung
11.2.2 Stichprobe
11.2.3 Durchführung des Trainings
11.2.4 Datenerhebung
11.2.5 Ergebnisse
11.2.6 Schlussfolgerung
11.3 Follow-up nach 15 Monaten (Lauth, Lauth-Lebens & Heubeck, im Druck)
11.3.1 Fragestellung
11.3.2 Stichprobe
11.3.3 Ergebnis
11.3.4 Schlussfolgerung
11.4 Durchführung unter Praxisbedingungen (Lauth, Otte & Heubeck, 2009)
11.4.1 Fragestellung
11.4.2 Stichprobe
11.4.3 Durchführung des Elterntrainings
11.4.4 Abhängige Variablen
11.4.5 Ergebnisse
11.4.6 Schlussfolgerung
11.5 Teilnehmerzufriedenheit im Einzel- und Gruppentraining (Heubeck, Otte & Lauth, 2016)
11.5.1 Fragestellung
11.5.2 Stichprobe
11.5.3 Abhängige Variablen
11.5.4 Ergebnisse
11.5.5 Schlussfolgerung
11.6 Aufsuchendes Elterntraining im Rahmen kinderpsychiatrischer Behandlung (Heidrich, 2015; weitere Publikationen in Vorbereitung)
11.6.1 Fragestellung
11.6.2 Treatment
11.6.3 Stichprobe
11.6.4 Abhängige Variablen
11.6.5 Versuchsplan
11.6.6 Ergebnisse
11.6.7 Schlussfolgerung
11.7 Allgemeine Schlussfolgerungen
11.7.1 Wirksamkeit
11.7.2 Gruppen- oder Einzeltraining?
Literatur
Anhang
Hinweise zu den Online-Materialien
|9|Vorwort
Das Manual richtet sich an Berufsgruppen, die im Rahmen von Erziehungsberatung oder Therapie eine Reduzierung der kindlichen Verhaltensauffälligkeiten, die Steigerung der elterlichen Erziehungskompetenz sowie eine Verringerung der elterlichen Belastung erreichen wollen. Ferner wird das Training in der Prävention bei beginnenden sozialen Auffälligkeiten eingesetzt.
Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wird das ursprüngliche Gruppentraining nun auch als Einzeltraining vorgelegt, da beide Formate deutliche Erfolge zeigen, jedes auf seine Weise. Damit ergeben sich neue Anwendungsfelder: So ist das KES für die Einzelfallarbeit in der Erziehungsberatung geeignet. Es kann abrechnungsfähig als strukturierte Kurzzeitintervention in der begleitenden Therapie der Bezugsperson in der Kinderpsychotherapie eingesetzt werden. Ferner kann es in der Psychotherapie der Erziehungsperson vollständig oder teilweise als wirkungsvolle Intervention in das therapeutische Gesamtkonzept eingebettet werden, wenn Schwierigkeiten im Erziehungsalltag zu Leidensdruck, emotionaler Belastung, oder Insuffizienzgefühlen bei den Eltern führen und für die psychische Störung des Patienten einen aufrechterhaltenden Charakter haben. Das Training wurde daher speziell für den Einsatz im Rahmen einer ambulanten Psychotherapie mit 50-minütigen Einheiten konzipiert.
In den folgenden Kapiteln wird zunächst das Trainingskonzept erläutert. Im ersten Informationsteil über indizierte Störungen werden typische Merkmale dieser expansiven Auffälligkeiten bei den Kindern beschrieben und Auskünfte über Prävalenz, Ätiologie, Verlauf, Diagnostik und Behandlung erteilt. Schließlich werden im Trainingsteil die Indikationsprüfung, der Aufbau des KES, sowie die Inhalte der einzelnen Sitzungen beschrieben.
Dieses Praxismanual enthält nicht nur die notwendigen Informationen und Materialien, die zur Durchführung eines Elterntrainings notwendig sind. Es bietet außerdem einen Katalog von Hinweisen an, die auf langjährigen Praxiserfahrungen mit dem Training beruhen. Diese machen auf mögliche Hindernisse im Alltag aufmerksam und erleichtern die Anwendung.
Wir wünschen allen Eltern viel Erfolg mit dem Training und ein leichteres und frohes Zusammenleben mit ihren Kindern.1
Köln
Gerhard Lauth und
Canberra, im Frühjahr 2023
Bernd Heubeck
|11|Überblick
|12|Trainingsprofil und konzeptionelle Grundlagen
Indikation
Eltern von Kindern mit expansiven Verhaltensauffälligkeiten
ADHS und Störung des Sozialverhaltens
auffälliges Kindverhalten in der Familie
problematische Eltern-Kind-Interaktion
Altersbereich Kinder
5 bis 12 Jahren
Ziele
Verringerung der elterlichen Belastung
Erhöhung der Erziehungskompetenz
Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion
Verringerung der Verhaltensauffälligkeiten des Kindes
Verringerung von familiärem Stress
Einsatz/Anwendung
Einzeltraining im Rahmen
der Psychotherapie eines Kindes
der Psychotherapie belasteter Eltern
Erziehungsberatung
Prävention
Gruppentraining in
Erziehungs- und Familienberatungsstellen
Psychiatrischen Kliniken
Kur- und Reha-Kliniken
Familien- und Erziehungshilfe
Familienzentren (Prävention)
Kombination von Gruppentraining und Einzelsitzungen
je nach Vorankommen und Bedarf der Eltern
Umfang
sieben Sitzungen
Dauer der Trainingseinheiten
Einzelformat 50 Minuten; bei Einsatz optionaler Trainingsmodule entsprechend länger
Gruppenformat 180 Minuten incl. Pause
Frequenz
1 Trainingseinheit pro Woche
dazwischen therapeutische Hausaufgaben
Vorteile
kurze und intensive Intervention
optionale Zusatzmodule ermöglichen individuelle Anpassung
Wirksamkeit in einer randomisierten klinischen Studie überprüft
Langzeitwirkung nach 15 Monaten
KES stützt sich auf 5 Grundannahmen, die im Kapitel 5 ausführlich dargestellt werden:
Sozial auffälliges Verhalten entsteht auf einem Entwicklungspfad mit drei wichtigen Stationen: Der Pfad beginnt mit einer (1) mangelnden Informationsverarbeitung und einer Aktivierungsschwäche, (2) geht weiter über entwicklungsneurologische Schwierigkeiten des Kindes, (3) verläuft dann über eine abträgliche Eltern-Kind-Interaktion, die die Verhaltensschwierigkeiten des Kindes verschärfen und stabilisieren.
Stress und mangelnde Ressourcen begünstigen ungeeignete und abträgliche Erziehungsstile (z. B. Fixierung der elterlichen Aufmerksamkeit auf unerwünschtes kindliches Verhalten, einseitig bestrafendes Elternverhalten, inflexibles Erziehungsverhalten). Das sozial auffällige Verhalten des Kindes wird als mangelnde Anpassung verstanden („poor fit“). Die Eltern sollen es dementsprechend als Ausdruck mangelnder Einvernehmlichkeit verstehen und im Training eine bessere „Passung“ anstreben.
Das Familienleben rankt sich um zentrale Standardsituationen (z. B. morgens aufstehen, frühstücken, Hausaufgaben, gemeinsame Mahlzeiten). Wenn die Eltern diese „lenken lernen“ ist viel gewonnen. Deshalb geht das Training von Standardsituationen (z. B. Zu-Bett-gehen, gemeinsame Mahlzeiten, Hausaufgaben machen) aus und verbessert den Umgang damit. Die Eltern lernen und üben nur, was sie für die Änderung ihrer eigenen Alltagsschwierigkeiten brauchen. Andere Punkte (z. B. Nachdenken über allgemeine Erziehungsprinzipen) stehen nicht im Vordergrund, sondern werden beiläufig gelernt.
In diesem Text wird entweder die männliche oder die weibliche Form zur Bezeichnung von Personen verwendet. Diese Begriffe beziehen sich auf alle Geschlechter.
|13|Teil 1 – Expansive Verhaltensauffälligkeiten
|15|Kapitel 1„Schwierige Kinder“ und ihre Familien
Unter „expansiven Auffälligkeiten“ versteht man ein breitgefächertes Spektrum von impulsiven, hyperaktiven und normverletzenden Verhaltensweisen, die vorwiegend in sozialen Standardsituationen auftreten (z. B. bei Besuchen, bei den Hausaufgaben). Häufig werden einzelne, subklinische Anpassungs- und Verhaltensprobleme bereits im frühen Kindesalter beobachtet, die sich aber formal noch nicht als krankheitswertige Störung diagnostizieren lassen. Erst wenn die Kriterien gemäß ICD-10 erfüllt sind, kann die Diagnose einer Hyperkinetischen Störung (F90.-, s. Punkt 3.1) bzw. einer Störung des Sozialverhaltens (F91.-, s. Punkt 3.2) vergeben werden.
Expansive und speziell auch oppositionelle Verhaltensmerkmale gehen mit familiären Belastungen und konfliktreichen Interaktionsmustern zwischen Eltern und Kind einher (Theule, Wiener, Tannock & Jenkins, 2013). Ferner verbinden sich mit der kindlichen Störung emotionale Probleme bei den Eltern (z. B. erhöhte Belastung, mangelnde Selbstwirksamkeit, mangelnde eheliche Zufriedenheit, elterliche Depression, Anpassungsstörungen). Dabei sind diese nicht notwendigerweise als nachfolgende, sondern auch als ursächliche oder aufrechterhaltende Störungsbedingungen zu werten, weshalb Elterntrainings als interventioneller Zugang nahelegt werden und durchaus auch Belastungen bzw. psychische Beeinträchtigungen der Eltern mindern (Leijten, Scott, Landau et al., 2020).
Kinder mit expansiven Auffälligkeiten verhalten sich im Familienalltag oftmals problematisch und nicht situationsangemessen, was die Eltern als „nervig“, schwierig und emotional belastend erleben. Selten erledigen die Kinder etwas einfach „von sich aus“ und ohne Trödeln oder Widerspruch. Stattdessen müssen die Eltern „stärker hinterher sein“, damit beispielsweise die Hausaufgaben gelingen, das Zubettgehen klappt oder Anweisungen wirklich befolgt werden. Die Kinder handeln in der Regel kurzschlüssig und unüberlegt und folgen dem ersten Impuls, was meist eskalierende Verhaltensschwierigkeiten nach sich zieht. Wenn sie Anforderungen wie Hausaufgaben machen, das Zimmer aufräumen, oder den Müll raustragen erfüllen sollen, halten sie den Aufwand gering und suchen nach „verkürzten“ Lösungsstrategien. Ursächlich hierfür sind meist wiederholte Misserfolge, derentwegen die betroffenen Kinder die geforderten Anstrengungen als nicht lohnenswert und potenziell frustrierend erleben. Sie versuchen dieser unangenehmen Erfahrung zu entgehen, indem sie sich anstrengungsmeidend verhalten. Typischerweise werden Anweisungen kaum befolgt und Erklärungen nicht bis zum Ende angehört. Infolgedessen unterlaufen ihnen viele Fehler, was die Selbstwirksamkeits- und Belohnungserwartung weiter einschränkt und das problematische Antwortverhalten weiter verstärkt. Daher sehen die Kinder ihre Fehler auch selten ein, sondern reagieren darauf eher großspurig, offensiv und auftrumpfend und ziehen dadurch weiteren elterlichen Unmut auf sich. Selbst Zuwendung vonseiten der Bezugspersonen ertrotzen sich die Kinder regelrecht, indem sie bspw. nörgeln, quengeln oder herumhampeln. Gelingt dies nicht, greifen sie zunehmend zu drastischeren und provozierenden Verhaltensweisen.
Nach Meinung der Eltern und anderer Bezugspersonen sind die Kinder viel zu selten kooperativ. Sie streiten sich häufig und scheinen sich an keine Regeln und Anweisungen halten zu wollen. Im Zusammensein mit Gleichaltrigen ecken sie oft an, ärgern ihre Mitschüler, warten nicht, bis sie an der Reihe sind, sind schnell reizbar und handeln aggressiv. Infolgedessen werden sie häufig abgelehnt, schließen nur schwer Freundschaften und sind folglich häufig nicht richtig integriert.
|16|1.1 Schule/Familie
Auch die Anpassung an die schulische Anforderungen fällt den Kindern schwer. Voraussetzungsvolle Aufgaben mit Aufmerksamkeits- und Anstrengungserfordernissen werden nur widerstrebend, flüchtig und fehlerhaft erledigt. Anstatt sich einer solchen Aufgabe zu stellen und weitere Misserfolge zu vermeiden, diskutieren sie mit dem Lehrer und verweigern dann nicht selten die Mitarbeit. Selbst nachfolgende Sanktionsmaßnahmen haben für die Kinder einen geringeren Bestrafungswert als die eigentliche Aufgabe. Langfristig bringt dieses Vermeidungs- und Ausweichverhalten schulische Lernrückstände hervor; die Lehrpersonen berichten oftmals auch von Störverhalten im Unterricht. Dementsprechend erleben sie die expansiven Kinder meistens als „schwierig“, was entsprechende Sanktionen nach sich zieht. Ihre Entwicklung ist aus all diesen Gründen oft – zumindest vorübergehend – gefährdet.
Die Eltern wie auch andere Bezugspersonen (Lehrpersonen, Erzieher, Verwandte) sehen sich immer wieder vor Probleme gestellt, die sich geradezu regelhaft wiederholen. Der alltägliche Umgang mit den betroffenen Kindern wird zur Belastung; nichts läuft von allein; ständig gibt es Schwierigkeiten und Konflikte. Dabei entzünden sich die familiären Konflikte vor allem in Standardsituationen: Anziehen, Waschen, Hausaufgaben machen, Verwandtschaftsbesuche, Zu-Bett-gehen. Für diese Geschehensabläufe gelten einerseits klare Regeln und andererseits wird oft auch in einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Ergebnis erwartet (z. B. sollen Hausaufgaben mit vertretbarem Aufwand erledigt werden). Die Kinder halten sich aber kaum an die geltenden Regeln, verstoßen deutlich gegen die bestehenden Erwartungen und erreichen meistens auch nicht das erwartete Verhaltensziel. Sie benötigen genauere Anleitungen, vermehrte Aufsicht, stärkere Verhaltenslenkung und größere Konsequenz. Oft fühlen sich die Eltern hilflos und überfordert; fast zwangsläufig reagieren sie ungeduldig, genervt und gereizt.
Beispiel: Belastungen in der Familie
Justin ist 8 Jahre alt. Er besucht zurzeit die 2. Klasse einer Grundschule. Er hat noch einen Bruder, der ein Jahr älter ist. Justin lebt mit seinen Eltern in einem Doppelhaus am Rande der Großstadt. Die Mutter ist Hausfrau, der Vater hat eine leitende Position in einer Firma und ist beruflich viel unterwegs.
Die Mutter berichtet, dass sie schon alles probiert hat: Zuckerarme Diät, heilpädagogische Massagen, Ergotherapie und Kinesiologie. Sie war bei einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, der eine psychopharmakologische Behandlung vorschlug, womit sie als Mutter aber nicht einverstanden war. Die Lehrerin drängt auf eine stationäre Aufnahme in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Mutter ist durch die Situation seelisch stark belastet. Sie befand sich deswegen bereits ein Jahr lang in psychotherapeutischer Behandlung.
Die meisten Konflikte gibt es nach Aussage der Eltern in folgenden Situationen:
Hausaufgaben sind eine „reine Katastrophe“. Sie enden fast immer im Streit. Justins motorische Unruhe zeigt sich hier besonders deutlich. Er ist ständig in Bewegung und kann nicht ruhig sitzen bleiben. Außerdem lenkt er sich häufig ab und kritzelt auf den Arbeitsblättern herum. Wenn die Mutter Druck macht, verliert er die Nerven, es kommt zum Streit. Am Ende sind beide geschafft.
Morgendliches Anziehen. Nach dem Aufstehen trödelt Justin herum. Er reagiert mit Trotz auf Aufforderungen der Mutter, sich zu beeilen oder sich richtig anzuziehen. Selten einmal kann die Mutter sich so durchsetzen, dass sich Justin allein anzieht. Oft muss sie ihren Sohn selbst anziehen, weil er sonst zu spät zur Schule kommt.
Zu-Bett-gehen. Gegen 20 Uhr schicken die Eltern Justin in sein Zimmer. Aber an jedem Abend spielen sich die gleichen Szenen ab: Justin kommt nach spätestens 20 Minuten wieder in das Wohnzimmer zurück und klagt, er könne nicht einschlafen. Die Eltern schicken ihn wieder auf sein Zimmer. Justin steht dann durchschnittlich noch zehnmal auf und wird immer wieder von seinen Eltern in sein Zimmer geschickt. Erst gegen 22.30 Uhr gibt es Ruhe. Dieses Verhalten belastet beide Eltern gleich stark.
Das Kind soll etwas erledigen. Justin kommt Aufforderungen der Mutter oder des Vaters häufig nicht oder nur halbherzig nach. Er muss immer wieder daran erinnert werden. In der Regel versucht er durch negative überzogene Reaktionen den Aufforderungen zu entkommen.
Als Verhaltensstärken des Jungen geben die Eltern an, dass sich Justin gerne körperlich betätigt. Im Sommer ist er oft auf dem Spielplatz oder fährt Fahrrad. Er interessiert sich für Tiere und hat auf diesem Gebiet ein großes Wissen. Weitere Verhaltensstärken können die Eltern jedoch nicht benennen.
|17|Justin selbst sieht das alles ganz anders als seine Mutter. Er beklagt sich darüber, dass seine Eltern immer nur „meckern“ und „schimpfen“. Er bekomme immer für alles die Schuld, z. B. wenn es Krach mit seinem Bruder gebe. Meistens würde der aber anfangen und ihn „aufziehen“. Wenn er sich wehre, würde der Bruder gleich losheulen und zur Mutter laufen, um sich zu beschweren.
Mit den Freunden sei es auch so eine Sache. Sie seien so zimperlich und ängstlich. Wenn er mit ihnen raufe, hätten sie keinen Spaß daran. Und auch wirklich spannende Filme dürften sie nicht sehen. Wenn er bei ihnen zu Hause spiele, müsse man zu ruhig sein und „sich benehmen“. Das mache eigentlich gar keinen Spaß. Und zu ihm nach Hause wollten sie meistens nicht kommen.
1.2 Eltern-Kind-Interaktionen
Aus dieser Konstellation ergeben sich schließlich unangemessene Erziehungspraktiken und -einstellungen, die den Eltern selten bewusst sind. Die Eltern legen eine eher bestrafende und kritisierende Reaktionsbereitschaft an den Tag. Vor allem aber richtet sich ihre Aufmerksamkeit nahezu ausschließlich auf das Fehlverhalten und die Unzulänglichkeiten des Kindes. Es wird immer weniger gesehen, was das Kind gut macht und erwartungsgemäß ausführt oder welche Stärken vorliegen. Letztlich sind die Eltern kaum mehr bereit, sich in das Kind einzufühlen und werden ihm emotional nur unzureichend gerecht.
Die Kinder hingegen entwickeln ein misserfolgsorientiertes Verhalten, sie meiden die für sie unerwünschten Situationen nach Kräften. Sie sind dann immer weniger gewillt, den Regeln, Erwartungen und Wünschen der Erwachsenen zu folgen. Im Gegenteil: Sie „stellen sich quer“ und versuchen selbst zu bestimmen „wo es lang geht“. Gerade weil sie so offensichtlich gegen die eigentlichen Wünsche und Verhaltenserwartungen verstoßen, erlangen sie oft eine relativ dominierende Position in der Familie. Infolgedessen wird das kindliche Problemverhalten unter Beteiligung der negativen Elterninteraktion aufrechterhalten; der Anteil der Eltern an diesem Geschehen erhält oftmals nicht die verdiente Aufmerksamkeit (Johnston & Jassy, 2007; Theule, Wiener, Tannock & Jenkins, 2013).
All dies führt auch zu Schwierigkeiten der Eltern untereinander. Beispielsweise weil die Partner das kindliche Verhalten unterschiedlich interpretieren und sich über die richtige Erziehung uneins sind. Kommen weitere Belastungen im Familienalltag hinzu kann leicht Unzufriedenheit bei den Partnern entstehen. Relativ triviale Alltagsbelastungen können dann eskalieren, und immer weniger von den Eltern bewältigt werden (etwa wegen Kommunikationsschwierigkeiten, negativer Vorerwartungen beim Partner). Im Zuge dessen erleben die Eltern allmählich ihre Beziehung als überwiegend unbefriedigend. Aus dem kindlichen Verhalten entstehen also leicht weitere sowie umfassendere familiäre und paarbezogene Belastungen, die bestehende Schwierigkeiten aufrechterhalten oder sogar weiter anreichern (Johnston & Jassy, 2007).
|18|Kapitel 2Einordnung in Diagnose-/Klassifikationssysteme
Die von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebene Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD, englisch International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) ist das wichtigste, weltweit anerkannte Diagnoseklassifikationssystem. Die im vorausgegangenen Kapitel beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten und Schwierigkeiten lassen sich dort im Wesentlichen unter zwei Kategorien einordnen: Hyperkinetische Störungen und Störungen des Sozialverhaltens. Diese werden im Weiteren dargestellt.
2.1 Hyperkinetische Störungen (HKS)
Unaufmerksamkeit, Überaktivität und Impulsivität stellen die drei Kernsymptome der HKS dar (ICD-10; Dilling, Mombour, Schmidt, Schulte-Markwort & Weltgesundheitsorganisation, 2006; siehe auch Tabelle 1):
Unaufmerksamkeit manifestiert sich insbesondere im vorzeitigen Abbrechen und einem häufigen Wechsel von Aktivitäten. Betroffene Kinder lassen sich leichter und schneller durch Außenreize ablenken und haben Schwierigkeiten, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Es fällt ihnen schwer, ihre Aufmerksamkeit selektiv auszurichten, was sich besonders deutlich bei eintönigen, nicht abwechslungsreichen Lernaufgaben zeigt. Bei eher passiven Tätigkeiten, zu denen eine hohe intrinsische Motivation besteht (Fernsehen, Videospiele), zeigt sich diese Symptomatik häufig weniger deutlich.
Die Überaktivität äußert sich in einer ständigen Unruhe, sowohl motorisch als auch verbal: Hyperaktive Kinder sind fast immer in irgendeiner Form in Bewegung, zappeln, schaffen es kaum, ruhig sitzen zu bleiben, fallen im Klassenraum häufig durch unaufgefordertes Aufstehen und Umherlaufen auf. Typisch ist auch ein so genannter Redeschwall. Die Überaktivität wird besonders auffällig in strukturierten Gruppensituationen, wie beispielsweise dem Schulunterricht, und lässt sich häufig nicht anhaltend durch disziplinarische Maßnahmen begrenzen.
Kennzeichen der Impulsivität ist eine mangelnde Impulskontrolle, eine Ungehemmtheit im Verhalten. Diese äußert sich beispielsweise darin, dass die Kinder direkt sagen, was sie gerade denken, ohne Rücksicht auf Gefühle anderer zu nehmen oder etwaige Konsequenzen für die eigene Person zu bedenken. In sozialen Kontakten wirken sie häufig distanzlos. Sie platzen mit einer Antwort heraus, noch bevor die Frage beendet wurde, oder unterbrechen und stören während eines Gespräches. Betroffenen Kindern bereitet es große Schwierigkeiten, auf etwas zu warten, etwa bis sie bei einem Spiel an die Reihe kommen. Es gelingt ihnen in der Regel nicht, auf ein längeres Ziel hinzuarbeiten, sie ziehen eine kleine unmittelbare Befriedigung oder Belohnung einer größeren, aber späteren vor. Aufgaben werden meist mit möglichst geringem Aufwand und in möglichst kurzer Zeit erledigt.
Neben dieser Kernsymptomatik müssen weitere Kriterien erfüllt sein, um eine HKS diagnostizieren zu können: Die Symptome müssen bereits vor dem siebten Lebensjahr aufgetreten sein und deutliches Leid verursachen bzw. die soziale oder schulische Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Weiterhin müssen die Symptome situationsübergreifend beobachtet werden, also beispielsweise im schulischen Kontext und im familiären Bereich. Als Ausschlusskriterien gelten eine tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84), eine manische Episode (F30), eine depressive Episode (F32) oder eine Angststörung (F41).
Tabelle 1: Forschungskriterien der Kernsymptomatik einer HKS sowie Einschluss- und Ausschlusskriterien gemäß ICD-10.
|19|Unaufmerksamkeit
mindestens 6 Monate lang mindestens 6 der folgenden Symptome:
Die Kinder
sind häufig unaufmerksam gegenüber Details oder Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten und sonstigen Arbeiten und Aktivitäten.
sind häufig nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben und beim Spielen aufrecht zu erhalten.
hören häufig scheinbar nicht, was ihnen gesagt wird.
können oft Erklärungen nicht folgen oder ihre Schularbeiten, Aufgaben oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht erfüllen.
sind häufig beeinträchtigt, ihre Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren.
vermeiden ungeliebte Aufgaben, wie Hausaufgaben, die geistiges Durchhaltevermögen erfordern.
verlieren häufig Gegenstände, die für bestimmte Aufgaben oder Aktivitäten wichtig sind, z. B. Unterrichtsmaterialien, Stifte, Bücher.
werden häufig von externen Stimuli abgelenkt.
sind im Verlauf der alltäglichen Aktivitäten häufig vergesslich.
Überaktivität
mind. 6 Monate lang mindestens 3 der folgenden Symptome:
Die Kinder
zappeln häufig mit Händen und Füßen oder winden sich auf den Sitzen.
verlassen ihren Platz im Klassenraum oder in anderen Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird.
laufen häufig herum oder klettern exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist, sind häufig unnötig laut beim Spielen oder haben Schwierigkeiten, sich ruhig mit Freizeitbeschäftigungen zu befassen.
zeigen ein anhaltendes Muster exzessiver motorischer Aktivitäten, die durch die soziale Umgebung oder Vorschriften nicht durchgreifend beeinflussbar sind.
Impulsivität
mind. 6 Monate lang mind. 1 der folgenden Symptome:
Die Kinder
platzen häufig mit der Antwort heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist.
können häufig nicht in einer Reihe warten oder warten, bis sie an die Reihe kommen.
unterbrechen oder stören andere häufig.
reden häufig exzessiv, ohne angemessen auf soziale Beschränkungen zu reagieren.
Beginn
Vor dem siebten Lebensjahr
Symptomausprägung
Die Kriterien sollten in mehr als einer Situation erfüllt sein, z. B. in der Schule und zuhause.
Leiden und soziale bzw. schulische Funktion
Die Symptome verursachen deutliches Leiden oder Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit.
Ausschlusskriterien
Die Störung erfüllt nicht die Kriterien einer
Tiefgreifenden Entwicklungsstörung (F84)
Manischen Episode (F30)
Depressiven Episode (F32)
Angststörung (F41)
|20|2.1.1 Subtypen in der ICD-10 bzw. DSM-5
Im ICD-10 werden mehrere Störungsformen unterschieden:
Eine einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (F90.0)
Eine Hyperkinetische Störung mit Störung des Sozialverhaltens (F90.1), welche vorliegt, wenn bei einer Störung von Aktivität und Aufmerksamkeit zusätzlich die Kriterien einer Störung des Sozialverhaltens erfüllt sind
Eine sonstige hyperkinetische Störung (F90.8), wenn nicht alle geforderten Kriterien der Kardinalsymptomatik erfüllt sind
Nicht näher bezeichnete hyperkinetische Störung (F90.9), wenn die allgemeinen Kriterien zwar erfüllt sind, aber nicht sicher zwischen F90.0 und F90.1 unterschieden werden kann
Eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung ohne Hyperaktivität (auch bekannt als ADS) wird unter der Restkategorie der sonstigen näher bezeichneten Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F98.8) eingeordnet.
Störungsmerkmale der ADHS gemäß DSM-5. Im deutschsprachigen Raum wird neben der HKS häufig analog der Begriff der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung bzw. ADHS verwendet. Diese Bezeichnung geht zurück auf das Klassifikationssystem der American Psychiatric Association. Aktuell handelt es sich um das DSM-5 (2013). Im Vergleich zur ICD-10 unterscheiden sich die beiden Klassifikationssysteme teilweise in der Definition der Diagnosekriterien und hinsichtlich der Anzahl und Bestimmung von Subtypen. Die folgenden Subtypen werden vorgestellt:
Gemischtes Erscheinungsbild (F90.2): Hier werden sowohl die Symptome von Unaufmerksamkeit als auch die von Hyperaktivität/Impulsivität während der letzten 6 Monate bestätigt (dieser Subtyp entspricht F90.0 in der ICD-10).
Vorwiegend unaufmerksames Erscheinungsbild (F90.0): Hier werden nur die Symptome der Unaufmerksamkeit während der letzten 6 Monate in der kritischen Häufigkeit erfüllt, nicht aber hyperaktiv-impulsives Verhalten.
Vorwiegend hyperaktiv-impulsives Erscheinungsbild (F90.1): Es werden hyperaktiv-impulsive Verhaltenssymptome festgestellt; die Hinweise auf eine klinisch bedeutsame Unaufmerksamkeit bleiben jedoch während der letzten 6 Monate unter der kritischen Grenze.
Teilremittierte Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung: Diese Einordnung wird dann vorgenommen, wenn die Diagnosekriterien zwar früher vollständig erfüllt wurden, in den letzten 6 Monaten aber nicht mehr in vollem Umfang, wobei die bestehenden Symptome aber immer noch das soziale, schulische oder berufliche Funktionsniveau beeinträchtigen.
Nicht näher bezeichnete Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (F90.9): Diese Kategorie gilt für Erscheinungsbilder, bei denen zwar charakteristische Symptome der ADHS vorherrschen, die in klinisch bedeutsamer Weise zwar Leiden oder Beeinträchtigungen verursachen, aber ohne daß die Kriterien für eine ADHS oder eine andere Störung der neuronalen oder mentalen Entwicklung vollständig erfüllt sind (vgl. APA/Falkai et al., 2015, S. 87).
2.1.2 Differenzierung nach Schweregraden
Im DSM-5 wird die Störung nach dem Grad der Schwere differenziert (DSM-5, S. 79):
Leichte ADHS: Wenige oder keine Symptome zusätzlich zu denjenigen, die zur Diagnosestellung erforderlich sind, nur geringfügige Beeinträchtigungen in sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsbereichen.
Mittelgradige ADHS: Die Ausprägung der Symptome und der funktionellen Beeinträchtigung liegt zwischen „leicht“ und „schwer“.
Schwere ADHS: Die Anzahl der Symptome übersteigt deutlich die zur Diagnosestellung erforderliche Zahl oder mehrere Symptome sind besonders stark ausgeprägt oder die Symptome beeinträchtigen die soziale, schulische oder berufliche Funktionsfähigkeit erheblich.
Dadurch kann eine verfeinerte Diagnose vorgenommen werden, außerdem orientieren sich die Behandlungsleitlinien an dem Schweregrad der Störung.
2.2 Störungen des Sozialverhaltens (SSV)
Die Kategorie „Störung des Sozialverhaltens“ fasst vier Gruppen von problematischen Verhaltensweisen zusammen (vgl. Petermann, Döpfner & Schmidt, 2001; Beelmann & Raabe, 2007):
Oppositionelle Verhaltensweisen richten sich in der Regel gegen erwachsene Bezugs- oder Beziehungspersonen (z. B. Eltern, Lehrer, Erzieher) und sind gekennzeichnet durch einen Mangel an Akzeptanz der Autoritäten, Nichteinhaltung von Regeln, Verweigerungshaltung und unangemessene Ärger|21|reaktionen (z. B. Wutausbrüche) zur Durchsetzung eigener Interessen;
Aggressives Verhalten beschreibt verbale und körperliche Verhaltensweisen mit einer Schädigungsabsicht, die sich gegen Sachen oder Personen richtet und gegen gesellschaftliche Normen und Regeln verstößt;
Delinquentes Verhalten verstößt gegen formelle Regeln, ist jedoch nicht zwingend von strafrechtlicher Relevanz (z. B. Konsum illegaler psychotroper Substanzen wie Cannabis oder Stimulanzien, Betrug, Schulschwänzen);
Kriminelles Verhalten verstößt gegen gültiges Recht und Gesetze und wird strafrechtlich verfolgt (z. B. Raub, Körperverletzung).
Das Klassifikationssystem ICD-10 (Dilling, Mombour, Schmidt, Schulte-Markwort & Weltgesundheitsorganisation, 2006) definiert eine Störung des Sozialverhaltens als ein wiederholtes, über mindestens 6 Monate anhaltendes Verhaltensmuster, bei dem entweder die Grundrechte anderer oder die wichtigsten altersentsprechenden sozialen Normen oder Gesetze verletzt werden. Tabelle 2 enthält die Merkmale der Störung.
Tabelle 2: Merkmale einer Störung des Sozialverhaltens gemäß ICD-10.
Merkmale
für das Alter ungewöhnlich häufige und schwere Wutausbrüche
häufiges Streiten mit Erwachsenen
häufige aktive Verweigerung von Forderungen Erwachsener oder Hinwegsetzen über Regeln
häufiges Handeln, das andere absichtlich ärgert
für eigenes Fehlverhalten werden andere häufig verantwortlich gemacht
leichte Reizbarkeit oder hohe Empfindlichkeit gegenüber anderen
häufiger Ärger oder Groll
häufige Gehässigkeit oder Rachsucht
häufiges Lügen oder Brechen von Versprechen zur Erlangung von Vorteilen oder zur Vermeidung von Verpflichtungen
häufiges Beginnen von körperlichen Auseinandersetzungen (außer Geschwisterauseinandersetzungen)
Gebrauch von gefährlichen Gegenständen/Waffen
häufiges Draußenbleiben in der Dunkelheit entgegen elterlichem Verbot (beginnend vor dem 13. Lebensjahr)
körperliche Grausamkeit gegenüber Menschen (z. B. Fesseln oder Verletzungen durch Feuer)
Tierquälerei
absichtliche Zerstörung fremden Eigentums anderer
absichtliches Legen von Feuer
Stehlen von Wertgegenständen
häufiges Schuleschwänzen
Weglaufen von den Eltern
kriminelle Handlung, bei der das Opfer direkt angegriffen wird
Zwingen einer anderen Person zu sexuellen Handlungen
häufiges Tyrannisieren anderer
Einbruch in Häuser, Gebäude oder Autos
Beginn in der Kindheit
Vor dem 10. Lebensjahr
Symptomausprägung
Vorliegen eines wiederholten, andauernden Verhaltensmusters, bei dem entweder die Grundrechte anderer oder die wichtigsten altersentsprechenden sozialen Normen oder Gesetze verletzt werden
Mindestens 6 Monate anhaltend, mit einigen der oben angegebenen Symptome
|22|Ausschlusskriterien
Die Störung erfüllt nicht die Kriterien einer
Dissozialen Persönlichkeitsstörung (F60.2)
Schizophrenie (F20)
Manischen Episode (F30)
Depressiven Episode (F32)
Tiefgreifenden Entwicklungsstörung (F84)
Hyperkinetischen Störung (F990)
Wenn die Kriterien für eine emotionale Störung (F93) erfüllt sind, ist die Diagnose „gemischte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen (F92)“ zu stellen.
2.2.1 Subtypen in der ICD-10
Die Klassifikation nach ICD-10 berücksichtigt das Vorhandensein von sozialen Bindungen (fehlende oder vorhandene Bindungen), den Kontext (auf den familiären Rahmen beschränkt oder situationsübergreifend) sowie den Schweregrad der auffälligen Verhaltensweisen:
Bei der auf den familiären Rahmen beschränkten Störung des Sozialverhaltens (F91.0) treten die problematischen Verhaltensweisen ausschließlich im familiären/häuslichen Rahmen auf und übersteigen das Maß oppositionellen Verhaltens (drei oder mehr Symptome aus Tabelle 2 müssen vorliegen, davon mindestens drei der Merkmale 9 – 23);
Bei der Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen (F91.1) weist der Betroffene nur wenige Beziehungen zu Gleichaltrigen sowie das Fehlen dauernder enger und gegenseitiger Freundschaften auf, es müssen drei oder mehr Symptome aus Tabelle 2 vorliegen, davon mindestens drei der Merkmale 9 – 23;
Bei der Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen (F91.2) müssen drei oder mehr Symptome aus Tabelle 2 vorliegen, davon mindestens drei der Merkmale 9 – 23, die Symptomatik muss auch außerhalb des familiären Rahmens auftreten, zudem müssen Beziehungen zu Gleichaltrigen in normalem Ausmaß vorliegen;
Bei der Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten (F91.3) müssen die Verhaltensweisen für das Entwicklungsalter unangemessen sein, vier oder mehr Symptome aus Tabelle 2 müssen vorliegen, davon höchstens zwei der Merkmale 9 – 23.
2.2.2 Störungsmerkmale der SSV gemäß DSM-5
Hier lassen sich die sozialen Störungen des ICD-10 wiederfinden in den relativ weitgefassten Verhaltensstörungen (conduct disorder, CD) sowie in der Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten (oppositional defiant disorder, ODD). Relativ leichte Verletzungen sozialer Normen genügen zur Erfüllung der Leitsymptomatik. Somit sind die Kriterien für eine klinisch bedeutsame Diagnose im DSM 5 „leichter“ zu erfüllen als im ICD-10.
Im DSM-5 werden verschiedene Schweregrade der Sozialstörung bestimmt (DSM-5, S. 647):
Leicht: Zusätzlich zu den für die Diagnose erforderlichen Symptome sind wenige oder keine weiteren Probleme des Sozialverhaltens vorhanden, und die Probleme des Sozialverhaltens fügen anderen nur geringen Schaden zu (z. B. Lügen, Schule schwänzen, ohne Erlaubnis nachts außer Haus bleiben, andere Regelverletzungen).
Mittel: Die Anzahl der Probleme des Sozialverhaltens und die Auswirkung auf andere liegen zwischen denen, die leichtgradig, und jenen, die als schwergradig beschrieben werden (z. B. Stehlen ohne direkten Kontakt mit dem Opfer, Vandalismus).
Schwer: Zusätzlich zu den für die Diagnose erforderlichen Symptomen sind viele weitere Probleme des Sozialverhaltens vorhanden oder die Probleme des Sozialverhaltens fügen anderen beträchtlichen Schaden zu (z. B. erzwungene sexuelle Handlungen, körperliche Grausamkeit, Benutzen einer Waffe, Stehlen in Kontakt mit dem Opfer, Einbruchsdelikte).
Das Ausmaß der prosozialen Emotionalität wird zudem über die Kategorien bestimmt: Mangel an Reue oder Schuldbewusstsein; Gefühlskälte; Mangel an Empathie; Gleichgültigkeit gegenüber eigener Leistung und schließlich oberflächlicher oder mangelnder Affekt.
Störung mit oppositionellem Trotzverhalten bildet eine eigene Kategorie (F91.3). Das dazugehörige Verhalten wird als anhaltendes Muster von ärgerlicher/gereizter Stimmung, streitsüchtigem/trotzigen Verhalten oder Rachsucht definiert, das sich in mindestens vier Symptomen sowie in der Interaktion mit mindestens einer anderen Person zeigt, die kein Geschwister ist. Gefordert wird, dass diese Verhaltensweise seit mindestens 6 Monaten besteht.
|23|Der aktuelle Schweregrade dieser Störung wird differenziert in:
leicht (die Symptome begrenzen sich auf eine Situation (z. B. auf die Schule, auf zu Hause, mit Gleichaltrigen auf der Arbeit)
mittel (die Symptome zeigen sich in zwei Situationen bzw. Bereichen)
schwer (die Symptome zeigen sich in drei oder mehr Situationen bzw. Bereichen)
2.3 Diagnostik
Die leitliniengerechte Diagnostik einer ADHS bzw. einer Störung des Sozialverhaltens ist voraussetzungsvoll und soll nur durch Fachärzte (Kinder- und Jugendpsychiater, Psychiater, Neurologen, Psychosomatische Mediziner) oder approbierte Psychotherapeuten für Kinder- und Jugendliche bzw. Erwachsene erfolgen. Dabei werden als routinemäßige Maßnahmen eingesetzt:
Eine umfassende strukturierte Exploration von Eltern und Bezugspersonen (Lehrkräfte, Erzieher*innen) zur aktuellen Symptomatik (Art, Häufig, Intensität) in den verschiedenen Lebensbereichen und in ihrer situativen Ausprägung (z. B. bei den Hausaufgaben, bei Familienausflügen, beim Fernsehen).
Feststellung der Funktionseinschränkungen (z. B. in Beziehungen, in der Leistungsfähigkeit, bei der sozialen Teilhabe).
Feststellung von komorbiden psychischen Störungen (z. B. Störung des Sozialverhaltens, Depression, Ängstlichkeit) bzw. begleitenden körperlichen Erkrankungen.
Differenzialdiagnostische Abgrenzung zu anderen Störungsbildern mit ähnlicher Symptomatik (z. B. Autismus-Spektrum-Störungen, stereotype Bewegungsstörungen, Schlafmangel, Hyperarousal bei traumatischen Belastungsstörungen).
Aktuelle und frühere Rahmenbedingungen des Patienten (Kind, Jugendlicher, Erwachsener), Ressourcen und Belastungen in der Familie, im Kindergarten oder der Schule bzw. bei Jugendlichen und Erwachsenen am Arbeitsplatz, einschließlich der Belastung und Gesundheit der Bezugspersonen, bspw. von Eltern, Lehrkräften, Ehepartner).
Spezifische Entwicklungsgeschichte des Patienten (Beginn und Verlauf der ADHS, Vorbehandlungen und deren Ergebnisse).
Möglichkeiten (Ressourcen), Wünsche und Bedürfnisse des Patienten und seiner Bezugspersonen.
Familienanamnese mit Schwerpunkt auf ADHS bei den Eltern oder den Geschwistern.