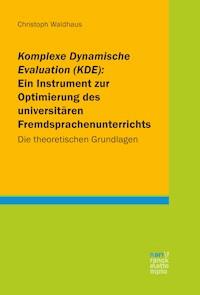
Komplexe Dynamische Evaluation (KDE): Ein Instrument zur Optimierung des universitären Fremdsprachenunterrichts E-Book
Christoph Waldhaus
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Komplexe Dynamische Evaluation (KDE) generiert Daten zur Verbesserung des universitären Fremdsprachenunterrichts und fördert die selbstreflexiven Kompetenzen der Lehrenden und Studierenden. Durch den Einsatz dieses Evaluationsmodells rücken die Studierenden nicht nur verstärkt ins Zentrum des Unterrichtsgeschehens, sondern beteiligen sich auch aktiv an dessen Optimierung. KDE stärkt die Autonomie der Lernerinnen und Lerner und verdeutlicht ihre zentrale Rolle am Gelingen von gutem Unterricht. Für die Lehrenden stellen die gewonnenen Informationen eine wichtige Quelle bei der Optimierung der Lehre und der Entwicklung ihrer eigenen Lehrkompetenz dar. KDE ermöglicht ein umfassendes Verständnis von Evaluation im Unterricht und schöpft bisher ungenutztes Potential bei Lehrveranstaltungsevaluationen aus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Waldhaus
Komplexe Dynamische Evaluation (KDE): Ein Instrument zur Optimierung des universitären Fremdsprachenunterrichts
Die theoretischen Grundlagen
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2017 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.francke.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
E-Book-Produktion: pagina GmbH, Tübingen
ePub-ISBN 978-3-8233-9012-1
Inhalt
Meinen Eltern.
Geleitwort
Als Universitätslehrender beobachtete ich jahrelang am Semesterende meine Studierenden beim Ausfüllen eines von meiner Universität vorgelegten Fragebogens, in dem sie über meine Lehrveranstaltung, meine fachliche Kompetenz und über meine Fähigkeit, Lehrstoff zu vermitteln, befragt wurden. Ob ich in meinen (auf Englisch abgehaltenen) Kursen gendergerechte Formen verwendete, wollte die Universität auch wissen. Weder die Studierenden noch ich nahmen das Ankreuzen der Fragebogen-Kästchen besonders ernst; wir wussten ja, dass die Fragen sehr allgemein formuliert und daher wenig aussagekräftig waren, dass die Antworten zwar in eine statistische Auswertung konvertiert würden, diese aber weitgehend ungelesen oder unbeachtet im Papierkorb landen würde.
In einer Zeit, in der im Zuge des Bologna-Prozesses die Betonung auf den Ausgangskompetenzen der Studierenden liegt, fand ich diese trivialisierte Form der Evaluierung äußerst bedenklich. Obwohl ich dieses Ritual zwangsläufig durchführte, schwirrte mir ständig die Frage im Kopf herum: cui bono? Oder um es etwas umgangssprachlicher zu formulieren: wozu der ganze Zirkus? Daher erwartete ich mit großer Spannung die Ergebnisse des von Christoph Waldhaus durchgeführten Forschungsprojektes, welches ich im Rahmen seiner Dissertation betreuen konnte. Erleichtert konnte ich feststellen, dass es ihm mit seinem Modell der Komplexen Dynamischen Evaluation gelungen war, die Evaluierung aus dem Zirkuszelt zu befreien und sie in den Bereich der hohen Künste zu führen.
LeserInnen dieses Buches werden in mehrfacher Hinsicht auf ihre Kosten kommen:
Der erste Teil liefert einen äußerst umfassenden Überblick über vorhandene Theorien und Modelle der Qualitätssicherung und Evaluation. Vor einigen Jahren trug ein Film von Woody Allen den Titel »Everything you always wanted to know about sex but were afraid to ask«. Man könnte die ersten Kapitel dieses Buchs ähnlich titulieren: »Alles was Sie schon immer über Evaluation und Qualität wissen wollten, aber sich bisher nicht zu fragen trauten«. Denn Christoph Waldhaus informiert seine LeserInnen sowohl über die vielen Fragen, die die Qualitätsoptimierung auf Basis von Evaluation aufwirft, als auch über eine sehr breite Palette an Theorien und Modellen, die sich in den letzten Jahrzehnten der Evaluation im Kontext der europäischen Hochschulen widmeten, fasst sie zusammen und nimmt sie kritisch unter die Lupe bzw. nutzt Aspekte daraus für sein eigenes Modell.
Den Höhepunkt des Buches bildet die Präsentation des eigens entwickelten Modells der Komplexen Dynamischen Evaluation (KDE). Diese besteht aus drei ineinanderfließenden Komponenten: eine Vor-, eine begleitende und eine Endevaluation. Von besonderem Interesse ist der prozessorientierte Ansatz der Evaluation, der, im Gegensatz zu einer alleinigen Vor- und Endevaluation, das Potential hat, Erkenntnisse unmittelbar in den Lehr- und Lernprozess einfließen zu lassen und damit beide positiv zu beeinflussen. Sie ist also nicht nur summativer, sondern auch formativer Natur. Eine prozessorientierte Evaluation im gegebenen Kontext setzt voraus, dass der/die Evaluierende selbst in der Lehre tätig ist; die Evaluation sieht ja eine Begleitung vor.
Ein besonderer Vorzug dieses Buches besteht zudem darin, dass Christoph Waldhaus kein abgehobener unterrichtsferner Akademiker ist, sondern er und einige seiner KollegInnen die KDE in Sprachkursen an der Universität Graz angewendet haben. Das kontinuierliche Feedback von Studierenden über den Unterricht und über das eigene Lernen, sowie die aus dem Einsatz der KDE gewonnenen Erkenntnisse ermöglichten es ihm in Folge, sein Modell ständig zu verbessern. Was die LeserInnen dieses Buches erwartet, ist daher ein Evaluierungsmodell, das auf einer Fülle theoretischer Erkenntnisse basiert, die im vorliegenden Band behandelt werden und zusätzlich wertvolle Impulse und Ideen für praktizierende LehrerInnen liefert. Diese werden im Detail in den Folgebänden gegeben. Vor allem zeigt sein Ansatz auch, welchen Stellenwert Evaluation im Rahmen eines aufgeklärten, modernen Unterrichtskonzepts haben kann.
Graz, im April 2017
Ao. Univ-Prof. Dr. David Newby
Vorwort
Das vorliegende Buch ist ein Teil meiner Dissertation, welche im Jahr 2014 an der Karl-Franzens-Universität Graz zugelassen wurde. Nach einigen Modifikationen und Aktualisierungen habe ich mich dazu entschlossen, die Idee, die hinter der Komplexen Dynamischen Evaluation (KDE) steht, aufgrund ihres Umfangs in mehreren Bänden zu publizieren. Dieser erste Band soll die theoretischen Grundlagen schaffen und, auf diesen aufbauend, die Konzeption der KDE aufzeigen.
Wenngleich die unterschiedlichen Inhalte auch für ForscherInnen in den Bereichen Qualität und Evaluation interessant sein dürften, so richten sich die einzelnen Bände primär an universitäre Fremdsprachenlehrende, die das Modell in ihrem Unterricht einsetzen, oder eine andere Sichtweise auf Evaluation und Qualitätsverbesserung im Fremdsprachenunterricht kennen lernen möchten. Zudem wird eine Verknüpfung zwischen Fremdsprachendidaktik und der Theorie der komplexen dynamischen Systeme (CDST) hergestellt, was in Folge auch als Basis für die Komplexe Dynamische Evaluation dient. Nach Auseinandersetzung mit den einzelnen theoretischen Komponenten wird gegen Ende dieses ersten Bandes die KDE auf Basis der vorangehenden theoretischen Ausführungen konzipiert und der Einsatz dieses Modells im universitären Fremdsprachenunterricht skizziert. Band Eins dient daher als Grundlage für sämtliche spätere Publikationen zur KDE.
Die zukünftigen Bände befassen sich in Folge mit der Konzeption und Testung der einzelnen Hauptkomponenten des Modells (Vorevaluation, Begleitende Evaluation und Endevaluation) und seinen jeweiligen Bestandteilen. Zudem werden sowohl potentielle Herausforderungen wie auch mögliche Lösungen aufgezeigt und die LeserInnen finden Hinweise und Tipps bei der praktischen Anwendung der KDE oder ausgewählter Teilkomponenten im Fremdsprachenunterricht.
Taipei, im April 2017
Assist. Prof. Dr. Christoph Waldhaus
Danksagung
Wie bereits Goethe feststellte, lässt sich wahrhafte Dankbarkeit mit Worten nicht ausdrücken. Dennoch möchte ich dies versuchen, weil das vorliegende Buch ohne die Unterstützung vieler Menschen in meinem Umfeld nicht möglich gewesen wäre.
An erster Stelle sage ich meinen Eltern Danke, denn sie ermöglichten mir, diesen Weg einzuschlagen und unterstützten mich dabei, ihn bis zum Ende zu gehen. In Hinblick auf die Publikation bedanke ich mich dabei besonders herzlich bei meiner Mutter, die die Mühe des Korrekturlesens auf sich nahm.
In weiterer Folge danke ich meinem Doktorvater Prof. Dr. David Newby und meinem Zweitbetreuer Prof. Dr. Paul Portmann-Tselikas für ihre wertvollen Hinweise, kritischen Fragen, sowie auch für ihre aufmunternden Worte und die Gespräche zwischendurch, die mich auch in persönlicher Hinsicht bereicherten. Ebenso bedanke ich mich bei Prof. Dr. Stefan Schneider für seine hilfreichen Impulse und bei Prof. Dr. Tobias Wolbring sowie Ass.-Prof. Dr. Werner Stangl, die mir vor der Publikation ein Feedback gaben.
Ein großes Dankeschön gilt DI Michael Spitzer, der mir bei technischen Fragen zur Seite stand und sämtliche Programmierarbeiten an der KDE in höchster Effizienz und Präzision und zumeist unter hohem Zeitdruck durchführte.
Darüber hinaus möchte ich dem Team von treffpunkt sprachen meinen herzlichen Dank aussprechen, in erster Linie der Leiterin, Dr. Daniela Unger-Ullmann, die mir nicht nur den einen oder anderen praxisbezogenen Tipp gab, sondern auch ermöglichte, das Projekt VorEval am treffpunkt sprachen zu testen und die finanziellen Voraussetzungen und organisatorischen Rahmenbedingungen hierfür schaffte. Natürlich wäre es auch ohne meine KollegInnen und alle an der Konzeptions- und Testphase teilnehmenden Studierenden nicht möglich gewesen, dieses Projekt durchzuführen, weswegen ich auch ihnen zu großem Dank verpflichtet bin.
Zuletzt danke ich Frau Dr. Corinna Whyment für die Endkorrektur und ihre aufmunternden Kommentare.
1Einleitung
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen,
durch die sie entstanden sind.
(Albert Einstein)
Die Evaluation von Lehrveranstaltungen durch Studierende stellt ein mittlerweile in nahezu allen universitären Kursen, Seminaren und Vorlesungen verwendetes Mittel der Qualitätsoptimierung und -sicherung dar. Diese Methode wird in den USA bereits seit den 1920er Jahren (vgl. Marsh 1987:257) eingesetzt und untersucht und hat sich inzwischen auch im deutschsprachigen Raum als wahrscheinlich die Methode zur Verbesserung der Lehre etabliert. Hier fand sie ihren Ursprung als Folge der 68er-Bewegung und den damit verbundenen Reformen an den Hochschulen und »ergießt« sich seit Anfang der 1990er Jahre geradezu über die deutschsprachigen Universitäten, wie Rindermann (2009:32f) dies treffend formuliert.
Ihr Stellenwert im universitären Qualitätsmanagement wird auch durch ihre Verankerung in den jeweiligen Universitätsgesetzen untermauert, welche regelmäßige Evaluationen an deutschsprachigen Universitäten vor gut 20 Jahren zum fixen Bestandteil sämtlicher qualitätsverbessernder Bestrebungen machte (für Österreich siehe Kohler, 2009; für Deutschland siehe Schmidt, 2009 und für die Schweiz siehe Rhyn, 2009). Zudem werden die mit Evaluationen verbundenen Ergebnisse vielfach nicht nur innerhalb der Universitäten, sondern auch von Geldgebenden, PolitikerInnen und in den Medien diskutiert (siehe z.B. Der Standard 9. Mai 2007). Darüber hinaus hat mittlerweile sowohl die Anzahl der einzelnen Evaluationsmodelle als auch die Literatur hierzu ein Ausmaß erreicht, das – wie auch Mittag/Mutz/Daniel (2012:14) feststellen – »im Rahmen eines qualitativen Literaturreviews nicht mehr zu bewältigen ist«. Evaluation stellt demnach keine Modeerscheinung dar, sondern wird als wesentlicher Bestandteil der Qualitätsbestrebungen an Hochschulen gesehen.
Trotz dieser langen Historie, der Fülle an Publikationen zu diesem Thema und trotz ihres vermeintlichen Stellenwertes in der Hochschulpolitik wird die Lehrveranstaltungsevaluation dennoch nach wie vor von einigen kritisch betrachtet und ihre Effizienz im Hinblick auf die Optimierung der Lehre oftmals in Frage gestellt. Dies hat unterschiedliche Gründe und ist häufig auch darauf zurückzuführen, dass viele Evaluationen mitunter relativ konzeptlos wirken bzw. sind und mehrheitlich nicht von EvaluationsexpertInnen konzipiert oder ohne klar ersichtliche theoretische Basis erstellt wurden, wie Spiel (vgl. 2001:7) feststellt.
Während die einen (siehe z.B. Alphei 2006:7) in Bezug auf Lehrveranstaltungsevaluation von einem der wichtigsten Verfahren zur Unterrichtsoptimierung sprechen, ist es für andere (siehe z.B. Liessmann 2005:15ff) höchst umstritten oder sogar eine Krankheit, »Evaluitis« (siehe z.B. Simon 2000, Frey 2007), die die Lehrveranstaltungen an Universitäten befällt und an welcher Studierende und Lehrende gleichsam leiden, ohne wirklich nachhaltige Verbesserungen zu bemerken. Und in der Tat ist gerade jener Bereich der Evaluationsforschung rar, der sich konkret mit den durch Evaluation ausgelösten vermeintlichen Verbesserungen oder Verschlechterungen der Lehrqualität befasst, wie Rindermann (vgl. 2009:227) feststellt. vgl. Spiel/Gössler (vgl. 2001:13) weisen zudem darauf hin, dass die Konzentration der Evaluation im universitären Kontext primär auf Analyse und Bewertung liegt und nicht auf konkreten Änderungsmaßnahmen. Außerdem wird das »Wie« meist breit diskutiert, während das »Wozu« fast immer ausgeklammert bleibt (vgl. ibid.).
Welchen Standpunkt man in diesem mitunter subjektiv und oftmals emotional geführten Krieg der (Evaluations-)Welten auch vertreten mag, es sind reichlich Argumente für und auch gegen das Durchführen von Lehrveranstaltungsevaluationen vorhanden, die für die jeweiligen Evaluationsprojekte sorgfältig abgewogen werden müssen. Eine detaillierte Abhandlung hierzu würde den Rahmen dieses Buches sprengen, es sei u.a. jedoch auf Rindermann (2009), Kromrey (1996), McKeachie (1997), Simon (2000) und Frey (2007) verwiesen.
Während für mich die potentiellen Vorteile einer Evaluation in vielen Bereichen der universitären Qualitätsoptimierung, ganz besonders auch im Bereich des Fremdsprachenunterrichts, klar auf der Hand liegen, so teile ich gleichzeitig auch den kritischen Zugang zur Lehrveranstaltungsevaluation als der Methode zur Qualitätsoptimierung der Lehre, denn das Durchführen einer Evaluation stellt per se noch lange keine hinreichende Bedingung für Qualität oder deren Optimierung dar, wie auch Schöch (vgl. 2005:152) feststellt. Mindestens genauso wichtig wie die Evaluation selbst ist das, was darauf folgt. Nur wenn die mit Hilfe der Evaluation gewonnen Informationen genutzt und umgesetzt werden, lohnt sich der damit zwangsläufig verbundene Mehraufwand.
Zwei Dinge müssen an dieser Stelle mit aller Deutlichkeit kommuniziert werden: Erstens, jede Evaluation ist mit einem gewissen (Mehr-)Aufwand verbunden und braucht daher Ressourcen. Zweitens, eine Evaluation ohne durchdachtes Follow-Up bewirkt keine Qualitätsoptimierung. Nur wenn man sich dieser Tatsachen bewusst ist und den mit einer Evaluation bzw. dem daran anschließenden Follow-up verbundenen Mehraufwand in Kauf nimmt, kann eine Qualitätsverbesserung erfolgen.
Evaluation wird im vorliegenden Ansatz – wenn richtig durchgeführt – als zentrale, vielschichtige und wirkungsvolle Methode zur Unterrichtsoptimierung gesehen, jedoch ist auch zu betonen, dass sie kein Allheilmittel darstellt und auch nicht alle Probleme und Defizite, die sie aufzeigt, im Rahmen des Hochschulkontextes beseitigt werden können. Vielfach fehlen hier die nötigen (monetären) Mittel und (zeitlichen) Ressourcen. Zudem muss darauf hingewiesen werden, dass nicht jede aktuell eingesetzte Evaluation jene Wirkung erzielt, die damit intendiert wird.
Evaluiert man die an vielen Universitäten eingesetzten Evaluationsmodelle, kann man nicht selten feststellen, dass zahlreiche dieser Werkzeuge und Methoden in Hinblick auf deren Optimierungspotential oftmals fragwürdig sind und mitunter angezweifelt werden muss, ob damit tatsächlich eine wirksame Unterrichtsverbesserung möglich ist. Zentrale Probleme, die bei einer Metaevaluation1 im Vorfeld detektiert wurden, sollen in Folge kurz diskutiert werden, bevor im anschließenden Abschnitt der in diesem Buch konzipierte Lösungsansatz vorgestellt wird.
1.1Problemstellung
Die Motivation für diese Arbeit entstand primär aus einer Unzufriedenheit heraus, die ich im Laufe meiner mittlerweile über zehnjährigen Lehrtätigkeit an unterschiedlichen universitären Fremdsprachenzentren und Instituten im In- und Ausland mit den jeweils eingesetzten Lehrveranstaltungsevaluationen verspürte. Diese sind in der Regel mit einem hohen Aufwand verbunden und bringen oftmals aber nur einen kleinen Ertrag. Sie werden z.B. vielfach nach wie vor mit Hilfe von Papierfragebögen durchgeführt, in welchen die LernerInnen den Lehrpersonen am Ende des Semesters ein Feedback zum Kurs geben. Dadurch soll zur Qualitätsverbesserung der betreffenden Lehrveranstaltung beigetragen werden, was mit den jeweiligen Modellen meiner Erfahrung nach und nach Ansicht vieler meiner KollegInnen in den meisten Fällen jedoch nur eingeschränkt möglich ist.
Eine vollständige Auflistung sämtlicher Aspekte, die mit vielen dieser und anderer aktuell eingesetzter Evaluationsmodelle und Methoden einhergehen, wäre verhältnismäßig lang und zu umfangreich, um ihr an dieser Stelle die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass die Zahl an Evaluationsmodellen und Fragebögen, wie bereits angeführt, mittlerweile nahezu unüberschaubar ist, und zum anderen damit, dass auch die Kriterien, nach welchen man die einzelnen Modelle untersuchen und bewerten könnte, vielfältig und umfangreich sind. Daher wird hier von einer detaillierten Analyse Abstand genommen und es sollen nur einige zentrale Punkte aufgezeigt und kurz diskutiert werden, die das effektive Optimieren des universitären Fremdsprachenunterrichts mit Hilfe der untersuchten Modelle erschweren.
Um die Analyse auf einen für den Rahmen dieses Buches angemessenen Umfang zu beschränken, konzentrierte ich mich auf die Lehrveranstaltungsevaluationen jener fünf österreichischen Fremdsprachenzentren, die zum Untersuchungszeitpunkt (2012) dem Verband universitärer Sprachenzentren und -institutionen (VUS) angehören.
Obwohl es sich hierbei um eine vergleichsweise kleine Stichprobe handelt, kann dennoch festgestellt werden, dass sie sehr repräsentativ ist und die hier angeführten zentralen Problematiken auf die Mehrheit der Sprachenzentren im europäischen Hochschulraum – und wahrscheinlich auch darüber hinaus – in der einen oder anderen Weise zutreffen, da viele Sprachenzentren ähnliche Verfahren zur Qualitätsoptimierung einsetzen.
Eine Kollegin am treffpunkt sprachen, die in einem, der im Rahmen meiner Dissertation durchgeführten qualitativen Interviews befragt wurde, bringt einige der zentralen Themen aktueller Lehrveranstaltungsevaluationen im Fremdsprachenunterricht wie folgt auf den Punkt:
[…] weil ich mich sowieso seit einiger Zeit schon über diese ständigen Evaluierungen ärgere, nicht weil sie schlecht sind, sind sie nicht, aber es interessiert mich auch nicht zum hundertsten Mal zu hören, dass ich so ein nice teacher bin und so. Irgendwann finde ich, reicht es. treffpunkt sprachen muss natürlich für Qualität sorgen, soll mich von mir aus ein Jahr beobachten und dann finde ich, ist es aus und ich habe einfach keine Lust mehr. Ich mag mich nicht mehr evaluieren lassen.
[LP002, 224–230]
Die Inhalte dieser Aussage sind zweifelsfrei auch als einige der Hauptgründe für die von Simon (2000) und Frey (2007) angeführte »Evaluitis« zu sehen, an der viele KollegInnen, vor allem, wenn sie schon mehrere Jahre unterrichten, leiden. Die meisten Lehrenden sind nicht mit einer Evaluation ihres Unterrichts per se unzufrieden und negieren auch nicht deren Wichtigkeit im Hinblick auf ihr Potential, essentielle Informationen zur Qualitätsoptimierung zu generieren. Sie erkennen in der Regel auch die allgemeine Notwendigkeit von Evaluationen in Hinblick auf die Präsentation der betreffenden Institute und Zentren nach außen an, stellen jedoch, wie die Kollegin aus dem Interview, vielfach fest, dass die Art und Weise, mit der diese Evaluationen durchgeführt werden, also der Evaluationsansatz, und die Informationen, die sie zum Teil fördern, insuffizient sind, was oftmals zur Folge hat, dass Lehrende mit der Zeit eine Aversion gegen das Evaluieren entwickeln. In der Tat ist diese Abneigung auch bei vielen Studierenden zu bemerken, denn es darf nicht vergessen werden, dass diese in der Regel viele Evaluationen pro Semester – in jedem der von ihnen besuchten Kurse zumindest eine – durchführen müssen. Hinzu kommen weitere Befragungen, die beispielsweise einen bestimmten Lehrgang oder die Universität und deren Einrichtungen etc. betreffen. Man kann also nicht behaupten, es würde zu wenig evaluiert.
Auf der Suche nach den Gründen, warum es in Hinblick auf Lehrveranstaltungsevaluationen überhaupt zu den oben genannten und anderen Problemen kommt, können unterschiedliche Ursachen ausfindig gemacht werden. Im Wesentlichen hängen sie jedoch damit zusammen, dass bei vielen Evaluationen oftmals gewisse Standards, wie sie etwa im Handbuch der Evaluationsstandards (siehe unten bzw. Sanders 2006) angeführt werden, keine oder eine zu geringe Berücksichtigung finden. Auch die Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung im europäischen Hochschulraum (ESG), die im folgenden Kapitel vorgestellt werden und für die Qualitätsoptimierung bzw. -sicherung durch Evaluation zentral sind, werden in der Regel nicht in das Evaluationsprozedere integriert.
Bevor ich nun einige der zentralen Stellen aufzeige, an welchen die einzelnen Evaluationsmodelle Raum für Optimierung haben, möchte ich einen kurzen Exkurs zu den Evaluationsstandards machen, damit die darauffolgenden Ausführungen für den Leser/die Leserin leichter nachvollziehbar sind.
1.2Evaluationsstandards
Damit sowohl die Anforderungen aus der Praxis als auch wissenschaftliche Standards und Richtlinien beim Durchführen von Evaluationen berücksichtigt bzw. die Qualität von Evaluationen optimiert und gesichert werden können, entwickelte das Joint Commitee on Standards for Educational Evaluation1 Richtlinien, die beim Planen, Durchführen und Bewerten von Evaluationen als Orientierung dienen.
Diese Qualitätsmaßstäbe sind im Handbuch der Evaluationsstandards festgehalten und richten sich sowohl an EvaluatorInnen als auch an AuftraggeberInnen. Sie sind nicht als starre mechanische Regeln, sondern als Leitprinzipien zu verstehen und enthalten wichtige Hinweise und Warnungen zur Vermeidung von Fehlern, die bei der Konzeption bzw. der Durchführung von Evaluationen auftreten können. Zudem bezeichnen sie, welche Vorgehensweisen allgemein als akzeptabel bzw. inakzeptabel gehalten werden und zeigen die zurzeit beste Praxis auf (vgl. Sanders 2006:35). Die aktuelle Version sieht folgende Standards für Evaluationen vor:
1.2.1Inhalte der Evaluationsstandards
Nützlichkeitsstandards
Nützlichkeitsstandards legen fest, ob eine Evaluation den tatsächlichen Informationsbedürfnissen der jeweiligen AdressatInnen gerecht wird. Dazu werden die AdressatInnen und deren Evaluationsbedürfnisse genau ermittelt und die Evaluation demgemäß durchgeführt. Zudem müssen die gewonnenen Informationen bedeutsam sein und rechtzeitig ermittelt werden.
Durchführbarkeitsstandards
Durchführbarkeitsstandards betonen die Praxisbezogenheit von Evaluationen. Diese werden in der Regel nicht in einem Labor, sondern in einem natürlichen Umfeld durchgeführt und verbrauchen daher Ressourcen. Folglich müssen sie so konzipiert sein, dass sie nur so viel Material, Personal, Zeit etc. in Anspruch nehmen, wie erforderlich ist.
Korrektheitsstandards
Die Korrektheitsstandards fordern, dass Evaluationen rechtlich und ethisch korrekt durchgeführt und die Rechte (Privatsphäre, Zugänglichkeit zu Informationen, Schutz der Persönlichkeit etc.) der an Evaluationen beteiligten Personen gewahrt und respektiert werden.
Genauigkeitsstandards
Die Genauigkeitsstandards legen fest, ob eine Evaluation angemessene Informationen hervorbringt. Es sollen die relevanten und als wichtig erachteten Daten erhoben und beurteilt werden. Die Daten sollen technisch angemessen sein und die Urteile müssen in einem logischen Zusammenhang mit den Daten stehen. Damit wird die Güte und Verwendbarkeit der Informationen bestimmt.
Tab. 1: Inhalte der Evaluationsstandards in Anlehnung an Sanders (vgl. 2006:31f)
Natürlich muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass diese Standards ursprünglich in den USA entwickelt wurden und eine Eins-zu-eins-Übertragung nicht für alle Länder und alle Situationen möglich und sinnvoll ist. Es ist ratsam, zuerst den Evaluationskontext zu analysieren und dann eventuell nötige Adaptionen durchzuführen. Insgesamt sind diese potentiellen Anpassungen jedoch, wie auch Beywl/Widmer (2006:261) festhalten, »eher geringfügiger Art«, weswegen sich die Evaluationsstandards als Basis für die meisten Evaluationen eignen. Dies trifft vor allem auf die Grundstruktur mit den vier genannten Hauptgruppen (Nützlichkeits-, Durchführbarkeits-, Korrektheits- und Genauigkeitsstandards) zu.
Im Bereich des universitären Fremdsprachenunterrichts können diese Standards meiner Erfahrung nach weitgehend unverändert übernommen werden, wenngleich der oben angesprochene Kontext durch die Ausführungen in den Theoriekapiteln (Kapitel 3, 4, 5) zuerst genau analysiert und bestimmt werden sollte. Dies ist nötig, um festzustellen, welche der einzelnen Standards für die Evaluation von Fremdsprachenkursen, wie sie hier vorgestellt wird, in welcher Form und in welchem Umfang sinnvoll und plausibel sind. Neben diesen bereits erwähnten sind auch noch weitere Standards wie z.B. die genannten ESG sowie andere Qualitäts- und Bildungsstandards zu beachten.
1.2.2Evaluationsstandards im Detail
Nützlichkeitsstandards
Ermittlung der Beteiligten und Betroffenen
Glaubwürdigkeit der EvaluatorInnen
Umfang und Auswahl der Informationen
Feststellung von Werten
Klarheit des Berichts
Rechtzeitigkeit der Verbreitung des Berichts
Wirkung der Evaluation
Durchführbarkeitsstandards
Praktische Verfahren
Politische Tragfähigkeit
Kostenwirksamkeit
Korrektheitsstandards
Unterstützung der Dienstleistungsorientierung
Formale Vereinbarungen
Schutz individueller Menschenrechte
Human gestaltete Interaktion
Vollständige und faire Einschätzung
Offenlegung der Ergebnisse
Deklaration von Interessenskonflikten
Finanzielle Verantwortlichkeit
Genauigkeitsstandards
Programmdokumentation
Kontextanalyse
Beschreibung von Zielen und Vorgehensweisen
Verlässliche Informationsquellen
Valide Informationen
Reliable Informationen
Systematische Informationsüberprüfung
Analyse quantitativer Informationen
Analyse qualitativer Informationen
Begründete Schlussfolgerungen
Unparteiische Berichterstattung
Meta-Evaluation
Tab. 2: Evaluationsstandards im Detail (vgl. Sanders 2006)
Um die im folgenden Abschnitt diskutierten Probleme bei den untersuchten Lehrveranstaltungsevaluationen beim Entwurf des in diesem Band vorgestellten Modells weitgehend zu vermeiden, werden sämtliche der hier genannten Standards bei dessen Konzeption berücksichtigt.
1.3Optimierungspotential bei Evaluationsmodellen
Um nun wieder auf jene Aspekte zurückzukommen, die bei vielen Lehrveranstaltungsevaluationen optimiert werden können, werden, ausgehend von den Evaluationsstandards, in Folge einige zentrale Punkte angeführt, die vor allem mit den Nützlichkeitsstandards, Durchführbarkeitsstandards und Genauigkeitsstandards in Konflikt stehen. Die Korrektheitsstandards wurden in den analysierten Lehrveranstaltungsevaluationen meiner Ansicht nach nicht verletzt, da alle, soweit von außen nachvollziehbar, zum Zeitpunkt der Analyse rechtlich und ethisch korrekt durchgeführt wurden.
Als ein Hauptkriterium für das erfolgreiche Durchführen von Evaluationen wird im Handbuch der Evaluationsstandards unter den Nützlichkeitsstandards festgehalten, dass Evaluationen »informativ, zeitgerecht und wirksam« sein sollen (vgl. Sanders 2006:31). Dies ist eine zentrale Forderung, denn mit jeglicher Evaluation stehen gewisse Ziele in Verbindung. Werden Nützlichkeitsstandards nicht erfüllt, sind die Ergebnisse der Evaluation für bestimmte Absichten, wie etwa die Qualitätsoptimierung des Fremdsprachenunterrichts, kaum relevant und der Aufwand steht in keiner vertretbaren Relation zum Informationsgehalt.
Wenngleich der Informationsgehalt, den die untersuchten Evaluationsfragebögen generieren, den Lehrenden bei der Optimierung der Lehre in der einen oder anderen Form durchaus behilflich sein könnte, so ist bei den analysierten Modellen der Zeitpunkt sehr ungünstig, zu welchem die Lehrenden an die jeweiligen Informationen gelangen. Ausnahmslos alle analysierten Evaluationen wurden zum Untersuchungszeitpunkt in Form einer summativen Evaluation am Ende des Kurses/Semesters durchgeführt.
Summative Evaluationen werden im Gegensatz zu formativen Evaluationen nach der Durchführung eines Programms (z.B. Fremdsprachenkurs) oder einzelner Maßnahmen eingesetzt und sollen zusammenfassende Aussagen über deren Wirksamkeit tätigen (vgl. Gollwitzer/Jäger 2009:16). Das bedeutet, sie sollen in Erfahrung bringen, wie wirksam bestimmte Maßnahmen/Programme waren. Das Ziel formativer Evaluationen hingegen besteht darin, Maßnahmen zu optimieren bzw. Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Wirksamkeit einer Maßnahme eher wahrscheinlich machen (vgl. ibid.). Bei formativen Evaluationen werden somit in regelmäßigen Intervallen Zwischenergebnisse erstellt, die das Ziel verfolgen, laufende Interventionen zu modifizieren oder zu verbessern (vgl. Bortz/Döring 2006:110).
Im konkreten Fall der Lehrveranstaltungsevaluationen bedeutet dies, dass die betreffenden Lehrpersonen mit den eingesetzten Methoden jene Informationen, die ihnen beim Optimieren des Unterrichts behilflich sein könnten, zu einem Zeitpunkt erhalten, zu welchem es ihnen nicht mehr möglich ist, auf diese Informationen einzugehen und eventuell notwendige Veränderungen durchzuführen, die potentielle Verbesserungen für den jeweiligen Kurs nach sich ziehen könnten, ein Suboptimum, welches u.a. auch von Stieger/Burger (vgl. 2010:163) in einer ähnlichen Analyse kritisiert wird. Wenngleich nicht negiert werden kann, dass einige Informationen durchaus auch für kommende Semester bzw. für die Optimierung der Lehre einzelner Lehrpersonen generell von Relevanz sein können, so ist die Unterrichtsoptimierung für die betreffende Gruppe, die an der Evaluation teilnahm, nicht mehr möglich und es stellt sich die Frage, ob durch diese Herangehensweise nicht das eigentliche Ziel verfehlt wird, welches man mit der Evaluation initial intendierte.
Ein weiterer Grund, warum Evaluationen nicht ihr volles Wirkungspotential ausschöpfen können, wenn sie ausschließlich am Ende des Kurses/Semesters durchgeführt werden, ist, dass die Lehrenden auch nicht mehr direkt zum Handeln angehalten werden, da sie ja im darauffolgenden Semester oftmals mit einer völlig neuen Gruppe konfrontiert sind und eventuell auch bei gleichen Unterrichtsmethoden unterschiedliche Evaluationsergebnisse erwarten können. Dadurch ist fraglich, wie sinnvoll die Lehrenden diese Art der Evaluation einstufen und wie ernst sie die Ergebnisse nehmen bzw. wie motiviert sie sind, Dinge zu verändern. Dies trifft natürlich umgekehrt auch auf die Studierenden zu. Mit welcher Ernsthaftigkeit werden sie die Fragebögen ausfüllen, wenn sich für sie keine unmittelbaren Verbesserungen mehr abzeichnen? Vielfach resultiert diese Methode daher rein in einer Bewertung, die wenige bis keine Konsequenzen in Form einer Optimierung nach sich zieht.
Ein dritter Grund, warum sich die Wirkung der analysierten Evaluationen in einigen Bereichen in Grenzen hält, ist vielfach der Aufbau der Fragebögen selbst, der zwar für eine statistische Auswertung hervorragend geeignet ist, jedoch genau jene Informationen nicht erhebt, die für die Lehrenden in Hinblick auf eine weitreichende Verbesserung der Lehre interessant und notwendig wären. Die in den Bögen gestellten Fragen analysieren vielfach einen von den Studierenden empfundenen Zustand, regen die LernerInnen jedoch nicht dazu an, sich an der Verbesserung aktiv zu beteiligen bzw. konkrete Informationen Preis zu geben oder hilfreiche Vorschläge zu unterbreiten, die zu einer Optimierung führen würden, wie dies auch in den ESG explizit vorgeschlagen wird.
Ein Beispiel stellt etwa folgende Frage aus einem der untersuchten Fragebögen dar: Hat der/die Lehrende die Lern- und Prüfungsziele klar dargelegt? Abgesehen von der Tatsache, dass das Explizieren der Lern- und Prüfungsziele, wenn überhaupt dezidiert, dann zu Beginn des Semesters erfolgt, kann bezweifelt werden, dass sich alle LernerInnen mehrere Monate danach noch im Detail daran erinnern können, was genau die Lehrperson wie mitteilte. Des Weiteren waren u.U. in der Lehrveranstaltungseinheit, in welcher die Lern- und Prüfungsziele expliziert wurden, nicht alle LernerInnen anwesend und werden nun dennoch zu einer Antwort gezwungen, da alle Fragen zu beantworten sind, damit die Evaluation gültig ist. Darüber hinaus gibt diese geschlossene Frage lediglich Auskunft darüber, wie einzelne LernerInnen diesen Sachverhalt in der jeweiligen Gruppe empfanden, wie die Analyse der Fragebögen zeigt. Während es für manche auf der Likert-Skala nicht klar war, war es für andere LernerInnen sehr klar. Sie offeriert der Lehrperson jedoch keine Anhaltspunkte darüber, wo genau die Probleme lagen, wenn diese Frage etwa mit nicht klar beantwortet wurde. Auch bietet der Fragebogen den Studierenden keine Möglichkeit, Vorschläge zu unterbreiten, die für sie eine Verbesserung der Situation bewirken würden. Das bedeutet, die Lehrperson weiß zwar Bescheid darüber, dass für einige LernerInnen in diesem Bereich ein Problem war bzw. dass einige dies rückwirkend so empfanden, sie kann jedoch aufgrund fehlender Information, wo genau das Problem lag und wie dies für die LernerInnen gelöst werden könnte, verhältnismäßig wenig verändern. Diese Tatsache bewahrheitet sich bei sämtlichen Fragen in allen untersuchten Fragebögen.
Man könnte dies nun mit der Sektion der offenen Fragen am Ende des Fragebogens rechtfertigen, wo die LernerInnen angeben können, was ihnen am Kurs gut/weniger gut gefallen hat. Jedoch zeigte eine Analyse der Lehrveranstaltungsevaluationen, die von mir in den letzten sechs Jahren in den eigenen Kursen durchgeführt wurden, dass diese Sektion von den Studierenden kaum bis nicht genutzt wird, um davor getätigte Angaben zu verdeutlichen oder um Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Es bleibt zu bezweifeln, dass sich dieser Sachverhalt in anderen Kursen bzw. an anderen Instituten/Zentren in dieser Hinsicht markant unterscheidet.
Darüber hinaus ist auch das Stellen der betreffenden Frage nach der Darlegung der Prüfungsziele an sich problematisch. Einerseits, weil diese Art der Fragestellung generell sehr differenzierte Ergebnisse fördert, die in der Praxis schwer nutzbar gemacht werden können, ein Phänomen, auf welches bereits Kromrey (vgl. 1996) hinweist, und andererseits, weil das Verstehen der Erklärung der Lehr- und Prüfungsziele zu sehr auf die Lehrperson zentriert wird. Dies bedeutet im konkreten Kontext bei ersterem, dass einige LernerInnen die betreffende Frage positiv und andere negativ beantworten werden, wie dies oben bereits angeführt wurde, und diese Inkonsistenz nicht nur zwischen verschiedenen Lehrveranstaltungen zu bemerken ist, sondern ebenso innerhalb jeder (oder fast jeder) Veranstaltung, die eine bestimmte TeilnehmerInnenzahl von ca. 20 überschreitet, wie Kromrey (vgl. ibid.) expliziert.
Dieser Umstand wurde auch in meinen eigenen Lehrveranstaltungen mehrfach beobachtet, wenn von mir exakt der gleiche Unterrichtsstoff anhand identer Lehrmethoden in Parallelgruppen vermittelt, aber von diesen unterschiedlich aufgenommen bzw. evaluiert wurde. Das bestätigt die Annahme, dass es folglich nicht nur an der Art und Weise liegen kann, wie die jeweilige Lehrperson Inhalte vermittelt, sondern auch daran, wie die LernerInnen diese aufnehmen und verarbeiten. Dies wiederum verdeutlicht die unterschiedliche Auffassung der Studierenden über gutes Lehrverhalten und man sieht sich als Lehrperson mit der Tatsache konfrontiert, dass, wenn man verstärkt auf Vorschläge einer Interessensgruppe eingeht, bei dieser Pluspunkte sammelt, während man u.U. bei anderen mit derselben Methode für Unmut sorgt – eine Feststellung, auf die auch eine Lehrende1 in den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten qualitativen Interviews hinwies:
Weil da ist ein Mensch, schreibt das und will über Bolivien reden, aber das ist wirklich … so extrem individuell. Und das ist eben wo manchmal die Evaluierungen vom Ende vom Kurs … ist ein bisschen dieses … gleicher Punkt, komplett auseinander. […] Also komplett die Meinung. Ich hätte lieber mehr davon, ich hätte lieber mehr davon. Und der andere sagt, ich hätte lieber weniger davon. Und es ist schwer irgendwie … [LP007: 230–236]
Ein weiteres Problem ist im Bereich der Auswertung der Fragen zu finden. Kromrey (vgl. 1996) expliziert, dass bei vielen Evaluationen lediglich die Mittelwerte aus den Angaben aller Befragten betrachtet werden, was oftmals ein für die Lehrperson durchaus zufriedenstellendes Resultat liefern kann, jedoch im Endeffekt ein »statistisches Artefakt« (ibid.) darstellt. Konkret ist damit gemeint, dass, wenn die Lehrleistung einer Lehrperson in einer bestimmten Lehrveranstaltung beispielsweise als durchschnittlich bewertet wurde (also die Leistung der Lehrperson auf fast allen Items ungefähr mit »3« bewertet wird) und man in dieser Kursgruppe danach sucht, wie groß die Anzahl der Studierenden ist, die die betreffende Lehrveranstaltung mit »3« bewertet hat, dann zeigt sich, dass eine solche Gruppe in diesem Kurs vielfach nicht vorhanden ist. Vielmehr gibt es Studierende, die die Lehrleistung besser beurteilen, schlechter beurteilen, und andere, die teils positiv, teils negativ bewerten. Dadurch ergibt sich, wie Kromrey (1996) folgert, kein statistisch befriedigendes Ergebnis mit ausreichend homogenen Clustern, welches »hinreichend große Gleichartigkeit der Urteile innerhalb der jeweiligen Gruppen von Befragten bei zeitgleich möglichst deutlichen Unterschieden zwischen den Gruppen« erlaubt.
Für die unmittelbare Praxis des Fremdsprachenunterrichts im Rahmen von universitären Sprachenzentren sind für die meisten Lehrenden viele statistische Auswertungen meiner Erfahrung nach ohnehin eher sekundär. Zweifelsfrei kann man sich ein ungefähres Bild über die Qualität des Unterrichts machen, wenn z.B. 20 von 25 LernerInnen einen Kurs mit »sehr gut« bewerten, die Frage, die für mich als Lehrperson jedoch brennender scheint, ist, zu erfahren, warum die verbleibenden 20 % diesen Kurs z.B. mit »eher gut« oder vielleicht sogar »weniger gut« bis »nicht gut« bewertet haben. Dies kann aus den untersuchten Fragebögen nicht erfahren werden.
Ein weiterer Kritikpunkt, der zwar nur auf eines der untersuchten Fremdsprachenzentren zutrifft, aber dennoch Brisanz aufweist, ist die Tatsache, dass an einer Universität die Fremdsprachenkurse zum Untersuchungszeitpunkt ausschließlich mit dem universitätsweiten Evaluationsbogen evaluiert wurden. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Fremdsprachenkurse dort fix in den Rahmen der Lehrveranstaltungen fielen und die Studierenden für diese nicht bezahlten, wie dies an den externen Sprachenzentren der Fall war. Die primäre Kritik an Globalfragebögen ist, dass diese per se üblicherweise, und allem Anschein nach auch im konkreten Fall, für einen Lehrveranstaltungstyp wie etwa eine Vorlesung oder Übung konzipiert wurden und in der Regel sehr allgemein gehalten sind, damit sie für möglichst viele Veranstaltungen verwendet werden können. Daher wird in derartigen Evaluationsfragebögen kaum auf die Besonderheiten des Sprachenunterrichts eingegangen, was eine wirkliche Optimierung desselben mit diesen Mitteln somit eher unwahrscheinlich macht.
Darüber hinaus wurde im besagten Fragebogen auch die fachlich-inhaltliche Qualität der Lehrveranstaltung erfragt, die die fachliche Kompetenz der Lehrenden beurteilen soll, was, wie bereits Marques et al. (vgl. 1979:848) konstatieren, nicht durch Studierende beurteilt werden kann, denn wenn sie dies könnten, besuchten sie, wie Rindermann (2009:71) folgert, »aufgrund der Redundanz die falsche Veranstaltung«.
Ähnlich verhält es sich mit Fragen, ob die Lehrperson nach Ansicht der Studierenden gut vorbereitet wirke bzw. die Lerninhalte sicher vortrage, wie dies im Fragebogen einer anderen Universität erfragt wurde. Aus der Perspektive der Lehrperson stellt sich nun die Frage, wie die Studierenden beurteilen wollen, wie intensiv man sich als Lehrperson auf die einzelnen Unterrichteinheiten vorbereitet bzw. was dies letztendlich über das tatsächliche Gelingen und über die Qualität der Veranstaltungen aussagt. Viele KollegInnen werden mir an dieser Stelle wahrscheinlich zustimmen, dass sie schon oft sehr genau und gut vorbereitet waren und eine bestimmte Einheit dennoch nicht oder weniger zufriedenstellend verlief, während man an anderen Tagen vom vorbereiteten Konzept vielleicht völlig abwich, spontan handelte, und der Unterricht sehr erfolgreich war. Erfahrene Lehrende werden zudem in vielen Fällen weniger Vorbereitungszeit benötigen als DebütantInnen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ihr Unterricht dadurch weniger Qualität aufweist. Des Weiteren generiert die besagte Frage keine wirklich brauchbare Information für die Optimierung des Unterrichts, sondern stiftet meiner Ansicht nach bei den Studierenden eher zu Spekulationen an und sorgt bei den Lehrenden nicht selten für Unmut.
Ein weiterer Punkt, der im Zusammenhang mit Evaluationsmodellen genannt werden muss, die nur am Ende des Kurses evaluieren, ist, wie im Kapitel zur Qualität noch im Detail erörtert wird, die Tatsache, dass man sich, bevor man irgendetwas (beispielsweise eine Lehrveranstaltung) hinsichtlich der Qualität beurteilen möchte, zu Beginn Beurteilungskriterien festlegen muss, nach denen man im Endeffekt evaluiert. Nur wenn unter allen Beteiligten ein gewisser Konsens herrscht, was für diese Gruppe unter Qualität, also unter gutem Unterricht zu verstehen ist, und man sich darauf einigt, in welche Richtung während des Kurses gesteuert werden soll, kann man am Ende beurteilen, ob und wie gut man dort angekommen ist. Um es frei nach Seneca (vgl. epist. 71:3) zu sagen: Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß, welchen Hafen er anstrebt. Diese initiale Bestimmung der Ziele und Festlegung der Beurteilungskriterien stellt einen zentralen Standard qualitativ hochwertiger Evaluationen dar und wurde zum Untersuchungszeitpunkt von keinem der analysierten Evaluationsansätze berücksichtigt.
Auch hinsichtlich der Distribution bzw. Auswertung der Fragebögen ist bei einigen Instituten/Zentren leise Kritik gerechtfertigt, vor allem bei jenen, an welchen die Fragebögen von den Lehrenden in Papierform während einer Unterrichtseinheit (üblicherweise gegen Ende des Kurses/Semesters) an die LernerInnen ausgeteilt, danach eingesammelt und im Anschluss daran mühsam ausgewertet werden. Dies kann im 21. Jahrhundert aus zumindest drei Gründen nicht mehr gerechtfertigt sein: Erstens bedeutet die Auswertung für die Lehrenden einen erheblichen zeitlichen Zusatzaufwand, der in der Regel nicht extra vergütet wird und bei der vielfach schlechten Bezahlung der LektorInnen meiner Ansicht nach nicht zu legitimieren ist. Zweitens kann es durch die manuelle Auswertung vor allem aufgrund des Zeitfaktors zu Fehlern kommen, die die (statistischen) Ergebnisse verfälschen. Drittens sind mittlerweile viele Online-Evaluationsprogramme vorhanden, die nicht nur gratis genutzt werden können, sondern die zudem die Ergebnisse auch mehr oder weniger automatisch und in digitaler Form generieren, sollten vermehrte Kosten als Argument gegen eine computergestützte Evaluation sprechen. Dadurch können Ergebnisse in Folge nicht nur schnell und platzsparend gespeichert, sondern auch leicht miteinander verglichen und weiter genutzt werden, was auch bei der Beantwortung zukünftiger Forschungsfragen nützlich sein könnte.
Ein weiterer und für mich vielleicht der zentrale Punkt im Hinblick auf Lehrveranstaltungsevaluationen wird von Nowakowski et. al. (2012:255) angeführt, die zu dem Schluss kommen, dass »das Potential, das Lehrevaluationen für die Qualitätsentwicklung der Lehre bergen, bisher nicht wirklich verstanden und ausgeschöpft« wird. Dies ist zum einen darauf zurück zu führen, dass sie aktuell, wie oben bereits angeführt, primär als retrospektives Verfahren zur Analyse von Lehrveranstaltungen eingesetzt werden, wobei es sich bei dieser Art des Feedbacks um keinen dialogischen Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden handelt, sondern überwiegend um eine einseitige Darstellung von Sichtweisen, die ein weiteres Diskutieren der darin angegebenen Punkte üblicherweise nicht ermöglicht und somit eine Optimierung des Unterrichts nur begrenzt erlaubt. Zudem werden wesentliche Faktoren, die mit Evaluationen einhergehen können, kaum berücksichtigt, wie z.B. die Förderung der Reflexion bzw. Selbstreflexion auf beiden Seiten, wesentliche Vorgänge beim Sprachlehren und -lernen (siehe z.B. Anderson 2008) sowie die daraus möglicherweise resultierende Bildung, Bestätigung oder Veränderung des Selbstbildes der am Unterrichtsgeschehen Beteiligten. Dass dies für das erfolgreiche Sprachenlernen wesentlich ist, darauf wird in der Literatur vielfach hingewiesen (siehe z.B. Jerusalem 1993). Zudem kann Evaluation, die im Wesentlichen auch eine spezielle Art des Feedbacks ist, ebenso zur Optimierung der Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden beitragen. Alle diese essentiellen Punkte werden in den untersuchten Evaluationen zum Zeitpunkt der Analyse kaum bis nicht beachtet.
Die hier angeführte Auflistung ist nur ein kurzer Ausschnitt und könnte noch weiter fortgesetzt werden, was jedoch nicht Intention dieses Buches ist. Vielmehr wird versucht, Lösungen aufzuzeigen, die zur Verbesserung der aktuell eingesetzten Evaluationsmethoden und Werkzeuge beitragen sollen bzw. überhaupt einen neuen Zugang zur Evaluation als wichtige Hilfestellung bei der Qualitätsoptimierung aufzuzeigen.
1.4Zielsetzung des vorliegenden Buches
Da die einzelnen Themenbereiche des vorliegenden Buches (Evaluation, Qualität und universitärer Fremdsprachenunterricht) per se bereits sehr umfangreich sind, ist es notwendig, bei der Zielsetzung eine klare Ab- und Eingrenzung vorzunehmen, damit die realistische Umsetzung einiger ausgewählter Teile des gesamten Vorhabens ermöglicht werden kann. In diesem ersten Band werden daher im Wesentlichen zwei Ziele verfolgt:
Erstens, der Leser/die Leserin soll einen differenzierten (für ihn/sie vielleicht neuen) Zugang zum Thema Lehrveranstaltungsevaluation bekommen. Das Buch richtet sich in erster Linie an Fremdsprachenlehrende und versteht sich daher als Einführung in die einzelnen damit in Verbindung stehenden Themenbereiche. Durch die mitunter detaillierten Ausführungen soll Laien auf den Gebieten der Qualitäts- und Evaluationsforschung jene Basis zugänglich gemacht werden, die sie benötigen, um für sich selbst und auch im Unterricht eine Qualitäts- und Evaluationskultur zu schaffen. Nur wenn Lehrende und Studierende dieses Verständnis haben, kann Evaluation so eingesetzt werden, dass damit ein besserer Unterricht gelingen kann.
Zweitens wird auf Basis der theoretischen Ausführungen in Kapitel 6 ein umfassendes theoriebasiertes Evaluationsmodell (Komplexe Dynamische Evaluation, KDE) konzipiert, welches
auf Evaluations- und Qualitätsstandards basiert,
explizit der Optimierung des universitären Fremdsprachenunterrichts für die evaluierende Gruppe dient und
sich durch Effektivität und Effizienz (vor allem auch in Hinblick auf Ressourcen) auszeichnet.
Das bedeutet zum einen, dass das hier vorgestellte Modell intendiert, jene Informationen zum nötigen, d.h. zum für die Optimierung richtigen Zeitpunkt zu generieren, die erforderlich sind, um den universitären Fremdsprachenunterricht für die evaluierende LernerInnengruppe wirksam und umfassend zu verbessern. Zum anderen bedeutet es auch, dass dies auf eine möglichst effiziente Weise geschieht, damit das Prozedere den mit qualitätsoptimierenden Maßnahmen verbundenen Mehraufwand für die daran beteiligten AktantInnen in einem überschaubaren Rahmen hält.
1.5Forschungsdesign
Die Forderungen, die mit den oben angeführten Zielen dieses Ansatzes einhergehen, haben für die Konzeption der KDE weitreichende Folgen, weil viele der in der Zielsetzung angeführten Ansprüche und Begriffe mit weiteren Fragen in Verbindung stehen, die beantwortet werden müssen, bevor die eigentliche Konzeption der KDE in Angriff genommen werden kann. Dies erklärt, warum der Konzeption des Modells ein derart umfangreicher Theorieteil vorangeht.
1.5.1Ableitung der Forschungsfragen
Die Hauptforschungsfrage in diesem ersten Band ergibt sich aus der Zielsetzung und lautet wie folgt: Wie kann ein Evaluationsmodell aussehen, damit es den universitären Fremdsprachenunterricht für die evaluierende LernerInnengruppe wirksam und umfassend verbessert?
Mit dieser Frage stehen folgende Unterfragen in direktem Zusammenhang:
Was bedeutet Qualität im universitären Fremdsprachenunterricht?
Was bedeutet Verbesserung des universitären Fremdsprachenunterrichts?
Welche Evaluationsmethoden können zur Optimierung des Fremdsprachenunterrichts beitragen?
Was bedeuten wirksam und umfassend in Zusammenhang mit Qualitätsoptimierung auf Basis von Lehrveranstaltungsevaluation?
Welche Informationen werden im Detail für die Qualitätsverbesserung benötigt?
Wann ist der richtige Zeitpunkt, um die benötigten Informationen zu generieren bzw. allfällige Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten?
Auf welche Weise (wie) müssen die Informationen generiert werden, damit sie zur Qualitätsoptimierung genutzt werden können?
1.5.2Beantwortung der Forschungsfragen
Die Beantwortung der primären Forschungsfrage ergibt sich im Wesentlichen aus der Beantwortung der sieben Unterfragen, was implizit im Verlauf des Theorieteils erfolgt, der die drei Hauptthemen (1) Evaluation, (2) Qualität und (3) universitärer Fremdsprachenunterricht zum Gegenstand hat. Zudem werden die gewonnenen Erkenntnisse explizit in Abschnitt 6.4 rekapituliert.
Gemäß den Evaluationsstandards (vgl. Sanders 2006) reicht es für ein Evaluationsinstrument, welches auf umfassende Weise dazu beitragen soll, den universitären Fremdsprachenunterricht zu verbessern, nicht aus, wenn dieses nur eine solide theoretische Basis aufweist. Vielmehr muss auch der direkte Praxisbezug hergestellt werden, was bedeutet, dass neben theoretischen Überlegungen auch die am Unterrichtsgeschehen Beteiligten – die Lehrenden und Studierenden – bei der Konzeption miteinbezogen werden müssen. Vereinfacht kann diese Annäherung an das Evaluationsinstrument (KDE) wie folgt skizziert werden:
Abb. 1: Annäherung an die KDE
Der praxisbezogene Aspekt bei der Konzeption der KDE kann aus Gründen des Umfangs im Rahmen dieses Bandes nicht berücksichtigt werden und wird für den jeweiligen Teilaspekt in den folgenden Bänden dargestellt.
1.5.3Gliederung und Aufbau des Buches
Dieses Kapitel versteht sich als Einführung in die Themenbereiche Qualität und Evaluation im Kontext von Hochschulen. Zu Beginn wird dargestellt, welchem Wandel die zentralen Begriffe mit der Zeit unterworfen waren, bevor die Diskussion um Qualitätssicherung auf Basis von Evaluation im universitären Kontext und ganz besonders auch im Fremdsprachenunterricht Einzug gefunden hat. Im Anschluss daran werden zentrale Begriffe wie Norm, Zertifizierung, Rating und andere Termini aus dem Qualitätsmanagement erklärt und zentrale qualitätsoptimierende Verfahren vorgestellt, die im Hochschulkontext eingesetzt werden, um Qualität zu sichern.
Kapitel 3:In diesem Kapitel sollen die wesentlichen Grundzüge der Evaluation bzw. Evaluationsforschung expliziert werden. Nach einer kurzen allgemeinen Einführung in das Thema wird auf die Komplexität des Begriffs Evaluation eingegangen und dessen Abgrenzung von inhaltsähnlichen Begriffen, wie beispielsweise dem Qualitätsmanagement, erklärt. Im Anschluss daran werden zentrale Evaluationsmodelle aus der Evaluationsforschung vorgestellt, die häufig in Lehrveranstaltungsevaluationen Verwendung finden, und ihr potentieller Einsatz im universitären Fremdsprachenunterricht wird diskutiert. Diese Ausführungen sollen im Detail die unterschiedlichen Evaluationsansätze aufzeigen, da diese in der einen oder anderen Form auch bei der KDE zum Einsatz kommen, und außerdem darlegen, welches Potential Evaluation in Bezug auf Qualitätsoptimierung haben kann.
Kapitel 4:Kapitel 4 nähert sich an das zweite Kernthema der Arbeit, Qualität, an und versucht, die unterschiedlichen Aspekte, Dimensionen und Perspektiven zu diesem Begriff zu erörtern, bevor der Versuch unternommen wird, Qualität für den universitären Fremdsprachenunterricht zu definieren. Im Anschluss daran wird expliziert, warum Qualitätsverbesserung mit Hilfe von Evaluation nur erfolgen kann, wenn diese als Bestandteil eines übergeordneten Qualitätsmanagementsystems gesehen wird. Daran anschließend werden Total Quality Management (TQM) und KAIZEN, zwei sehr geeignete Ansätze aus dem Qualitätsmanagement, eingeführt und ihre Anwendung für die Qualitätsverbesserung des universitären Fremdsprachenunterrichts diskutiert.
Kapitel 5:Hier wirft man zu Beginn einen hochschuldidaktischen Blick auf das Lehren und Lernen von Sprachen, bevor im Anschluss daran die Complex Dynamic System Theory vorgestellt wird, die die komplexen Dynamiken beschreibt, die beim Lernen, Lehren und Evaluieren im universitären Fremdsprachenunterricht festgestellt werden können. Im Anschluss daran werden Anforderungen an ein Evaluationsmodell herausgearbeitet, die im Kontext eines komplexen dynamischen Unterrichtsgeschehens notwendig sind, um für dessen Verbesserung relevante Informationen zu generieren. Die Umsetzung durch die KDE wird im Anschluss daran beschrieben.
Kapitel 6:In Kapitel 6 wird zuerst aufgezeigt, wie die für die Optimierung relevanten Daten gesammelt werden und welche Grundfragen dabei zu stellen sind, bevor im Anschluss daran die theoretischen Erkenntnisse der vorangehenden Abschnitte kurz rekapituliert werden, um den theoretischen Entwurf der Komplexen Dynamischen Evaluation auszuführen, die sich aus den Komponenten Vorevaluation, Begleitende Evaluation, Endevaluation und Selektive Evaluation zusammensetzt. Danach wird das Multifaktorielle Modell der Lehrveranstaltungsqualität (Rindermann 2009) skizziert, welches den Lehrerfolg aus dem Zusammenspiel von Dozent, Studierenden und Rahmenbedingungen herleitet und als ein Aspekt bei der theoretischen Grundlage zur Itemsgenerierung der KDE herangezogen wird, bevor das Kapitel mit der Beantwortung der Forschungsfragen endet.
Kapitel 7:Dieser Abschnitt rekapituliert die zentralen Themen der Arbeit erneut und die daraus gewonnen Erkenntnisse werden diskutiert, bevor aufgezeigt wird, welche weiteren Schritte für die Fertigstellung der KDE noch unternommen werden müssen.
2Qualität, Evaluation, Hochschule
Was aber gut ist, Phaidros, und was nicht -
müssen wir danach erst andere fragen?
(Sokrates)
Die im vorangehenden Zitat durchaus berechtigte und zugleich rhetorische Frage stammt aus Robert M. Pirsigs Buch Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten, welches in seiner Originalfassung1 erstmals 1974 erschien und sich seitdem nicht nur zu einem Welt-Bestseller entwickelte, sondern geradezu den Status eines wahren Kultbuches genießt (vgl. auch Simon 2000:15). In seiner ursprünglichen Form ist diese Aussage jedoch wesentlich älter und stammt aus dem Platon-Dialog Phaidros, in welchem der griechische Philosoph Sokrates und sein Schüler Phaidros unter anderem über das Schöne, das Wahre, das Gute philosophieren. Auf das 21. Jahrhundert umgemünzt, unterhielten sich die beiden an dieser Stelle im Wesentlichen über Qualität und indirekt auch über Evaluation, zwei Begriffe, die – damals wie heute – in enger Verbindung zueinander stehen und in fast allen Bereichen des täglichen Lebens in der einen oder anderen Weise vorkommen – nimmt man dies nun bewusst wahr oder nicht.
Im Alltag bewertet bzw. evaluiert man z.B. die Qualität eines bestimmten Produktes, wie etwa die eines PKWs oder eines Mobiltelefons, spricht über die zusehends sinkende Qualität des Fernsehprogramms, lobt das gute Essen in einem renommierten Restaurant oder entscheidet sich beim Einkauf für einen Qualitätswein aus einer bestimmten Region. Die Aufzählung solcher Beispiele ließe sich beliebig fortsetzen. Ähnlich verhält es sich mit vergleichbaren Wertungen im universitären Kontext, wenn etwa Lehrpersonen oder Studierende von guten oder schlechten Kursen, nützlichen Lehrmaterialien, ansprechenden Übungen etc. sprechen oder man in der Forschung versucht zu ergründen, was guter Fremdsprachenunterricht ist bzw. ob – und wenn – wie dieser durch Evaluation verbessert werden kann.
Für die Beantwortung dieser und anderer zentraler Fragen sind nicht nur die Kapitel 3, 4 und 5 des vorliegenden Buches relevant, in welchen die einzelnen Themenbereiche Qualität, Evaluation und Fremdsprachenunterricht im Detail behandelt werden, sondern auch ein gewisses Kontextwissen, welches die Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen herstellt und Qualität und Evaluation in den Rahmen des universitären Fremdsprachenunterrichts einbettet. Dieses Kontextwissen wird im vorliegenden Kapitel aufbereitet.
2.1Dynamik von Qualität und Evaluation
Das Philosophieren über, das Streben nach und das Evaluieren von Qualität sind, wie oben genanntes Platon-Zitat verdeutlicht, keine neuen Phänomene, sondern in der einen oder anderen Form vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Zahlreiche Gelehrte setzten sich im Laufe der Geschichte in ihren Schriften immer wieder mit diesen Begriffen auseinander und waren darum bemüht, ein konkretes Verständnis davon zu erlangen, was letztendlich die Qualität einer Sache bestimmt (für eine detaillierte Abhandlung siehe z.B. Zollondz 2011:8–19, Küpers 2001, Ritter et al 1971–2007) und wie man diese messen oder evaluieren kann. Was jedoch ein vergleichsweise neues Phänomen zu sein scheint – möglicherweise auch ein Zeitgeist der letzten 25 Jahre – ist, dass zur üblichen Reflexion bzw. zum Diskurs über Qualität und dem eigentlichen Bestreben, eine Sache möglichst gut bzw. kontinuierlich besser machen zu wollen, gegenwärtig auch ein stärkeres Nach-Außen-Hin-Sichtbarmachen dieser Bestrebungen zu beobachten ist.
Manchmal hat es sogar den Anschein, als wäre dieses Aufzeigen sämtlicher qualitätsverbessernder Maßnahmen, die in Verbindung mit einem Produkt oder einer Dienstleistung durchgeführt werden, beinahe noch wichtiger als die tatsächliche Qualitätsverbesserung an sich. Es geht primär nicht nur darum, danach zu streben, ein Produkt bzw. eine Dienstleistung zu verbessern oder die Herstellung des besten Produktes und eine optimale Dienstleistung zu gewährleisten, sondern (oftmals vor allem auch) darum, potentielle KundInnen, KäuferInnen oder InvestorInnen davon zu überzeugen, dass eine bestimmte Ware nicht nur besser ist als eine andere und wert ist, produziert bzw. gekauft zu werden, sondern auch darum, darauf hinzuweisen, dass der jeweilige Betrieb/das Produkt/die Dienstleistung etc. von externen ExpertInnen evaluiert wurde und eine gute Platzierung in einem nationalen oder gar internationalen Vergleich (Rating) erhielt oder mit einem bestimmten Gütesiegel ausgezeichnet wurde. Es geht darum, aufzuzeigen, dass die Ware Qualität hat. Qualität wird in dieser Hinsicht oft synonym zu Exzellenz gesehen. Ähnliche Tendenzen sind auch im Hochschulbereich längst kein Novum mehr, vor allem dann, wenn es um das Akquirieren von finanziellen Mitteln geht, sei dies für den regulären Betrieb oder für die Finanzierung von (Drittmittel-)Projekten.
Die Motive für dieses explizite Hinweisen auf qualitätsoptimierende Prozesse sind in großer Zahl vorhanden. Während sich in der Wirtschaft z.B. durch die Globalisierung generell ein stärkerer Konkurrenzdruck bemerkbar macht(e), hat auch das Internet in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer völlig neuen Marktsituation geführt. Die bequeme Bestellung von nahezu allen nur erdenklichen Produkten von zu Hause aus, deren schnelle und weltweite Verfügbarkeit bzw. (oftmals kostenlose) Lieferung und die von KundInnen und HerstellerInnen vielfach gleichermaßen in Kauf genommene Kurzlebigkeit diverser Produkte (e.g. Mobiltelefone, PCs, Betriebsprogramme etc.) zugunsten noch schnellerer und besserer Modelle bzw. Updates, hat viele kleine und mittelgroße Betriebe zum Vorteil von Großkonzernen vor scheinbar unlösbare Herausforderungen gestellt und in weiterer Folge oftmals zur Aufgabe ihrer Produktion getrieben.
Auch bei den Universitäten sind ähnliche Veränderungen zu spüren. Sie müssen sich, wie Landfried (vgl. 1999:5) festhält, »zunehmend im nationalen und internationalen Wettbewerb behaupten« und »müssen sich auf internationalen Bildungsmärkten positionieren und ihre Leistungsfähigkeit mehr als bisher öffentlich darstellen«. Neben diesem verstärkten Wettbewerbsdruck wurden und werden vielfach auch die finanziellen Mittel auf nationaler und auch auf europäischer Ebene für die Forschung und Wissenschaft gekürzt, was in Folge nicht nur zu personellen Einsparungen führt(e), sondern auch Einschränkungen bzw. sogar das potentielle Ende gewisser Studienrichtungen oder Institute bedeuten kann. Eine Petition1 gegen die Kürzung der Forschungsmittel wurde etwa von der Initiative for Science in Europe (ise) im Oktober 2012 gestartet und aktuell (Stand 23.04.2017) von über 154500 Personen unterzeichnet.
Mit der Kürzung der Forschungsmittel geht aber auch ein verstärkter Rechtfertigungsdruck der Hochschulen nach außen einher und es wird von der Öffentlichkeit zusehends mehr Transparenz und Rechenschaftslegung über die Verwendung knapper öffentlicher Mittel gefordert (vgl. Landfried 1999:5). Zudem sehen sich Universitäten vermehrt dazu gezwungen, darauf hinzuweisen, dass sie kontinuierlich darum bemüht sind, akademische Standards zu sichern und die Lehre zu verbessern, wie Dill (vgl. 2000:212) anführt.
2.1.1Bildung als Ware und Lehre als Dienstleistung
In der Wirtschaft kann generell beobachtet werden, dass sich der Markt in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert hat und überwiegend von einem HerstellerInnenmarkt zu einem KundInnenmarkt geworden ist. Daraus resultieren vor allem für die KundInnen Vorteile, es gibt aber auch negative Begleiterscheinungen. Der Käufer/die Käuferin hat nun in der Regel nicht nur eine fast unüberblickbare Auswahl an weltweit hergestellten und beziehbaren Produkten und eventuell sogar Preisvergleiche, die von diversen Firmen (nicht selten gegen eine versteckte Gebühr) angeboten werden und dem Kunden/der Kundin das gewünschte Produkt beim günstigsten Anbieter/der günstigsten Anbieterin herausfiltern, sondern er/sie muss nun vielfach auch vermehrt auf das Kleingedruckte bei den angepriesenen Waren achten. Neben Betrügereien klagen immer mehr KäuferInnen über eine scheinbar sinkende Qualität bzw. Kurzlebigkeit vieler Produkte.
Diese Veränderungen haben u.a. dazu geführt, dass sich mittlerweile zahlreiche Unternehmen der Tatsache bewusst sind, in einer Marktwirtschaft im Zeitalter der Globalisierung und des ständig zunehmenden Konkurrenzdrucks, bei scheinbar kontinuierlich sinkenden Preisen vieler Produkte nur mehr dann langfristig bestehen zu können, wenn sie die KundInnen durch die Qualität der von ihnen angebotenen Waren überzeugen. Während manche HerstellerInnen weiterhin auf den niedrigen Preis ihrer Produkte und Dienstleistungen bauen und dies oftmals nur durch verminderte Qualität bzw. durch das Produzieren der Ware in Billiglohnländern erreichen können, versuchen andere verstärkt auf die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit, Service und Qualität hinzuweisen.
Das Kriterium Qualität hat somit nicht nur wieder an Bedeutung gewonnen, sondern muss auch vor einem anderen Hintergrund als bisher betrachtet werden. Laut Timischl (vgl. 2007:1) ist gegenwärtig sogar die Tendenz feststellbar, dass der Kunde/die Kundin eine Qualität auf einem ihm/ihr ansprechenden Niveau fordert und dass zukünftig hochentwickelte Technologien weniger entscheidend sein werden als die Einstellung eines Unternehmens, die Erwartungen der KundInnen erfüllen zu wollen. In einem derart kundInnenorientierten Ansatz (user-based-approach) ist Qualität folglich weitgehend davon abhängig, was der Kunde/die Kundin darunter versteht. Dieser Aspekt ist auch im Kontext des vorliegenden Ansatzes wesentlich, da durch diverse Umstrukturierungen an den Hochschulen – wie z.B. die Auslagerung von Fremdsprachenkursen an universitäre Sprachenzentren – der Sicherung und Verbesserung von Qualität eine ganz neue Wichtigkeit zugekommen ist.
Zudem werden an vielen Universitäten bzw. Fachhochschulen Studierende verstärkt als KundInnen wahrgenommen, bzw. fühlen sie sich selbst als KundInnen, die für eine Ware Bildung bzw. eine Dienstleistung Lehre bezahlen und demgemäß gewisse Forderungen damit verbinden. Dass diese Sichtweise nicht nur bei vielen Lehrenden für Ablehnung sorgt und auch hinsichtlich der akademischen (Aus-)Bildung der Studierenden zu hinterfragen ist, muss an dieser Stelle nicht expliziert werden.
Während mit dieser Wahrnehmung mancher Studierenden, KundInnen zu sein bzw. dem Umstand, dass viele von ihnen an den Universitäten für eine gewisse Leistung in Form von Studiengebühren bezahlen müssen, oftmals von ihrer Seite stärkere Forderungen nach Qualität bzw. Service einhergehen, ist gleichzeitig in vielen universitären Kursen auch ein von innen heraus entstehendes Bestreben zu beobachten, verstärkt teilnehmerInnenorientiert zu lehren. Dies steht mitunter vielleicht zum einen mit der Forderung der ENQA1 (vgl. 2012:6) in Zusammenhang, dass bei sämtlichen qualitätssichernden Maßnahmen im Bereich des Lehrens und Lernens an den europäischen Hochschulen die Studierenden im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen sollen, und zum anderen mit dem Paradigmenwechsel shift from teaching to learning, welcher das Lernen gegenüber dem Lehren explizit hervorhebt.
Zweifelsfrei sind derartige Strömungen nicht neu, sondern finden ihre Ursprünge im deutschsprachigen Raum – vor allem auch in Zusammenhang mit Evaluation – bereits in der 68er-Bewegung und den Protesten an Hochschulen, die, wie Rindermann (vgl. 2009:31) anführt, die Reformen an deutschen Universitäten einleiteten. Was jedoch als Novum der letzten Jahre gesehen werden kann, ist, dass Evaluationsergebnisse mitunter online gestellt werden und dadurch verhältnismäßig leicht zugänglich sind. Demzufolge werden diverse Fragen, Probleme, Erwartungen bzw. Forderungen den einzelnen am Unterrichtsgeschehen Beteiligten aktuell vielleicht deutlicher als bisher vor Augen geführt. Qualität bzw. fehlende Qualität wird sichtbar (gemacht) und steht auf Lehrendenseite auch vielfach in direkter Verbindung mit Vertragsverlängerungen oder eben der Nichtverlängerung von Lehraufträgen. Evaluation, besser gesagt, deren Ergebnisse können dadurch nolens volens auch als Druckmittel fungieren.
2.1.2Normen, Zertifizierungen, Ratings
Zu diesen bisher genannten Gründen für Veränderungen muss auch die Veröffentlichung zahlreicher Normen und Zertifizierungen gezählt werden, die seit den 1980er Jahren verstärkt zum Einsatz kommen und auch explizit das Thema Qualität zum Gegenstand haben.
Allen voran seien hier die DIN-EN-ISO Normen 8402 und 9000–9004 genannt. In diesen Qualitätsmanagementnormen, die von internationalen ExpertInnen erarbeitet wurden und erstmals die KundInnen in den Mittelpunkt rücken, werden jene Kriterien beschrieben, die ein Unternehmen erfüllen muss, um einem bestimmten Standard bei der Umsetzung des Qualitätsmanagements zu entsprechen. Anders formuliert: Sie definieren auf eine allgemeine Weise jene Maßnahmen, die der Optimierung von Prozessen, Produkten oder Leistungen jeglicher Art dienen. Werden die betriebsinternen Abläufe und in weiterer Folge auch das hergestellte Produkt diesen bestimmten, festgelegten Qualitätskriterien gerecht, dann spricht man von einem ISO-zertifizierten Unternehmen und einem Qualitätsprodukt. Normen und Standards haben mittlerweile in fast allen Bereichen des täglichen Lebens Einzug gefunden. Alles scheint genormt zu sein, selbst der Begriff Qualität.
2.1.3QM-Begriffe im Hochschulkontext
Auch Universitäten im deutschsprachigen Raum wurden von diesen oben angeführten Strömungen nicht verschont und diverse Begriffe und Termini, die ursprünglich der Wirtschaft bzw. dem Qualitätsmanagement zugeordnet waren, sind mittlerweile ebenfalls im Hochschulkontext längst salonfähig geworden und prägen ferner seit gut zwanzig Jahren verstärkt den wissenschaftlichen Diskurs. Dies inkludiert interessanterweise auch jene Disziplinen, deren primäre Forschungsschwerpunkte üblicherweise a priori nicht unbedingt mit Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, Ratings und dergleichen assoziiert werden, aber mit den Themen dieses Buches in direkter Verbindung stehen, wie z.B. die Sprachlehrforschung oder die Fremdsprachendidaktik.
Hätte man beispielsweise Qualitätsverbesserung, Qualitätssicherung, Evaluation, Audit, Akkreditierung, Sicherung von Standards, KundInnenzufriedenheit etc. vor etwa 25 Jahren an den Universitäten noch hauptsächlich mit Wirtschafts-, Unternehmens- und Managementwissenschaften assoziiert, oder generell mit Produktion, Produkten und Dienstleistungen etc. in Verbindung gebracht, so haben sich diese heute in fast allen wissenschaftlichen Bereichen etabliert und auch im Bildungssektor bzw. im Bereich des Fremdsprachenunterrichts Einzug gefunden. Hier spricht man u.a. von pädagogischer Qualität, didaktischer Qualität, Bildungsstandards oder diskutiert z.B. die Anwendung diverser Normen auf die Hochschule (siehe z.B. Knoll 2005).
Während der Impuls der Qualitätssicherung und -entwicklung in Wirtschaftsunternehmen überwiegend von innen heraus entstand und in vielen Bereichen eine unabdingbare Voraussetzung darstellte, um erfolgreich am nationalen und internationalen Wettbewerb teilnehmen zu können, so waren bei den Bildungseinrichtungen zu Beginn vor allem externe Faktoren, wie zum Beispiel Impulse aus der Politik ausschlaggebend, um das Rad in Sachen Qualität ins Rollen zu bringen (vgl. Kaufmann 2009:9). Spätestens seit Ende der 1990er Jahre findet man jedoch auch im Hochschulbereich vermehrt ein von innen gesteuertes Bestreben, nicht nur qualitativ hochwertige Forschung, sondern auch Qualität in der Aus- und Weiterbildung zu forcieren. Qualität ist folglich »zu einem zentralen Fokus der theoretischen, forschungsmethodischen und gestalterischen Bemühungen geworden« (Helmke/Hornstein/Terhart 2000:7). Dasselbe trifft auf Evaluation zu.
Dies zeigt auch die nahezu unüberschaubar gewordene Zahl1





























