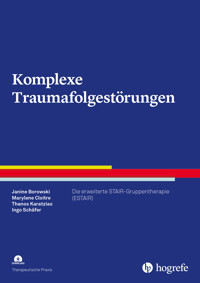
47,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das erweiterte Skillstraining zur affektiven und interpersonellen Regulation (ESTAIR) richtet sich an Personen, die an den Folgen anhaltender und wiederkehrender traumatischer Ereignisse in der Vergangenheit leiden. Durch das Übermaß an Belastungen und den Verlust von inneren und äußeren Ressourcen entwickeln Betroffene häufig komplexe Posttraumatische Belastungsstörungen (kPTBS), die durch Beeinträchtigungen in der Emotionsregulation, in zwischenmenschlichen Beziehungen und im Selbstkonzept gekennzeichnet sind. Basierend auf der Einzeltherapie STAIR/Narrative Therapie, deren Wirksamkeit für die Behandlung von PTBS nachgewiesen ist, wurde ein Gruppenprogramm konzipiert. Zur Durchführung des Gruppenprogramms sind Kenntnisse von STAIR/Narrative Therapie erforderlich. Die Kombination mit der Einzeltherapie für eine traumafokussierte Arbeit ist sinnvoll, aber nicht zwingend notwendig. Das Gruppenprogramm umfasst drei Behandlungsschwerpunkte: Emotionsregulation, Selbstkonzept und zwischenmenschliche Beziehungen. In 17 Sitzungen werden den Patientinnen und Patienten Fähigkeiten, sogenannte Skills, vermittelt, die den Umgang mit Gefühlen verbessern, zu einem positiveren Selbstbild beitragen und ein gesundes Beziehungsverhalten fördern. Das Gruppensetting bietet dabei einen sicheren und geschützten Rahmen, um die neuen Skills zu erproben und korrigierende Beziehungserfahrungen zu sammeln. Die einzelnen Bausteine lassen sich auch flexibel einsetzen. Zahlreiche Materialien in Form von Arbeitsblättern und Audiodateien unterstützen die Durchführung und können nach erfolgter Registrierung von der Hogrefe Webseite heruntergeladen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Janine Borowski
Marylene Cloitre
Thanos Karatzias
Ingo Schäfer
Komplexe Traumafolgestörungen
Die erweiterte STAIR-Gruppentherapie (ESTAIR)
Dipl.-Psych. Janine Borowski. Psychologische Psychotherapeutin und zertifizierte Traumatherapeutin. Von 2010 bis 2024 Mitarbeiterin in der Psychiatrischen Institutsambulanz am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Seit 2017 Mitarbeiterin in der Spezialambulanz für Traumafolgestörungen, seit 2019 in der Rolle der therapeutischen Leitung. Seit 2024 in eigener Praxis in Hamburg tätig.
Marylene Cloitre, PhD. Stellvertretende Forschungsdirektorin des National Center for PTSD Dissemination and Training Division, Palo Alto VA Health Care Services. Klinische Professorin (Affiliate) in der Abteilung für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften der Stanford University sowie Forschungsprofessorin in der Abteilung für Psychiatrie, der NYU Langone Medical Center, New York City.
Prof. Thanos Karatzias. Seit 2008 Professor für Mental Health an der Edinburgh Napier University, Mitarbeiter im „Rivers Centre for Traumatic Stress“, Edinburgh und Forschungsdirektor für die „School of Health and Social Care“ an der Edinburgh Napier University.
Prof. Dr. med. Ingo Schäfer, MPH. Seit 2001 Mitarbeiter und seit 2011 Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Dort Leitung der Ambulanzen für Traumafolgestörungen und seit 2016 Leiter des Arbeitsbereichs Suchtmedizin und abhängiges Verhalten. 2010–2016 Geschäftsführer und seit 2017 Direktor des Zentrums für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS) der Universität Hamburg.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten. All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
www.hogrefe.de
Sprecherin der Audioübungen: Annika Bolbeth, Berlin
Tonstudio: Boris Israel, Condor Recording, www.crstudios.de, Berlin
Satz: Sina-Franziska Mollenhauer, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2025
© 2025 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3311-0; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3311-1)
ISBN 978-3-8017-3311-7
https://doi.org/10.1026/03311-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Es ist nie zu spät,
das zu werden,
was man hätte sein können.
George Eliot (1819 – 1880)
Für unsere Patient:innen, die uns beeindrucken
mit ihrem Mut für ein anderes Leben zu kämpfen.
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
I Grundlagen zur erweiterten STAIR-Gruppentherapie (ESTAIR)
Kapitel 1: Die Behandlung mit dem ESTAIR-Gruppenprogramm
1.1 Einführung in die Behandlung mit STAIR/ESTAIR
1.2 Für wen eignet sich eine Behandlung mit STAIR/ESTAIR?
1.3 Beschreibung der kPTBS und PTBS
1.4 Vergleich des ESTAIR-Gruppenprogramms mit STAIR/Narrative Therapie
1.5 Was sollten Therapeut:innen mitbringen?
1.6 Die Behandlungsphilosophie von ESTAIR: Therapeutische Allianz als Basis
1.7 Durchführung des ESTAIR-Gruppenprogramms
1.7.1 Rahmenbedingungen
1.7.2 Überblick über Sitzungen und Inhalte
1.7.3 Allgemeine Struktur der Sitzungen
1.8 Vorteile des Gruppensettings
1.9 Befunde zur Durchführung des ESTAIR-Gruppenprogramms
Kapitel 2: Indikationsstellung – Das Vorgespräch
2.1 Vorabinformationen für und Motivation der Patient:innen
2.2 Traumaanamnese
2.3 Diagnosestellung einer kPTBS
2.4 Passung und Bereitschaft hinsichtlich der Behandlung
II Die 17 Sitzungen der erweiterten STAIR-Gruppentherapie (ESTAIR)
Kapitel 3: Sitzung 1 – Willkommen bei ESTAIR
3.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
3.2 Gruppenvereinbarungen besprechen
3.3 Vorstellungsrunde durchführen
3.4 Behandlungsziele vorstellen
3.5 Einfluss von Traumatisierungen auf Emotionen besprechen
3.6 Einfluss von Traumatisierungen auf das Selbstbild besprechen
3.7 Auswirkungen von Traumatisierungen auf Beziehungen besprechen
3.8 Persönliche Ziele der Patient:innen klären
3.9 Überblick über die drei Ebenen von Emotionen geben
3.10 In das bewusste Atmen einführen
3.11 Übungen zwischen den Sitzungen vereinbaren
Kapitel 4: Sitzung 2 – Emotionswahrnehmung
4.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
4.2 Übungen zwischen den Sitzungen nachbesprechen
4.3 Die persönliche Lerngeschichte hinsichtlich der Emotionen der Patient:innen besprechen
4.4 Über den Zweck von Emotionen austauschen
4.5 In das Gefühlstagebuch einführen
4.6 Emotionssurfen vorstellen
4.7 Übungen zwischen den Sitzungen vereinbaren
Kapitel 5: Sitzung 3 – Emotionsregulation auf Körperebene
5.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
5.2 Übungen zwischen den Sitzungen nachbesprechen
5.3 Den Begriff der Emotionsregulation einführen
5.4 Gesunde und ungesunde Strategien zur Emotionsregulation besprechen
5.5 Zusammenhang zwischen emotionaler und körperlicher Gesundheit aufzeigen
5.6 Skills auf der Körperebene auswählen
5.7 Übungen zwischen den Sitzungen vereinbaren
Kapitel 6: Sitzung 4 – Emotionsregulation auf Gedankenebene
6.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
6.2 Übungen zwischen den Sitzungen nachbesprechen
6.3 Ungesunde Bewältigungsstrategien auf der Gedankenebene besprechen („Typische Gedankenmuster nach Traumata“)
6.4 Skills auf der Gedankenebene auswählen
6.5 Übungen zwischen den Sitzungen vereinbaren
Kapitel 7: Sitzung 5 – Emotionsregulation auf Verhaltensebene
7.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
7.2 Übungen zwischen den Sitzungen nachbesprechen
7.3 Ungesunde Bewältigungsstrategien auf der Verhaltensebene besprechen
7.4 Skills auf der Verhaltensebene auswählen
7.5 Alle drei Ebenen der Emotionsregulation zusammenfassen
7.6 Übungen zwischen den Sitzungen vereinbaren
Kapitel 8: Sitzung 6 – Leben in Kontakt mit den eigenen Emotionen (Belastungen tolerieren)
8.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
8.2 Übungen zwischen den Sitzungen nachbesprechen
8.3 Den Begriff der Belastungstoleranz und ihren Nutzen einführen
8.4 Ziele und dafür nützliche Bewältigungsstrategien erarbeiten
8.5 Erfolge und Herausforderungen bei der Anwendung der Skills besprechen
8.6 Übungen zwischen den Sitzungen vereinbaren
Kapitel 9: Sitzung 7 – Förderung von Selbstwahrnehmung (Was ist mein „Ich“?)
9.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
9.2 Übungen zwischen den Sitzungen nachbesprechen
9.3 Einfluss von Trauma auf das Selbstkonzept besprechen
9.4 Typische selbstkonzeptbezogene Muster vorstellen und darüber austauschen
9.5 Imaginationsübung „Umsorgende Begleiterin/Umsorgender Begleiter“ durchführen
9.6 Übungen zwischen den Sitzungen vereinbaren
Kapitel 10: Sitzung 8 – Förderung von Selbsterkenntnis (Mein „Ich“ im gegenwärtigen Augenblick)
10.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
10.2 Übungen zwischen den Sitzungen nachbesprechen
10.3 Achtsamkeit als ein Weg zur Selbsterkenntnis einführen
10.4 Erdungsübung (5-4-3-2-1-Übung) als Skill zur Förderung von Selbsterkenntnis vorstellen
10.5 Meditation zu Selbsterkenntnis durchführen
10.6 Übungen zwischen den Sitzungen vereinbaren
Kapitel 11: Sitzung 9 – Förderung von Selbsterkenntnis (Lernen, über das „Ich“ nachzudenken)
11.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
11.2 Übungen zwischen den Sitzungen nachbesprechen
11.3 (Geringes) Selbstwertgefühl sowie dahinterliegende Überzeugungen über sich selbst thematisieren und darüber austauschen
11.4 Selbstabwertende Überzeugungen identifizieren und dahinterliegende Erfahrungen würdigen
11.5 Möglichkeiten zur Veränderung aufzeigen: Ausgleich durch wohltuende Perspektiven
11.6 Übungen zwischen den Sitzungen vereinbaren
Kapitel 12: Sitzung 10 – Selbstmitgefühl und Selbstkritik
12.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
12.2 Übungen zwischen den Sitzungen nachbesprechen
12.3 In Selbstkritik und Selbstmitgefühl einführen
12.4 Selbstkritische Gedanken identifizieren und in selbstmitfühlende Alternativgedanken umwandeln
12.5 Meditation zum Selbstmitgefühl durchführen
12.6 Übungen zwischen den Sitzungen vereinbaren
Kapitel 13: Sitzung 11 – Förderung von Selbsterkenntnis (Mein „Ich“ in Beziehungen zu anderen)
13.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
13.2 Übungen zwischen den Sitzungen nachbesprechen
13.3 Bedeutung eines ausgewogenen Selbstbilds beschreiben
13.4 Innere Ressourcen entdecken: Liste positiver Eigenschaften erstellen
13.5 Zukunfts-Ich erarbeiten
13.6 Übungen zwischen den Sitzungen vereinbaren
Kapitel 14: Sitzung 12 – Verstehen von Beziehungsmustern
14.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
14.2 Übungen zwischen den Sitzungen nachbesprechen
14.3 Gesunde und ungesunde Beziehungen reflektieren
14.4 In Beziehungsmuster einführen
14.5 Beispiele für typische traumabedingte Beziehungserwartungen sammeln
14.6 An eigenen Beziehungsmustern arbeiten
14.7 Übungen zwischen den Sitzungen vereinbaren
Kapitel 15: Sitzung 13 – Verändern von Beziehungsmustern
15.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
15.2 Übungen zwischen den Sitzungen nachbesprechen
15.3 Verschiedene Formen von Beziehungsgestaltung mit Vor- und Nachteilen vorstellen
15.4 Über die Aufrechterhaltung und Veränderung von Grenzen austauschen
15.5 Eigene Beziehungsmuster verändern
15.6 Alternative Reaktionen explorieren
15.7 Übungen zwischen den Sitzungen vereinbaren
Kapitel 16: Sitzung 14 – Verändern von Beziehungsmustern (Selbstsicherheit stärken)
16.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
16.2 Übungen zwischen den Sitzungen nachbesprechen
16.3 Über Erfahrungen mit symbiotischer Nähe austauschen
16.4 Verschiedene Arten von Selbstsicherheit vorstellen
16.5 Strategien zur selbstsicheren Abgrenzung einführen und üben
16.6 Arbeitsblatt „Beziehungsmuster 2“ mit Fokus auf selbstsicherem Verhalten vertiefen
16.7 Persönliche Grundrechte vorstellen
16.8 Übungen zwischen den Sitzungen vereinbaren
Kapitel 17: Sitzung 15 – Verändern von Beziehungsmustern (Flexibilität fördern)
17.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
17.2 Übungen zwischen den Sitzungen nachbesprechen
17.3 Über verschiedene Machtverhältnisse austauschen und traumabedingte Annahmen explorieren
17.4 Rollenspiel zur Flexibilität durchführen
17.5 Arbeitsblatt „Beziehungsmuster 2“ zur Vertiefung des Rollenspiels ausfüllen
17.6 Übungen zwischen den Sitzungen vereinbaren
Kapitel 18: Sitzung 16 – Verändern von Beziehungsmustern (Nähe fördern)
18.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
18.2 Übungen zwischen den Sitzungen nachbesprechen
18.3 Über Erfahrungen mit emotionaler Distanz austauschen
18.4 Einen Fertigkeitsbereich auswählen: Vertiefung aktueller Beziehungen oder Entwicklung neuer Beziehungen
18.5 Rollenspiel zum ausgewählten Fertigkeitsbereich durchführen
18.6 Arbeitsblatt „Beziehungsmuster 2“ mit Fokus auf die ausgewählte Fertigkeit vertiefen
18.7 Über das Vorgehen zur Förderung von Nähe in bestehenden Beziehungen austauschen
18.8 Übungen zwischen den Sitzungen vereinbaren
Kapitel 19: Sitzung 17 – Bilanz und Abschied
19.1 Schwerpunkt der Sitzung vorstellen
19.2 Übungen zwischen den Sitzungen nachbesprechen
19.3 Individuelle Erfolge und hilfreiche Erfahrungen zusammenfassen
19.4 Teilnehmer:innen beglückwünschen
19.5 Skills, die die Teilnehmer:innen weiterhin nutzen möchten, sammeln
19.6 Abschied feiern
Literatur
Anhang
Arbeitsblätter
Hinweise zu den Online-Materialien
|6|Danksagung
Herzlichen Dank an die Kolleginnen, die ihren Beitrag zur Konzeptentwicklung, Adaption und Evaluation dieses Gruppenprogramms geleistet haben: Claudia Oehlrich, Dana Barthel, Myrthe Aline Klene, Jule Käselau und Alina Brinkmann – habt Dank für euren Einsatz, eure Unterstützung und Inspiration.
Besonderen Dank an unsere Team-Kollegin Alina Momberger, mit der im Rahmen der Gruppendurchführungen sowohl professionelles als auch persönliches Wachstum geteilt wurde.
|11|I Grundlagen zur erweiterten STAIR-Gruppentherapie (ESTAIR)
|13|Kapitel 1:Die Behandlung mit dem ESTAIR-Gruppenprogramm
1.1 Einführung in die Behandlung mit STAIR/ESTAIR
Für die Behandlung von Personen, die interpersonellen Traumatisierungen, wie körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt waren und in ihrem gegenwärtigen Leben an den Folgen dieser Erlebnisse leiden, wurde mit STAIR/Narrative Therapie (Skillstraining zur affektiven und interpersonellen Regulation/Narrative Therapie) ein spezielles Therapieprogramm entwickelt (Cloitre, Cohen & Koenen, 2014; Cloitre, Cohen, Ortigo, Jackson & Koenen, 2025). STAIR/Narrative Therapie besteht aus den beiden Behandlungsmodulen „STAIR“ und „Narrative Therapie“. Während im STAIR-Modul Skills vermittelt werden, die helfen, Emotionen zu regulieren und Verhaltensmuster in zwischenmenschlichen Beziehungen zu verändern, fokussiert das NT-Modul die emotionale Verarbeitung der Traumatisierung (Cloitre et al., 2014; Cloitre et al., 2025).
Wenn interpersonelle Traumatisierungen in der Kindheit stattfinden, hat dies Einfluss auf viele verschiedene Ebenen der kindlichen Entwicklung. Oftmals führen sie zu Beeinträchtigungen in den emotionalen, kognitiven sowie verhaltensbezogenen Kompetenzen. STAIR/Narrative Therapie betrachtet die Bedingungen unter denen Betroffene sich entwickeln und heranwachsen mussten als eine Art anhaltenden Verlust von Ressourcen, nämlich dem Verlust von Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich emotionaler und sozialer Fertigkeiten (Cloitre, Cohen, Ortigo, Jackson & Koenen, 2020; Cloitre et al., 2025). Die „Genesung“ von den Auswirkungen kindlicher Traumatisierung erfordert demnach eine Wiederherstellung dieser Ressourcen, indem das Erlernen diverser Fertigkeiten und Strategien, deren Aufbau aufgrund des anhaltenden „Überlebensmodus“ in der Vergangenheit nicht möglich war, nachgeholt wird. Bei Traumatisierungen in der Kindheit waren primäre Bezugspersonen und Täter:innen vielfach ein und dieselbe Person. Deshalb spielen außerdem der Verlust und Wiederaufbau gesunder Bindungs- und Beziehungsfähigkeit eine zentrale Rolle. Insbesondere die Regulation von Nähe und Distanz in Beziehungen fällt vielen Betroffenen schwer, weil Bindung eng mit dem traumatischen Geschehen verknüpft ist. Zusätzlich fehlte es in den meisten Fällen schlichtweg an gesunden Modellen zur Orientierung.
Hinzu kommt, dass interpersonelle Traumatisierungen und andere andauernde traumatische Lebensereignisse ein Übermaß an Belastung und Beschwerden zur Folge haben. Beides zusammen, das Mehr an Belastung und das Weniger an Ressourcen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, im Erwachsenenalter eine (komplexe) Traumafolgestörung zu entwickeln (Cloitre et al., 2014). Einer komplexen Posttraumatischen Belastungsstörung (kPTBS), die in der ICD-111 eine eigene Diagnose darstellt, liegen meistens langanhaltende oder wiederholte traumatische Ereignisse zugrunde (World Health Organization WHO, 2023).
Zur Behandlung einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) erwies sich STAIR/Narrative Therapie in verschiedenen Studien als wirksam (Cloitre, Koenen, Cohen & Han, 2002; Lorbeer, Knaevelsrud & Niemeyer, 2022). Teilweise wurde STAIR auch ohne das zweite Behandlungsmodul eingesetzt. Dabei zeigen sich je nach Studie kleine bis große Effekte hinsichtlich emotionaler Ressourcen und zwischenmenschlichen Beziehungen (Lorbeer et al., 2022). STAIR eignet sich somit als Grundlage zur Behandlung von kPTBS. Die Arbeit an der Emotionsregulation und an Beziehungsmustern des STAIR-Moduls kann sehr gut auch in der Gruppe umgesetzt werden, was gerade in Hinblick auf die psychotherapeutische Grundversorgung sinnvoll ist. Das ESTAIR-Gruppenprogramm basiert dabei auf STAIR/Narrative Therapie für das Einzelsetting (vgl. Kapitel 1.4), mit dem Therapeut:innen, die das Gruppenprogramm verwen|14|den, vertraut sein sollten. Das Gruppenmanual ist kompakt gehalten, um die Anwendung und Gruppendurchführung möglichst einfach zu gestalten. An einigen Stellen, vor allem zu den Grundlagen von ESTAIR, ist es empfehlenswert, vertiefende Informationen im Einzelmanual nachzulesen (Cloitre et al., 2014, 2020, 2025). Das vorliegende Gruppenmanual geht über das Einzelmanual insofern hinaus, als es neben den Bereichen Emotionsregulation und interpersonelle Probleme auch den dritten Bereich der „Störungen der Selbstorganisation“ im Rahmen der komplexen Posttraumatischen Belastungsstörung (kPTBS) adressiert, das negative Selbstkonzept (Sitzungen 7 bis 11). Es basiert damit auf einer Erweiterung, die STAIR in den letzten Jahren erfahren hat (ESTAIR; Karatzias, McGlanaghy & Cloitre, 2023).
Das ESTAIR-Gruppenprogramm richtet sich also vor allem an Betroffene mit der Diagnose einer kPTBS (vgl. Kapitel 1.2 und 1.3). Sein Aufbau spiegelt die Empfehlung der S3-Leitlinie zur Behandlung der PTBS wider (Schäfer et al. 2019), die bei Patient:innen mit kPTBS neben traumafokussierter Arbeit (Behandlungsmodul Narrative Therapie) Interventionen zur Verbesserung der Emotionsregulation und zur Bearbeitung dysfunktionaler zwischenmenschlicher Muster (Behandlungsmodul STAIR) empfiehlt. Es eignet sich aber auch für die Behandlung anderer Störungen, die aufgrund von (Entwicklungs-)Traumatisierungen entstanden sind (vgl. Kapitel 1.2). Über die reine Symptomebene hinaus dient es der Förderung von Emotionsregulation, dem Aufbau eines gesunden Selbstkonzepts sowie der Verbesserung von Beziehungsstörungen und den zugrunde liegenden traumaassoziierten Beziehungsmustern.
1.2 Für wen eignet sich eine Behandlung mit STAIR/ESTAIR?
STAIR/Narrative Therapie wurde für Betroffene von interpersoneller Gewalt entwickelt, die in Folge dieser Erlebnisse eine Traumafolgestörung entwickelt haben (Cloitre et al., 2014). Auch das ESTAIR-Gruppenprogramm richtet sich deshalb in erster Linie an diese Personengruppe (vgl. Kapitel 1.3).
Klinische Erfahrungen mit STAIR/Narrative Therapie zeigen, dass das ESTAIR-Gruppenprogramm auch bei Personen mit einer „subsyndromalen kPTBS“, die nicht die vollen Diagnose-Kriterien erfüllen, anwendbar ist. Auch das Vorhandensein komorbider Erkrankungen ist kein Ausschlusskriterium für die Behandlung mit ESTAIR in der Gruppe. Wie schon beschrieben können die Auswirkungen von Traumatisierung vielfältig sein und sich entsprechend in verschiedenen Symptombildern zeigen. Oftmals sind die zu adressierenden Problembereiche dann die gleichen, wie etwa bei der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen. Andere Erkrankungsbilder können nicht selten als Folgen dysfunktionaler Bewältigungsstrategien interpretiert werden, wie beispielsweise die Entwicklung von depressiven Symptomen, Angststörungen oder auch der Konsum von Substanzen. Das Vorliegen anderer psychischer Störungen sollte also nicht automatisch dazu führen, den Patient:innen ein anderes Behandlungsverfahren zu empfehlen. Vielmehr sollte aufgrund der individuellen Lebensgeschichte, dem spezifischen Symptomprofil und den eventuell vorliegenden Vorbehandlungen entschieden werden, welches Verfahren am passendsten erscheint. Dabei sind das Vorliegen von akuter Suizidalität, akuter psychotischer Symptomatik und aktueller Substanzabhängigkeit allerdings mögliche Kontraindikationen. Bestehen diese Problembereiche in abgewandelter oder abgeschwächter Form, ist ein individueller Abwägungsprozess sinnvoll, in dem die Therapeut:innen entscheiden, was sie in ihrem Rahmen anbieten können und wollen (z. B. wenn zuverlässige Vereinbarungen getroffen werden, wie kein Substanzkonsum während der Behandlungsdauer o. Ä.).
1.3 Beschreibung der kPTBS und PTBS
Die Auswirkungen, die früh erlebte, anhaltende oder wiederholte Traumatisierung durch interpersonelle Gewalt haben können, sind vielfältig und in klassischen Diagnosekriterien teilweise schwer abbildbar. Neben den „klassischen“ PTBS-Symptomen zeigen sich eine Reihe von Beschwerden, die Betroffene stark in ihrer Alltagsfunktion und Lebensweise beeinträchtigen. Symptome wie Schwierigkeiten in der Impuls- und Affektregulation (übermäßige aversive Gefühle; Leere und/oder Taubheit; erhöhte Reizbarkeit), wiederkehrende zwischenmenschliche Probleme (Misstrauen; Isolation; Reviktimisierung) oder ein verändertes Selbstbild (Dissoziationen; sehr negativ; geprägt von Scham, Schuld oder Versagen) sind oftmals Teil des Spektrums.
Konzepte einer kPTBS, die über die klassischen Diagnosekriterien der PTBS hinausgehen, existieren schon sehr lange (Herman, 2018). Inzwischen ist die kPTBS auch offiziell als Diagnose in der ICD-11 anerkannt (WHO, 2023). Sie umfasst mit Wiedererle|15|ben, Vermeidungsverhalten und Hyperarousal alle drei Kernbereiche der PTBS. Zusätzlich wird eine „Beeinträchtigung in der Selbstorganisation“ beschrieben, die drei wesentliche Problembereiche umfasst: Affektive Dysregulation, negatives Selbstkonzept und interpersonelle Schwierigkeiten (Maercker et al., 2013) (siehe Tabelle 1).
Tabelle 1: Diagnostische Kriterien einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und komplexen PTBS (kPTBS) nach ICD-11 (WHO, 2023)
Symptomcluster
Symptom
PTBS
Traumatisches Ereignis
Klassische PTBS: einmaliges oder mehrere extrem bedrohliche oder entsetzliche Ereignisse
Komplexe PTBS: meist langanhaltende oder sich wiederholende Ereignisse, ohne oder mit schwierigen Fluchtmöglichkeiten
Wiedererleben
Intrusive Erinnerungen, Fashbacks oder Alpträume, typischerweise mit starken oder überwältigenden Emotionen (Angst oder Entsetzen) und starken körperlichen Empfindungen
Vermeidung
Vermeiden von Gedanken, Aktivitäten, Situationen oder Personen, die an das traumatische Geschehen erinnern
Wahrnehmung aktueller Bedrohung
Wahrnehmung einer erhöhten aktuellen Bedrohung mit Hypervigilanz oder erhöhter Schreckhaftigkeit
Beeinträchtigung
Über mehrere Wochen Beeinträchtigungen in wichtigen Funktionsbereichen
Bei kPTBS zusätzlich
Störungen der Emotionsregulation
Hohe emotionale Aktivierbarkeit bei verhältnismäßig „milden“ Auslösern
Intensives Stresserleben und langsame Regulierung oder Beruhigung
Tendenz zu Dissoziationen
Dysfunktionale Strategien im Umgang mit aversiven Gefühlen, z. B. selbstschädigendes Verhalten, Konsum von Substanzen etc.
Negatives Selbstkonzept
Traumaassoziierte Selbstbilder mit:
Gefühl, minderwertig oder wertlos zu sein
Gefühl, anders oder falsch zu sein
Chronischem Gefühl von Schuld, Scham oder Versagen
Störungen der Beziehungsfähigkeit
Schwierigkeiten, zu vertrauen und Nähe zuzulassen
Erhöhte Sensitivität für Kritik und Ablehnung
Selbstunsicherheit
Tendenz zu emotionaler Distanz in Beziehungen und/oder abrupten Beziehungsabbrüchen
Wiederholung dysfunktionaler Beziehungsgestaltung oder Reviktimisierung
Untersuchungen von Levitt und Cloitre (2005) zeigen, dass eben diese, eine kPTBS charakterisierende Problembereiche häufig sogar zu stärkerem Leidensdruck führen bzw. vielfach der primäre Grund für Betroffene sind, sich in Beratung oder Behandlung zu begeben. Natürlich hängen Symptombereiche einer kPTBS und einer PTBS miteinander zusammen und stehen in Wechselwirkung zueinander. So kann etwa Intimität im Rahmen einer Beziehung schnell beeinträchtigt sein, wenn bestimmte Berührungen oder Sinneseindrücke eng mit dem traumatischen Geschehen verknüpft sind. Unwohlsein, Ängste und Intrusionen können auftreten, die wiederum sowohl intrapsychisch als auch interpersonell eine Herausforderung darstellen und besondere Bewältigungsstrategien erfordern. Viele emotionale oder zwischenmenschliche Schwierigkeiten, die von Betroffenen beschrieben werden, gehen allerdings weit über die Aktivierung von Traumaerinnerungen hinaus und scheinen Folgen von nachvollziehbaren Entwicklungsstörungen (insbesondere Störungen in der Bindungs- und Beziehungsfähigkeit) zu sein.
|16|Vor dem Hintergrund, dass Opfer von Traumatisierung in der Kindheit oftmals sowohl an den klassischen PTBS-Symptomen als auch den anhaltenden Beeinträchtigungen in der Emotionsregulation, in zwischenmenschlichen Beziehungen und bezüglich des Selbstkonzepts leiden, wird eine phasenorientierte Behandlung empfohlen. Dabei geht es in der ersten Phase um die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen sowie um die Bearbeitung dysfunktionaler, traumaassoziierter Beziehungsmuster, bevor in der zweiten Phase traumafokussiert gearbeitet wird. Das ESTAIR-Gruppenprogramm entspricht der ersten Behandlungsphase. Das Verfahren adressiert damit direkt die Schwierigkeiten in der affektiven und zwischenmenschlichen Regulation sowie im Selbstkonzept durch den Aufbau von Kompetenzen (sogenannten Skills) und stärkt dadurch die Alltagsfunktion der Betroffenen. Weiter wird auf das häufig negative Selbstkonzept bei Betroffenen eingegangen. Eine Traumafokussierung (NT) findet in der Gruppe nicht statt. Diese kann bei Bedarf im Anschluss an das STAIR-Gruppenprogramm oder parallel dazu im Einzelsetting durchgeführt werden (vgl. Kapitel 1.4).
1.4 Vergleich des ESTAIR-Gruppenprogramms mit STAIR/Narrative Therapie
Wie bereits beschrieben, basiert das ESTAIR-Gruppenprogramm auf STAIR/Narrative Therapie, das im Einzelsetting durchgeführt wird. Aufgrund der großen Überschneidungen, die vor allem den theoretischen Hintergrund und die Grundlagen des Verfahrens, teilweise aber auch die praktische Anwendung einzelner Bausteine betreffen, sollte STAIR/Narrative Therapie bekannt sein. Bei Bedarf können vertiefende Informationen im Einzelmanual (Cloitre et al., 2025) nachgelesen werden.
Die beiden zentralen Unterschiede zwischen STAIR/Narrative Therapie als Einzeltherapie und dem ESTAIR-Gruppenprogramm sind die Durchführung im Einzel- bzw. Gruppenkontext und die traumafokussierte Arbeit, die in der Gruppe nicht stattfindet. Daneben enthält das Gruppenprogramm einen weiteren Baustein und mehr Sitzungen. Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Verfahren sind in Tabelle 2 aufgeführt. Die genauen Inhalte der Behandlungsschwerpunkte des ESTAIR-Gruppenprogramms werden in Kapitel 1.7 beschrieben.
Die Kombination des ESTAIR-Gruppenprogramms und der Einzeltherapie ist dabei nicht nur gut möglich, sondern ein Idealfall. Es ist anzunehmen, dass Patient:innen besonders gut von der Therapie profitieren, wenn sie zusätzlich zur Gruppe die Möglichkeit haben, in einem parallel laufenden oder im Anschluss an das Gruppensetting stattfindenden einzeltherapeutischen Rahmen gewisse Prozesse individuell zu vertiefen. Zudem kann es entlastend sein, in dieser sehr fordernden Behandlungszeit mehrere Ansprechpartner:innen zu haben. Nicht zuletzt dient das Skillstraining der ersten Phase, das im ESTAIR-Gruppenprogramm durchgeführt wird, der Vorbereitung für die zweite, traumafokussierte Behandlungsphase (NT), die grundsätzlich im Einzelsetting erfolgen sollte. Voraussetzung für eine Gruppenteilnahme muss eine parallel laufende Einzeltherapie jedoch nicht sein.
1.5 Was sollten Therapeut:innen mitbringen?
ESTAIR ist eine aktive, auf Kompetenzförderung im Hier und Jetzt ausgerichtete Intervention aus dem Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie. Gleichzeitig spielen psychodynamische und traumaspezifische Elemente eine zentrale Rolle. Die Anwendung des Verfahrens setzt voraus, dass Therapeut:innen über eine anerkannte Ausbildung zur Psychotherapeut:in verfügen bzw. innerhalb eines Behandlungsteams durch entsprechende Personen supervidiert werden. Zertifizierungen in Traumatherapie sowie Fachkundenachweise in der Durchführung von Gruppentherapie sind zusätzlich hilfreich. In jedem Fall sollten Erfahrungen in der Anwendung evidenzbasierter Psychotherapieverfahren bestehen. Zudem sind fundierte Kenntnisse in STAIR/Narrative Therapie als Einzeltherapie hilfreich, vor allem bezüglich der Grundlagen der Behandlung mit STAIR(/Narrative Therapie).
Die Leitung einer Gruppe von Menschen mit traumatischen Erfahrungen bringt besondere Herausforderungen mit sich. Denn die Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation, im Selbstkonzept und in Bindungen der Patient:innen zeigen sich auch in der therapeutischen Beziehung. Trotz des Fokus auf dem Kompetenzaufbau und dem Vermeiden von traumafokussierter Arbeit lässt es sich zudem nicht vermeiden, dass Therapeut:innen mit den belastenden Erfahrungen der Gruppenmitglieder konfrontiert wer|17|den. Umso wichtiger ist die Selbstfürsorge der Therapeut:innen. In diesem Zusammenhang zeichnet sich eine gute Selbstfürsorge aus durch (Cloitre et al., 2014)
den Austausch mit und Unterstützung durch andere Traumatherapeut:innen,
ausreichende Pausen zwischen den Terminen,
die Behandlung von Patient:innen mit unterschiedlichen Schwierigkeiten sowie in verschiedenen Phasen der Traumabearbeitung,
die Berücksichtigung der eigenen Grenzen.
1.6 Die Behandlungsphilosophie von ESTAIR: Therapeutische Allianz als Basis
In der Behandlung komplexer Traumafolgen begegnen wir oftmals Menschen, die schon an den Anfängen ihres Lebens interpersonelle Gewalt und Misshandlungen erfahren mussten. „Misshandlung in der Kindheit“, „Kindheitstrauma“, „Entwicklungstrauma“ – all diese Beschreibungen sind mehr als eine Diagnose oder eine Ansammlung von typischerweise auftretenden Beschwerden und Beeinträchtigungen. Es sind Lebensbedingungen, unter denen die Betroffenen aufwachsen mussten. Bedingungen, die nicht nur durch schreckliche Erlebnisse geprägt waren, sondern zusätzlich durch das Fehlen stärkender, schützender und umsorgender (Beziehungs-)Erfahrungen. Wir begegnen also oftmals Menschen mit einem Mehr an Belastung und gleichzeitig einem Weniger an inneren und äußeren Ressourcen.
Tabelle 2: Vergleich von ESTAIR-Gruppenprogramm und STAIR/Narrative Therapie als Einzeltherapie (nach Cloitre et al., 2025)
Behandlungsschwerpunkt
ESTAIR-Gruppenprogramm
STAIR/Narrative Therapie (Einzeltherapie)
Einführung
Sitzung 1
Sitzung 1
Emotionsregulation
Sitzungen 2 bis 6 zu:
Emotionswahrnehmung
Umgang mit Emotionen
Bedürfnis- und emotionsorientierte Lebensgestaltung
Sitzungen 2 bis 5 zu:
Emotionswahrnehmung
Umgang mit Emotionen
Bedürfnis- und emotionsorientierte Lebensgestaltung
Selbstkonzept
Sitzungen 7 bis 11 zu:
Traumabezogene und dysfunktionale Selbstkonzepte
Selbstmitgefühl
–
Zwischenmenschliche Beziehungen
Sitzungen 12 bis 16 zu:
Traumabezogene und dysfunktionale Beziehungsmuster
Handlungsfähigkeit in Beziehungen
Flexibilität in Beziehungen
Bindungsfähigkeit
Sitzungen 6 bis 9 zu:
Traumabezogene und dysfunktionale Beziehungsmuster
Handlungsfähigkeit in Beziehungen
Flexibilität in Beziehungen
Vorbereitung der Narrativen Therapie
–
Sitzung 10 zu:
Abschluss des Skillstrainings
Vorbereitung der Narrativen Therapie
Traumafokussierte Arbeit
–
Sitzungen 11 bis 17 zu Narrativer Therapie
Abschluss
Sitzung 17
Sitzung 18
Viele unserer Patient:innen hatten während ihres Aufwachsens nicht die Möglichkeit oder Kapazität, um gesunde emotionale und soziale Fertigkeiten zu entwickeln. Wenn die beschützende Person (also die primäre Bindungsperson) und Täterin bzw. Täter in einer Person vereint ist, kann es zu sehr ungesunden Verknüpfungen kommen. Fürsorge und Liebe sind dann eng verbunden mit existenzieller Bedrohung. Eine gesunde Bindungsfähigkeit, die mit einem wohlwol|18|lenden Umgang mit sich und anderen einhergeht, kann im Erwachsenenalter somit deutlich beeinträchtigt sein – einfach deshalb, weil den Betroffenen wichtige Entwicklungsschritte verwehrt wurden. Es ging in der Vergangenheit unserer Patient:innen weniger um Wachstum oder persönliche Entfaltung, sondern um Überleben.
Wir arbeiten also mit Menschen, die bereits viel bewältigt haben, die neben den „Entwicklungsstörungen“ starke Widerstandfähigkeit mitbringen und häufig über eine Reihe von Kompetenzen verfügen, die sie weit gebracht haben: in unsere Behandlung. Sie verfügen darüber hinaus über eine ganz wesentliche innere Ressource, nämlich Hoffnung! Anderenfalls hätten sie ihren Weg zu uns nicht finden können. Diese würdigende und wertschätzende Grundhaltung wird im ESTAIR-Gruppenprogramm in jeder Sitzung transportiert. Die Gruppe soll einen sicheren Rahmen bieten, in dem korrigierende Erfahrungen möglich sind.
Es wurde bereits beschrieben, inwieweit Misshandlungen durch primäre Bezugspersonen die Entwicklung einer gesunden Beziehungsfähigkeit beeinträchtigen. Nachvollziehbarerweise tragen die Patient:innen ihre dysfunktionalen Beziehungsmuster sowie die bestehenden Schwierigkeiten bezogen auf ihre Emotionsregulation und ihr Selbstkonzept in die therapeutische Beziehungsarbeit hinein. Der Behandlungserfolg hängt also auch maßgeblich davon ab, inwieweit es den Therapeut:innen gelingt, eine tragfähige, starke und verlässliche Allianz aufzubauen – trotz dieser Herausforderungen in den Interaktionen.
Die Basis für eine tragfähige therapeutische Beziehung ist eine bedingungslos wertschätzende Haltung sowie eine wertfreie (Beob-)Achtung all dessen, was unsere Patient:innen mit uns teilen (Rogers, 1951). Voraussetzung dafür scheint zunächst, dass wir als Therapeut:innen Freude an unserer Arbeit haben und – überwiegend – gerne mit unseren Patient:innen arbeiten. Diese authentische Zugewandtheit ist also eine wesentliche Grundlage für den Aufbau der therapeutischen Allianz. Ebenso wichtig ist es, dass wir selbst an die Möglichkeiten einer Verbesserung glauben und somit glaubwürdig Hoffnung vermitteln können (Cloitre et al., 2014).
Vor dem Hintergrund des teilweise stark dysfunktionalen Interaktionsverhaltens der Betroffenen fällt diese uneingeschränkte Wertschätzung und Hoffnung manchmal schwer. Deshalb ist es wichtig, sich selbst, eigene Muster, Reaktionsweisen und Verhaltensimpulse gut zu kennen, im therapeutischen Prozess wahrzunehmen und entsprechend reflektiert und professionell zu handeln.
Herausforderungen und Stolpersteine in der therapeutischen Allianz
Hinter den Herausforderungen in der therapeutischen Beziehung stecken häufig Angst, Konflikte oder andere Schwierigkeiten, die Patient:innen nicht anders zeigen können (Cloitre et al., 2014). Diese Herausforderungen sind vielfältig und individuell. Gleichzeitig können auch „typische Stolpersteine“ beobachtet werden.
Unzureichendes Gefühl, verstanden zu werden
Es ist unumgänglich, dass es innerhalb der therapeutischen Arbeit auch einmal dazu kommt, dass das Verständnis von Seiten der Therapeut:innen nur bedingt oder eingeschränkt empfunden werden kann. Gleichzeitig ist der Eindruck, nicht verstanden oder gesehen zu werden, oftmals ein „chronisches“ Problem im Erleben von Betroffenen und eine typische Auswirkung von traumatischem Geschehen. Wir können dieser Herausforderung auf zwei Ebenen begegnen:
Transparent darüber sprechen, dass Missverständnisse einen natürlichen Teil von zwischenmenschlichen Beziehungen darstellen, sie keinen Beziehungsabbruch bedeuten müssen und die Beziehung durch eine gemeinsame Klärung wächst. Auf diese Weise können erste hilfreiche interpersonelle Strategien vermittelt und korrigierende Beziehungserfahrungen angeboten werden.
Kommunizierte Kränkungen und/oder Erwartungen auf Seiten der Patient:innen für die Arbeit an dysfunktionalen Beziehungsmustern nutzen.
Sexualisiertes Verhalten
Sexualisierte Verhaltensweisen gegenüber den Therapeut:innen können vor allem dann eine Rolle spielen, wenn Patient:innen sexuelle Missbrauchserfahrungen in ihrer Biografie erlebt haben. Oftmals handelt es sich um automatisch ablaufende, traumaassoziierte Dynamiken, die dem Beziehungsaufbau dienen und die Hinweise auf die bestehenden interpersonellen Beziehungsmuster geben können (z. B. „Bindung bedeutet, sich sexuell zu zeigen.“, „Nur wenn ich mich sexuell nähere, kann eine Beziehung bestehen bleiben.“).
Auch hier ist es ratsam, erst einmal zu reflektieren, was die Patient:innen mit einem solchen Verhalten bezwecken und welche Funktion dieses Interaktionsverhalten haben könnte, anstatt den Betroffenen oder die |19|Betroffene unmittelbar zu begrenzen oder (aus dem eigenen Unwohlsein heraus) ihrerseits zu beschämen. Natürlich ist es wichtig, als Behandler:in eigene Grenzen wahrzunehmen und zu formulieren, nur sollten wir versuchen, dabei auch unsere Wertschätzung und professionelle Sichtweise zu transportieren. Wir können unsere Beobachtung und Einschätzung transparent mitteilen und/oder vermitteln, dass uns die therapeutische Beziehung wichtig ist – aus Gründen, die nichts mit Sexualität zu tun haben. Auf diese Weise unterstützen wir unsere Patient:innen, sich als mehr als „ein sexuelles Objekt“ wahrzunehmen und die Erfahrung zu machen, dass Bindung ohne sexuellen Nutzen wachsen kann. Es sollte auf deutliche, aber mitfühlende Weise klargestellt werden, dass keine sexuelle Beziehung entstehen wird, diese aber für den Aufbau einer vertrauensvollen, ernst gemeinten zwischenmenschlichen Beziehung auch nicht nötig ist. Eine solche korrigierende Erfahrung kann eine heilsame und beruhigende Wirkung haben.





























