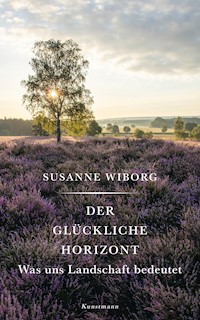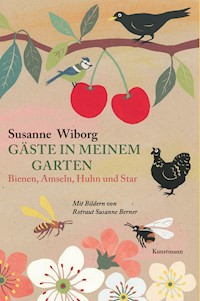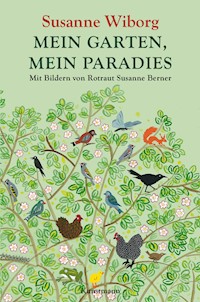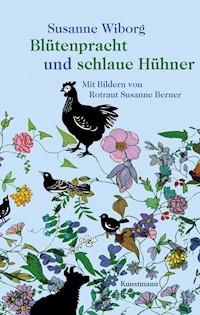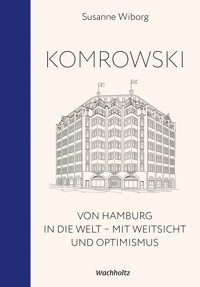
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wachholtz Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Im Montanhof, einen Steinwurf vom weltbekannten Chilehaus entfernt, ist ein typisches Hamburger Unternehmen zu Hause: Komrowski. Es steht, wie das ganze Kontorhausviertel, für eine Mischung aus Tradition und Innovation. Geprägt von Handel und Schifffahrt, weltweit engagiert, wird es inzwischen in vierter Generation immer noch von der Gründerfamilie geführt. Vor über 100 Jahren gab Senior und Selfmademan Ernst Komrowski zusammen mit seinem Partner Carl Dobbertin den Bau des Montanhofs in Auftrag. Das beeindruckende Rotklinkergebäude mit der expressionistischen Fassade gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Unternehmensgruppe, die hier residiert, ist allerdings alles andere als museal. Komrowski verbindet Heimatverbundenheit mit Weltoffenheit, Tradition mit Moderne. Ein lebendiges Stück Hamburg also, ein Unternehmen, dessen Auf und Ab Hamburger, Wirtschafts- und Weltgeschichte wie in einem Prisma spiegelt und anschaulich miterleben lässt. Und nicht zuletzt ein modernes Beispiel für die uralte, aber auch im 21. Jahrhundert gültige hanseatische Weisheit: "Kaufmanns Gut ist Ebb' und Flut." Das prototypische Schicksal dieser Unternehmensgruppe macht die Geschichte des Gebäudes und der Menschen, die seit 100 Jahren mit ihm verbunden sind, beispielhaft, faszinierend und deshalb so erzählens- und miterlebenswert. Die von den Inhabern selbst, ihren Mitarbeitern und vielen Zeitzeugen erzählte, von Susanne Wiborg niedergeschriebene Unternehmensgeschichte, dieser offene Blick in eine diskrete Branche, zeigt eines deutlich: Es gibt immer Chancen und Aufbruchzeiten, es gibt Kriege und Krisen, große Gewinne und bedrohliche Verluste. Das Familienunternehmen Komrowski hat dies alles und mehr erlebt – und über 100 Jahre hinweg überstanden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VON HAMBURG IN DIE WELT – MIT WEITSICHT UND OPTIMISMUS
Susanne Wiborg
KOMROWSKI
VON HAMBURGIN DIE WELT – MIT WEITSICHTUND OPTIMISMUS
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Lauter solide Häuser 1912–1932
Business as usual? Die Republik stirbt – »Der Führer entscheidet« 1933–1939
Alles, was unsere Generation schuf und lebte, ist zerstört« 1939–1945
»Über die Runden kommen« 1945–1949
Comeback und Neubeginn 1945–1960
Erneuter Aufbruch: Der Weg ins internationale Chartergeschäft 1958–1969
»Das deutsche Wirtschaftswunder« 1950–1968
Umbrüche und Herausforderungen 1966–1978
Epochenwechsel oder: »Zusammenhalten!« 1978–2000
Ebb' und Flut 2000–2024
100 Jahre Montanhof: Weltkulturerbe im Herzen Hamburgs 1925–2025
ZITATNACHWEISE
QUELLENANGABEN
BILDNACHWEISE
ÜBER DIE AUTORIN
Vorwort
Ein Jahrhundert Montanhof – für uns der willkommene Anlass, Sie zu einer Reise durch seine und unsere Geschichte einzuladen. Das einmalige Kontorhaus im Herzen Hamburgs wurde nicht nur von unserem Gründer und seinem Partner erbaut, ist nicht nur seitdem unser Unternehmenssitz, sondern gehört sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ein historisches Denkmal von Weltrang also, aber eben nicht museal. Der Montanhof steht für lebendige Geschichte, und dieser – unserer – Geschichte sind wir intensiv nachgegangen, weil wir sie auch als integralen Teil Hamburgs begreifen. Unsere Reise in die Vergangenheit erwies sich als derart spannend und vielfältig, dass wir sie hier festgehalten haben: für unsere Familie, für unsere Partner, Mitarbeiter und Freunde, aber besonders auch für alle, die immer schon wissen wollten, was sich hinter so nüchternen Begriffen wie »mittelständisches Hamburger Familienunternehmen« oder »Handelshaus« verbirgt. Wir hoffen sehr, dass wir Sie auf einen umfassenden Einblick in all das mitnehmen können, wofür der Montanhof und das ganze Weltkulturerbe Kontorhausviertel eigentlich stehen: Sie stehen für Hamburgs Wirtschaft, für ihr Auf und Ab und für viele verschiedene Menschen, die sie mitgeprägt haben.
Ernst Komrowski, unser Unternehmensgründer, bietet da ein anschauliches Beispiel: Als Selfmademan wurde er einer der ganz Großen der Hamburger Wirtschaft, fühlte sich aber der hanseatischen Tradition von Diskretion und Zurückhaltung so verpflichtet, dass er öffentlich so gut wie unbekannt blieb. Uns ist es daher ein Anliegen, endlich an ihn, an seine prototypische Karriere mit allen Höhen und Tiefen und an ein Lebenswerk zu erinnern, für das der Montanhof nun seit hundert Jahren steht. Wie in einem Prisma spiegeln sich dabei in seinem und im Schicksal unseres Unternehmens Stadt- Wirtschafts- und Weltgeschichte.
In unserer großen Geschichte stecken unzählige kleinere, aus denen sie sich zusammensetzt. Es gibt viel Wechsel, aber eine Konstante: Entscheidend bleiben die Menschen, deren Wege sich mit dem Montanhof verbinden. Da sind unsere Partner im In- und Ausland, und da sind unsere Mitarbeiter, dem Familienunternehmen und seinen Inhabern oft über Jahrzehnte loyal verbunden. Ihnen allen ausdrücklich und herzlich für ihr Engagement zu danken, war für uns ein weiterer Grund, unsere gemeinsame Geschichte festzuhalten. Nicht nur der Gründer, auch viele tüchtige junge Männer und Frauen fanden und ergriffen im Unternehmen ihre Lebenschance, konnten aufsteigen und buchstäblich ihr Glück machen. Damit, dass auch sie aus ihrem Berufsalltag von gestern und heute erzählen, möchten wir beispielhaft zeigen, wie sehr sich Engagement und Zielstrebigkeit auch in schwierigsten Zeiten lohnen, wie persönlicher Einsatz und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten oft über schwerste Rückschläge hinweghelfen. Auf diese Weise hoffen wir, auch heute jungen Menschen Mut für die eigene Karriere, für die eigene Leistung und den eigenen Erfolg machen zu können.
Kurz: Wir möchten Ihnen an unserem Beispiel zeigen, wie viel bewegtes, vielseitiges und modernes Leben sich hinter einer historischen Fassade verbergen kann. So wünschen wir Ihnen viel Freude und Unterhaltung beim gemeinsamen Weg durch unsere lange, wechselvolle und für die Zeit, die Branche und die Stadt nicht untypische Geschichte.
Hamburg, Montanhof, im Juni 2025
Ernst P. Komrowski und E. Thomas Komrowski
Lauter solide Häuser1912–1932
»Die Stadt Hamburg ist eine gute Stadt, lauter solide Häuser. Hier herrscht nicht der schändliche Macbeth, hier herrscht Banko. Der Geist Bankos herrscht überall in diesem kleinen Freistaate, dessen sichtbares Oberhaupt ein hoch- und wohlweiser Senat …«
Manches ändert sich nie. Heinrich Heine, nach seiner gescheiterten Hamburger Kaufmannslehre der Freien und Hansestadt in inniger Hassliebe verbunden, schrieb diese Zeilen vor beinahe zwei Jahrhunderten. Seitdem ging Hamburg durch wechselvolle Zeiten, und dennoch blieb vieles gleich. Immer noch herrscht nicht nur der hoch- und wohlweise Senat in der Stadtrepublik, sondern daneben auch »der Geist Bankos«, das Geld. Immer noch wird, wie seit Hansezeiten, ein beträchtlicher Teil dieses Geldes mit Handel und Schifffahrt verdient. In Hamburgs Stadtbild ist ihre Bedeutung unübersehbar, nicht nur in Hafen und Speicherstadt, sondern ebenso im Kontorhausviertel, dem repräsentativen Rotklinker-Symbol von Merkurs eigener Stadt. Nirgendwo sonst gibt es so viele solide Häuser auf so engem Raum wie in diesem Teil der Hamburger Altstadt rund um den Burchardplatz. Ihre Höfe, wie die hamburgischen Geschäftshäuser seit jeher heißen, sind berühmt und viel fotografiert: Zwanzigerjahre-Backsteinexpressionismus, derart einmalig, dass sowohl das gesamte Ensemble als auch seine Einzelbauten 2015 ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen wurden.
Der ortstypische, ebenfalls durch und durch solide Klinker verrät Wohlstand und Selbstsicherheit, doch er tut das unaufdringlich und daher umso einprägsamer, hanseatisch eben. Hinter diesen roten Fassaden arbeiten heute wie vor hundert Jahren Unternehmen, deren Schicksal eng mit der Stadtgeschichte verwoben ist und die auch im 21. Jahrhundert das Rückgrat von Hamburgs Wirtschaft bilden. Viele von ihnen haben einen einschneidenden Wandel hinter sich: vom traditionellen Handelshaus wie zu Heines Zeiten zum modernen Anbieter von Waren und Dienstleistungen, vom Kontor mit Stehpult zum Hightechbüro. Eines jedoch haben sie unverändert beibehalten: Hanseatisch diskret sind sie immer noch. Es ist kein Zufall, dass man sie gerade hier antrifft und nicht in spektakulären verspiegelten Bürotürmen. Keine glitzernden Fassaden künden von ihrem Erfolg, grelle Werbung entspricht nicht ihrem Selbstverständnis. Die Namen ihrer Inhaber sucht man vergebens in den Klatschspalten der Boulevardpresse.
An der Ecke Kattrepel und Niedernstraße, einen Steinwurf vom weltbekannten Chilehaus entfernt, ist ein typisches Unternehmen dieser Art zu Hause: Familienunternehmen über inzwischen vier Generationen, weltweiter Handel, Schifffahrt – mehr Hamburg geht nicht. So ist es ebenso logisch wie symbolisch, dass es in einem der prägenden Gebäude des Kontorhausviertels residiert, im Montanhof am Kattrepel 2. Mit seiner prägnanten Ziehharmonika-Fassade, den gestaffelten oberen Stockwerken und den expressionistischen Statuen ist das eindrucksvolle Gebäude Beginn und Akzent für das einmalige Ensemble. Denkmalschutz, Weltkulturerbe und jetzt auch noch der hundertste Geburtstag – der Montanhof steht für steingewordene Stadtgeschichte. Die Unternehmensgruppe, deren Gründer das Gebäude vor über einem Jahrhundert in Auftrag gaben, ist dennoch alles andere als museal. Sie verbindet die traditionelle Form des Familienunternehmens mit modernen Geschäftsfeldern. Ihr Name: Ernst Komrowski.
Komrowski ist ebenso ein Stück Hamburg wie der Montanhof, ein Beispiel für all die soliden Häuser, die dieser Stadt ihren speziellen Charakter verleihen. In ihrem Schicksal spiegelt sich das Auf und Ab eines guten Jahrhunderts, ihre Beständigkeit liegt im Wandel. In erster Linie passen sich Handelshäuser fortlaufend den Erfordernissen
Zusammen ein Stück Hamburg: Montanhof mit Stadt- und Komrowski-Flagge.
des Marktes, den Wünschen der weltweiten Kunden an. Aber ebenso bestimmen äußere Einflüsse, die Hamburger und die Weltgeschichte, immer ihr Schicksal mit. »Kaufmanns Gut ist Ebb' und Flut«, hieß es schon in der Hansezeit vor über 800 Jahren, und das gilt unverändert für das 21. Jahrhundert: Es gibt Chancen und Aufbruchszeiten, es gibt Kriege und Krisen, große Gewinne und bedrohliche Verluste. Das Familienunternehmen Komrowski hat alles erlebt und alles überstanden. Dabei entwickelte es sich aus einer Verbindung von reiner Handelsfirma und Reederei zum Dienstleister mit umfassendem Angebot. »Es ist unsere Aufgabe«, so fasst Inhaber Ernst Peter Komrowski zusammen, »internationale Trends auf jedem Gebiet zu erkennen, Märkte zu nutzen und die Basis für eine erfolgreiche geschäftliche Entwicklung unserer Kunden zu schaffen – durch professionelle Planung, professionelle Produkte und professionellen Service.«
So verkauft Komrowski heute nicht mehr nur Handelswaren wie Roh- und Fertigprodukte, sondern ganze Produktionsverfahren und das dazugehörige Know-how, individuell passend zugeschnitten auf die jeweilige Nachfrage. Die Mitarbeiter bieten nahezu weltweiten Service, eigene Niederlassungen in Kundenländern sorgen für engen Kontakt. Hauptquartier jedoch ist und bleibt der stolze Montanhof am Kattrepel. Seine Entstehungsgeschichte bedeutete nicht nur den großen Aufbruch für seine Erbauer, sondern auch Hamburgs Schritt in die architektonische Moderne – wenn auch zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.
Einladung in die Welt von Handel und Schifffahrt: Das historische Treppenhaus des Montanhofs, später ergänzt durch die Glocke der »Ossian«.
Zuversicht und Zukunft: Aufbruch im Chaos
18. Januar 1923. Ein grauer Tag in einer düsteren Zeit. Norddeutsches Schmuddelwetter, wie es im Buche steht, Temperaturen um den Gefrierpunkt, Nieselregen. Viel scheußlicher ging es nicht, und das passte perfekt zur allgemeinen Stimmung: Es schien undenkbar, dass die Freie und Hansestadt Hamburg noch vor einem knappen Jahrzehnt das strahlende Tor zur Welt, das Außenhandelszentrum eines unerschütterlich sicheren Wirtschaftswunderlandes gewesen war. Handel und Schifffahrt hatten seit der Reichsgründung 1871 einen nie dagewesenen Boom erlebt. Kurz vor dem Kriegsausbruch 1914, auf dem Gipfel der hanseatisch-wilhelminischen »Belle Époque«, hatte das Selbstbewusstsein vieler Hanseaten sogar ihre glänzenden wirtschaftlichen Erfolge übertroffen – und das wollte schon einiges heißen.
Nun, 1923, war all das vorbei. Es herrschten Katerstimmung und Chaos. Mit dem Ersten Weltkrieg hatte der deutsche Griff nach der Weltmacht in einer Katastrophe nie gesehenen Ausmaßes geendet. Eine Epoche war untergegangen, das Kaiserreich 1918 zerbrochen, der Monarch geflohen. Eine Welt und ein Selbstverständnis lagen in Trümmern, und was blieb, waren Erschütterung und Ernüchterung. Die Deutschen waren jetzt nicht mehr die tüchtigen, unaufhaltsamen Emporkömmlinge, die lautstark ihren »Platz an der Sonne« einfordern konnten, sondern geschlagene, buchstäblich am Boden zerstörte Verlierer, und entsprechend wurden sie international behandelt. Die Wirtschaft musste der Politik ins Abseits folgen: Nach dem als unerträglich demütigend empfundenen Friedensvertrag, der 1919 in Versailles geschlossen worden war, war der deutsche Außenhandel nahezu zum Erliegen gekommen. Die Schifffahrt hatte es ebenfalls hart getroffen, denn die Reedereien mussten alle größeren Schiffe an die Siegermächte abgeben. Die junge Weimarer Republik, politisch tief zerrissen und unter dem Druck ungeheurer Reparationslasten, kämpfte um ihre Existenz. Die einst so florierende deutsche Wirtschaft versank im Chaos, und das graue winterliche Hamburg spiegelte die freudlose Lage perfekt. Erst eine Woche zuvor, am 11. Januar 1923, waren die Franzosen ins Ruhrgebiet einmarschiert, angeblich, um ausstehende Reparationen einzutreiben. An diesem Donnerstag ließen die Besatzer dort die Reichsbankstellen besetzen und die sogar die Lohngelder privater Betriebe beschlagnahmen. Reichskanzler Wilhelm Cuno, vorher übrigens Hapag-Chef in Hamburg, hatte die Deutschen zu passivem Widerstand, zum Generalstreik, aufgerufen.
So etwas jedoch war teuer, vor allem für ein Land in einer ohnehin verzweifelten wirtschaftlichen Situation. Die Kosten für den »Ruhrkampf«, gedeckt aus der Notenpresse, bewirkten eine immer schneller galoppierende Inflation. Am 1. Januar 1923 war der Dollar mit 7600 Papiermark notiert worden, am Ende des Jahres sollte er unglaubliche 4,2 Billionen Mark wert sein. Besonders schwer traf es die Privathaushalte, die nicht über Devisen verfügten. Kartoffeln, damals das Grundnahrungsmittel, hatten vor dem Krieg je Kilo etwa 15 Pfennige gekostet. Im Januar 1923 waren es schon 28 Mark, im Juni sollten es 333 Mark, im November schließlich 80 Milliarden sein. In Hamburg wie in anderen Großstädten herrschten Hunger, Not und Unruhe.
Und doch: Sogar in diesen Zeiten tiefster Depression gab es unübersehbare Signale von Zuversicht und Zukunft, an der Elbe sogar mehr als anderswo. Da war etwa die Hapag, lange Zeit die größte Reederei der Welt, die nahezu ihre komplette Flotte eingebüßt hatte. Trotzdem hatte sie, als erstes Unternehmen nach dem Krieg, 1921 den Neubau ihres Kontorhauses am Alsterdamm vollendet. Für die niedergedrückte Stadt, die sich so sehr mit ihrem Hafen und ihrer Schifffahrt identifizierte, war das ein Symbol gewesen, eine unübersehbare, aufmunternde Demonstration von Optimismus und Überlebenswillen. Auch die Stadt Hamburg wollte jetzt Zeichen setzen: Sie hatte sich entschlossen, allen Schwierigkeiten zum Trotz ein kühnes Vorkriegsprojekt ihres Oberbaudirektors Fritz Schumacher wieder aufzunehmen. An der Schnittstelle von Alt- und Neustadt, auf dem Gelände der ehemaligen Gängeviertel, sollte, in direkter Hafennähe und Sichtweite der Speicherstadt aus der Kaiserzeit, ein großes neues Kontorhausviertel, ein Ensemble reiner Bürohäuser entstehen.
Das bedeutete einen ebenso städtebaulichen wie sozialen Meilenstein. Das Viertel, lange ein Slum übelster Sorte, sollte aus anachronistischem Elend direkt in die architektonische Moderne aufbrechen. Die Stadt hatte schon vor dem Krieg Teile der alten, berüchtigt engen und übervölkerten Gängeviertel, in denen vor allem Hafenarbeiter hatten hausen müssen, aufgekauft und abgerissen. An deren Stelle war zunächst die Mönckebergstraße mit ihren aufsehenerregenden kombinierten Büro- und Geschäftshäusern entstanden. Nun sollte es auf dem nächsten Stück mit reinen Bürohäusern noch moderner weitergehen, und dafür verkaufte der Senat erneut Parzellen in allerbester Innenstadtlage. Wieder war ein Straßendurchbruch geplant, die Burchardstraße, und gebaut werden sollte ein geschlossenes, einmaliges Ensemble, zeitgemäße, ebenso praktische wie repräsentative Versionen traditioneller hanseatischer Höfe, das erste reine Bürohausviertel der Welt. Käufer und Bauherren waren deshalb an strenge Auflagen gebunden. Kurz: Die Stadt wollte nicht nur Hafen und Schifffahrt, sie wollte daneben auch ihren bedeutenden Außenhandel sichtbar in der City repräsentiert sehen.
Dazu trafen sich in der Hamburger Börse an diesem Donnerstag um »pünktlich 2 1/2 Uhr nachmittag« ein Vertreter der Finanzdeputation, der Notar Paul de Chapeaurouge und einige Makler, die hochkarätige Kunden vertraten. Ein zentraler Platz des geplanten neuen Viertels, das Flurstück M2, knapp 1000 Quadratmeter in der Altstadt-Nord zwischen Kattrepel und Niedernstraße, stand zur Versteigerung an. Der Käufer würde verpflichtet sein, den Platz an allen Fronten zu bebauen und das Gebäude bis zum 1. Oktober 1925 bezugsfertig herzustellen. Der Mindestpreis betrug »2941200,- Mark und Rente«, also Zinsen. Das klang noch vergleichsweise moderat, nach einer günstigen Möglichkeit, der eben erst beginnenden Inflation in einen so soliden Sachwert wie ein Grundstück in bester Citylage zu entfliehen.
Das Bieten begann bei 6000000 Mark. Die vier Makler überboten einander eine längere Zeit, zunächst schnell, dann nur noch fünfzigbis hundertmarkweise. Der Zuschlag wurde schließlich für ein Höchstgebot von 43300000 Mark erteilt. Als der versiegelte Umschlag mit dem Namen des Käufers geöffnet wurde, gab es eine riesige Überraschung: Das Filetstück des neuen Viertels, das Eckgrundstück am Kattrepel, ging nicht, womit fest gerechnet worden war, an eines der alteingesessenen Hamburger Häuser. Im Umschlag fand sich stattdessen ein noch relativ unbekannter Name: Dobbertin & Co. Das war eine Stahlhandelsfirma, die erst gut ein Jahrzehnt existierte, ein Jahrzehnt, das überdies fast zur Hälfte Kriegszeit gewesen war. Trotzdem
Finanzielles Duell um ein Grundstück im Herzen Hamburgs: Notariatsurkunde der Grundstücksversteigerung.
hatten die Newcomer nun diesen herausgehobenen Platz mit allen Chancen und Verpflichtungen erworben und damit nicht nur ihren schnellen kommerziellen Erfolg bewiesen, sondern auch ihre Zielstrebigkeit, ihre Zuversicht und ihren Aufstiegswillen. Die Dynamik, die in dem jungen Unternehmen steckte, unterstrich es noch einmal, dass die Teilhaber im selben Jahr, allen ungünstigen Rahmenbedingungen zum Trotz, auch noch eine eigene Schifffahrtsgesellschaft gründeten. Sie hieß Ernst Komrowski Reederei, und der Mann, dessen Namen sie trug, war erst knapp 34 Jahre alt.
Ein klassischer Selfmademan
Seine steile Karriere – Großkaufmann, Reeder, schließlich als Hapag-Großaktionär Mitinhaber einer hanseatischen Institution – war diesem jungen Mann nicht vorbestimmt gewesen. Ernst Theodor Walter Komrowski war ein klassischer Selfmademan. Seine Familie stammte ursprünglich aus dem Danziger Raum. Ernst Komrowskis Urgroßvater, der Zimmermeister Johann Gottlieb Komrowski, hatte 1849 das Bürgerrecht der Stadt Danzig erworben, war dann aber mit seiner Familie nach Hamburg gezogen. Dort wurden die Komrowskis 1860 ebenfalls eingebürgert, was auf einen gewissen Wohlstand schließen lässt, da das Hamburger Bürgerrecht an Grundbesitz gebunden war. Der Bürgereid war Voraussetzung für alle »bürgerlichen Befugnisse« in der Stadt, darunter selbstständige Erwerbstätigkeit, Kauf von Grundbesitz und Wahlrecht. Urenkel Ernst Komrowski war hundert Jahre später ein derart überzeugter und stolzer Hamburger, dass er dem Senat 1960, zum hundertsten Jahrestag dieses Bürgereids, einen Teller für den Silberschatz stiftete. Dennoch blieben die Verbindungen nach Danzig offenbar weiter so eng, dass noch Ernst Komrowskis Vater in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts abwechselnd in Hamburg und in Danzig lebte. Wie sehr sich auch Ernst Komrowski selbst dieser Wurzeln im heutigen Polen bewusst blieb, zeigten viele seiner geschäftlichen Aktivitäten im Ostseeraum und in Polen, einem Land, zu dem er früh Geschäftsverbindungen anknüpfte und hielt. Nach der Einbürgerung blieb die Familie zunächst auch an der Elbe dem
Jung, aber umso selbstsicherer: Zwei zielstrebige hanseatische Gentlemen, bereit, ihren Weg in der Geschäftswelt zu machen und es mit jeder Konkurrenz aufzunehmen. Die Partner Carl Dobbertin und Ernst Komrowski, 24 und 23 Jahre alt, kurz nach dem gemeinsamen Start in die Selbstständigkeit.
Zimmermannshandwerk treu: Ernsts Vater Carl Friedrich Komrowski war Schiffszimmermann. Doch sein jüngster Sohn, geboren am 16. Juli 1889 im Hinterhaus der Mittelstraße 25 in Hamburg-Hamm, setzte diese solide, aber bescheidene Tradition nicht fort. Er hatte andere Pläne.
Als Ernst zu Ostern 1904 die Schule verließ und, wie damals üblich, nach der Konfirmation vierzehnjährig ins Berufsleben eintrat, wollte er kein Handwerker werden. Seine Talente lagen, ebenso wie seine beruflichen Ziele, in der klassischen Hamburger Aufstiegsbranche, im Handel. Hier konnten begabte und fleißige junge Männer sich auch ohne ererbte Privilegien relativ schnell beträchtlichen Wohlstand erarbeiten. Doch in seiner ersten Stellung, bei der Firma J.H. Heuer im Schleusenhof an den Alsterarkaden, hielt es der ehrgeizige Teenager nicht lange aus. Sein Prinzipal bescheinigte »Herrn Ernst Komrowski« recht säuerlich: »… dass derselbe vom 22. März bis 12. Juli probeweise als Lehrling angestellt gewesen ist. Derselbe unterbricht die Lehre, da anzunehmen ist, dass er in einem anderen Geschäft geeigneter untergebracht ist.« Das Zeugnis schloss mit den doppeldeutigen Worten: »In sittlicher Beziehung ist gegen Genannten nichts einzuwenden.«
Immerhin. Ernst war offenbar schon während dieser kurzen Probezeit ebenso unzufrieden gewesen wie sein Chef, hatte sich intensiv nach einem »geeigneteren Geschäft« umgesehen und es auch schnell gefunden: Er begann jetzt eine Kaufmannslehre bei Coutinho & Co, später Coutinho, Caro & Co, einem Eisen- und Stahl- und Im- und Exportunternehmen im Amerika-Haus in der Ferdinandstraße. Für einen zielstrebigen jungen Mann war das gleich in doppelter Hinsicht eine gute Wahl. In der Wirtschaftswunderzeit des frühen 20. Jahrhunderts wuchs der Eisen- und Stahlhandel, und Felix Coutinho, der Unternehmensgründer, war da in gewisser Hinsicht ein Pionier gewesen. Er hatte sich nicht, wie die meisten damaligen Hamburger Exporteure, auf eine bestimmte Region, auf einen Markt konzentriert und den dann mit allem bedient, was sich dort eben verkaufen ließ. Coutinhos Konzept bestand vielmehr darin, sich weniger auf einen bestimmten Markt als auf eine bestimmte Ware, eben Eisen und Stahl, zu spezialisieren und die dann weltweit zu verkaufen. Führende Hersteller waren 1895, als er sich selbstständig machte, Großbritannien und Belgien, und Coutinho erwarb zunächst die Vertretungen englischer und belgischer Werke und belieferte mit deren Produkten Hamburger Überseefirmen.
Ein guter Start, umso mehr, als ihm ein allgemeiner Boom folgte. Im Deutschen Reich und vor allem in der Hafen- und Handelsstadt Hamburg wurde gebaut wie nie zuvor. Der Bedarf an Eisen und Stahl war entsprechend hoch. Überall entstanden Eisenbahnschienen und -züge, Marine- und Handelsschiffe, große Häuser, moderne Tunnel, kühne Brücken und nicht zuletzt Kanonen – und für all das und mehr besorgten die Handelshäuser das begehrte Material. Felix Coutinho hatte sich mit 24 Jahren selbstständig gemacht, war also noch ebenso jung wie sein Unternehmen. Das bedeutete, dass hier einem ehrgeizigen Berufsanfänger wie Ernst Komrowski weit mehr Chancen geboten wurden als in vielen lange etablierten Häusern mit ihren fest verankerten Hierarchien.
Mit wie viel Begabung und Engagement der junge Mann diese Chance zu nutzen verstand, fiel in der Ferdinandstraße schnell auf: Zu Weihnachten 1909, kurz vor Ende seiner Lehrzeit, verdiente der zwanzigjährige Lehrling schon ein erstaunlich hohes »Salair« von 1920 Goldmark im Jahr, deutlich mehr als der damalige Durchschnittsverdienst eines angestellten Familienvaters oder eines kleinen Beamten. Anschließend blieb er als angestellter Abteilungsleiter bei Coutinho, verantwortlich für die Abteilung »Diverse«. Ernst Komrowskis Begabung für seine Branche und sein Erfolg lassen sich nicht nur an seinem weiter schnell steigenden Einkommen ablesen, sondern auch daran, dass das Unternehmen ihm Ende 1911, mit zweiundzwanzig Jahren, schon einen förmlichen Dreijahresvertrag anbot. Das zeigte deutlich, wie viel Felix Coutinho daran gelegen war, dieses aufstrebende Talent an sein Haus zu binden. 1914 sollte Komrowski danach ein Jahresgrundgehalt von 2800,- Goldmark beziehen, zusätzlich drei Prozent Tantieme auf alle von ihm bearbeiteten Artikel.
»Eigenständige Phantasie, eigenständiges Wagnis, eigenständige Verantwortung«
Jedoch: Selbst diese für die damalige Zeit glänzende Offerte nützte nichts. Komrowski ließ sich nicht halten. Der Zweiundzwanzigjährige hatte in diesem modernen, florierenden Unternehmen viel gelernt, und zwar nicht nur die praktischen Grundlagen seines Berufes, sondern vor allem dessen Geschäftsphilosophie: »Welthandel ist höchster Anspruch auf eigenständige Phantasie, eigenständiges Wagnis, eigenständige Verantwortung«. So fasste Herbert Coutinho, Sohn des Firmengründers, einmal das Selbstverständnis einer gesamten Branche zusammen: »Handel ohne Unabhängigkeit hört auf, Handel zu sein.« Dem jungen Abteilungsleiter seines Vaters muss diese Einstellung ein Vorbild gewesen sein. Jedenfalls richtete sich Ernst Komrowski danach, und zwar viel schneller und wörtlicher, als es Coutinho lieb gewesen sein dürfte. Er suchte das »eigenständige Wagnis«, die eigene Verantwortung, und natürlich vor allem den eigenen Erfolg: Komrowski wollte unabhängig sein. Während seiner Lehrzeit hatte er Carl Dobbertin kennengelernt, einen nahezu gleichaltrigen, gleich ehrgeizigen Kollegen. Diese beiden jungen Männer arbeiteten so eng und so erfolgreich zusammen, dass sie schnell überzeugt waren, auf eigene Rechnung noch weit besser vorankommen zu können. Folglich verließen sie gemeinsam Coutinho Caro, wurden Partner und gründeten ein eigenes Unternehmen. Am 24. November 1912 wurde es als »Dobbertin & Co« ins Handelsregister eingetragen. Ernst Komrowski, 23 Jahre alt, hatte damit den nächsten Schritt geschafft: Er war selbstständiger Unternehmer.
Sein ehemaliger Arbeitgeber war nicht amüsiert über die kurzfristige Kündigung seiner geschäftlichen Zukunftshoffnung. Darüber hinaus nahm Coutinho die Konkurrenz, die ihm von diesem jungen Mann drohte, offensichtlich sehr ernst. Um Komrowski so schnell freizugeben, bestand er auf einem restriktiven Passus im Auflösungsvertrag: »Herr Komrowski ist für das Jahr 1913 dem im Vertrage von 1911 vorgesehenen Konkurrenzverbot unterworfen, ohne dass eine Gehaltszahlung von seiten der Firma Coutinho & Co infrage kommt. Dieses Konkurrenzverbot wird für die ersten drei Monate des Jahres 1913 dahin erweitert, dass sich Herr Komrowski während dieser Zeit in keiner Weise geschäftlich betätigen und sich während des Januar auch nicht in Hamburg oder in einem Umkreis von 25 Kilometern um Hamburg aufhalten darf. Falls Herr Komrowski während des ersten Vierteljahres 1913 seine vorstehend festgestellten Verpflichtungen getreulich erfüllt hat, ist er mit dem 1. April 1913 von dem Konkurrenzverbot befreit.«
Aufbruch im Wirtschaftswunderland
Verbannung auf Zeit – auch das ein Spiegel dieser Epoche mit ihrer noch sehr eingeschränkten Kommunikation: Wer so weit aus dem Weg war, konnte in Hamburg keine heimlichen Geschäfte machen. So einfach war das damals. Wenn die Selbstständigkeit für Ernst Komrowski auch mit diesem Zwangsexil begann, einen besseren Zeitpunkt für ihr Start-up hätten sich die beiden jungen Männer kaum aussuchen können. Hamburg boomte, und mit seiner größten Hafenstadt schwelgte das ganze Deutsche Reich in einem Wachstums- und Erfolgsrausch, der keine Grenzen zu kennen schien. In den nur gut 40 Jahren seit der Reichsgründung 1871 war das wilhelminische Deutschland wie ein Komet zur führenden Wirtschaftsmacht des Kontinents aufgestiegen. Es war das Zeitalter der großen Selfmademen, und der bedeutendste von ihnen war nicht nur in Hamburg geboren, sondern hatte dort auch seine einmalige Karriere gemacht: Albert Ballin, einer der ersten Topmanager der deutschen Wirtschaftsgeschichte und bis heute einer der erfolgreichsten. Er war eine Generation älter als Komrowski und Dobbertin und hatte es mit nichts als Genie, unbegrenztem persönlichem Engagement und brennendem Ehrgeiz vom dreizehnten Kind eines kleinen jüdischen Passageagenten aus dem Hafenviertel zum international respektierten »Souverän der Seefahrt« gebracht, zum autokratischen Generaldirektor der Hapag. Unter seiner Führung war sie zum größten Schifffahrtsunternehmen der Welt aufgestiegen.
Ballins beispiellose Karriere wirkte auf ehrgeizige junge Männer wie Komrowski wie ein Signal: War der eigene Einsatz groß genug, war an der Elbe alles möglich und nichts unerreichbar. Von schier grenzenlosen Chancen zeugten auch die Aufstiege von Hamburgs größten Industrieunternehmen, der Werft von Blohm & Voss oder Paul Beiersdorf & Co, auch sie von Selfmademen gegründet und binnen weniger Jahre an die Weltspitze geführt. Unzählige Außenhändler waren an der Elbe zu Hause, dazu bedeutende Reedereien. Die Schiffe der Hamburg-Süd oder der Woermann-Linie waren ebenso weltbekannt wie die legendären »Hamburger Veermaster« der Segelschiffreederei Laeisz. Die Hapag war »nur« das bedeutendste der vielen florierenden Unternehmen und Handelshäuser, denen Hamburg nicht nur seinen Ruf als »des Deutschen Reiches Tor zur Welt« und den nie dagewesenen Aufschwung verdankte, sondern auch ein ganz neues Stadtbild: Überall in der City wurde gebaut, und die Gebäude dieser Epoche prägen Hamburg bis heute. Mönckebergstraße, Hauptbahnhof und Elbtunnel kündeten ebenso wie das neue Rathaus von Wohlstand und Weltverkehr, rund um die Binnenalster wuchs anstelle eines eher verträumten Gartenareals ein neues Zentrum um das Hapag-Haus. Die erste U-Bahn-Ringlinie, 1912 eröffnet, verband die Innenstadt mit dem Hafen und dem Arbeitervorort Barmbek. Sie war nicht nur ein technischer, sondern auch ein sozialer Fortschritt: Gängeviertel, dicht bevölkerte Slums in fußläufiger Hafennähe, waren nun nicht mehr notwendig. Die Arbeiter konnten Hafen und Werften jetzt auch von gesünderen, weniger dicht bebauten Vororten aus bequem mit dem neuen öffentlichen Verkehrsmittel erreichen.
Dank ihres kommerziellen Erfolges und ihrer Rolle im Weltverkehr sonnte sich die Elbmetropole auch noch in allerhöchster Gnade. Wilhelm II., deutscher Kaiser, König von Preußen und seines Reiches ranghöchster »shiplover«, kam seit der Jahrhundertwende immer öfter und immer lieber nach Hamburg. Kaiserliche Gnade, das wussten die kühl kalkulierenden Hanseaten ganz genau, vermochte die Geschäfte auf das Erfreulichste zu beleben. So investierte man ganz gezielt Millionen in eine kostspielige Goodwill-Kampagne, schmeichelte dem eitlen Monarchen mit Denkmalsenthüllungen und maritimen Großereignissen aller Art und schuf damit, was man heute als beste Rahmenbedingungen für die Hamburger Wirtschaft bezeichnen würde. Während einer Unterelb-Regatta sprach Wilhelm II. denn auch endlich die Worte, auf die die Hanseaten so sehr gehofft, für die sie so viel investiert hatten: »Deutschlands Zukunft liegt auf dem Wasser!«
Wieder unbegrenzte Möglichkeiten: Neben Ballin, der sogar als Freund Seiner Majestät galt, war es vor allem der Erste Bürgermeister der Stadt, Johann Heinrich Burchard, genannt der »königliche Bürgermeister«, der geschickt und erfolgreich um allerhöchste Sympathien warb. Mit seiner Vorliebe für Prunk, Pracht und pathetische Reden wurde er nicht nur die Galionsfigur seiner florierenden Stadt, sondern die Verkörperung des hanseatisch-wilhelminischen Zeitgeistes. Die Hamburger waren derart stolz auf diesen ebenso dekorativen wie aristokratischen Republikaner, dass sie noch zehn Jahre später, in einer nüchtern gewordenen Welt, zentrale Orte des neuen Kontorhausviertels nach ihm benannten: Burchardstraße und Burchardplatz. Ein Enkel des königlichen Bürgermeisters übrigens, Dr. Harald. P. Burchard, wurde später Mitinhaber von Ernst Komrowski & Co.
Im Komrowski-Gründungsjahr 1912 erlebte Hamburg das bis dahin größte Open-Air-Spektakel seiner Geschichte, eine Feier, in der sich wie in einem Prisma die Bedeutung der Stadt und die Verflechtung von Wirtschaft, Weltverkehr und Politik, von Unternehmens- und Zeitgeschichte widerspiegelten. Am 23. Mai lief auf der Hamburger Vulkan-Werft das größte Schiff der Welt vom Stapel, ein Hapag-Luxusliner von über 277 Metern Länge und mehr als 52000 BRT. Das sind die Maße eines modernen Containerschiffes – unvorstellbar und faszinierend für die rekordverliebten Zeitgenossen von 1912. Dieses Schiff war, im Gegensatz zum allgemeinen Brauch, männlich: Eigentlich hatte der diplomatische Hapag-Chef Ballin die Herausforderung, die dieses Schiff gewordene Auftrumpfen mit einem gewaltigen, aggressiven Bronzeadler am Bug darstellte, mit dem verbindenden Namen »Europa« abmildern wollen. Doch der Taufpate, Kaiser Wilhelm II., hatte auf dem Namen »Imperator«, »der Herrscher«, bestanden. Aus Bürgermeister Burchards Rede klangen denn auch Selbstverständnis und Selbstbewusstsein dieser Epoche: »Schon jetzt ist es ein Triumph deutscher Schiffbaukunst, zukunftsfroher Machtstellung auf allen befahrenen Meeren. Vor allem aber stellt es sich dar als eine Schöpfung hochkultivierter Friedenszeit des unter der Kaisermacht blühenden selbstbewußten Bürgertums.«
Doch, und auch das ist typisch für das ungewöhnliche Jahr, in dem Ernst Komrowski den Aufbruch wagte und in dem eine Epoche kulminierte: auf allen Glanz senkten sich erstmals schwere Schatten, die strahlende Oberfläche bekam Risse. Im Nordatlantik ging im April die »Titanic« unter und riss wie ein Menetekel den unbegrenzten Fortschritts- und Technikglauben mit sich. In Hamburg starb im September plötzlich und unerwartet Johann Heinrich Burchard, erst 60 Jahre alt, an einer scheinbar simplen Grippe. Mit ihrem königlichen Bürgermeister trug die Stadt, ohne es zu ahnen, schon ihre »gute alte Zeit« zu Grabe, den Stolz, den Optimismus und auch den bürgerlichen Glamour, die er wie kein zweiter Hamburger verkörpert hatte.
In Wirklichkeit sah die Zukunft eher düster aus. In Europa rüsteten inzwischen zwei Allianzen um die Wette, und einer, der die Gefahr daraus besonders deutlich erkannte, war Hapag-Direktor Albert Ballin. Seit 1908 hatte der Hamburger mit den glänzenden internationalen Kontakten daher diskret hinter den Kulissen zu vermitteln versucht. Er fürchtete den »großen Krieg«, von dem in Europa immer häufiger, immer leichtfertiger gesprochen wurde, so, als sei er ein unabwendbares und eigentlich begrüßenswertes Naturereignis. Ganz im Gegensatz zu vielen deutschen Politikern und Militärs hielt Ballin einen solchen Krieg jedoch nicht für den Weg zur Weltmacht, sondern für den in die Katastrophe. Der Hapag-Chef war durch und durch vernünftig und pragmatisch, Hamburger und Geschäftsmann gleichermaßen, und damit dem uralten Hanseatenmotto verbunden: »Lasset uns tagen, denn schnell ist das Fähnlein an die Stange gebunden – aber es kostet viel, es in Ehren wieder abzunehmen.« Ballin sah, im Gegensatz zur offiziellen deutschen Politik, nicht Säbelrasseln, sondern Abrüstung und Verständigung als wichtigste Aufgaben des neuen Jahrhunderts, und da setzte er voll auf das hanseatische »Lasset uns tagen«, auf internationale Verhandlungen. So versuchte der »Freund des Kaisers« immer wieder, sie hinter den Kulissen in Gang zu bringen. Vergeblich.
Solche Unterströmungen blieben der Öffentlichkeit 1912 noch weitgehend verborgen. Noch herrschten naiver Optimismus und weit verbreitete Zuversicht, eine Zeitstimmung, die Deutschland seitdem nie wieder erlebt hat, wohl auch nie wieder erleben kann, und die ganz sicher auch die Existenzgründer Komrowski und Dobbertin beflügelt hat. Ihr erstes Büro lag in der Spitaler Straße 16, in der heute noch existierenden Seeburg, einem Kontorhaus, das zusammen mit der Mönckebergstraße 1909 ebenfalls auf dem Gelände eines Gängeviertels gebaut worden war. Dobbertin, mit einer Belgierin verheiratet, hatte von der Familie seiner Frau Fina ein Startkapital für das eigene Unternehmen zur Verfügung gestellt bekommen. Das machte den Sprung in die Selbstständigkeit leichter, doch den größten Aktivposten des jungen Hauses bedeuteten der Elan seiner Inhaber und deren gute Kontakte aus der Lehrzeit. Verbindungen waren – und sind – das Wichtigste für ein Handelshaus. Da hatte Dobbertin & Co einen Aktivposten aufzuweisen, der kaum mit Geld zu bezahlen war: Die beiden Unternehmensgründer verfügten über gute direkte Kontakte zu den Hüttenwerken der Gebrüder Stumm.
Die rasche Industrialisierung und nicht zuletzt der forcierte deutsche Flottenbau, für den sie die Panzerplatten lieferten, hatten die Stumm-Dynastie zu »Königen« des Saarlandes aufsteigen lassen. Ihr Unternehmen, so dessen offizieller Biograf Fritz Hellwig, »zeigte
Ein mächtiger Partner: Gute Geschäftskontakte zu den »Königen des Saarlandes«, der marktbeherrschenden Stumm-Dynastie, waren zunächst der wichtigste Aktivposten von Komrowski und Dobbertin. Die Neunkirchener Eisenwerke produzierten Stab- und Fassoneisen, Schienen und Draht, die die Hamburger vermarkteten.
große Ähnlichkeit mit den Trustbildungen amerikanischen Stils. Die drei Stummschen Werke in Neunkirchen, Dillingen und Brebach waren sämtlich sogenannte gemischte Werke, das heißt, sie umfaßten den Eisenproduktionsprozeß von den Rohmaterialien Erz und Kohle bis zum Fertigprodukt. Dagegen waren sie in der Art ihrer Fertigerzeugnisse streng spezialisiert: Das Neunkircher Eisenwerk stellte Stab- und Fassoneisen, Schienen und Draht her, die Dillinger Hütte Bleche, Platten und Panzerplatten, die Halberger Hütte endlich Gußwaren I. und II. Schmelzung, besonders Röhren. So machten sich die drei Werke untereinander keine Konkurrenz, während sie doch zugleich miteinander den Markt mit allen Fertigprodukten beherrschen konnten.«
Einen freien Stahlhandel gab es vor dem Ersten Weltkrieg nicht. Sämtliche deutschen Roheisen- und Stahlproduzenten waren in einem Syndikat, dem 1903 gegründeten Stahlwerksverband, zusammengeschlossen, der sowohl Preise als auch Quoten für jedes Werk festlegte. Er bezog die Erzeugnisse zu Verrechnungspreisen von seinen Mitgliedern und setzte sie zu Verkaufspreisen ab, die der Verbandsvorstand festsetzte. Alle Erzeugnisse wurden in A- und B-Produkte unterteilt. Als A-Produkte galten laut Vereinssatzung der »Rohstahl, welcher für Halbzeug, Eisenbahn-Oberbaumaterial sowie Formeisen Verwendung findet«, während B-Produkte »denjenigen Rohstahl, welcher zu Stabeisen, Walzdraht, Grobblechen, Feinblechen, Riffelblechen, Röhren, Eisenbahnachsen, Rädern, Radreifen, Schmiedestücken, Stahlgußstücken und Stahlwalzen Verwendung findet« umfassten.
Von der Brieftaube zum Fernsprecher: Kommunikation ist alles
Dobbertin & Co begann als reines Handelsunternehmen, Dienstleistungen wurden noch nicht angeboten. Damals wie heute waren zwar vor allem die persönlichen Kontakte lebenswichtig, doch Handel profitiert auch immer von möglichst schneller und zuverlässiger weltweiter Kommunikation. 1912 waren auch da die Möglichkeiten vielversprechend wie nie zuvor. Der wirtschaftliche Aufschwung Anfang des 20. Jahrhunderts war die Folge einer ersten Globalisierung gewesen, die um 1850 mit der industriellen Revolution begonnen hatte. Der technische Fortschritt hatte den Verkehr beschleunigt, die Kommunikation erleichtert. Die Welt war erstmals näher zusammengerückt und stand der Wirtschaft buchstäblich offen. Das brachte zwar 1857 und 1873 die ersten schweren Weltwirtschaftskrisen mit sich, und auch 1908 war ein Rezessionsjahr gewesen, doch alles in allem waren die Verbindungen und Chancen zum ersten Mal so etwas wie grenzenlos – wenn man sie denn nutzen konnte.
Komrowski und Dobbertin standen dafür ganz neue Technologien zur Verfügung. Waren frühere Kaufmannsgenerationen noch auf Pferde-, Segelschiffs- und später Eisenbahntempo angewiesen, waren Brieftaube oder Nachrichten per Telegrafenstationen die schnellste erreichbare Verbindung gewesen, war die Geschäftswelt inzwischen längst auf Draht. Buchstäblich: Es gab schnelle, wenn auch teure Telegramme, die für den Handel meist codiert wurden, einmal, um Geld zu sparen, zum anderen, um Betriebsspionage zu verhindern. So gehörte ein dickes Codebuch zur Grundausstattung im Büro eines jeden Handelshauses. Mehr noch: 1912 konnte ein Kaufmann relativ schnell und direkt Kontakt zu seinen Geschäftspartnern aufnehmen, sogar wenn die weiter entfernt waren. Seit etwa 30 Jahren gab es das Telefon, das schon Felix Coutinho in seinem Unternehmen erfolgreich eingesetzt hatte und für das 1912 ebenfalls ein Durchbruchsjahr bedeutete. Nachdem die Kabel zunächst oberirdisch verlegt und entsprechend störanfällig gewesen waren, erhielt die Firma Siemens & Halske in diesem Jahr den Auftrag für die Verlegung der ersten unterirdischen Kabelstrecke, des Rheinlandkabels, zunächst auf der Strecke von Berlin nach Hannover. Was so eine Verbindung für den Handel bedeutete, ist kaum zu überschätzen. Doch international war das Telefon immer noch eher unsicher und sehr teuer, und so blieb für die Wirtschaft das codierte Telegramm zunächst weiter Kommunikationsmitel Nummer eins. Telegramm und Telefon waren der Anfang der Entwicklung zu immer schnellerer technischer Kommunikation, zu immer engerer Verbindung, die heute mit dem Internet sicher noch nicht beendet ist.
»Er dachte von morgens bis abends ›in Stahl‹«
Für Ernst Komrowski, jetzt als selbstständiger Kaufmann etabliert, hatte das Leben vor allem einen Sinn: Er wollte etwas leisten und dafür Erfolge sehen. Das hatte er schon früh damit bewiesen, dass er sich nicht damit zufriedengab, ein biederer mittlerer Handwerker zu werden, das war während seiner Lehrzeit deutlich geworden, als ihm ein guter Verdienst nicht reichte, sondern er früh nach Unabhängigkeit strebte. Als Unternehmer war er dann zwangsläufig vor allem am Erfolg orientiert. »Reichtum muss erworben werden«, lautete seine Devise, ein durch und durch bürgerlicher, nahezu puritanischer Wert, und dieses Motto eines Selfmademans verfolgte er konsequent. Neben dieser Zielstrebigkeit besaß Komrowski, und das war eine Gabe, die wohl nicht erlernt werden kann, ein viel bewundertes, oft »phänomenal« genanntes Gespür für Geschäfte, sowohl für deren Chancen als auch für deren Gefahren. Komrowski war inzwischen, wie einer seiner späteren Geschäftspartner anerkennend überlieferte, durch und durch ein »Stahlmann« geworden: »Er dachte von morgens bis abends ›in Stahl‹.« Das war für Dobbertin & Co umso entscheidender, als die Gewinnspanne in dieser Branche nur relativ klein ist. Unbedacht übernommene Risiken können die Existenz einer Firma abrupt beenden. Die Karriere des Inhabers natürlich auch.
Komrowskis Fähigkeit, ganz und gar in seinem Unternehmen aufzugehen, es rückhaltlos zum Lebensinhalt zu machen, war die Grundlage seiner beruflichen Erfolge. Sie wurde verstärkt durch eine traditionelle Einstellung des hanseatischen Kaufmanns, die er kritiklos übernahm und lebte: Das Handelshaus – oder später das Unternehmen – wurde als eine Art Lebewesen betrachtet und behandelt. Es kam immer vor allem und allen anderen. Sein guter Name stand über allem, seinem Wohlergehen hatte sich alles unterzuordnen. Diese Haltung brachte oft den kommerziellen Erfolg, doch sie hatte auch Nachteile und barg vor allem erhebliche Risiken: Die »déformation professionelle« des erfolgreichen Kaufmanns, die Lebenseinstellung, alles nur durch sein und für sein Unternehmen zu sehen und zu beurteilen, konnte sehr schnell betriebsblind machen.
So weit auch viele Hanseaten im Ausland herumgekommen waren, so weltläufig ihre Umgangsformen, so international ihre Kontakte waren, ihr Gesichtsfeld blieb meist erstaunlich, selbstgewollt, beschränkt. Albert Ballin, der Kosmopolit, war in Hamburg eher die Ausnahme als die Regel. Sein Nachfolger Wilhelm Cuno dagegen erwies sich geradezu als Prototyp für selbst gesetzte Grenzen, unglücklicherweise vor allem, als er später Reichskanzler wurde. »So angenehm der persönliche Verkehr mit ihm war«, staunte Otto Braun, der preußische Ministerpräsident, »so war ich doch oft erschreckt über seine fast kindliche Naivität und Ratlosigkeit, mit der er schwierigen politischen Situationen gegenüberstand.« Dabei war der Thüringer Cuno nicht etwa ein geborener Hanseat. Er war vor seiner Hapag-Karriere Geheimer Oberregierungsrat in Berlin gewesen und als diplomatisches Talent hoch gehandelt worden. Wenn selbst er, eigentlich Polit-Profi, so hilflos und weltfremd reagierte, lässt sich der durchschnittliche Hamburger Kaufmann jener Tage leicht vorstellen: Politik interessierte den erst, sobald sie sozusagen vor der Tür stand. Dann nämlich, wenn sie unmittelbare Auswirkungen auf die Geschäfte hatte.
Männer wie Ballin, die immer auch über den engen Rahmen hinaussahen, Hanseaten, die wussten, wie untrennbar Wirtschaft und Politik längst weltweit verflochten waren, denen klar war, dass auch das heimische Kontor kein Reservat mehr sein konnte, blieben noch lange Exoten. Die Regel war die von den Urvätern übernommene Devise: Gut ist, was dem Unternehmen nützt, alles andere ist Nebensache und wird am besten ignoriert. Mit der jeweiligen Obrigkeit arrangiert man sich, solange die Geschäfte nicht leiden. Ansonsten gilt: Augen zu und durch, und dabei möglichst unter sich bleiben. Komrowski verhielt sich da ganz typisch: Er war und blieb ein sehr vorsichtiger, außerhalb seiner beruflichen Sphäre äußerst zurückhaltender Mann, der immer versuchte, sich möglichst unauffällig und reibungslos auf die herrschenden Verhältnisse einzustellen. Das traditionelle hanseatische Verantwortungsbewusstsein galt zuerst und zuletzt dem eigenen Haus, darüber hinaus höchstens noch der eigenen Stadt. Das war eine Haltung, die sich über Jahrhunderte derart bewährt hatte, dass sie den erfolgreichen Kaufleuten quasi in die DNS überging: Woher sie auch ursprünglich stammten, sobald sie in Ham-
Tafelsilber zum Hundertsten: Ernst Komrowski überreicht ein Präsent für den Silberschatz des Senats an Bürgermeister Max Brauer. Genau hundert Jahre zuvor hat sein Urgroßvater den Hamburger Bürgereid geleistet. Doch auch als buchstäblich eingeschworene Hanseaten vergaßen die Komrowskis ihre östlichen Wurzeln nie.
burg etabliert waren, verhielten sie sich entsprechend. Als mit dem Kaiserreich auch der als Sicherheit empfundene Rahmen des Obrigkeitsstaates zerbrochen war, sollte diese kollektive Selbstbeschränkung fatale Konsequenzen haben.
Nicht nur politisch, auch privat konnte die absolute Konzentration auf den Beruf zuweilen Nachteile haben. Ernst Komrowski war in erster Linie mit seinem Unternehmen verheiratet, sein Privatleben blieb zeitlebens eher eingeschränkt. Er heiratete 1914 die 22-jährige Lehrerin Else Bastian, die Tochter eines Hamburger Konstabels. Komrowski besaß zwar auf der einen Seite einen ausgeprägten Familiensinn, betrachtete aber andererseits auch diese Familie in erster Linie als Hintergrund und Basis für seinen Beruf. So beschäftigte er sich auch daheim vorwiegend mit seinem Unternehmen. Hobbys lenkten ihn nicht ab, vom gelegentlichen Reiten und der Lektüre historischer Bücher einmal abgesehen. Auch sein Hobby hieß Dobbertin & Co. Gesellschaftliche Ambitionen hatte er, im Gegensatz zu seiner Frau und ganz anders als Dobbertin, keine. Im Gegenteil: Komrowski war, wie man heute sagen würde, äußerst publicityscheu, nie auf Außenwirkung bedacht und trat möglichst nicht hervor. Die für jedes erfolgreiche Unternehmen unerlässliche Repräsentation überließ er nur zu gern seinem geselligen Kompagnon, privat zog er sich nach Feierabend völlig zurück. So blieben seine ganze Zeit und Kraft für die Arbeit reserviert. Das machte ihn so erfolgreich, doch die spröde Zurückgezogenheit, beinahe Einsamkeit, die ihn schon früh umgab, war darüber hinaus auch ein Grundzug seines Charakters. Im Laufe der Jahre, unter wachsendem Druck, verstärkte sich seine Verschlossenheit immer mehr. Das dürfte einer der Gründe gewesen sein, an denen seine Ehe nach mehr als 30 Jahren schließlich zerbrach.
»Dummheit, die explodiert«: Europa zieht in den Krieg
Am Anfang aber passte alles: Die Rahmenbedingungen waren glänzend, die so unterschiedlichen Partner Dobbertin und Komrowski ergänzten einander bestens, und entsprechend vielversprechend war ihr Start. Doch das Unternehmen war noch keine zwei Jahre alt, als Europa von der »Urkatastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts« überrollt wurde, vom Ersten Weltkrieg. »Dummheit, die explodiert«, urteilte Albert Ballin von Anfang an. Eine fatale Kombination aus säbelrasselnder Leichtfertigkeit und dem Automatismus von militärischen Bündnissen hatte ermöglicht, dass ein eskalierter Regionalkonflikt den Kontinent im Sommer 1914 in die blutige, sinnlose Selbstzerstörung riss. Es war, wie der britische Militärhistoriker John Keegan gut achtzig Jahre später bilanzierte, »ein tragischer und unnötiger Konflikt. Er war unnötig, weil die Kette der Ereignisse, die zu seinem Ausbruch führte, während der fünfwöchigen Krise, die dem ersten bewaffneten Zusammenstoß vorausging, noch jederzeit hätte unterbrochen werden können. Er war tragisch, weil er den Tod von zehn Millionen Menschen zur Folge hatte, die Gefühle von weiteren Millionen verletzte, die liberale und optimistische Kultur des europäischen Kontinents zerstörte
und so starke politische und rassistische Hassgefühle hinterließ, dass die Ursachen des Zweiten Weltkrieges ohne diese Wurzeln nicht zu verstehen sind.« Ballin, der von Hamburg aus jahrelang vergeblich versucht hatte, genau diese Katastrophe abzuwenden, konnte es nur noch resigniert auf den Punkt bringen: »Der dümmste und blutigste Krieg, den die Weltgeschichte gesehen hat.« Doch er war wieder die absolute Ausnahme. In Hamburg, in ganz Deutschland rissen die »patriotischen Kundgebungen« nicht ab. Überall drängten sich jubelnde Menschenmassen auf den Straßen und Plätzen und skandierten immer wieder: »Wir wollen in den Krieg!« Es eile, so die allgemeine Annahme, schließlich werde der glorreiche Feldzug spätestens bis Weihnachten siegreich beendet sein.
Doch es kam anders. Als der Krieg sich hinzog, als die Front in mörderischen Materialschlachten erstarrte, wurden immer mehr Männer eingezogen. 1916 war auch Komrowski an der Reihe, doch er hatte erstaunliches Glück – oder, was wahrscheinlicher ist, allerbeste Beziehungen: Der 1,81 Meter große, kerngesunde Siebenundzwanzigjährige musste nicht an die Front. Stattdessen wurde er einer Sanitätskompanie in Oldenburg zugeteilt und dort zum Sanitätshundeführer ausgebildet. Das war nicht nur eine gute Chance, zu überleben, es war auch, ausgerechnet im ersten Hightechkrieg, eine neuartige Waffengattung. Seit 1900 hatten alle europäischen Streitkräfte Hundesoldaten ausgebildet, bei Kriegsausbruch 1914 verfügte allein die deutsche Armee über 6000 geschulte Tiere. Sie wurden vor allem als Sanitäts- und Meldehunde im tödlichen Niemandsland der Westfront eingesetzt, und das so erfolgreich, dass Deutschland auch in Belgien und Frankreich alle tauglichen Hunde beschlagnahmte und zur Ausbildung heim ins Reich schickte. Sanitätshundeführer Komrowski arbeitete deshalb zeitweise als auch Hundefänger in einer, wie es offiziell hieß, Fangschleuse im besetzten Frankreich. Der Umgang mit den Vierbeinern muss ihm gelegen haben, denn seine Affinität zu Hunden blieb zeitlebens bestehen. Im Zivilleben allerdings umgab er sich am liebsten mit einer Rasse, die es vorzieht, sich jedem Drill standhaft zu entziehen: Ernst Komrowski liebte Dackel.
Im Frühjahr 1917 dann war die Schonzeit vorbei, und Komrowski wurde mitsamt seinen vierbeinigen Schützlingen an die Front abkommandiert. Das ganze Jahr über war er in den Schlachten bei Arras, im ganzen Artois und in der zweiten großen Flandernschlacht eingesetzt, einem hochtechnisierten Gemetzel bis dahin unvorstellbaren Ausmaßes, in dem gut eine halbe Million junger Europäer, vor allem Deutsche und Briten, sinnlos sterben mussten. Der Hamburger hatte auch hier wieder Glück: Er überlebte das Massaker unverletzt und wurde im November 1917 »im heereswirtschaftlichen Interesse 6 Wochen zur Firma ›Dobbertin & Co‹, Hamburg beurlaubt.«
Das Schicksal dieser Firma hatte bis dahin in den Händen zweier junger Frauen gelegen. Erfahrene ältere Angestellte, die die eingezogenen Inhaber hätten vertreten können, hatte es in dem jungen Unternehmen noch nicht gegeben. Nachdem Ernst und Else Komrowski im Oktober 1914 geheiratet hatten, waren die Führungsaufgaben an die beiden Ehefrauen der Inhaber gefallen. Frauen, die eine derartige Verantwortung trugen, Frauen als Unternehmer – so etwas war im wilhelminischen Kaiserreich bis dahin undenkbar gewesen. Doch die Stellvertreterinnen setzten sich durch. Fina Dobbertins Familie hatte in Belgien eine Reinigungsfirma besessen, so waren ihr die Anforderungen eines, wenn auch sehr viel kleineren, Unternehmens durchaus vertraut. Else Komrowski war als Lehrerin mit besten Zeugnissen für eine Frau ihrer Zeit überdurchschnittlich gebildet und zudem ein geborenes Organisationstalent. Vor allem aber waren beide sehr ehrgeizig, engagiert wie ihre Ehemänner und willens, Dobbertin & Co auf jeden Fall zu erhalten.
Ihr Startvorteil: Es ging nicht mehr um große Geschäfte, sondern in erster Linie darum, präsent zu sein, einmal angeknüpfte Verbindungen nicht jäh abreißen zu lassen. Dass den beiden das gelang, war ein unschätzbarer Aktivposten in einer Branche, in der persönliche Kontakte so viel bedeuten. Ernst Komrowski war auch nicht unerreichbar. Er kam nicht wieder an die Front, sondern wurde zunächst einer Husareneskadron in Oldenburg und später dem Ersatzbataillon des traditionsreichen 76. Infanterieregiments in Hamburg zugeteilt. Seine Aufgaben entsprachen auf makabre Weise dem Kriegsverlauf: Nun bildete er die Tiere aus, für die ein immer größerer Bedarf bestand, Blindenhunde für die Opfer des großen Gemetzels.
Eine Welt zerbricht, ein Unternehmen überlebt
Im Herbst 1918 dann war alles vorbei. Am Mittag des 9. November rief der sozialdemokratische Staatssekretär Philipp Scheidemann aus einem Fenster des Berliner Reichstages die »deutsche Republik« aus. Wilhelm II. hatte sich eilends ins neutrale Holland abgesetzt. Um diese historische Stunde starb in Hamburg Hapag-Generaldirektor Albert Ballin. Er konnte und wollte die Katastrophe, vor der er so lange gewarnt hatte, nicht überleben. Zwei Tage später, am 11. November, war der Krieg endlich vorbei und für das Deutsche Reich verloren. Komrowski und Dobbertin gehörten zu den Glücklichen im großen Unglück. Sie waren nicht nur dem Massaker entkommen, sogar ihr Unternehmen bestand noch, und sie konnten die Geschäfte sofort wieder aufnehmen. Das verlieh ihnen vielen Konkurrenten gegenüber einen deutlichen Startvorsprung. Und doch: Es war ein Neuanfang, denn die Welt hatte sich völlig verändert. Eine Epoche war untergegangen, das deutsche Wirtschaftswunder ebenso geplatzt wie alles andere, alle Auslandskontakte schienen dahin. Die Zukunft lag nicht mehr auf dem Wasser, im von Hunger und Unruhen erschütterten Hamburg lautete die Frage eher, ob es überhaupt noch eine gab. Die ganze deutsche Rundum-Misere wurde nicht etwa den Verantwortlichen, der militärischen und politischen Elite des Kaiserreiches, angerechnet, sondern stattdessen deren hilflosen Konkursverwaltern. Die neue Republik von Weimar, von Rechten und Linken gleichermaßen bekämpft, war von Anfang an eine Republik ohne Republikaner.
Doch inmitten von Depression und Desaster gab es einige wenige Deutsche, die von der chaotischen Situation profitieren konnten. Darunter waren die Außenhandelsunternehmen, denen es eben doch gelang, ihre alten Verbindungen schnell wieder anzuknüpfen, weil sie über alle politische Feindschaft hinweg auf persönlichen Grundlagen beruht hatten und sie sie auch über die Kriegszeit so gut wie möglich gehalten hatten, so, wie es Dobbertin & Co gelungen war. Wer doch noch bewährte, weiterhin kooperative ausländische Geschäftspartner hatte, verfügte jetzt über einen Riesenvorteil. Dank ihres engagierten Ehefrauen-Teams und sicher auch dank der belgischen Wurzeln von Fina Dobbertin war das Unternehmen jetzt tatsächlich nicht ganz von den internationalen Märkten abgeschnitten, und mehr noch: Die immer schwächer werdende Reichsmark eröffnete ihm sogar Chancen. Das Handelshaus erwarb von Werken im Inland Waren, die mit der schwachen deutschen Währung bezahlt wurden, und verkaufte sie dann gegen harte Währung, Dollar oder Pfund Sterling, ins Ausland. Ganz besonders die Eisenhandelsfirmen hatten hier große Möglichkeiten, und Dobbertin & Co war eines der Häuser, die, sofort wieder zur Stelle, diese Möglichkeiten auch zu nutzen wussten. So brachte dem Unternehmen das große Unglück am Ende Glück, denn der Neuanfang nach dem Krieg erwies sich als der eigentliche Start, zumindest als Aufbruch in eine neue geschäftliche Dimension. Dobbertin & Co reüssierte jetzt schnell, und das wurde bald auch nach außen hin deutlich.
Nachkriegs-Neustart: 1922 trägt das Unternehmen offiziell auch den vollen Namen von Ernst Komrowski. Die Partner haben eine GmbH gegründet und informieren, wie bis heute üblich, ihre Geschäftspartner. Auffallend: Komrowski ist schon eine derart gefestigte Persönlichkeit, dass sich seine Signatur bis ins hohe Alter nicht mehr im Geringsten verändern wird.
Ernst und Else Komrowski, die zunächst in der Sievekingsallee gelebt hatten, bezogen 1922 ein repräsentatives neues Haus im Schlebuschweg 17 in Bergedorf. 1918 war ihr Sohn Ernst Günter geboren worden, 1923 folgte die Tochter Renate.
In diesem Inflationsjahr 1923 wurde der Erfolg von Dobbertin & Co auch in der Hamburger City unübersehbar, als die Aufsteiger den zentral und exponiert gelegenen Bauplatz am Kattrepel erwarben. Wie das ganze Kontorhausviertel war es nicht irgendein Bauplatz in günstiger Hafennähe. Sich hier anzusiedeln, bedeutete, Stadtgeschichte zu schreiben, stand für größtmögliche Kontraste auf engstem Raum. Ein stärkerer Gegensatz als der zwischen Vergangenheit und Zukunft dieses Viertels im Herzen von Hamburg war kaum denkbar: »Ich vergesse, dass ich mich in Europa befinde« – so erschüttert hatte der berühmte Arzt Robert Koch erst dreißig Jahre zuvor auf das soziale und hygienische Elend des kaiserlichen Hamburg reagiert, das sich an diesem Ort, in den berüchtigten Gängevierteln, geballt hatte. Dort, wo zwei Jahre nach Ernst Komrowskis Geburt eine verheerende Cholera-Epidemie ihren Anfang genommen hatte, sollte nun »solide und vornehm« gebaut werden. So heißt es jedenfalls in dem Entwurf, den das Hamburger Architekturbüro Distel und Grubitz den beiden Bauherren im März 1923 vorlegte. »Montanhof« sollte ihr repräsentatives großes Kontorhaus heißen und »vom Keller bis zum Dach zehn Geschosse erhalten, mit allen neuzeitlichen Einrichtungen versehen werden.« Auch die Architekten betonten die günstige Lage der neuen Unternehmenszentrale: »In unmittelbarer Nachbarschaft von Hafen und Bahn hat es von allen Bauten dieses Viertels die geringste Entfernung zur Börse.« Der Preis für rund 26500 Kubikmeter umbauten Raumes wurde damals mit M 4240000000 veranschlagt, in Worten: vier Milliarden zweihundertvierzig Millionen Mark.
»Ernst Komrowski Reederei«
Ernst Komrowski konnte die hafennahe Toplage besonders gut nutzen, denn er traf noch eine weitere wichtige Entscheidung. Am Dienstag, dem 13. November 1923 erschien er zusammen mit Dobbertin in einem Notariat in der Großen Bäckerstraße. Die beiden gründeten dort ein weiteres Unternehmen, eine Schifffahrtsgesellschaft: die »Ernst Komrowski Reederei GmbH«. Ihr Stammkapital betrug zwanzig Milliarden Mark. Davon hielt Komrowski die Mehrheit, zehn Milliarden und fünfhundert Millionen. Die Einlagen waren, so das Notariatsprotokoll, »in bar voll zu leisten«. Das dürfte einige Transportprobleme aufgeworfen haben, und als die junge Gesellschaft am 1. Dezember im »Wirtschafts- und Börsenblatt« des »Hamburger Fremdenblatts« angezeigt wurde, hatte die absurde Entwicklung selbst diese Summen schon wieder weit überholt. Auf derselben Zeitungsseite stand der amtliche Tageskurs des Dollar in Berlin – und der betrug inzwischen 4,2 Billionen Mark. Eine Hamburger Giro-Goldmark notierte mit 1000 Milliarden Mark, ein Hamburger Notgeldschein über 84 Goldpfennig kostete 840 Milliarden Mark. Auch politisch herrschte immer noch Dauerkrise. Eben war eine Reichsregierung unter Kanzler Gustav Stresemann gestürzt und eine neue unter Wilhelm Marx gebildet worden. Am 16. November, drei Tage nach der Reedereigründung, war mit der Rentenmark eine neue Währung eingeführt worden. Gleichzeitig wurde die Notenpresse für die Papiermark endlich stillgelegt.
Inmitten dieser ebenso hektischen wie tristen Tage hatte Komrowski seinen entscheidenden Schritt in die Zukunft vollzogen. Die Reederei war von Anfang an sein ureigenes Geschäft, und schon wenige Jahre später, im Juni 1928, übernahm er Dobbertins Anteil, diesmal für realistische 12500 Reichsmark. Ernst Komrowski war nun eigenständiger Reeder, unabhängig vom Handelshaus und doch zu dessen Vorteil. Zum einen wurde Dobbertin & Co unabhängiger vom Frachtenmarkt und konnte deshalb vorteilhafter disponieren und kalkulieren. Zum anderen konnten die Partner ihren Kunden jetzt auch erstmals eine Dienstleistung anbieten, nämlich den Transport auf einem eigenen Schiff. Das war der erste Schritt weg vom reinen Handel und hin zum kombinierten Handel- und Serviceangebot der heutigen Unternehmensgruppe. Schon im Februar 1923, noch vor der offiziellen Firmengründung, hatte Ernst Komrowski das erste eigene Schiff bestellt. Der Stumm-Konzern stellte ihm dafür ein Devisendarlehen von 6000 Pfund Sterling zur Verfügung, in der Inflationszeit eine unschätzbare Hilfe. Das war nicht nur Unterstützung für eine zukunftsträchtige Geschäftsverbindung, sondern auch eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme innerhalb des saarländischen Konzerns: Komrowski, das war die Bedingung für den Kredit, musste das Schiff auf der Werft von J. Frerichs & Co AG in Einswarden an der Weser bauen lassen. Sie gehörte zum Stumm-Imperium.
Anfang Juli 1923 hatten Tausende von Hanseaten am Hafen gestanden, um erstmals seit Kriegsende wieder ein neues großes Passagierschiff zu feiern. Nachdem sie im Vorjahr stumm der letzten Ausreise des »Imperator« zugesehen hatten, der den Briten zugesprochen worden war und fortan als »Berengaria« für Cunard fuhr, wollten sie nun dem neuen Hapag-Flaggschiff eine gute Jungfernreise wünschen. Mit 191 Metern Länge und gut 20000 BRT war die »Albert Ballin« zwar nur halb so groß wie die Luxusliner der Vorkriegszeit, doch zwischen Hamburg und New York verkehrte endlich wieder ein neues, großes Passagierschiff unter Hamburger Flagge. Mit dieser schönen und bald auch wieder berühmten Hamburgerin konnte sich Ernst Komrowskis Neubau nicht messen, wenn er auch, auf seine bescheidene Weise, genauso ein Symbol für Hoffnung und Zuversicht in schwierigen Zeiten war. Das neue Fracht-Motorschiff, ausgeliefert zum Reedereistart im November 1923, bekam – natürlich! – den Namen »Montan«.
Mit 30 Metern Länge, 189 BRT und 244 Ladetonnen, tons deadweight, abgekürzt tdw, war das erste Komrowski-Schiff mit diesem Namen ein völlig unspektakulärer kleiner Frachter. Er wies aber eine entscheidende Neuerung auf: Komrowski hatte die »Montan« als eines der ersten Schiffe dieses Typs mit einem klappbaren Mast versehen lassen, damit sie problemlos den Niederrhein mit seinen vielen Brücken passieren konnte. Zusätzlich hatte der Frachter besonders große Luken und war so in der Lage, Langeisen direkt von den Hütten abzunehmen und an die Empfänger zu liefern. Komrowski hatte sich, auch darin vielen Konkurrenten voraus, gleich für ein modernes Motorschiff entschieden. Die »Montan« wurde also nicht mehr, wie die meisten älteren Frachtdampfer, mit Kohlenfeuerung angetrieben, sondern mit Diesel, was an Bord eine erhebliche Arbeitsersparnis bedeutete. Sie fuhr von Hamburg und Rotterdam rheinaufwärts bis Köln. Dorthin beförderte sie meist landwirtschaftliche Produkte, zurück Stahl und Eisen von Rhein und Ruhr.
Ein kleines, mit 189 BRT fast schon winziges Schiff, aber ein großer Schritt: Mit der ersten »Montan«, die im November 1923 in Hamburg registriert wurde, begann die hundertjährige Geschichte der Komrowski-Reederei.
Doch sehr schnell zeigte sich, dass dieses Schiff zu klein war, um gewinnbringend zu fahren. So verkaufte Komrowski die »Montan« schon im Juli 1925 nach Norwegen. Zuvor hatte er, wieder auf der Frerichswerft, zwei Neubauten geordert, die im Januar und Oktober 1924 vom Stapel liefen: die Rhein-See-Frachter »Mangan« und »Methan«. Mit je gut 50 Metern Länge, mehr als 470 BRT und 700 tdw übertrafen sie die »Montan« erheblich und bewährten sich als Prototypen von Komrowskis Rhein-See-Flotte. Die »Mangan« wurde erst nach 14 Jahren verkauft, während die »Methan« so etwas wie einen Unternehmensrekord aufstellte: Sie blieb, mehrfach modernisiert, bis 1957, also 33 Jahre, unter der blau-weiß-roten Flagge ihrer Reederei. Danach war sie noch bis mindestens 1977 für andere Eigner in Fahrt. 1927 kam noch die 989 BRT große »Vulkan« zur Komrowski-Flotte, die ein Jahr später im Binnenhafen von Brunsbüttel kenterte und sank. Sie konnte aber gehoben und repariert werden.
Die »Vulkan« wird für eine Decksladung vorbereitet. Hoch aufragende Stangen und Drahteinzäunung zur Absicherung zeigen, dass sie zum Beispiel Kokskohle oder Langholz an Bord nehmen soll, Ladungen, die noch bis in die sechziger Jahre auf diese Weise transportiert wurden. Was seine Tücken hatte: 1928 verrutschte eine zu hohe Nutzholzladung der »Vulkan« im Binnenhafen von Brunsbüttel, und das Schiff kenterte und sank am Kai. Es konnte später gehoben werden und fuhr weiter für Komrowski, bis es 1944 vor Norwegen versenkt wurde.
Im Montanhof in die »Goldenen Zwanziger«
Pünktlich zum 1. Oktober 1925 bezog Dobbertin & Co den neuen Montanhof, an dem zu dieser Zeit noch weitergebaut wurde, und war damit für jedermann sichtbar in der ersten Reihe der Hamburger Unternehmen etabliert.
Auch sonst ging es rundum aufwärts: Die Rentenmark war eine stabile Währung geworden, die Inflation endete, die politischen Unruhen flauten ab. Mit diesem »Wunder der Rentenmark« und der Lockerung der Reparationen im Laufe des folgenden Jahres begannen die wenigen Jahre der Weimarer Republik, die als die »Goldenen Zwanziger« in die Geschichte eingehen sollten. Dobbertin & Co florierte. An
»Hamburgs Hochhäuser« als neue Wahrzeichen für Merkurs eigene Stadt: Der expressionistische Montanhof und das ganze Kontorhausviertel verkörpern die Aufbruchsstimmung und Modernität der kurzen »Goldenen Zwanziger« zwischen Inflation und Weltwirtschaftskrise.
den Arbeitsbedingungen und dem Tagesgeschäft in einem Handelshaus hatte sich seit der Kaiserzeit wenig geändert. Adolf Jürgens, der 1925 als Einundzwanzigjähriger in das Unternehmen eingetreten war, erinnerte sich später: »Das waren noch andere Verhältnisse. Es wurde noch acht Stunden täglich gearbeitet, sechs Tage die Woche. Die technischen Einrichtungen waren schwierig. So gab es noch keine Selbstwahl beim Telefon. Jedes Gespräch musste angemeldet werden. Es meldete sich das Amt, wenn man den Hörer aufnahm, man sagte die gewünschte Nummer, zum Beispiel ›Elbe 1904‹ oder ›Hansa 3459‹, wartete einen Augenblick und hatte die Verbindung. Wollte man ein Ferngespräch, meldete man ›Essen 1457‹ an, dann musste man warten, bis das Amt Gesprächsbereitschaft meldete. Das konnte fünf bis zehn Minuten, aber auch ein bis zwei Stunden dauern. Unter diesen Umständen waren Exportgeschäfte schwierig zu bearbeiten, denn es mussten die Telegramme noch am selben Tag herausgehen. Wurde ein Ferngespräch gemeldet, entweder das angemeldete oder als Angerufener, musste man im Büro in eine Zelle gehen, weil die Gespräche meistens schwer zu verstehen waren.«
Zu dieser Zeit war das Unternehmen in mehrere Abteilungen aufgeteilt: Einkaufsabteilung, Stahlwerksprodukte, Blech-, Röhren-, Draht- und Exportabteilung. »Wenn die Preise von den Werken durchgegeben waren«, schilderte Jürgens die tägliche Routine, »begann die Arbeit der Exportabteilung: kalkulieren und die Telegramme fertig machen, das hieß, den Normaltext verschlüsseln, um Gebühren zu sparen. Dafür gab es Codes, zum Beispiel ABC-Code englisch, Mosse-Code deutsch oder selbst gemachte Privatcodes.« Dobbertin & Co war Werksvertreter für das Walzwerk Gebr. Stumm und anerkannter A-Händler, also Direkthändler des Stahlwerksverbandes. Damit konnten die Hamburger, wie vor dem Krieg, Waren direkt ab Werk beziehen, während die B-Händler auf den Großhandel angewiesen waren und natürlich dessen Handelsspanne bezahlen mussten. Die Walzwerke brauchten berechenbare Mindestauftragsmengen, sogenannte Mindestwalzlose, um ihre Produktion darauf einzustellen, und sie hatten deshalb für den innerdeutschen Handel das A- und B-Händler-System eingeführt. Ihre Direkthändler mussten regelmäßig Mindestmengen abnehmen. Das wiederum barg für die Werke ein gewisses Risiko, denn die Ware wurde damals stets zum 15. des Monats bezahlt, der auf die Lieferung folgte, die Werkshändler erhielten also Kredit. Deshalb musste jeder A-Händler zunächst seine finanzielle Bonität nachweisen und Sicherheiten hinterlegen, damit für den Produzenten kein Forderungsausfall-Risiko bestand. Der begehrte A-Händler-Status lohnte sich dafür gleich in mehrfacher Hinsicht: Dobbertin & Co zum Beispiel konnte nicht nur den Großhandel umgehen, sondern erhielt noch einen A-Händler-Rabatt von zwei bis zweieinhalb Prozent von den Walzwerken und zusätzlich einen Großkundenrabatt von bis zu vier Prozent. Außerdem brauchte das Unternehmen kein eigenes Lager zu halten. Die Hamburger verkauften den Stahl dann an B-Händler oder andere Großabnehmer weiter.
Mitte der Zwanzigerjahre geriet der bedeutendste Geschäftspartner von Dobbertin & Co, der Stumm-Konzern, in eine existenzbedrohende Krise. Die Saarindustrie war besonders schwer von den Folgen des Ersten Weltkrieges getroffen worden. Erz und Kohle hatte man vor