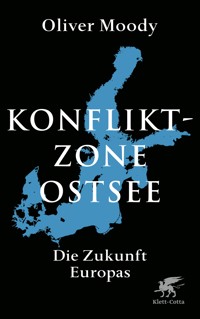
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Die Ostsee ist Zentrum eines Spiels, das über das morgige Europa entscheiden wird.«Oliver Moody Die Zeit der europäischen Ostseestaaten ist angebrochen: Finnland, Schweden, Dänemark, Deutschland, Polen, Estland, Lettland, Litauen. Als neuer Gegenpol Russlands bestimmen sie über die Zukunft Europas. Oliver Moody entwirft fesselnd das Panorama einer politisch zu lange unterschätzten Region. Mehr denn je braucht der Westen nun ihre Perspektiven. Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat sich die geopolitische Lage bedrohlich verändert: Putin ist im Konflikt mit dem gesamten Westen und greift bereits nach der Ostsee. Die USA unter Donald Trump verschärft die Lage bedrohlich. Es kommt nun auf die acht europäischen Anrainerstaaten an, die Probleme des Kontinents zu bewältigen und wichtige Bündnisse untereinander einzugehen. Mit tiefem Verständnis erkundet Oliver Moody diese neuerliche Konfliktzone, um ihre akuten Gefahren, politischen Möglichkeiten und vielschichtigen Beziehungen zu verstehen. Durch viele Begegnungen und Gespräche mit Experten, Politikerinnen, hochrangigen Militärs und Bürgerinnen entwickelt er ein feines Gespür für die Geschichte, Strategien und Perspektiven dieser Länder. Auf die Fragen, wie die Ressourcen demokratischer Gesellschaften angesichts andauernder Unsicherheit mobilisiert werden können, findet Moody die dringend benötigten Antworten. Das Buch zur Zeitenwende – mit einem exklusiven Zusatzkapitel zu den deutsch-polnischen Beziehungen. »Großartig. Ein herausragendes Buch, das die große Bedeutung der Ostseeregion unterstreicht und ebenso spannend zu lesen ist.« Peter Frankopan, Historiker und Autor »Ein brillant geschriebenes Buch ... Moody führt uns durch die Ostseeregion und zeigt, wie sie die Frontlinie in der Konfrontation mit Wladimir Putin markiert und wie viel uns die Kenntnis darüber lehren kann.« Brendan Simms, Historiker und Autor »Oliver Moodys klares und zugängliches Buch wirft Licht auf einen der wichtigsten, aber am wenigsten verstandenen Orte in Europa. ›Konfliktzone Ostsee‹ ist ein Meisterwerk, das es vermag, die schwindelerregende Komplexität der Region in einen fesselnden Pageturner zu verwandeln.« Katja Hoyer, Historikerin und Autorin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 716
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Oliver Moody
Konfliktzone Ostsee
Die Zukunft Europas
Aus dem Englischen von Tobias Gabel, Enrico Heinemann und Jörn Pinnow
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »BALTIC« bei John Murray Press, einem Imprint von Hodder & Stoughton Limited, 50 Victoria Embankment, London EC4Y 0DZ.
© 2025 by Oliver Moody
Für die deutsche Ausgabe
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH,
gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Textund Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von ©mauritius images/Rainer Lesniewski/Alamy/Alamy Stock Photos
Vorsatzkarte: Shutterstock/Peter Hermes Furian
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
Lektorat: Volker Kühn, Oldenburg
ISBN 978-3-608-96650-3
E-Book ISBN 978-3-608-12403-3
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorbemerkung des Autors
Einleitung
Sie können sich Ihre Strategie in den Arsch schieben
Der Osterangriff
Ein tektonisch sehr aktiver Ort
Teil I
Resilienz
1
Tigersprung
Erst Hunger, dann Elend
Sagen Sie den Balten, sie sollen mit diesem Unsinn aufhören
Die Zukunftsfabrik
Goodbye Lenin and Just Do It
Der neue Molotow und sein Ribbentrop
Die gesamte Geschichte neu denken
Der magische Diener
Gazpacho und Luftschläge
»Liebe an der nationalen Verteidigung interessierte Leserinnen und Leser«
Schießen in persönlicher Funktion
2
Absolute Verteidigung
Die Tugend des Pessimismus
Die Menschen und die Bäume
Schwieriger Nachbar
Der finnisch-britische Krieg
Ein freies Land, aber niemand darf Russland beleidigen
Der rote Teppich
Die Spritze herausziehen
Wenn ihr Helsinki trefft, treffen wir Moskau
Roosevelt war ein Amateur
3
Die Hexe und der Weise
Der Held mit den pelzigen Ohren
Bloodlands des Nordens
Für Stalin zu stimmen, ist unsere Wonne
Der Bärenreißer kehrt zurück
Gefährlich fremd
Stellt euch hinter uns oder verschwindet
Die ganze Welt um uns herum ist gegen uns
Die Theorie der Lügen
Ein gewisses fundamentales Wertesystem
Die leeren Rahmen
4
Giftsee
Leben am Abgrund
Die Kaskade
Windeln zerdrücken
Ein Stör namens Maria
Sie fangen soft an
Das Ass, das keines war
»Tiefseeforschung«
Teil II
Widerstand
5
Nach Europa ja, aber mit unseren Toten
Mag jemand die polnische Regierung?
Krieg gegen Polen
Für unsere Freiheit (und für eure)
Mit den Großen arbeiten
Das Gebet vom Getöse der Stahlkelle
Die unvollendete Revolution
6
Zeitenwende
Schaum vor dem Mund
Eine Republik der Angst
Die Energiewende
Die Militärwende, Teil eins
Die Militärwende, Teil zwei
Die diplomatische Wende, Teil eins
Die diplomatische Wende, Teil zwei
Kanonen, Butter und Wasserstoff
Reinen Wein einschenken
7
Die Hobbits
Ständiger Druck
Kleine Staaten mit schlechtem Benehmen
Eine Rebellennation
Die Königin vom Pfannkuchenball
Man kann nicht alles in Gefahr bringen, was man erreicht hat
Das Berlin der 2020er-Jahre
Teil III
Überleben
8
Wiedergewonnene Gebiete
Gefahren? Russland und Deutschland
Was sie uns gestohlen haben
Wir vergeben nicht
Ich bin jetzt an der Grenze und kann mich nicht mehr bewegen
Hier bei uns verrottet der Spargel
Goldlöckchen und die drei Bären
Stalins Bleistift
Kümmert euch um die Kleinen
Wasser nach oben fließen lassen
9
Imperium der Ausweglosigkeit
Mit der ganzen Wucht der Ohnmacht
Die Rückgabe dessen, was Russland gehört
Geschichtsfälschung
Turnier der Schatten
Kant, Immanuel Kant – ein russischer Agent?
Bojen im Fluss
Hunde mit Hirnschaden
Unser Ausland
Ein Zahlenspiel
10
Frieden durch Feuerkraft
Europa wird uns anflehen, nicht weiter vorzudringen
Ein Mensch zählt nichts
Tiefe Operationen
Eine Willensprobe
11
Schlacht im Ostseeraum
Die Schlacht am Himmel
Die elektronische Schlacht, erster Teil
Die elektronische Schlacht, zweiter Teil
Wie man keinen Atomkrieg führt
Die Front ist überall
Epilog
Ein widerspenstiger, unvernünftiger Patient
Eine ewige Entwicklungsregion
Dank
Zitatnachweis
Anmerkungen
Einleitung
1 Tigersprung
2 Absolute Verteidigung
3 Die Hexe und der Weise
4 Giftsee
5 Nach Europa ja, aber mit unseren Toten
6 Zeitenwende
7 Die Hobbits
8 Wiedergewonnene Gebiete
9 Imperium der Ausweglosigkeit
10 Frieden durch Feuerkraft
11 Schlacht im Ostseeraum
Epilog
Register
Für Pippa, Walter und Arthur
Vorbemerkung des Autors
Der Großteil dieses Buches wurde in den ersten Monaten des Jahres 2024 verfasst, und letzte Änderungen nahm ich im Oktober vor, wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten und dem Ende der Ampelkoalition in Deutschland.
Eine der Leitideen hinter diesem Projekt war, über den Strudel der Ereignisse hinwegzuschauen und die tieferen Strömungen zu betrachten, die Europa beeinflussen. Ich glaube, dass sich diese Vorgehensweise bewährt hat: Die in diesem Text vorgebrachten Argumente sind heute noch immer ebenso gültig wie sie es zum Zeitpunkt des Verfassens waren. Einige sind sogar noch erheblich dringlicher geworden. Andere verschoben sich vom Rand der öffentlichen Wahrnehmung in Europa mitten hinein in dessen Zentrum.
Allerdings habe ich einen großen Punkt vollständig übersehen. Es war unmissverständlich klar, dass eine zweite Amtszeit von Donald Trump einen Härtefall für Europa bedeuten würde. Die Verteidigungsausgaben würden steigen müssen; amerikanische Soldaten könnten aus Europa abgezogen werden; die Glaubwürdigkeit des NATO-Beistandspakts könnte in Gefahr geraten. Es war vorhersehbar, dass es zu einer ganzen Reihe unangenehmer Überraschungen kommen könnte.
Was ich jedoch nicht voraussah, war, dass ein Präsident Trump(1) und sein Hofstaat eher Europa denn Russland als Feind ansehen würden – dass die Vereinigten Staaten dem Rest des Westens nicht nur den Rücken zukehren, sondern sich, in Abstimmung mit Moskau, aktiv gegen ihn wenden. Wir waren so beschäftigt damit, die feinen Unterschiede zwischen den Fraktionen der Restrainer und der Prioritizer zu verstehen, die Trump(2) zwischen Isolationismus und einem vollständigen Aufmerksamkeitsschwenk in Richtung China(1) hin und hertreiben, dass wir jene vergaßen, die einen Kreuzzug führen wollen und darauf aus sind, einen regelrechten Regimewechsel in den liberalen Demokratien Europas durchzusetzen.
Es gibt zahlreiche Führungspersönlichkeiten, darunter viele in den Ostseeanrainerstaaten, deren Reaktion auf diese Staatsangelegenheit wohlmeinend als phlegmatisch bezeichnet werden kann. »Wir haben das kommen sehen«, sagen sie. »Wir haben euch oft genug gewarnt.«
Doch das stimmt nicht. Niemand in Europa sagte eine Welt voraus, in der die Trump(3)-Regierung die ideologischen Pole des Westens so radikal umkehren und versuchen würde, unseren Kontinent nach ihren Vorstellungen umzugestalten. Die heutige Situation kann als Tiefpunkt in den Prophezeiungen der pessimistischsten europäischen Analysten aus der Zeit vor dem 5. November 2024 gelten – oder geht sogar darüber hinaus. Wer noch etwas anderes behauptet, hat vermutlich den Ernst der Lage nicht erkannt.
Dies bringt die Frontstaaten in der Ostseeregion in eine besonders missliche Lage. Seit dem Ende des Kalten Kriegs(1) haben Polen, Litauen, Lettland und Estland ihre gesamte Außen- und Sicherheitspolitik rund um die Zwillingsleitsterne der transatlantischen Allianz und der Europäischen Union herum aufgebaut. In den beiden letzten Jahren überwanden Finnland und Schweden ihre jahrzehntelang sorgfältig austarierte Neutralität und traten der NATO bei, nur um nun feststellen zu müssen, dass diese zur Schutzgeldzahlstelle geworden ist. Was die Sache noch schlimmer macht: Die Länder müssen sich derzeit entscheiden, ob sie ihre wertvollen militärischen Ressourcen für eine Friedensmission in der Ukraine freigeben oder sie im Inland für die Eventualität eines russischen Angriffs auf ihr Staatsgebiet bereithalten wollen.
Wir begreifen erst jetzt langsam, in welchem Ausmaß die US-Sicherheitsgarantien die europäische Nachkriegsordnung zusammenhielten, darunter die EU selbst, und wie schwer es werden wird, sie angesichts eines aktiv feindlich gestimmten Weißen Hauses aufrechtzuerhalten.
Es gibt noch immer jene in Polen und Finnland – vor allem, aber nicht nur dort –, die dies für Theatralik halten. Trump(4) versuche nur, so ihre Überzeugung, die Europäer so lange zu erschrecken, bis sie sich endlich um sich selbst kümmern und dass er die Russen mit einem falschen Sicherheitsgefühl einlullen wolle. Der Sturm werde schon vorüberziehen. Die Allianz werde bestehen bleiben. In der Zwischenzeit sollten wir einfach ruhig bleiben, große Mengen amerikanisches Gas und amerikanische Waffen kaufen und ohne aufzumucken den Missbrauch, die Erniedrigung und die politische Einflussnahme durch Washington hinnehmen. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es, als könnten diese Analysten recht behalten. Ich vermute allerdings, dass sie sich täuschen. Ich neige eher zu der vom lettischen Präsidenten Edgars Rinkēvičs(1) vertretenen Position, der auf allen drei seiner Social-Media-Profile postete: »Never stop panicking.«
Diese Herausforderung ist eine völlig andere als alles, was Europa seit 1945 anpacken musste. Sollte sich die Idee des Westens weiter fragmentieren, wird jedes Land gezwungen sein, sich seiner fundamentalen Werte und Interessen zu vergewissern und sich die Frage stellen müssen, ob es seinen Verbündeten trauen oder nicht doch strategische und wirtschaftliche Vorteile aus der Abstoßung derselben ziehen kann. China(2), Russland und die Vereinigten Staaten werden versuchen, diese Spaltungen für ihre eigenen Zwecke auszuweiten und auszunutzen. Es ist durchaus denkbar, dass wir auf die Frage zurückgeworfen werden, die sich die Franzosen Anfang 1939 stellen mussten, als das »Dritte Reich« Polen bedrohte: Warum sollten wir für Danzig(1) sterben? Warum sollten wir unsere Soldaten in den Kampf um ein Land schicken, dass die meisten Soldaten nicht einmal auf einer Karte finden konnten?
Vor diesem Hintergrund ist die Ostsee wichtiger denn je. Nicht nur, da ihre moderne Geschichte überdeutlich zeigt, was geschieht, wenn sich Nationen nicht auf den schlimmstmöglichen Fall vorbereiten, wenn Bündnisse auseinanderfallen und wenn Nachbarn es zulassen, dass gegenseitiger Groll oder Rivalitäten die Überhand über gemeinsame Interessen gewinnen. Sondern vor allem, weil die Region weitaus besser als sonst jemand in Europa auf diese neue Welt vorbereitet ist. Die Länder haben schon Jahrzehnte damit verbracht, Resilienz, Überlebensinstinkte, sicherheitsbasierte Gesellschaftsverträge, das Gespür für eine moralischen Mission und das solide, aber flexible Modell der internationalen Kooperation zu entwickeln, die unsere Zeit heute verlangt, schließlich mussten sie es. Es wird höchste Zeit, dass wir anderen das ebenfalls tun.
Alle nicht direkt einer Quelle zugeordneten Zitate stammen aus von mir geführten Interviews. Viele meiner Gesprächspartner haben in der Zwischenzeit ihren Arbeitsplatz gewechselt. In diesen Fällen beziehe ich mich im Folgenden auf den Interviewten unter der Position, die er oder sie zum Zeitpunkt des Interviews einnahm, und erwähne die neue Stelle in den Anmerkungen. Ausschnitte aus diesen Interviews sind zuvor bereits in The Times und Sunday Times erschienen. Die Angaben dazu finden sich in den Endnoten.
Ich nutze die landeseigene Schreibung von Ortsnamen, es sei denn, es gibt eine allgemein übliche deutsche Bezeichnung (zum Beispiel Warschau(1), Sankt Petersburg(1) oder Kopenhagen(1)).
Russische Namen wurden direkt transkribiert, mit Ausnahme der Fälle, in denen eine andere Schreibweise bereits etabliert ist.
März 2025
Einleitung
Die schwedische Insel Fårö(1) erscheint unberührt, Spuren der letzten Jahrhunderte sind kaum zu erkennen. Die Trockenbauhütten für das Vieh sind nach mittelalterlichen Vorbildern errichtet und tragen steil aufragende Reetdächer. Etwa alle 50 Jahre wird ein solches Dach in einer Gemeinschaftsaktion der Inselbewohner ausgebessert, wobei das uralte Wissen über Reetdächer an die nächste Generation weitergegeben wird. Anschließend wird der Erfolg mit einem gewaltigen Trinkgelage gefeiert. Einige der kleinen Bauernhöfe sind auch heute noch mit löchrigen Linien gekreuzter Holzpfähle umzäunt, als wollten sie damit einen Kavallerieangriff abwehren. Vor der Küste ragen die raukar auf, große, von den Wellen der Ostsee überspülte Kalksteinbrocken, die wie seltsame Nachbildungen von Hunden, Triumphbögen oder menschlichen Köpfen wirken.
Als der schwedische Regisseur Ingmar Bergman 1967 zum ersten Mal nach Fårö(2) kam, stieß er auf einen »steinigen Strand, der sich bis in die Ewigkeit erstreckt«. Die Insel wurde zu seinem Zufluchtsort.[1] In diesen Jahren reiste auch der sozialdemokratische Ministerpräsident Schwedens Olof Palme(1) regelmäßig hierher und mietete sich in der Nähe des Dörfchens Sudersand eine Hütte ohne Fernseher oder Telefonverbindung. Manchmal brachte er seine engsten Mitarbeiter oder befreundete Politiker aus der ganzen Welt mit nach Fårö(3), um weit entfernt von prüfenden Blicken in Stockholm(1) heimlich Pläne zu schmieden. Meist nutzte er jedoch einfach die Zeit, um den Kopf freizubekommen.
Die winzige Insel mit ihren milden Wintern liegt näher am Mittelpunkt der Ostsee als jedes andere Fleckchen Land. Sie nimmt einen ganz speziellen Platz in der Nationalmythologie des modernen Schweden ein und steht für Abgelegenheit, Nostalgie, Sicherheit, Ruhe und eine ununterbrochene Verbindung zu der langen Geschichte des Landes.
Doch dieses Gefühl von Sicherheit und Zeitlosigkeit ist eine Illusion. Fårö(4) und die benachbarte, größere Insel Gotland(1) befinden sich in einer strategischen Position inmitten jener Schifffahrtslinien, die die wirtschaftliche und militärische Lebensader der Ostsee bilden. Dank moderner Waffentechnik sind sie von der westlichen Hälfte der baltischen Staaten leicht unter Beschuss zu nehmen, genau wie von Kaliningrad(1) aus, der russischen Exklave, die bis oben hin mit Hyperschallwaffen, Kampfflugzeugen, Kriegsschiffen ausgestattet ist – und auch mit Atomsprengköpfen, wie einige benachbarte Regierungen vermuten.[2]
Fårö(5) und Gotland(2) sind in einen Krieg verstrickt, der sich von Kalifornien(1) bis Kamtschatka(1) rund um den Globus erstreckt, mit der Ostsee als geografischem und geopolitischem Mittelpunkt. Derzeit kämpfen die Ukraine und Russland diesen Krieg aus, doch der umfassendere Konflikt bestimmt das Leben und bedroht die Sicherheit und das Wohlergehen jedes Menschen im Westen, auch wenn viele von uns den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben.
Dabei haben die ersten Donnerschläge eines physischen Kriegs den Ostseeraum bereits erreicht. Im September 2022 schaltete eine Reihe Unterwasserexplosionen östlich der dänischen Insel Bornholm(1) die russischen Gaspipelines Nord Stream(1) 1 und 2 aus.[3] Eineinhalb Jahre später erklärte Kyjiw(1), seine Spezialkräfte hätten die »Serpuchow« in Brand gesteckt, eine Korvette der Buyan-M-Klasse der russischen Baltischen Flotte, und zwar möglicherweise an einem Ort, der rund 150 Kilometer südlich von Gotland(3) liegt. Es dürfte der erste bekannt gewordene Angriff auf ein russisches militärisches Ziel in der Region seit 1945 gewesen sein.[4]
Nun ist es ein Leichtes, diese Vorfälle als Kollateralschäden eines örtlich begrenzten Stellvertreterkriegs abzutun, der sich fast 1500 Kilometer entfernt abspielt. Das wäre allerdings gefährlich überheblich. Sie sind Teil von etwas deutlich Größerem: einem generationsübergreifenden Wettstreit zwischen Russland und dem Westen auf jeder denkbaren Ebene unterhalb einer direkten militärischen Konfrontation, angefangen bei Energie und Wirtschaft bis hin zu Parlamenten und sozialen Netzwerken. Dieser Wettstreit hat zwei Dreh- und Angelpunkte. Einer ist die Ukraine. Der andere ist der Ostseeraum.
Moskau hat dies bereits ziemlich explizit klargemacht. Während Russland im Dezember 2021 seine Truppen in Vorbereitung einer groß angelegten Invasion an der ukrainischen Grenze aufmarschieren ließ, die dann ja auch drei Monate später erfolgte, stellten Wladimir Putin(1)s Unterhändler in Washington(1) eine dermaßen extravagante Forderung, dass US-Diplomaten kaum glaubten, was sie da hörten. Moskau forderte die vertragliche Zusicherung, dass die NATO alle militärischen Aktivitäten östlich jener Gebiete einstellte, die 1997 zum Bündnisgebiet gehörten.[5]
Das hätte Europas geopolitische Uhren um ein Vierteljahrhundert zurückgedreht und von der Allianz verlangt, ihre Kräfte aus Polen und den baltischen Staaten zurückzuziehen. Vor allem für Letztere hätte das die Gefahr einer russischen Einmischung extrem erhöht. Damals erklärte der britische Russland-Experte Sam Greene, das Ultimatum liefe darauf hinaus, dass Putin »eine Linie rund um den postsowjetischen Raum zieht und ein ›Zutritt verboten‹-Schild aufstellt«. »Es geht ihm dabei nicht um einen Vertrag«, fügte Greene hinzu. »Es geht ihm um eine Feststellung.«[6] Jeffrey Mankoff(1), ein Experte für russische Außenpolitik an der US National Defence University, formulierte es so: »Ich denke, die Russen waren ziemlich transparent in dem, was sie wollten. Sie wollten die nach dem Ende des Kalten Krieg(2)s(3) getroffenen Abmachungen neu verhandeln.«
Putin wird dieses Ziel kaum durch Verhandlungen erreichen können. Wird er versuchen, es gewaltsam durchzusetzen? Für Europa wird dies zur wichtigsten Frage des laufenden Jahrzehnts.
Sie können sich Ihre Strategie in den Arsch schieben
Dieses Buch handelt von der Wiederkehr der alten Auseinandersetzung mit Russland über den Ostseeraum. Es geht um die Frage, wie der Westen sie gewinnen kann und wie der Ausgang dieses Konflikts über die Zukunft Europas und des gesamten Westens entscheidet. Der Kampf wird seit mehr als 800 Jahren geführt, seit zwei russische Fürstentümer begannen, von mehreren estnischen Kleinstaaten Tributzahlungen zu fordern. Vor dem Ersten Weltkrieg(1) kontrollierte Russland Finnland, die baltischen Staaten und einen beträchtlichen Teil Polens. Bis 1989 reichte die sowjetische Einflusssphäre über die südliche Ostseeküste hinaus bis an die Mündung der Trave bei Lübeck.
Immer wieder machte Putin deutlich, dass er so viel wie möglich davon wiederherstellen möchte, notfalls mit Gewalt. Berichten zufolge prahlte er schon im September 2014 im »privaten Rahmen« damit, seine Streitkräfte könnten die Hauptstädte Polens und der baltischen Staaten innerhalb von 48 Stunden einnehmen.[7] Nachdem im Mai 2024 mehrere europäische Länder erklärten, die Ukraine dürfe die von ihnen gelieferten Waffen auch dazu nutzen, Ziele auf russischem Gebiet zu beschießen, erklärte er: »Die Vertreter der NATO-Staaten, insbesondere Europäer und ganz besonders die Vertreter kleiner Länder, sollten sich bewusst machen, womit sie hier spielen. Sie sollten nicht vergessen, dass ihre Länder klein und dicht besiedelt sind. Daran sollten sie denken, bevor sie von Angriffen tief auf russischem Gebiet sprechen.«[8]
Seine Propaganda-Scharfmacher sind in ihren Formulierungen noch weniger zurückhaltend. Der damalige Vertreter der russischen Föderation bei der NATO und spätere Chef der russischen Raumfahrtagentur Dmitri Rogosin bezeichnete 2018 neben der Krim(1) und anderen Teilen der Ukraine auch die baltischen Staaten als »Stammterritorium der russischen Nation«.[9] Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew(1), den die USA früher als verlässlichen Partner schätzten, der aber nun einen Großteil seiner Zeit mit irritierenden Posts in den sozialen Medien verbringt, erklärte wiederholt, die baltischen Staaten seien verirrte Provinzen Russlands.[10] In den meisten Fällen tendieren westliche Analysten dazu, solche Äußerungen nicht allzu ernst zu nehmen, doch das russische Regime möchte mit ihnen zumindest den Eindruck aufrechterhalten, dass ein Angriff auf die baltische Flanke der NATO jederzeit möglich ist.
Dabei kann es durchaus sein, dass Putin selbst noch nicht weiß, was er unternehmen wird. Witold Jurasz, ein polnischer Publizist mit Schwerpunkt Außenpolitik, der bereits als Diplomat in Moskau tätig war, erinnert sich an ein Gespräch, das er vor einigen Jahren mit einem russischen Minister führte. »Ich fragte ihn: ›Warum beschäftigt ihr Russen euch immer mit der taktischen Ebene und scheint euch nicht um die strategische zu kümmern?‹« Die Antwort seines Gesprächspartners lautete: Nun, wissen Sie, Sie glauben, Sie verfolgen diese großartige Strategie, aber dann haben wir zehn kleine taktische Siege, und Sie können sich Ihre Strategie in den Arsch schieben.
Und genau so war es bis zur Invasion der Ukraine. Putin wird manchmal ein großer Stratege genannt. Das ist er nicht. Er ist ein großer Taktierer. Er hat zahllose taktische Siege eingefahren, aber strategisch ist er ein völliger Verlierer.
Es passt in dieses Bild, dass westliche Regierungen viel mehr Energie auf Prognosen über Russlands Fähigkeiten zum Angriff verwenden, statt sich über dessen spezifisches Aussehen Gedanken zu machen.[11] Putin selbst wiederholte in diesem Zusammenhang mehrfach ein nicht gesichertes Zitat Ottos von Bismarck(1): »Nicht die Absichten sind wichtig, sondern die Fähigkeiten«, soll der deutsche Reichskanzler gesagt haben.[12]
Anfang 2023 erklärte der estnische Auslandsgeheimdienst, Russland halte ausreichend militärische Ressourcen zurück, »um glaubhaften militärischen Druck in unserer Region ausüben zu können«, und sei in der Lage, die Einheiten an seiner westlichen Grenze innerhalb von vier Jahren wieder aufbauen zu können.[13] Das löste eine Flut an weiteren Vorhersagen über einen möglichen russischen Angriff aus, wobei die Zeitangaben von drei bis acht Jahren reichten. »Wir müssen die Zukunft im Blick behalten und überlegen, wie die Dinge in den nächsten vier, fünf, sechs oder sieben Jahren aussehen«, erklärt ein ranghoher Mitarbeiter eines westlichen Geheimdienstes:
Die baltischen Staaten befinden sich vermutlich irgendwo in der Mitte der russischen Überlegungen. Sie sind nicht die Ukraine, die [nach Putins Meinung] nach Hause zurückgeholt werden muss, sie sind aber auch nicht der Westen. Die Russen halten diese Länder immer noch für einen Teil der UDSSR. Wenn der Krieg beendet ist, wird das russische Militär anfangen, sich neu aufzustellen. […] Am Ende, wenn die Russen die Situation analysieren, werden sie die Streitkräfte vergleichen und versuchen, die Planungen der NATO zu verstehen. Sie werden die Kampfkraft abschätzen und anhand dessen eine Entscheidung treffen.
Jenseits aller Zweifel steht fest, dass Russland seinen submilitärischen Feldzug nicht nur gegen den Ostseeraum, sondern gegen Europa als Ganzes stetig intensiviert hat. Dabei nehmen die Maßnahmen unterschiedliche Formen an: Sabotage(1), Mordanschläge, Cyberangriffe, Desinformation(1), Störungen der Energieinfrastruktur, Manipulationen, Beeinflussung von Politikern und, in zunehmendem Maß, auch Provokationen an Landesgrenzen. Im Grunde handelt Russland nach dem alten Strategiehandbuch der politischen Kriegführung, nun allerdings durchgeführt mit Mitteln des 21. Jahrhunderts in bisher nie dagewesenem Maßstab.[14] Der Inlandsgeheimdienst Estlands erwartet von Moskau inzwischen, »dass jegliche Maßnahmen ergriffen werden, die erst kurz vor dem Auslösen des NATO-Bündnisfalls Halt machen«.[15] Das Pentagon spricht davon, Russland habe einen »hybriden Krieg« gegen Finnland begonnen, seit das Land dem nordatlantischen Verteidigungsbündnis beigetreten ist.[16] Die NATO brachte ihre »große Sorge« über »bösartige Aktivitäten« gegen sieben Mitgliedsstaaten zum Ausdruck: gegen Polen, die baltischen Staaten, Großbritannien, Deutschland und Tschechien(1).[17]
Der Osterangriff
Im April 2021 versammelte Russland bis zu 120 000 Soldaten an der ukrainischen Grenze.[18] Wochen später begann Moskau damit, Gaslieferungen nach Europa zu drosseln, woraufhin Deutschlands größter Gasspeicher beinahe leerlief.[19] Der russische Satellitenstaat Belarus(1)(2) begann damit, Zehntausende Asylsuchende einzufliegen, um sie durch das Land an die Grenzen zu Polen, Lettland und Litauen zu treiben. Für die europäischen Grenzstaaten war all dies längst nichts Neues mehr. Diese Situation, die in westeuropäischen Staaten nun erst langsam ins Bewusstsein dringt, ist seit Jahrzehnten, wenn nicht gar seit Jahrhunderten Bestandteil ihrer Realität, und in vielerlei Hinsicht haben sie sich deutlich besser an sie angepasst als wir. Aufgrund ihrer Geschichte und Geografie leben sie gewissermaßen bereits in der Zukunft.
Zu dieser Zeit lebte ich bereits drei Jahre als Journalist der Times in Deutschland. Über Nordosteuropa hatte ich noch nie wirklich nachgedacht, doch nun fing ich an, durch den Ostseeraum zu reisen und alles in mich aufzusaugen, was ich in Erfahrung bringen konnte. Ich besuchte Hauptstädte, Inseln, Häfen, Fabriken, Elektrizitätswerke, NATO-Kriegssimulationen, Wintertrainingcamps, soziale Brennpunkte, Gasterminals, Offshore-Windparks(1)(2), heruntergekommene Herrenhäuser, eine riesige Tauchglocke, Ministerinnen, Geheimdienstmitarbeiter, Generäle, Diplomaten, Geschäftsleute, Historikerinnen, Wissenschaftler, Sicherheitsanalysten, einen Dichter-Rockstar und einen Mann, der sich als Recycling-Superheld verkleidet. Mir wurde klar, dass es ein Buch werden müsste, wollte man das umfassende Bild mit dem dazugehörigen Kontext vermitteln.
Ich bin nicht der Einzige, für den dies ein Prozess des späten Erwachens war. Zu Zeiten des Kalten Krieg(4)s hatte Schweden Gotland(4), das offensichtlichste Ziel eines möglichen Brückenkopfs auf seinem Staatsgebiet, mit 25 000 Mann verteidigt, dazu kamen Dutzende Stridsvagn 102R-Panzer, Haubitzen, Viggen-Kampfflugzeuge, Luftabwehrgeschütze, Küstenbatterien und Antischiffsraketen.[20] Doch zu Beginn der 2000er-Jahre wurde die militärische Präsenz auf der Insel abgebaut. Die Kasernen verkaufte man an den Gemeinderat von Visby(1), einen Großteil der Einrichtung und die schwedische Militärausrüstung für eine ganze Brigade übergab man den neugegründeten Armeen der baltischen Staaten.
Gotlands kurze Abwesenheit aus der Geschichtsschreibung endete abrupt am 29. März 2013, kurz nach Mitternacht. Die schwedische Radarüberwachung entdeckte vier russische Suchoi Su-27-Kampfflugzeuge sowie zwei mit Nuklearsprengköpfen bestückbare Tupolew Tu-22M Backfire Bomber, die sich in hoher Geschwindigkeit von Sankt Petersburg(2) aus näherten.[21] Anstatt wie üblich südlich Richtung Kaliningrad(2) abzudrehen, behielten sie ihren Westkurs Richtung Gotland(5) bei und streiften gegen 2 Uhr schwedischen Luftraum. Es handelte sich um einen simulierten Angriff mit Atomwaffen.[22] Als wahrscheinliche Ziele wurden ein Armeestützpunkt im Kreis Småland(1) auf dem schwedischen Festland sowie das Hauptquartier der nationalen elektronischen Überwachung am Stadtrand von Stockholm(2) ausgemacht, knapp 1,5 Kilometer vom Palast Drottningholm(1) entfernt, dem Sitz der königlichen Familie.[23]
Das war alarmierend, aber keineswegs völlig ungewöhnlich: Sowjetische Jets hatten während des Kalten Krieg(5)s(6) Schweden unzählige solcher »Besuche« abgestattet. Schockierend daran war die schwedische Reaktion. Die Luftstreitkräfte sollten für genau dieses Szenario jederzeit mindestens zwei JAS 39 Gripen-Kampfflugzeuge als »Schnellwarnsystem« bereithalten. Doch es war Karfreitag und alle Piloten saßen im Urlaub zuhause bei ihren Familien.[24] Niemand stellte sich den russischen Bombern in den Weg. Hätte es sich um einen echten Nuklearangriff gehandelt, wäre Schweden völlig hilflos gewesen, nicht in der Lage, sich zu verteidigen.
»Der russische Osterangriff, wie er bei uns in Schweden heißt, war ein absoluter Weckruf«, erklärt Magnus Frykvall(1), Oberst der schwedischen Armee. Zu dieser Zeit ging der Oberbefehlshaber der Streitkräfte davon aus, dass das Land »etwa eine Woche« durchhalten könne, sollte es zu einer Invasion kommen.[25] Das Regiment auf Gotland(6) wurde 2018 wieder eingesetzt und Frykvall zum Kommandierenden ernannt. Allerdings war die schwedische Militärkapazität derart zurückgebaut worden, dass die Armee nur ein paar Hundert Soldaten und eine Handvoll Leopard 2-Kampfpanzer bereitstellen konnte.[26]
Damals holte Schweden seine Vorlagen für den Krisenfall aus der Zeit des Kalten Krieg(7)s(8) wieder aus der Schublade.[27] Schwedens Übungen zur »Gesamtverteidigung«, bei denen sowohl die Fähigkeiten des öffentlichen wie des privaten Sektors zum Widerstand gegen submilitärische »Grauzonen«-Angriffe getestet wurden, fanden im Westen große Aufmerksamkeit.[28] Das Land versorgte alle Haushalte mit einem Faltblatt unter dem Titel »Wenn die Krise oder der Krieg kommt«. Zum ersten Mal seit den 1940er-Jahren wurde ein Minister für Zivilverteidigung ernannt. Der Oberbefehlshaber der schwedischen Streitkräfte Micael Bydén(1) trat in beliebten Kinderfernsehprogrammen auf, um Fragen nach dem richtigen Verhalten im Konfliktfall zu beantworten.[29] Sogar Kronprinzessin Victoria, auf Platz eins der Thronfolge, absolvierte an der Schwedischen Verteidigungsuniversität eine Ausbildung zur Offizierin.[30]
Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson(1) schlug im Mai 2024 vor, Gotland(7) zu befestigen.[31] Alliierte Truppen, darunter britische und amerikanische Marines, hatten die Erstürmung der Insel und des Archipels von Stockholm(3) mit Drohnen(1), Kriegsschiffen, gepanzerten Fahrzeugen und Fallschirmspringern im größten und realistischsten Kriegsspiel des Landes seit mehr als einem Vierteljahrhundert geübt.[32] Die Bewohner von Visby(2), der Hauptstadt der Insel, beklagten sich über den ungewohnten Lärm des von den Gripen-Kampfjets verursachten Überschallknalls über ihren Köpfen.[33]
Magnus Frykvall(2) bereitet seine Truppe auf so ziemlich jede denkbare Art des Angriffs vor, darunter eine Invasion durch Amphibien-Spezialkräfte, die mit einem zivilen Schiff wie einem Öltanker durchgeführt wird. »Wir müssen die Kommunikationsverbindungen in der Ostsee jederzeit offenhalten«, erklärt er. »Verlieren wir Gotland(8) und ist der Feind eingedrungen, kann er es Schweden, Finnland und den baltischen Staaten sehr schwer machen, sich zu verteidigen.«
Ein tektonisch sehr aktiver Ort
Viele von uns denken beim Begriff Ostsee nicht an eine Region, falls wir überhaupt über diesen Teil Europas nachdenken. Die Ostsee ist von neun Ländern umgeben, alle mit einer eigenen Sprache, einer deutlich abgegrenzten Identität und ganz eigenen historischen Entwicklungen. Zu verschiedenen Zeiten hatten Deutschland, Russland, Dänemark und Schweden ihre eigenen Reiche, während Finnland und die drei baltischen Staaten um ihre Existenz und ihren Fortbestand kämpfen mussten. Polen und Litauen lernten beide Extreme kennen. Einen Großteil seiner Geschichte war der Ostseeraum ein Konfliktgebiet für Regionalmächte. Nach dem Zweiten Weltkrieg trieben der Eiserne Vorhang und ihre unterschiedlichen geopolitischen Orientierungen die Anrainerstaaten auseinander. Es gab die NATO, den Warschauer Pakt(1) und die blockfreien Staaten, und auch innerhalb dieser Blöcke existierten widerstreitende Interessen und Wertvorstellungen. Noch heute gibt es wenig Hinweise auf ein gemeinsames »Ostseeregion-Gefühl« unter den Anrainern, das stark genug wäre, um sich gegen andere Gruppenzugehörigkeiten zu behaupten. Man fühlt sich als Skandinavier, als Balte oder als Mitglied der Europäischen Union(1).
Im Lauf der Jahre verschwand Nordosteuropa immer mehr aus dem Fokus der Aufmerksamkeit des Westens. Dabei ist es wahrlich das Herz Europas; Geografen verorten das Zentrum der kontinentalen Landmasse irgendwo im Hinterland der südlichen Ostseeküste.[34] Und der Fokus der Geopolitik verschiebt sich stetig ostwärts. Der Ostseeraum wird zum Dreh- und Angelpunkt eines größeren Spiels in ganz Eurasien.
Die Länder rund um die Ostsee, abgesehen von Russland, sind enger miteinander verknüpft als die meisten anderen Regionen der Welt. Seit der Bronzezeit wird hier Handel über das Meer getrieben. Heute gehört die Region auf organisatorischer Ebene zu einer der am intensivsten vernetzten der Erde, mit einem wilden Durcheinander an Buchstabenkombinationen für multilaterale Foren, die alles abdecken, vom Jazz bis zur hohen Politik.[35] Dies entspringt einer Notwendigkeit. Was die Länder am offensichtlichsten verbindet, ist die Ostsee. Die Staaten müssen lernen, gemeinsam für ein stark verschmutztes und ökologisch sensibles Gewässer zu sorgen, das durchzogen wird von einem Liniennetz aus Gaspipelines, Strom- und Datenkabeln und über das Schiffe die meisten der Im- und Exporte besorgen, von denen alle beteiligten Nationen abhängen.
Unübersehbar ist, dass sie durch Wladimir Putin(2) und seinen Krieg gegen die Ukraine zusammengeschweißt wurden. Fünf der oben erwähnten Länder haben eine Landgrenze mit Russland. Sie wissen, was passieren könnte, da es schon einmal passiert ist. »Wir haben das Gefühl, an einem tektonisch sehr aktiven Ort zu leben, bei all diesen Erdbeben«, erklärt ein einflussreicher Minister aus einem der baltischen Staaten:
Unter all den russischen Invasionsplänen ist das am ehesten vorhersagbare Szenario ein Angriff in westliche Richtung. Natürlich dürfte ihr erster Schritt die Eroberung des Baltikums sein, denn wir sind ein kleiner Ableger der NATO. Dann werden sie umgehend auch Finnland besetzen: Das gehört zu ihren Plänen. […] Wir geben uns keinen Illusionen hin. Ein umfassender Krieg ist nicht ausgeschlossen. Er würde die Auslöschung unseres Staats und die Zerstörung unserer Nation bedeuten.
Es war daher nie wichtiger, den Ostseeraum zu verstehen, mit all seinen Gefahren, Möglichkeiten und Komplexitäten, um ein Gefühl für die historischen Kräfte zu entwickeln, die seine Gegenwart formten. Die Ostsee ist eine verletzliche Region, doch sie kann weit mehr sein als das Scharnier einer interkontinentalen Konfrontation, bei der einige wenige Fehlkalkulationen einen nuklearen Weltenbrand auslösen können. Für ein Europa, das erschöpft wirkt und sich seines eigenen Niedergangs bewusst ist, das von langsamem Wachstum und Identitätskrisen geplagt wird, könnte der Ostseeraum ein Quell neuer Ideen sein – und für Optimismus.
Dieses Buch versucht, solche Vorstellungen einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Der erste Teil beleuchtet, auf welch unterschiedliche Art es einigen Ländern in dieser Region gelungen ist, Resilienz(1) zu entwickeln, wobei das Spektrum weit gefächert ist: durch erfindungsreiche Förderung des nationalen Zusammengehörigkeitsgefühls in Estland; durch große Strategien und »umfassende« Sicherheit in Finnland; durch den Kampf um sozialen Zusammenhalt und die russischsprachige Minderheit in Litauen sowie durch die Bemühungen zur Abwehr einer Umweltkatastrophe und des Klimawandels rund um die dänische Insel Bornholm(2). Keines dieser Beispiele funktioniert lupenrein, und in einigen Fällen sind die Erfahrungen auch eher negativ denn positiv. Doch es ist ebenso inspirierend, aus Fehlern zu lernen wie Erfolge zu bestaunen.
Am meisten interessiert mich, was die Ostseestaaten dem Westen darüber beibringen können, wie man kollektive Willenskraft mobilisieren und Gesellschaften im Angesicht von Gefahr und Unsicherheit zusammenhalten kann. Man verlangt substanzielle Opfer und Verpflichtungen von uns: Verteidigungsbudgets, die mehr als drei Prozent des BIP umfassen, zumindest vorübergehend höhere Energiepreise, den Umbau unserer Lieferketten und Handelsnetzwerke, Spannungen oder gar Konfrontationen mit Staaten, die für einige unserer Länder lange als vertrauenswürdige oder vielversprechende Partner galten. Die Zustimmung der Öffentlichkeit für derartige Maßnahmen kann nicht einfach als gegeben vorausgesetzt werden, sie muss erarbeitet werden.
Der zweite Teil des Buchs untersucht die Verschiebung der Mächteverteilung in Europa in Richtung Norden und Osten. Er geht der Frage nach, wie der Kontinent rund um den Ostseeraum neu konfiguriert wird. Dazu gehören Kapitel über die »Zeitenwende(1)« in der deutschen Politik, den Aufstieg Polens und die Rolle Litauens und anderer Frontstaaten, die den Rest Europas mitziehen. Im Zentrum dieser Kapitel steht eine Reihe fundamentaler Fragen, mit denen die Ostseeanrainer – insbesondere die fünf, die eine Landgrenze mit Russland haben – schon viele Jahre zu tun haben: Warum das alles? Was sind unsere zentralen Werte und unsere Ziele als Gesellschaft? Was bewegt uns als Bürgerinnen und Bürger gemeinsam, über unsere individuellen Interessen hinaus?
Der dritte und letzte Teil untersucht, wie sich der Konflikt mit Russland rund um die Ostsee und darüber hinaus in den kommenden Jahren entwickeln könnte. Hier wird gefragt, wie Putin und sein Regime ihre westlichen Nachbarn betrachten, wie der immer schneller eskalierende »hybride« Feldzug gegen Europa aussieht, welche Ziele er verfolgt und unter welchen Umständen Putin einen militärischen Angriff starten könnte. Die letzten beiden Kapitel widmen sich den Vorbereitungen der NATO auf die Verteidigung Nordosteuropas, mit oder ohne die USA. Sie schildern, was im Fall einer russischen Invasion geschehen könnte und vor allem stellen sie die Frage, wie man Moskau davon abbringen kann, darauf zu spekulieren.
Da es sich der Zukunft zuwendet, wird dieses Buch auch ein gutes Stück der Vergangenheit des Ostseeraums abdecken. Drei Gründe sprechen dafür. Erstens ist diese Geschichte an und für sich interessant und lohnenswert. Diese Länder gehören zu unseren stabilsten Freunden und Verbündeten, und doch wissen wir so wenig über sie. Zweitens sind die Eliten dieser neun Staaten, je auf ihre eigene Art, von der Geschichte und ihrer Relevanz für die Gegenwart besessen. Sie greifen unentwegt auf sie zurück, um zu informieren oder Entscheidungen zu rechtfertigen, die ohne Kenntnis der Geschichte unverständlich blieben. Drittens ereignen sich die Dinge mit überwältigender Geschwindigkeit und Unsicherheit. Dieses Buch wurde im Herbst 2024 abgeschlossen, kurz vor einer US-Präsidentschaftswahl, der wenige Monate später stattfindenden Bundestagswahl und im Angesicht der unvorhersagbaren Situation auf den Schlachtfeldern der Ukraine. Vorhersagen nur auf Basis der trügerischen Gegenwart zu treffen, wäre wie der Bau eines Wolkenkratzers aus nassem Sand. Der Blick nach vorn ist nur durch die Analyse langfristiger Trends möglich und durch die Hochrechnung dessen, was früher gewesen ist, in manchen Fällen auch über eine jahrhundertelange Zeitspanne.
Ein Kurzzeitgedächtnis ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Der Ausgangspunkt sollte also vielmehr sein: Wie würde eine Historikerin oder ein Historiker, die aus dem Jahr 2040 oder 2050 auf unsere Zeit zurückschauen, die heute von uns getroffenen Entscheidungen beurteilen?
Teil I
Resilienz(2)
1
Tigersprung
Was man von Estland über die Konfrontation mit existenziellen Bedrohungen lernen kann
Manchmal am Morgen sorge ich mich –
Trottel, der ich bin – ob
es noch immer eine Republik gibt,
eine Republik Estland
Ich frage meine Tochter,
ob sie heute Estnischunterricht hat,
und hat sie ihn,
dann ist alles in Ordnung,
denn dann scheint es noch eine Republik zu geben
Jürgen Rooste(1), Wer bewacht die Republik[1]
War Kaja Kallas als kleines Mädchen zu krank, um in die Schule zu gehen, passte ihre Großmutter auf sie auf, wenn ihre Eltern zur Arbeit mussten. Die ältere Dame unterhielt das Mädchen mit ihren Erinnerungen an Estlands kurze Unabhängigkeit vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. In ihrer Jugend, so erzählte sie Kaja, habe ein finnischer Schiffskapitän sie mit nach Hull genommen, einen Industrie- und Fischereihafen an Englands Ostküste. Für die kleine Kaja, die in einem seit 40 Jahren von der Sowjetunion besetzten Estland lebte, vom Westen durch den Eisernen Vorhang getrennt und von der UDSSR durch stacheldrahtbewehrte Grenzen, klang die Vorstellung, East Yorkshire zu besuchen, unvorstellbar exotisch. »Ich entgegnete ihr: ›Erzähl mir nicht solche Märchen‹«, berichtet Kallas.
Die Geschichte des anderen Zweigs ihrer Familie hörte sich weniger fantastisch an. Im Jahr 1949 kam es im Baltikum zu den sogenannten Märzdeportationen, der »Operation Priboi« (Operation Brandung), bei denen auch Kallas’ Mutter und Großmutter aus ihrem Haus verschleppt wurden. Innerhalb von zwei Tagen deportierten sowjetische Soldaten und Sicherheitskräfte 20 480 Estinnen und Esten mit klapprigen Güterzügen nach Sibirien. Mehr als drei Viertel der Verschleppten waren Frauen und Kinder; Kallas’ Mutter war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal sechs Monate alt. Jeder zwanzigste Deportierte starb im Exil. »Bald wird es Nacht«, sangen die estnischen Frauen in den sibirischen Lagern, »und alles ist still und dunkel / doch ich finde keinen Frieden.« Else, eine der deportierten Mütter, schrieb in ihr Tagebuch, sie wisse nicht, ob ihr elf Monate alter Sohn, den sie in Estland zurücklassen musste, noch am Leben sei. Sie blieb noch fünfzehn Jahre in der Verbannung und sah ihren Sohn erst 1969 wieder, da war er bereits 28.[2]
»Ich gehöre zur glücklichen Generation, die keine Freiheit hatte, sie dann aber gewann, weshalb ich den Wert von Freiheit kenne«, sagt Kallas. »Die Generation meiner Großeltern war das genaue Gegenteil: Sie hatten alles. Sie hatten Freiheit, sie hatten Wohlstand. Sie hatten alles, und ihnen wurde alles genommen.«
Als ich Kaja Kallas Anfang 2024 besuchte, war sie Ministerpräsidentin des erfolgreichen kleinen europäischen Landes (einige Monate später wurde sie zur Spitzendiplomatin der Europäischen Union(2) ernannt).[3] Seit Estland 1991 seine Unabhängigkeit wiedererlangte, also in rund einer Generation, steigerte es sein nominales Bruttoinlandsprodukt um 2500 Prozent, womit es Griechenland, Portugal und sogar Polen hinter sich ließ.[4] Es gründete die besten Schulen ganz Europas, zumindest nach den Prüfungsergebnissen der Schülerinnen und Schüler mit Blick auf die Hauptfächer.[5] Sein Kinderbetreuungssystem gilt nicht nur in Großbritannien als Vorbild.[6] Im jährlichen Bericht über die menschliche Entwicklung der Vereinten Nationen(1), der Faktoren wie Lebenserwartung, Einkommen und Bildung berücksichtigt, steht Estland ziemlich gleichauf mit Frankreich.[7] Trotz der im ehemaligen Ostblock verwurzelten Tradition von Bestechlichkeit und geschäftlichen Mauscheleien hat das Land auf dem globalen Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International den gleichen Standard wie Kanada(1) erreicht.[8]
Estlands Technologiesektor ruft auch in viel größeren Ländern Neid hervor. Relativ zu seiner Einwohnerzahl von 1,3 Millionen Menschen, existieren hier mehr »Einhörner« als in jedem anderen europäischen Staat. Der Begriff bezeichnet Start-ups mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar vor dem Börsengang. Dazu zählen Firmen wie Bolt, Skype(1) und Wise.[9] Estland war das erste Land, das ein allgemeines digitales Ausweissystem und die digitale Stimmabgabe bei Wahlen einführte. Sein Einfluss in der Europäischen Union(3) und der NATO wächst Jahr für Jahr, und Tallinn(1) war die treibende Kraft hinter dem Munitionsbeschaffungsprogramm der EU. Ein Land mit weniger Einwohnern als München(1) prägt mit seinen Bestrebungen einen Block aus 450 Millionen Menschen.
Stand Sommer 2024 ist Estland, gemessen an seiner wirtschaftlichen Größe, der großzügigste bilaterale Unterstützer der Ukraine. Die Hilfe reicht von der Lieferung von Javelin-Panzerabwehr-Waffensystemen kurz vor der russischen Invasion bis hin zu Haubitzen, dem Mistral-Flugabwehrsystem und amphibischen Fahrzeugen.[10] Zum zwanzigsten Jahrestag des Beitritts des baltischen Staats in die Europäische Union hob Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen(1) im Mai 2024 Estland als Beispiel für alle Mitgliedsländer hervor und betonte dessen »herausragende und beeindruckende« Moral gegenüber Russland und seine »phänomenale […] digitale Führungsrolle«.[11]
Sollte die triumphale Auflistung der Errungenschaften, die Tallinns führende Politiker im Schlaf aufzählen können, ein wenig bieder oder eintönig wirken, so ist das durchaus beabsichtigt: Das Land wäre nichts lieber als ein weiteres »langweiliges Land im Norden«, wie es der damalige Außenminister und spätere Präsident Toomas Hendrik Ilves in den 1990er-Jahren formulierte.[12] Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Was Estland von den nordischen Staaten unterscheidet, ist sein ununterbrochenes Streben nach Stabilität, eine nervöse Sorge nicht nur um seine Sicherheit, sondern auch um seine Identität, seine Zukunft und seine Existenz.
Diese Unruhe ist ein Quell großer Stärke und Anpassungsfähigkeit. Die Welt der 2020er-Jahre, mit all den Turbulenzen und Gefahren, an die sich die meisten westlichen Länder erst noch mühsam anpassen müssen, ist für Estland, mutatis mutandis, seit mehr als einem Jahrhundert Realität. Vorausgegangen waren – wie viele Estinnen und Esten es sehen – 700 Jahre Unterwerfung unter ausländische Mächte: unter die Dänen, die Deutschen, die Schweden und immer wieder auch die Russen.
Es sind diese Erfahrungen, aus denen heraus Estland uns viel beibringen kann – sofern wir zuzuhören bereit sind. Dabei geht es nicht nur darum, Erkundungsmissionen zu entsenden, die Estlands Kindergärten und seine digitalen Entwicklungspläne bestaunen (nur um die daraus resultierenden Strategiepapiere in den Archiven verstauben zu lassen). Es geht darum, das darunterliegende Mindset zu verstehen: die strategisch kalkulierte Risikobereitschaft, die tiefe Verwurzelung der Freiheit und über alldem die Idee, dass die Verteidigung einer Gesellschaft mehr umfassen muss als Bunker und Bomben.
Erst Hunger, dann Elend
Der tschechische Autor Milan Kundera definierte eine kleine Nation einmal als »eine, deren Existenz zu jedem beliebigen Zeitpunkt in Frage gestellt werden kann«.[13] Diese Prekarität ist entscheidend für das Verständnis von Estland heute. Die Esten wissen, was auf dem Spiel steht. Schon von ihrer Ausrufung 1918 galt Estlands Unabhängigkeit bei den Großmächten als derart fragile Anomalie, dass britische Diplomaten bereits Anfang der 1920er-Jahre warnten, sie könnten nicht länger im estnischen Sinn agieren. Im August 1939 regelte ein geheimer Zusatzartikel des Molotow-Ribbentrop-Pakts zwischen dem »Dritten Reich« und der Sowjetunion, dass Estland und Lettland der sowjetischen Einflusssphäre zufallen sollen, genau wie Finnland und Teile Rumäniens und Polens. Wochen später, als Polen unter Hitler und Stalin aufgeteilt wurde, akzeptierte die estnische Regierung ein sowjetisches Ultimatum und erlaubte der Roten Armee den Zugang zu ihrem Staatsgebiet.
Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs wurde Estland drei Mal erobert: zunächst 1940 von den Sowjets, im folgenden Jahr von den Deutschen und dann 1944 ein weiteres Mal von den Sowjets. Die erste sowjetische Besetzung dauerte nur elf Monate, doch sie hinterließ tiefe Narben. Das Land wurde nach einer Scheinwahl in die UDSSR eingegliedert, die Nationalflagge und andere Embleme der estnischen Identität wurden abgeschafft.
Als der Angriff der Wehrmacht auf die UDSSR im Sommer 1941 bevorstand, deportierten die Sowjets noch am 14. Juni mindestens 10 000 Esten im Versuch, die estnische Gesellschaft zu enthaupten und einzuschüchtern. Auch rund 7000 Frauen und Kinder gehörten zu den Opfern, die in Zügen abtransportiert wurden. Zu den weiteren »Konterrevolutionären« gehörten kirchliche Würdenträger, Polizisten, Esperanto-Sprecher und sogar Briefmarkensammler.[14] Etwa zehn Prozent der Lehrerinnen und Lehrer wurden deportiert oder hingerichtet.[15]
Die deutschen Besatzer hatten in der Folge vorrangig die Kriegsanstrengungen im Blick, und ihre Politik schwankte zwischen den sich widersprechenden Absichten der Militärs, von Himmlers SS, Görings Wirtschaftsplänen und den Vorhaben des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete. Letzteres war derart unfähig, dass es den Spitznamen »Chaosministerium« erhielt. Geführt wurde es von Alfred Rosenberg(1), einem in Tallinn(2) geborenen baltendeutschen Ideologen.[16] Die SS Einsatzgruppe A verhaftete und ermordete rund 1000 der zirka 4000 Jüdinnen und Juden, die im Land geblieben waren, unterstützt von den wieder aufgestellten estnischen Heimatschutzverbänden. Das Besatzerregime ermordete zudem weitere 6000 ethnische Esten und mehrere Tausend Russen, Sinti und Roma sowie sowjetische Kriegsgefangene.[17]
Nach der Rückeroberung Estlands 1944 machte Stalin mehr oder weniger dort weiter, wo er aufgehört hatte. Erst Hunger, dann Elend, so nahmen Zeitgenossen die Lage wahr.[18] Die Bauernhöfe wurde kollektiviert. Wir wissen bis heute nicht genau, wie viele Estinnen und Esten insgesamt deportiert wurden, doch der renommierte Politikwissenschaftler Rein Taagepera(1) schätzt, dass es etwa 124 000 gewesen sein dürften – bei einer Nachkriegsbevölkerung von rund 1,1 Millionen Menschen.[19] In den Schulen ging der Unterricht über die estnische Geschichte und Geografie in der weiter gefassten Geschichte und Geografie der Sowjetunion auf, nachdem er entsprechend der marxistisch-leninistischen Prinzipien überarbeitet worden war. Laut einer Schätzung wurden in den ersten zwei Jahrzehnten der Besatzung mehr als 30 Millionen Bücher zerstört, mit anderen Worten: Auf jeden noch im Land verbliebenen Menschen kamen 22 vernichtete Bücher.[20]
Denkmäler der estnischen Vergangenheit wurden abgerissen, darunter Statuen von Martin Luther und Gustav II. Adolf, dem schwedischen König und Feldherrn, der die Universität Tartu(1) gegründet hatte. Viertausend Kreuze auf den Gräbern von deutschen und estnischen Soldaten im Bezirk Maarjamäe in Tallinn(3) wurden dem Erdboden gleichgemacht. Anschließend nutzte man den Friedhof als Kartoffelacker.
Es erschien nur noch eine Handvoll Bücher mit estnischsprachiger Literatur pro Jahr. Die Geburtenrate sank, die Abtreibungsrate stieg, was zum Großteil mit einem akuten Wohnraummangel und der allgemeinen Lebensunsicherheit zu tun hatte.[21] Im Versuch, die vom Krieg versehrte und überwiegend noch auf Landwirtschaft basierende Wirtschaft des Landes schnell zu industrialisieren, brachte das Sowjetregime derart viele ausländische Arbeitskräfte aus Russland und anderen Teilen der Sowjetunion nach Estland, dass Russisch sprechende Menschen (darunter solche aus anderen Sowjetrepubliken wie der Ukraine und Belarus(3)(4)) mehr als 50 Prozent der Bevölkerung in Tallinn(4) ausmachten. In östlich gelegenen Städten wie Narva(1) und Sillamäe waren es sogar mehr als 90 Prozent.
Dem lettischen Historiker Aldis Purs zufolge durchlebte Estland einen noch dramatischeren demografischen Umbruch als Lettland, obwohl der Gesamtanteil von »Russen« dort höher war. Machten ethnische Esten 1935 noch 88 Prozent der Bevölkerung aus, waren es 1989 nur noch 61 Prozent.[22] Es findet sich die Meinung, dass sich hinter dieser Kolonisierung im Grunde eine völkermörderische Idee verbarg – demnach wollte man das estnische Volk und seine Traditionen auslöschen. Allerdings lassen sich kaum dokumentarische Belege für diese These finden. Der Historiker Peeter Kaasik hält jedoch fest, dass die graduelle Auflösung der »kleineren« Völker der Sowjetunion in der Propaganda als Preis dargestellt wurde, den zu bezahlen es für den Aufbau einer »sowjetischen« Nation lohne. Nach seinen Berechnungen wären die ethnischen Esten, hätte sich der Trend fortgesetzt, im Jahr 2000 zur Minderheit im eigenen Land geworden.[23] Die Kolonisierung mag nicht primär als ein konventioneller Genozid geplant oder ausgeführt worden sein, doch genau das war die sich allmählich einstellende Folge.
Widerstand war ein ebenso wichtiger Teil der modernen estnischen Geschichte wie Unterdrückung und Geduld. Es hat ihn immer gegeben, selbst in hoffnungslosen Zeiten. Wie auch in den anderen baltischen Staaten, begann er mit einem Netzwerk bewaffneter Partisanengruppen, den Metsavennad oder Waldbrüdern. Sie bauten auf dem Kaitseliit auf, dem Verteidigungsbund oder auch Heimatschutz aus Zwischenkriegszeiten. In den Jahren 1945 bis 1953 verfügten sie über etwa 15 000 Mann. Anfänglich erfolgreich, unterlagen sie schließlich der unerbittlichen sowjetischen Taktik, doch die Geschichten ihres Widerstands hielten noch Jahrzehnte danach die Moral der Esten hoch.
Der gewaltlose Widerstand setzte sich denn auch fort, vor allem während des »Chruschtschow-Tauwetters« nach Stalins Tod 1953. Nach der sowjetischen Unterdrückung des Ungarn-Aufstands 1956 und des Prager Frühlings 1968 kam es in Estland zu Unruhen. Die Nationalfarben Blau, Schwarz und Weiß tauchten »zufällig« als Dekoration auf Torten auf, und die estnische Flagge tauchte über Nacht an öffentlichen Plätzen auf. Slogans wie »Russen geht nach Hause« fanden sich auf Häuserwänden in den Städten.[24] Als das Gebäude, in dem 1918 die Unabhängigkeitserklärung verfasst worden war, zum Abriss bestimmt wurde, entfernten Dissidenten heimlich dessen Tür und hielten sie bis zum Ende des Kalten Krieg(9)s auf dem Land in einem Versteck verborgen.[25]
Dem Historiker Mart Laar(1) zufolge, zwei Amtszeiten lang estnischer Ministerpräsident, waren solche Dinge keineswegs ungewöhnlich. Er schätzt, dass mehr als 60 Prozent der Denkmäler für die Kriegstoten des Landes entweder vollständig oder teilweise bis zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit geschützt und versteckt worden seien. »Estland geriet in Orwells 1984 und alles, was an ein freies Estland erinnerte, musste ausgelöscht werden«, sagt Laar:
Aber die Erinnerung war noch da, und wir beschützten sie vor den Sowjets, die sie uns wegzunehmen versuchten. Es war wirklich ein bisschen absurd. Dass ein Volk unter ausländischer Besatzung Gold, Waffen oder auch Bücher versteckt, erscheint verständlich, aber dass man alles riskierte, um große Stein- oder Bronzedenkmäler zu verstecken, wirkt doch völlig unglaubwürdig. Doch genau das haben die Esten getan.
Künstler, Musiker und Schriftsteller spielten ebenfalls eine Rolle, als Zensur und Verfolgung etwas nachließen. Ihre Kritik am Regime war in unterschiedlichem Maß in Wortspielen, Andeutungen und Allegorien verschlüsselt, aber vernehmbar für alle, die Ohren hatten zum Hören. Die landesweiten Liederfeste, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Kern der ersten nationalen Erweckungsbewegung Estlands geworden waren, wurden wieder zugelassen. Unter dem stalinistischen Prinzip »nationalistisch in der Form, sozialistisch im Inhalt« wurden Komponisten dazu angehalten, Loblieder auf Lenin und die kollektive Landwirtschaft zu verfassen. Das ließ Spielraum für Subversion. Rund 100 000 Menschen, mehr als zehn Prozent der ethnisch estnischen Bevölkerung, nahmen an der ersten Wiederbelebung der Tradition 1947 teil. Am Ende des Liederfests leitete Dirigent Gustav Ernesaks(1) einen gewaltigen (Publikums)Chor und sang mit ihm ein neues Arrangement von Lydia Koidula(1)s Gedicht Mein Vaterland ist meine Liebe, das beim ersten Liederfest 1869 ebenfalls angestimmt und zu einer Art Ersatzhymne geworden war. Drei Jahre später allerdings waren die Behörden misstrauisch geworden. Drei der fünf wichtigsten Dirigenten wurden verhaftet und als »Volksfeinde« bezeichnet.[26]
Sagen Sie den Balten, sie sollen mit diesem Unsinn aufhören
Ende der 1970er-Jahre hatte sich unter der Oberfläche gewaltiger Frust aufgestaut. Die Bewohner Nordestlands konnten heimlich finnische Fernsehsendungen anschauen und entdeckten so eine Welt jenseits der sowjetischen Propaganda. Viele waren wütend über die von der Schwerindustrie über ihr Land gebrachte Umweltzerstörung und die überhandnehmende Russifizierung aller Lebensbereiche. Überall war die Verwendung des Russischen vorgeschrieben, von den Kinderkrippen bis zum Gerichtssaal. Der 1960 geborene Laar(2) erinnert sich, welcher russische Satz ihm im Kindergarten zuerst beigebracht worden war: »Ich liebe Lenin, und ich liebe den Frieden.«
Gorbatschows Perestroika- und Glasnost-Reformen ab Mitte der 1980er-Jahre belebten die estnische Nationalbewegung neu. 1987 kam es zu einem gewaltigen Aufschrei, als der Vorschlag bekannt wurde, die Phosphoritminen rund um die im Norden gelegenen Dörfer Kabala und Toolse auszuweiten, war die Natur dort doch bereits zu einer mondartigen Landschaft mit Abraumhalden und nackter Erde verkommen. Die Berge aus radioaktiver Asche waren so hoch, dass die Menschen vor Ort sie mit »Wolkenkratzern« verglichen, und in den umliegenden Dörfern machten Geschichten von Kindern die Runde, denen die Haare ausfielen.[27] Wissenschaftler schätzten, dass bis zu 40 Prozent der nationalen Grundwasservorräte durch die industrielle Ableitung von Uran und anderen Schadstoffen verschmutzt werden würden.[28]
Zu dieser Zeit hatte Kersti Kaljulaid(1), die spätere Präsidentin Estlands, gerade die weiterführende Schule abgeschlossen. »Wir reagierten mit spontanen Kinder- und Schülerprotesten«, erinnert sie sich. »1988 war unsere [National]Flagge nicht zu sehen. Sie war so streng verboten, dass man ins Gefängnis geworfen werden konnte, nur weil man blaue, schwarze und weiße Kleidung trug. Aber wir alle spürten, dass nun etwas passieren würde.«
In den folgenden Monaten wurde das Momentum unaufhaltsam. Im Juni 1988 versammelten sich an fünf Nächten hintereinander Hunderttausende Estinnen und Esten spontan auf dem Gelände des Liederfests und sangen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang lauthals Protestlieder, was den Unabhängigkeitsaktivisten Heinz Valk(1) dazu brachte, von einer »Singenden Revolution« zu sprechen.[29] Im Oktober desselben Jahres gründeten Marju Lauristin(1) und Edgar Savisaar die Rahvarinne (Volksfront), den moderaten Motor der Nationalbewegung. Sechs Wochen später gab der Oberste Sowjet Estlands, das Parlament der Sowjetrepublik, eine »Souveränitäts«-Erklärung heraus, womit er einseitig eine Autonomie anstrebte, die nach dem Wunsch der Abgeordneten zu einer lockeren Föderation mit Moskau führen sollte. Am mutigeren Ende des politischen Spektrums forderten Aktivisten der Gesellschaft für estnisches Kulturerbe wie Trivimi Velliste(1) bereits die völlige Unabhängigkeit von der Sowjetunion.
Zum vielleicht ersten Mal in der Geschichte der baltischen Staaten arbeitete die sich neu entwickelnde Generation von Führungsfiguren auf sinnvolle Art und Weise zusammen. Sie erkannten schnell, dass sie auf sich allein gestellt waren und ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen mussten. Der Westen, gefangen in seiner »Gorbimanie«, lehnte alles ab, was Gorbatschows Position im Kreml in Gefahr bringen konnte. Zu dieser Zeit war der in New Jersey(1) geborene Toomas Hendrik Ilves Chef der baltischen Redaktion des von der US-Regierung finanzierten Radio Free Europe (RFE). Eines Tages, die baltischen Unabhängigkeitsbewegungen nahmen gerade weiter Fahrt auf, bekam Ilves in seinem Münchener Büro Besuch vom westdeutschen Auslandsgeheimdienst. Ilves lud den BND(1)-Mitarbeiter zum Mittagessen ein. »Dann hieb [der BND(2)-Mann] mit einem Mal auf den Tisch, der mitten in dieser großen Kantine stand, und rief: ›Sagen Sie diesen Balten und Esten, sie sollen mit diesem Unsinn einer Unabhängigkeit aufhören‹«, so Ilves. »Na ja, und das war ein ziemlich resonanter Tisch. Der Knall hallte durch diesen riesigen Raum, in dem 800 Leute zu Mittag aßen.«
Am 23. August 1989, in Gang gesetzt von den Protesten kurz zuvor auf dem Tian’anmen-Platz in Peking, von den ersten halbwegs freien Wahlen in Polen seit einem halben Jahrhundert und dem absehbaren Untergang des kommunistischen Regimes in Ungarn, erreichte das innerbaltische Einvernehmen mit einem der einprägsamsten Bilder vom Ende des Kalten Krieg(10)s seinen Höhepunkt. Am fünfzigsten Jahrestag der Unterzeichnung des Molotow-Ribbentrop-Pakts bildeten zwei Millionen Menschen eine fast ununterbrochene Menschenkette durch ganz Estland, Lettland und Litauen. Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, als damals kaum die Hälfte der baltischen Haushalte einen Telefonanschluss hatte, ganz zu schweigen von einem Zugang zu unabhängigen Massenmedien.[30] Kaja Kallas war zu diesem Zeitpunkt zwölf Jahre alt. »Ich war im Haus meiner Großeltern, und wir gingen zu diesem Ort in der Nähe von Viljandi [einer südestnischen Stadt], um uns an den Händen zu halten. Damals verstand ich das nicht. Aber wenn man im Nachhinein sieht, dass es da wirklich eine Kette von Menschen von Litauen bis Estland gab, die gesamte Strecke entlang, die sich alle an den Händen hielten, ohne Lücke: Das war ein sehr starkes Zeichen.«
Die Demonstration des »Baltischen Wegs« brachte Gorbatschow zum ersten Mal dazu, eine wirklich aggressive Warnung gegen die »nationalistischen Exzesse« in den drei baltischen Staaten auszusprechen. »Die Lage der baltischen Völker ist in ernsthafter Gefahr«, erklärte er in einer Fernsehansprache.[31] Doch zu diesem Zeitpunkt war niemand mehr in der Lage, die Welle aufzuhalten – weder Gorbatschow noch Margaret Thatcher(1) oder Helmut Kohl(1), nicht einmal George H. W. Bush. Im März 1990 sprach sich der Oberste Sowjet Estlands dafür aus, in eine »Übergangsphase« in Richtung Unabhängigkeit einzutreten.
Im Januar 1991 rückten sowjetische Truppen und Panzer in Tallinn(5) ein und versuchten, den Fernsehturm, und damit das wichtigste Massenkommunikationsmedium, unter ihre Kontrolle zu bekommen. Er wurde anfangs nur von zwei jungen estnischen Grenzpolizisten bewacht, später dann von einer unbewaffneten Menschenmenge aus Zivilisten. Der sowjetische Kommandeur befahl seinen Panzermannschaften, ihre Kanonen auf den Turm zu richten und drohte damit, ihn zu zerstören. »Machen Sie ruhig«, erwiderte ein Polizist. Der Bluff löste sich in Luft auf.[32]
Sieben Monate später kam es zu einem weiteren Putsch, dieses Mal betrieben von sowjetischen Hardlinern und Reaktionären in der gesamten UDSSR, die Gorbatschow aus dem Amt jagen wollten. »Da ich mich in der Geschichte auskannte, hatte ich [während des Putsches] sehr, sehr große Angst, dass meine Eltern getötet werden könnten und ich sie nie wiedersehen würde«, erklärt Kallas. »Als die [sowjetische] Besatzung begann, hatte man die gesamte politische Elite, die kulturelle Elite, die Wirtschaftselite ausgelöscht; sie wurden entweder getötet oder starben in der Gefangenschaft oder wurden nach Sibirien verbannt. Ich fürchtete, dass sich das wiederholen würde.« Doch auch dieser Putsch scheiterte. Nur Tage später erklärte Estland formell seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion.
Die Singende Revolution fand auch jenseits der Grenzen der baltischen Staaten Widerhall. Natürlich sind die Ursachen der Auflösung der UDSSR zu Beginn der 1990er-Jahre vielseitig und komplex, doch waren es auch diese drei Volksbewegungen, die nicht nur in der Ukraine, Moldau(1) und Belarus(5)(6), sondern auch in Russland selbst auf Nachahmer stießen.
Sie waren dabei nicht nur passives Vorbild: Sie unterstützten aktiv ähnliche Organisationen in anderen Sowjetrepubliken. Die Esten druckten Zeitungen und Wahlkampfzettel für ihre Verbündeten in Leningrad(1) (Sankt Petersburg(3)), und die Sąjūdis, die litauische Entsprechung der lettischen und estnischen Volksfronten, veröffentlichte ein russischsprachiges Nachrichtenblatt namens Soglasie (Harmonie), das mit 40 000 Exemplaren von Moskau über Kyjiw(2) bis nach Jerewan(1) und Tiflis(1) verteilt wurde. Mehrere ukrainische Dissidentengruppen, etwa die Narodnyj Ruch Ukrajiny, orientieren sich bewusst an den baltischen Vorbildern, was so weit ging, dass am 17. September 1989, dem fünfzigsten Jahrestag der sowjetischen Besatzung der Westukraine, eine Menschenkette gebildet wurde. Moldau(2) tat es ihnen im Juni 1990 gleich.[33]
Die Zukunftsfabrik
Als ich mit meinen Recherchen begann, war eines der ersten Bücher, das ich mir kaufte, eine leicht stockfleckige Secondhand-Ausgabe von Lennart Meri(1)s Reden. Ich nahm sie immer mal wieder zur Hand. Nicht unbedingt, weil Meri ein außergewöhnlich begabter Redner gewesen wäre, auch wenn er (oder sein Redenschreiber) sicher ein Händchen für einprägsame Wendungen hatte, die einem selbst mit einem Abstand von 30 Jahren das Gefühl vermitteln, die Welt seit wieder jung. Es lag vielmehr daran, dass eine Rhetorik dieser Güteklasse nur ernsthaften und intensiven Überlegungen entsprungen sein kann.
In einer Phase, in der politische Regeln entsorgt wurden, die zwei Generationen lang unverrückbar waren, beschrieb Meri das ihn umgebende Chaos mit mehr Einsicht und Durchblick als fast jeder andere europäische Spitzenpolitiker seiner Zeit. Er drückte die Hoffnung aus, dass selbst ein kleiner Staat wie Estland, den viele anfangs für etwa so langlebig wie einen Laib Käse hielten, dazu beitragen konnte, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. »Hier […] verwandelt sich Vergangenheit in Gegenwart, Geschichte in Politik«, erklärte er in seiner ersten Rede vor dem NATO-Rat 1992. »Die Politik in unserer modernen Zeit ist wie eine Fabrik, die Zukunft herstellt. Und die baltischen Staaten sind die Experimentalwerkstätten dieser Fabrik.«[34]
Die estnische Werkstatt war einige Jahre lang ein ziemliches Durcheinander. Sie war mit funktionsunfähigen und ineffizienten Werkzeugen ausgestattet, wurde von Finanzkobolden geplagt und von Verbrechern besetzt, die der vorherige Besitzer zurückgelassen hatte. Und in ihrer Nachbarschaft saß eine deutlich größere Konkurrenzfirma, die mit ihr noch einige Hühnchen zu rupfen hatte. In Estland waren noch 132 000 sowjetische Militärangehörige stationiert, verteilt auf 500 Einrichtungen im ganzen Land.[35] Die eigenen, schlecht ausgestatteten Truppen waren sich uneins. Zudem musste der alte Regierungsapparat zerschlagen und neu aufgebaut werden. In der Sowjetära war das estnische Außenministerium ein machtloses Ressort mit wenigen Mitarbeitenden, die vor allem dafür angestellt waren, um den Anschein aufrechtzuerhalten. Als Meri ein Jahr vor der Wiederherstellung der Unabhängigkeit an die Macht kam, entließ er die gesamte Belegschaft und musste feststellen, dass die Bibliothek seines Ministeriums aus 64 Bänden von oder über Lenin und sonst nichts bestand. Die Radio- und Fernsehantennen, die er brauchte, um Nachrichten aus dem Westen folgen zu können, mussten aus Schweden herangeschafft werden. Sie wurden als Skier verpackt und deklariert, um am sowjetischen Zoll vorbeizukommen.[36]
Die Wirtschaft war ein hoffnungsloser Fall. Da die Preise an den Marktkurs von 1990 angepasst wurden und der Handel mit dem postsowjetischen Russland zusammenbrach, schnellte die Inflation in gewaltige Höhen. Zwar stiegen auch die Löhne und Gehälter, doch bei Weitem nicht im selben Maß. Die Arbeitslosigkeit(1), ein unter sowjetischer Herrschaft ziemlich unbekanntes Konzept, stieg innerhalb von zehn Monaten von 900 auf 75 000 Menschen.[37] Von 1991 bis 1993 ging die durchschnittliche Kaufkraft der Esten – also das, was sie sich tatsächlich von ihrem Verdienst leisten konnten – um zwei Drittel zurück.[38] Das Geld verlor so viel an Wert, dass die Stadt Tartu(2) 1992 keine Rubel mehr zur Verfügung hatte und sich dazu entschloss, auf alten sowjetischen Lebensmittelkarten eigenes Geld zu drucken.[39]
Als Moskau Anfang 1992 begann, seine Energielieferungen zu reduzieren, mussten ungeheizte Schulen geschlossen werden. Warmwasser gab es in den meisten Haushalten lediglich am Wochenende. Nur dank humanitärer Hilfe des Westens musste ein Notfallplan zur Evakuierung eines Großteils der Bevölkerung Tallinns aufs Land nicht umgesetzt werden.[40]
Meri hatte nicht übertrieben, als er der Nation im August 1991 erklärte, ihr Kampf habe gerade erst begonnen: »50 harte Jahre haben uns in die Situation geführt, in der wir uns eingestehen müssen: Die Zeit arbeitet gegen uns. Die zerstörerischen Prozesse intensivieren sich und sie umzukehren wird uns eine Menge Anstrengung kosten.«[41]
Goodbye Lenin and Just Do It
All diese Geschehnisse waren die in postkommunistischen Gesellschaften üblichen Symptome bei der Entkoppelung von Unterdrückung, Abhängigkeit und einer verdrehten Wirtschaftslogik. Sie waren wie das akute Fieber, das einen Patienten befällt, dessen Körper gegen ein Virus kämpft. In anderen Staaten führten sie zu Rückfällen, massiver Korruption(1), virulenten populistischen Bewegungen, Grenzkonflikten und Diktaturen. Estland kam in dieser Hinsicht glimpflich davon. Von Anfang an herrschte unter den Eliten ein außergewöhnliches Maß an Konsens darüber, was nötig sei, um das Land »zurück zur Normalität« zu führen: eine schnelle und stringente Liberalisierung der Wirtschaft, eine ebenso rasche Modernisierung der Verwaltungsmaschinerie, der strategische Aufbau zukunftsweisender Industrien, Verhandlungen über den Rückzug der russischen Truppen und vor allem anderen eine energische Anstrengung, um sich aus der Umklammerung Moskaus zu befreien und sich dem Westen zuzuwenden. Nur so könnte eine ausreichend hohe Fluchtgeschwindigkeit erreicht werden, um sich aus der Umlaufbahn des Kreml zu katapultieren.
Obgleich die Regierungen in Estland in den 1990er-Jahren und Anfang der 2000er in schwindelerregender Regelmäßigkeit aufstiegen und untergingen, verfolgten sie doch alle diesen Weg mit einer Konsequenz, wie sie in der ehemaligen Sowjetunion einmalig war. Es gibt eine ganze Reihe Gründe für diese Ausnahmestellung. Zum einen war die alte sowjetische Nomenklatura weithin aus der regierenden Klasse ausgeschlossen. Viele der zentralen Figuren starteten im jungen Alter und mit all der Lebhaftigkeit von Außenseitern: So war beispielsweise Mart Laar(3) erst 32, als er zum ersten Mal zum Ministerpräsidenten gewählt wurde.[42] Auch Estlands Verbindungen nach Finnland und Skandinavien halfen – zum einen wegen der von dort kommenden Investitionen und Ratschläge, zum anderen aber auch als Motivationshilfe: Man wollte aufholen und im nordischen Kontext wieder dort ankommen, wo man sich rechtmäßig verortet sah.





























