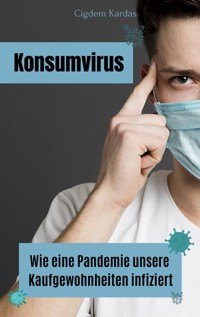
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In meiner ersten Vorlesung versprach mein Professor: "Die Studentenzeit ist die beste Zeit eures Lebens!" Doch 2020 wurde meine Vorfreude zerschlagen: Online-Seminare und Telefonkonferenzen statt lebendiger Gespräche. Ein Phänomen, dem ich auf den Grund gehen wollte, besonders in Zeiten der Corona-Pandemie. Besonders stach mir der Konsum ins Auge: Von schicken Jeans zu Jogginghosen. Karl Lagerfeld behauptete: "Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren." Diese Arbeit, entstanden im März 2021 teilt Fakten und Recherchen. Sie beleuchtet den Wandel im Konsumverhalten und die Herausforderungen, die die Corona-Pandemie brachte. Zum Schluss gewähre ich einen Einblick in abschließende Erkenntnisse und erzähle von meiner persönlichen Reise. Welche Herausforderungen und Veränderungen haben sich ergeben, und wie haben wir uns in dieser turbulenten Zeit angepasst?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
1 Einleitung
1.1 Motivation
1.1. Kapitelüberblick
2 Stand der Forschung
2.1 Die Covid-19 Pandemie
2.1.1 Definition Pandemie
2.1.2 Definition COVID-19
2.1.3 Ansteckung, Übertragung und Schutz/-Hygienemaßnahmen
2.2 Die Konsumgesellschaft
2.2.1 Eine mögliche Definition von Konsumgesellschaft
2.2.2 die Entwicklung der Konsumgesellschaft
2.2.3 Bereiche des Konsums
3 Methode
3.1 Feldforschung
3.2 Teilnehmende Beobachtung
3.3 Interviewmethode
4 Empirische Forschungsdaten
4.2 Feldforschung am 29.12.20 in Bad Nauheim
5 Interpretation der Daten/ Diskussion
5.1 Aller Eingang ist schwer
5.2 Arten von Konsumenten
5.3 Regional und Nachhaltig
5.4 Stresssituationen
5.5 Hamsterkäufe
5.6 Suchtkonsum
5.7 Zwischenmenschliche Interaktionen
5.8 Der Gang zur Kasse
6 Schlussfolgerung
7 März 2024- Ist der Klopapiermangel noch aktuell?
8 Interviews und Informationen zu den Gesprächspartner/innen
Interview 1: Klara Y. – die Kassiererin
Interview 2: Max L. - der Wächter
9 Dankaussagung
10 Literatur
11 Internetquellen
12 Bildquellen
13 Abbildungsverzeichnis
14 Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
Als junge Lehramtstudentin saß ich gespannt in meiner ersten Vorlesung, als die Worte meines Professors wie ein Versprechen in der Luft hingen: „Die Studentenzeit ist die beste Zeit eures Lebens!“ Doch Anfang 2020 wurde meine Vorfreude abrupt zerschlagen. Statt lebendiger Mensagespräche und voller Hörsäle prägten plötzlich Online-Seminare und Telefonkonferenzen meinen Studienalltag. Diese äußerlichen Veränderungen beeinflussten nicht nur unseren Alltag, sondern auch unsere inneren Einstellungen – ob bewusst oder unbewusst. Ein Phänomen, dem ich auf den Grund gehen wollte.
Ein besonderes Thema stach mir dabei ins Auge: Der Konsum. Unsere Neigung zum Konsum, sei es von Filmen, gutem Essen oder Kleidung, prägt unser alltägliches Leben. Und in puncto Kleidung wurde die einstige Freude an schicken Jeans durch die Bequemlichkeit von Jogginghosen ersetzt. Karl Lagerfeld wagte einst die Behauptung: „Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Ein gewagter Satz, dessen Bestätigung oder Widerlegung nicht eindeutig feststeht.
Diese wissenschaftliche Arbeit entstand im März 2021, und heute, drei Jahre später, möchte ich die liebevoll gesammelten Fakten und Recherchen mit euch teilen. Dabei werde ich nicht nur auf den Wandel im Konsumverhalten eingehen, sondern auch die weiteren Entwicklungen und Herausforderungen beleuchten, die die Pandemie in ihrem Verlauf mit sich brachte.
Zum Schluss möchte ich euch einen Einblick in die abschließenden Erkenntnisse gewähren und darüber berichten, wie meine persönliche Reise durch diese Zeit endet. Welche spannenden Herausforderungen und Veränderungen haben sich während dieser Jahre ergeben, und wie haben wir uns dieser turbulenten Zeit angepasst?
1 Einleitung
1.1 Motivation
„Ich meine, wir sollten das, was wir besitzen, bisweilen so anzusehen uns bemühen, wie es uns vorschweben würde, nachdem wir es verloren hätten; und zwar jedes, was es auch sei: Eigentum, Gesundheit, Freude, Geliebte, Weib, Kind, Pferd und Hund: denn meistens belehrt erst der Verlust uns über den Wert der Dinge.“ (von Arthur Schopenhauer 1851, zitiert nach Aphorismen.de).
Das Zitat von Arthur Schopenhauer lässt sich mit anderen Worten grob zusammenfassen als folgende Aussage: „Man weiß erst, was man hatte, wenn man es verliert“. Durch dieses gängige Zitat fühlen sich Viele seit Beginn der Pandemie dieses Jahr angesprochen und die Gesellschaft leidet an den Auswirkungen eines hochgradig ansteckenden Virus, welches den Namen COVID-19 trägt. Großveranstaltungen, Urlaube, Familienfeiern und vieles mehr fallen in Zeiten der sogenannten Lockdowns aus und viele Berufsgruppen werden durch die Pandemie eingeschränkt. Zum Teil ist es diesen sogar verboten, zu arbeiten. Unter diesen Umständen musste die Gesellschaft sich neu finden und mit neuen Regeln und Maßnahmen zurechtkommen, welche unseren Alltag verändern und uns in unseren Freiheiten beschneiden.
Alltagstätigkeiten, wie zum Beispiel das Einkaufen, wurden durch bestimmte Vorschriften und Hygienemaßnahmen eingeschränkt. Abstandsregeln und Maskenpflicht erlauben es der Konsumgesellschaft, Einkäufe im Lebensmittelbereich weiterhin zu tätigen, um für Jeden einen gewissen Lebensstandard während der Pandemie zu ermöglichen. Jedoch haben die Bedingungen der Pandemie viele Verhaltensweisen des Konsums beeinflusst und verändert. In dieser vorliegenden Arbeit wird die Forschungsfrage, inwiefern sich das Konsumverhalten unter den Bedingungen der Pandemie geändert hat, beantwortet.
Ziel ist es, die Konsumgesellschaft in verschiedene Bereiche zu kategorisieren und zu analysieren. Was sind die Beweggründe? Welches Verhalten hat welchen Hintergrund? Was hat sich durch das Virus nicht beeinflussen lassen? Diese Fragen stellt sich nicht nur die darunter leidende Gesellschaft, sondern auch viele Forscher und Wissenschaftler. Um dieser Fragestellung auf den Grund zu gehen, wird in dieser Arbeit eine qualitative Forschung durchgeführt. Zwei von mir angewandte methodische Vorgehensweisen sind das ethnologische Beobachten und das Beschreiben von alltäglichen zwischenmenschlichen Interaktionen. Darauf aufbauend werden Interviews und Gespräche durchgeführt, um die Ergebnisse der Beobachtungen bestärken oder widerlegen zu können. Um einen direkten Bezug auf meine Forschung zu ermöglichen, begebe ich mich persönlich in Märkte und führe dort eine Feldforschung durch.
Meine persönlichen Beobachtungen werden anschließend mit Daten aus aktuellen Artikeln und Sachtexten, welche sich mit dem selben Thema beschäftigen, verknüpft. Diese Ergebnisse werden darüber hinaus anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Die Forschungsfrage wird zum Schluss mit dem Forschungsstand und den ausgewerteten Daten meiner Beobachtung verglichen, diskutiert und interpretiert.
1.1.Kapitelüberblick
Zu Beginn der Arbeit wird der Stand der Forschung beschrieben und in diesem Teil wird auf die COVID-19-Pandemie sowie die Konsumgesellschaft bezogen. Zunächst definiere ich die Pandemie und das Virus an sich. Anschließend gehe ich auf die Übertragung und die dazu gehörigen Schutz/- Hygienemaßnahmen ein. Um ein Bild der Konsumgesellschaft zu skizzieren, wird dieses Thema im nächsten Abschnitt des Kapitels erläutert. Über eine mögliche Definition hinaus, wird die Entwicklung der Konsumgesellschaft nähergebracht. Als Nächstes gehe ich auf den Bezug zwischen dem Sozialverhalten und der Konsumgesellschaft ein. Im zweiten Teil geht es um meine durchgeführte Methodik.
In diesem Kapitel wird die Herangehensweise meiner Feldforschung beschrieben und die dazugehörige teilnehmende Beobachtung beleuchtet. Darauffolgend beziehe ich mich auf mein methodisches Vorgehen in den geführten Interviews.
Im nächsten und wichtigsten Teil meiner Arbeit berichte ich meine Feldforschung und verknüpfe in diesem Kapitel meine gewonnenen Daten und Interviews miteinander. Der Hauptort meiner Feldforschung ist das Rewe-Center in Bad Nauheim, jedoch werde ich auf weitere Beobachtungen aus verschiedenen Märkten eingehen. Die erhobene Datenmenge besteht aus meinen Beobachtungen, die ich während meinen Feldforschungen notiert und anschließend protokolliert habe und einigen aktuellen (Zeitungs)-Artikeln. Im letzten Teil werde ich meine bisherigen gesammelten Forschungsdaten qualitativ interpretieren und diskutieren. Zum Schluss folgt ein Fazit, welches die Forschungsfrage anhand der Ergebnisse reflektiert und beantwortet.
2 Stand der Forschung
2.1 Die Covid-19 Pandemie
“When written in Chinese, the word "crisis" is composed of two characters - one represents danger and one represents opportunity. In a crisis, be aware of the danger - but recognize the opportunity.” (von John Fitzgerald Kennedy 1959/60, zitiert nach Engels o.J.).
Anfang des Jahres 2020 ahnte kaum jemand in Deutschland, dass in diesem Jahr ein hoch infektiöses Virus ausbricht und viele Menschenleben auf den Kopf stellen wird. Die Krankheit namens COVID-19 hat sich durch die Ausbreitung zu einer weltweiten Pandemie entwickelt und sich rasend schnell über den Globus verteilt. Um der Ausbreitung entgegenzuwirken, mussten Lebensumstände verändert und Schutzmaßnahmen eingeführt werden. Der zentrale Aspekt meiner Forschung zeigt, inwiefern die Pandemie das Konsumverhalten der Menschen beeinflusst (hat). Was genau ist aber COVID-19? Wie werden Coronaviren übertragen? Welche Maßnahmen sind einzuhalten und welche Vorkehrungen sind zu treffen? Das Internet und die Medien sind überfüllt mit Informationen über den Virus, weshalb es wichtig ist, nur reliable Daten in Betracht zu ziehen.
2.1.1 Definition Pandemie
Eine Pandemie ist eine sich schnell ausbreitende Krankheit und der sogenannte Influenzavirus wird allgemein auch als Grippevirus bezeichnet. „Bei einer Influenzapandemie führt die fehlende Grundimmunität in der Bevölkerung zu einer erhöhten Zahl von schweren Erkrankungen und Toten.“ (Bundesärztekammer, o.J.). Das Gefährliche hierbei ist, dass der menschliche Körper nicht auf den neuen Erreger vorbereitet ist und demnach ist das Immunsystem nicht ausreichend geschützt und anfälliger für das Virus (vgl. Robert-Koch-Institut 2009).
2.1.2 Definition COVID-19
Die Krankheit COVID-19 wird vom Coronavirus ausgelöst. Viren sind keine Lebewesen und haben auch keinen eigenen Stoffwechsel (vgl. Friebe et al. 2020). Aus diesem Grund brauchen sie um sich zu vermehren einen Wirt. Als Wirte gelten Tiere und Menschen. In dieser Wirtzelle kann das Virus sein Erbgut weitergeben und die Zelle so umprogrammieren, so dass viele Viren produziert werden können. Der Ausbruch dieses Erregers fand auf einem lebendigen Tiermarkt im chinesischen Wuhan statt (vgl. ebd.: 2020).
„Man geht derzeit davon aus, dass Fledermäuse der natürliche Wirt sind und der Erreger über einen anderen tierischen Zwischenwirt in Menschen gelangt ist. Als Sars-CoV-2 wird der Erreger bezeichnet, weil er dem Sars-Erreger von 2002/03 sehr ähnlich ist, also von Experten als eine Variante dieses Virus eingestuft wird. ‚CoV‘ steht für ‚Corona-Virus‘ Die ‚2‘ bedeutet, dass es das zweite bekannte Sars-Virus ist. Die Krankheit, die von dem Virus Sars-CoV-2 ausgelöst wird, heißt offiziell Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)“ (ebd.: 2020).
2.1.3 Ansteckung, Übertragung und Schutz/- Hygienemaßnahmen
Die Übertragung ist über eine Schmier- oder Tröpfcheninfektion möglich und die Viren setzen sich hauptsächlich im Nasen-Rachen-Raum und in den Lungen ab. Die Viren werden durch das Niesen oder Husten in die Luft gewirbelt und die kleinen Flüssigkeitströpfchen können dadurch mit der Atemluft aufgenommen werden. „Aber auch schon beim Sprechen sind Übertragungen denkbar, wenn man sich nah an der sprechenden Person befindet." (ebd.: 2020). Das Coronavirus kann sich auch verbreiten, wenn ein infizierter Mensch die Hand von einem anderen gesunden Menschen berührt und dieser dann die eigene Hand in die Richtung der Nasen-Mund-Augen-Partie führt. „Auf diese Weise gelangen die Viren an die Schleimhäute.“ (ebd.: 2020).
„Verunsicherte Verbraucherinnen und Verbraucher haben beim Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) angefragt, ob das Virus auch über Lebensmittel oder Produkte wie Kinderspielzeug, Mobiltelefone, Gegenstände wie Türklinken, Werkzeuge etc. sowie Geschirr und Besteck auf den Menschen übertragen werden kann.“ (Bundesinstitut für Risikobewertung 2020).
Es sind bisher keine Infektionen bekannt, die auf eine Ansteckung durch Gegenstände zurückzuführen sind (vgl. ebd.: 2020).
Außer der Gegenstand kam direkt mit einem Infizierten in Kontakt, dann kann eine Übertragung durch eine Schmierinfektion möglich sein. Ein höheres Maß an Angst herrscht bei der Bevölkerung auch im Bereich der Lebensmittel. Diese ist jedoch unbegründet, da eine Ansteckung hier ebenso unwahrscheinlich ist (vgl. ebd.: 2020). Um alle Menschen und insbesondere Menschen die einer Risikogruppe angehören gleichermaßen vor dem COVID-19-Virus zu schützen, hat die Bundesregierung mit den entsprechenden Behörden und Institutionen (z.B. mit dem Robert-Koch-Institut1, sowie mit den Gesundheitsämtern) diverse Schutzmaßnahmen und Hygienekonzepte ins Leben gerufen.
Diese Schutzmaßnahmen und Hygienekonzepte betreffen alle in Deutschland lebenden Menschen. Um jeden potentiell gefährdeten COVID-19 Patienten angemessen medizinisch versorgen und behandeln zu können, ist es sehr wichtig, dass die teilweise empfohlenen und zum Teil per Gesetz vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen und Konzepte von jedem Mitglied unserer Gesellschaft eingehalten werden, um Risikogruppen zu schützen und die medizinische Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Eine Nichtbeachtung dieser Hygienekonzepte und Schutzmaßnahmen würde mit einer Überlastung des Gesundheitssystems und der Krankenhäuser einhergehen (vgl. BMBF LS5 Internetredaktion 2020).
Dies hätte katastrophale gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen für die Bundesrepublik Deutschland und würde die Eindämmung und Bekämpfung der Pandemie erheblich erschweren und verlangsamen. „Diese und zukünftige Maßnahmen können aber nur weiter erfolgreich sein, wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürgern die Maßnahmen kennen, sie verstehen und letztlich befolgen.“ (Redaktion: BMBF LS5 Internetredaktion, 2020).
Es gibt allgemeine Schutzmaßnahmen, um sich und andere vor der Krankheit zu schützen, wie zum Beispiel: Die Einhaltung von 1,5 bis 2 Metern Abstand zu anderen Menschen; das Niesen oder Husten in die Armbeuge; regelmäßiges Händewaschen/Händedesinfizieren und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Außerdem sollte man darauf achten, möglichst wenige Objekte im Alltag zu berühren und sich dabei nicht ins Gesicht zu fassen (vgl. BMBF - Lesen & Schreiben - Mein Schlüssel zur Welt 2021).
Bei Krankheitsanzeichen wie Husten oder Fieber, ist es wichtig Zuhause zu bleiben (vgl. ebd.: 2021). Seit dem 27. April 2020 gilt deutschlandweit die Maskenpflicht und zu Beginn des Jahres 2021 herrscht diesbezüglich eine neue Regelung: „Nach dem der Ministerpräsidentenkonferenz vom 19. Januar sollen in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen sogenannte OP-Masken oder auch Masken der Standards FFP2, KN95 oder N95-Masken getragen werden. Die Umsetzung der Regel liegt bei den Bundesländern.“ (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2021b)
Die Masken verhindern beziehungsweise verringern die Möglichkeit einer Tröpfcheninfektion. Hierbei ist es wichtig, die Mund-Nasen-Region gut zu bedecken und ordnungsgemäß zu tragen. Es gibt auch Großstädte, die für einen bestimmten Bereich oder Bezirk eine Maskenpflicht verordnen und bei Nichtbeachtung der Regel Geldstrafen verhängen (vgl. ebd.: 2021). Beim Thema Umgang mit Menschen gibt es regelmäßig neue Vorschriften. Diese besagen, wie viele Haushalte und Menschen sich treffen dürfen. Inwiefern der Kontakt eingeschränkt wird, hängt von den aktuellen Fallzahlen und dem persönlichen Wohnort oder dem betroffenen Landkreis ab.
"Wir wünschen uns unseren Alltag zurück, und zwar mit so wenig Einschränkungen wie möglich. Aber um das zu erreichen, müssen wir die Fallzahlen massiv reduzieren. Und sie müssen auch auf einem niedrigen Niveau bleiben. Es gibt keinen anderen Weg", so Professor Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts in einer Pressekonferenz am 14. Januar (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2021a).
Die Ansteckungsrate, oder auch Reproduktionszahl (R) genannt, wird in einem 7-Tage-Wert gemessen. Dieser Wert, zeigt die Anzahl der Personen, die ein Covid-19-Infizierter im Durchschnitt ansteckt (vgl. ebd.: 2021). „Wenn der R-Wert um 1 schwankt, stagniert das Infektionsgeschehen auf gleichem Niveau. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.“ (ebd.: 2021). Laut des RKI liegt die Ansteckungsrate in Deutschland aktuell bei 0.87 (Stand 20. Januar 2021).
„Das RKI ist die zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention und damit auch die zentrale Einrichtung des Bundes auf dem Gebiet der anwendungsund maßnahmenorientierten biomedizinischen Forschung. Die Kernaufgaben des RKI sind die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, insbesondere der Infektionskrankheiten.“ (Robert-Koch-Institut 2020).
Das RKI ist eine seriöse Quelle, die aktuelle Lage-/Situationsberichte zu COVID-19 bereitstellt und eng mit der Bundesregierung zusammenarbeitet (vgl. Robert-Koch-Institut). Jeder Bürger und jede Bürgerin2





























