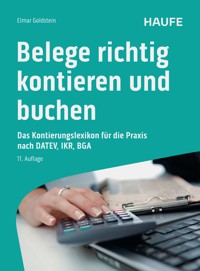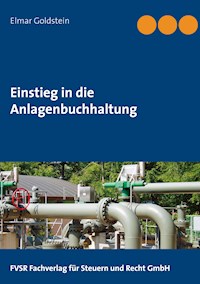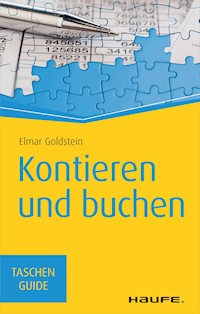
7,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe TaschenGuide
- Sprache: Deutsch
Die Frage nach dem richtigen Konto stellt sich oft auch erfahrenen Buchhaltern. Mithilfe der Kontierungstabellen in diesem Buch können Sie häufig vorkommende Geschäftsvorfälle schnell und sicher den richtigen Konten zuordnen. Inhalte: - Worum es in der Buchhaltung geht - Verlässliche Lösungen, systematisch nach Geschäftsvorfällen geordnet - Zahlreiche Buchungsbeispiele aus der betrieblichen Praxis - Kontierung nach DATEV-Kontenrahmen SKR03 und SKR04 sowie nach IKR und BGA
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumVorwortWorum geht es in der Buchhaltung?Was ist ein Geschäftsvorfall?Ergebnis, Bestands- und ErfolgskontenKontierung: Welche Konten sind betroffen?Auf Erfolgskonten buchenDie Gewinn- und Verlustrechnung nach dem GesamtkostenverfahrenWie Sie Umsatzerlöse buchenWelche Umsätze sind umsatzsteuerpflichtig?Welche Umsätze Sie steuerfrei buchen könnenBauleistungen und Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStGNicht steuerbare Umsätze buchenUmsatzsteuer im Binnenmarkt – so kommen Sie im Dschungel zurechtSo buchen Sie Abzüge von ErlösenBestandsveränderungen buchenEntnahmen, Leistungen an Gesellschafter und AnlagenverkäufeZuschreibungen buchen (Abschlussbuchungen)Erträge aus wertberichtigten ForderungenRückstellungen und Rücklagen auflösenSachbezüge verrechnen und buchenSteuererstattungen aus Vorjahren und sonstige ErträgeAufwendungen richtig kontierenWie Sie Vorsteuerbeträge zuordnen und buchenDie richtigen Konten für den WareneinsatzVerbrauch von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und Energiestoffe buchenWie Sie Aufwendungen bei EU-Geschäften verbuchenUSt-pflichtiger Erwerb ohne VorsteuerabzugWenn Ihnen Nachlässe, Skonti, Boni oder Rabatte gewährt werdenWo Sie die Vorsteuer nicht abziehen dürfenWeitere AufwendungenBestandsveränderungen buchenAufwendungen für bezogene Leistungen buchenSteuerschuldnerschaft nach § 13b UStGPersonalaufwand richtig kontierenWie Sie Löhne und Gehälter verbuchenVon den sozialen Abgaben bis zur AltersversorgungNettolohn- oder Bruttolohnverbuchung?Wie Sie Abschreibungen verbuchenImmaterielle Sachanlagegüter abschreibenMaterielle Sachanlagen abschreibenAbschreibungen des UmlaufvermögensDie sonstigen betrieblichen Aufwendungen buchenKosten für betriebliche Grundstücke und Räume, MietleasingWohin mit den Spenden?Versicherungen, Beiträge und AbgabenReparaturen und InstandhaltungFahrzeugkosten verbuchenGenau trennen: Werbung, Geschenke und BewirtungReisekosten richtig verbuchenProvisionen, Fremdarbeiten und GarantieleistungenVom Porto bis zur FachliteraturRechts- und SteuerberatungBankspesen und KursdifferenzenAbgang von VermögensgegenständenForderungsverluste und sonstige AufwendungenErträge der Positionen 9 bis 11 buchenAbschreibungen und Aufwendungen der Positionen 12 und 13Steuern: die Positionen 14 bis 15Sonstige SteuernKalkulatorische AbgrenzungenBuchungen auf BestandskontenBilanzgliederung im ÜberblickAktivaA. AnlagevermögenI. Immaterielle VermögensgegenständeII. SachanlagenIII. FinanzanlagenB. UmlaufvermögenI. VorräteII. Forderungen und sonstige VermögensgegenständeIII. WertpapiereIV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei KreditinstitutenC. RechnungsabgrenzungspostenD. Aktive latente SteuernPassivaA. EigenkapitalI-III. Gezeichnetes Kapital, Kapital- und GewinnrücklagenIV. Gewinnvorträge/VerlustvorträgeB. Rückstellungen1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen2. Steuerrückstellungen3. Sonstige RückstellungenC. VerbindlichkeitenVon Anleihen bis Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen UnternehmenD. RechnungsabgrenzungspostenE. Passive latente SteuernEröffnungsbilanz und JahresverkehrszahlenEröffnungsbilanzbuchungenJahresverkehrszahlenDer AutorWeitere LiteraturStichwortverzeichnisArbeitshilfen onlineHinweis zum Urheberrecht
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print: ISBN: 978-3-648-11221-2 Bestell-Nr.: 00860-0012
ePub: ISBN: 978-3-648-11222-9 Bestell-Nr.: 00860-0104
ePDF: ISBN: 978-3-648-11223-6 Bestell-Nr.: 00860-0154
Elmar Goldstein
Kontieren und buchen – Richtig, sicher und vollständig nach DATEV, IKR, BGA
12. Auflage 2018
© 2018, Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg
Redaktionsanschrift: Fraunhoferstraße 5, 82152 Planegg/München
Internet: www.haufe.de
E-Mail: [email protected]
Redaktion: Jürgen Fischer
Redaktionsassistenz: Christine Rüber
Umschlaggestaltung: Simone Kienle, Stuttgart
Umschlagentwurf: RED GmbH, Krailling
Satz: Reemers Publishing Services GmbH, Krefeld
Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten.
Vorwort
Welches Konto ist denn jetzt das richtige? Wie lautet der zugehörige Buchungssatz? Wie unterscheiden sich die einzelnen Konten? Selbst der versierte Buchhalter steht immer wieder vor solchen Fragen, will er die verschiedenen betrieblichen Vorgänge richtig buchen.[2]
Dieser TaschenGuide behandelt die in der Praxis häufigsten Kontierungsprobleme, systematisch nach Geschäftsvorfällen eingeteilt. Ob Erlös, Aufwendung, Zinsen oder Abschreibungen – hier finden Sie alle erfolgswirksamen Kontierungsfälle geordnet, so wie sie in der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren erscheinen. Wie Sie richtig auf Bestandskonten buchen, wird anschließend behandelt. Neben den DATEV-Kontenrahmen SKR03 und SKR04 finden Sie Kontierungen im Industriekontenrahmen IKR und Kontenrahmen des Groß- und Außenhandels BGA.
Zahlreiche Buchungsbeispiele aus der Praxis auf Grundlage der DATEV-Kontenrahmen SKR04 (SKR03) und ein ausführliches Stichwortverzeichnis runden den Band ab.
Dipl.-Kfm. Elmar Goldstein
Hinweis: Dieser TaschenGuide versucht, möglichst aktuell zu sein. Dennoch bitten wir um Verständnis, wenn im Einzelfall die konkrete Umsetzung aus dem betrieblichen Alltag zulasten von Aktualität geht. In steuerlichen Zweifelsfällen helfen Ihnen Loseblattwerke aus der Haufe Verlagsgruppe weiter. Anregungen, Kritik und Fragen können Sie auch per E-Mail an [email protected] richten. Wir werden jede Anfrage beantworten und in weiteren Auflagen dieses TaschenGuides berücksichtigen.
Worum geht es in der Buchhaltung?
Die Buchführung ist der zentrale Bestandteil des betrieblichen Rechnungswesens. Durch die korrekte Verbuchung aller Geschäftsvorfälle werden die Daten für die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt.
In diesem Kapitel erfahren Sie[3]
was ein Geschäftsvorfall ist,
wie das Jahresergebnis ermittelt wird und worin sich Bestands- und Erfolgskonten unterscheiden.
In der doppelten Buchführung erfasst man auf Sachkonten sämtliche Geschäftsvorfälle eines laufenden Wirtschaftsjahres sowohl im Hinblick auf ihre Vermögens- als auch Erfolgswirkung. Dementsprechend werden die Sachkonten in Bestandskonten und Erfolgskonten unterschieden.
Wichtig
Als Geschäftsvorfall wird ziemlich abstrakt jede Bewegung von Vermögenswerten innerhalb des Unternehmens oder mit seinem wirtschaftlichen Umfeld bezeichnet.
In der Buchhaltung müssen Sie sämtliche Geschäftsvorfälle erfassen, teilweise mit Auswirkungen auf mehrere Vermögenspositionen.
Was ist ein Geschäftsvorfall?
Hier handelt es sich z. B. um Geschäftsvorfälle:
Mit dem Ausstellen einer Rechnung für erbrachte Leistungen erhebt das Unternehmen eine Forderung und erhöht gleichzeitig seine Umsatzerlöse wie die Umsatzsteuerschuld.
Mit dem Verkauf über den Ladentisch wird der Kassenbestand wie auch der Umsatzerlös und die Umsatzsteuerschuld erhöht.
Bei Entnahme eines Firmenwagens durch den Unternehmer in sein Privatvermögen erhöht sich der Entnahmeerlös und die Umsatzsteuerschuld, der Wert der Privatentnahmen und der Aufwand für den Abgang von Anlagevermögen. Schließlich vermindert dieser einzige Geschäftsvorfall noch den Fahrzeugbestand.
Kein Geschäftsvorfall liegt vor
wenn Sie von der Bank einen Brief erhalten, dass das beantragte Darlehen jederzeit bereitgestellt werden kann,[4]
bei der Zusage „die Lieferung, der Scheck, die Bestellung, der unterschriebene Vertrag ist unterwegs“. Solche „schwebenden Geschäfte“ zu erfassen und zu bewerten ist Aufgabe des Jahresabschlusses. Erst dann müssen angefangene Arbeiten, unfertige Waren und drohende Risiken erkannt werden.
Eine Bürgschaftserklärung wird solange nicht als Geschäftsvorfall erfasst, wie sie nicht in Anspruch genommen wird.
Wichtig
Man kann auch sagen: Jeder Geschäftsvorfall verändert jeweils mindestens zwei Werte in der Bilanz.
Ergebnis, Bestands- und Erfolgskonten
Der Jahresgewinn oder -verlust wird zum Jahresende doppelt festgestellt:
Einmal in der Bilanz durch Vermögensvergleich zu Beginn und Ende des Jahres: Dazu werden sämtliche Bestandskonten abgerechnet. Hat sich das Vermögen vermehrt, schlägt sich der Jahresgewinn als Zuwachs im Eigenkapital nieder, umgekehrt wird bei Verlust das Eigenkapital vermindert.
In der Gewinn- und Verlustrechnung durch Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag. Hier fließen sämtliche Erfolgskonten ein. Der Unterschiedsbetrag (Saldo) entspricht dem Jahresergebnis.
Bestandskonten übernehmen vom Eröffnungsbilanzkonto zu Beginn des Jahres die Anfangsbestände. Nachdem im Laufe des Jahres sämtliche Bestandsveränderungen auf den jeweiligen Konten verbucht wurden, muss der errechnete Jahresendbestand mit dem Inventurwert zum Jahresende übereinstimmen.
Der Endbestand eines Bestandskontos bestimmt sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen beiden Seitensummen, dem Saldo. Wenn der Saldo verbucht wird, gilt das Konto als abgeschlossen. Es muss dann Summengleichheit herrschen.
Auf den Erfolgskonten erfassen Sie im Laufe des Jahres den betrieblichen Aufwand und Ertrag. Buchungen auf diesen Konten beeinflussen letztlich nur ein einziges Bestandskonto, das Eigenkapitalunterkonto „Jahresgewinn“. Zum Jahresende werden sämtliche Erfolgskonten abgeschlossen und über das Hilfskonto „Gewinn- und Verlustkonto“ saldiert. Der Saldo dieses Kontos wiederum entspricht dem Jahresgewinn/Jahresverlust.
Kontierung: Welche Konten sind betroffen?
Die Verbuchung der Geschäftsvorfälle erfolgt in zeitlicher und sachlicher Anordnung jeweils auf mindestens zwei betroffenen Konten. Die Entscheidung, welche Konten tatsächlich betroffen sind, nennt man Kontierung.
Praxis-Beispiel
Der Barkauf von Schreibwaren am 6.7. in Höhe von 238 EUR brutto wird sowohl auf den Konten „Bürobedarf“ und „Vorsteuer“ im Eingang/Soll als auch auf dem Konto „Kasse“ als Ausgang/Haben erfasst. Der Aufwand nimmt in dem Maße zu wie das Vermögen abnimmt.
Um die Buchung zu beschreiben, formuliert man einen standardisierten Buchungssatz, hier:
oder ganz allgemein:
Im DATEV-System wird der Buchungssatz des Beispiels in folgender Buchungszeile erfasst (Konten nach SKR04).
Der Endsaldo jedes Erfolgskontos wird zum Jahresende vom DATEV-System automatisch gegen das Gewinn- und Verlustkonto gebucht und ist damit ausgeglichen.
Auf dem Gewinn- und Verlustkonto erscheinen sämtlicher Aufwand auf der linken Seite, sämtliche Erträge auf der rechten Seite. Der Unterschiedsbetrag zwischen beiden Seiten entspricht dem Jahresergebnis. Ein Saldo auf der linken Seite bedeutet, dass die Erträge rechts den Aufwand links übersteigen. Dies bedeutet einen Gewinn. Steht der Saldo auf der rechten Seite, so war das Jahresergebnis negativ.
Hinweis: Wenn Sie Ihr Wissen über die Buchhaltung auffrischen wollen, können Sie dies mit dem TaschenGuide „Buchführung“ tun, der die Grundlagen der doppelten Buchführung behandelt (mit ausführlichem Übungsteil).
Auf Erfolgskonten buchen
Auf den Erfolgskonten werden die Aufwendungen und Erträge im Lauf eines Geschäftsjahres gebucht. In diesem Kapitel erfahren Sie
aus welchen Positionen die Gewinn- und Verlustrechnung besteht,
wie Sie Umsatzerlöse und Bestandsveränderungen buchen,
wie Sie Aufwendungen und Personalaufwand richtig kontieren,
wie Sie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen buchen,
welche Konten bei den GuV-Positionen 9-13 relevant sind.
Die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren
[7]Nach § 275 HGB müssen Kapitalgesellschaften ihre Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) in Staffelform aufstellen. Kleine und mittlere GmbHs dürfen die Positionen 1 bis 5 zu einem Posten „Rohergebnis“ zusammenfassen. Zwei Verfahren für die Gewinn- und Verlustrechnung sind zulässig, das Umsatzkosten- und das Gesamtkostenverfahren, wobei wir letzteres gewählt haben, da es in Deutschland überwiegend eingesetzt wird. Als Einzelunternehmer können Sie sich – ebenso wie Personengesellschaften – freiwillig an der im HGB vorgegebenen Gliederung orientieren.
Die einzelnen Positionen
Umsatzerlöse
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
andere aktivierte Eigenleistungen
sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen
Personalaufwand
Löhne und Gehälter
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung
Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
sonstige betriebliche Aufwendungen
Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen[8]
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Ergebnis nach Steuern
sonstige Steuern
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Wie Sie Umsatzerlöse buchen
Welche Umsätze sind umsatzsteuerpflichtig?
Die Umsatzsteuer wird in Deutschland als Mehrwertsteuer erhoben. Dies bedeutet für das einzelne Unternehmen eine Besteuerung seiner erzielten Mehrwerte zwischen Einkauf und Verkauf, den bezogenen und erbrachten Leistungen. Zwar schuldet der Unternehmer dem Finanzamt jeweils die volle Umsatzsteuer auf seine Lieferungen und Leistungen; von dieser Schuld kann er aber die seinerseits an andere Unternehmer gezahlte Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen.
Wenn Sie Erlöse buchen, müssen Sie wissen:
Welche Umsätze sind steuerpflichtig?
Welcher Steuersatz gilt?