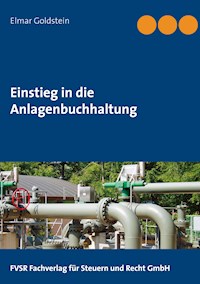Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: FVSR Fachverlag für Steuern und Recht
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Vorwort 7 Grundlagen der Inventur 9 Grundsatz der körperlichen Inventur 9 Körperliche Bestandsaufnahme von Sachanlagevermögen 10 Körperliche Bestandsaufnahme der Vorräte 12 Vollständigkeit der Bestandsaufnahme 14 Die nachprüfbare, richtige und wirtschaftliche Inventur 15 Inventurverfahren 18 Stichtagsinventur 18 Verlegte Inventur 18 Permanente Inventur 20 Stichprobenverfahren 21 Schätzverfahren 23 Testverfahren 24 Vorbereitungen zur Vorratsinventur 25 Festlegen der Inventurbereiche und Regalbelegungsplan 27 Personalplan 28 Aufnahmeplan 29 Schulung des Personals 30 Zeitliche Planung 30 Aufnahmebeleg und Aufnahmelisten 31 Terminsetzung 32 Abgrenzung 33 Umsatzabgrenzung 33 Vorbereitung des Lagers, Verkaufsraumes, der Ware 34 Lager und Handlager 34 Grundsätze der Inventuraufnahme 36 Einweisung des Personals 37 Ausgabe der Belege 37 Aufnahme der Warenbestände 38 Rücklauf der Inventurbelege 39 Inventurleiter prüft: 39 Kontrollen 40 6 Freigabe 41 Abschlussarbeiten 41 Aufbewahrungsfristen 42 Bewertungsmethoden für den Warenbestand 43 Niederstwert 44 Ermittlung des Markt-/Börsenwertes 45 Teilwertabschreibungen 46 Verlustermittlung 47 Verkaufswert 48 Gängigkeitsklassen 49 Pauschale Teilwertabschläge 51 Einzelbewertung 52 Retrograde Methode 53 Durchschnittsbewertung (Gruppenbewertung) 54 Gewogener Durchschnitt 55 Gleitender Durchschnitt 56 Verbrauchsfolgeverfahren 58 Lifo-Verfahren 60 Warenbestands-Veränderungen 63 Inventur-Gewinn-Steuern? 65 Anhang Checklisten und Vordrucke 67 Inventur – Checkliste 67 A. Planung 67 B. Vorbereitung 71 C. Inventurtag 76 D. Abschluss 79 E. Beurteilung 80 Inventurprotokoll für die Vorratsinventur Ausfüllanweisung Merkblatt über Fehlerquellen für Inventuraufsichten Merkblatt für Inventuraushilfen Aufnahmeblatt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 64
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Grundlagen der Inventur
Grundsatz der körperlichen Inventur
Körperliche Bestandsaufnahme von Sachanlagevermögen
Körperliche Bestandsaufnahme der Vorräte
Vollständigkeit der Bestandsaufnahme
Die nachprüfbare, richtige und wirtschaftliche Inventur
Inventurverfahren
Stichtagsinventur
Verlegte Inventur
Permanente Inventur
Stichprobenverfahren
Schätzverfahren
Testverfahren
Vorbereitungen zur Vorratsinventur
Festlegen der Inventurbereiche und Regalbelegungsplan
Personalplan
Aufnahmeplan
Schulung des Personals
Zeitliche Planung
Aufnahmebeleg und Aufnahmelisten
Terminsetzung
Abgrenzung
Umsatzabgrenzung
Vorbereitung des Lagers, Verkaufsraumes, der Ware
Lager und Handlager
Grundsätze der Inventuraufnahme
Einweisung des Personals
Ausgabe der Belege
Aufnahme der Warenbestände
Rücklauf der Inventurbelege
Inventurleiter prüft:
Kontrollen
Freigabe
Abschlussarbeiten
Aufbewahrungsfristen
Bewertungsmethoden für den Warenbestand
Niederstwert
Ermittlung des Markt-/Börsenwertes
Teilwertabschreibungen
Verlustermittlung
Verkaufswert
Gängigkeitsklassen
Pauschale Teilwertabschläge
Einzelbewertung
Retrograde Methode
Durchschnittsbewertung (Gruppenbewertung)
Gewogener Durchschnitt
Gleitender Durchschnitt
Verbrauchsfolgeverfahren
Lifo-Verfahren
Warenbestands-Veränderungen
Inventur-Gewinn-Steuern?
Anhang Checklisten und Vordrucke
Inventur – Checkliste
A. Planung
B. Vorbereitung
C. Inventurtag
D. Abschluss
E. Beurteilung
Inventurprotokoll für die Vorratsinventur
Ausfüllanweisung
Merkblatt über Fehlerquellen für Inventuraufsichten
Merkblatt für Inventuraushilfen
Aufnahmeblatt
Inventurkalender
Vorwort
Jeder Kaufmann hat zu Beginn seines Handelsgewerbes seine Grundstücke, seine Forderungen und Schulden, den Betrag seines Bargelds sowie seine sonstigen Vermögensgegenstände in einem sogenannten Inventar aufzuzeichnen. Dabei muss er den Wert seiner einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden angeben. Zum Ende eines jeden Wirtschaftsjahres ist ein solches Inventar erneut aufzustellen.
Wenn Sie jedes Jahr zur Inventur verpflichtet sind, so will Ihnen dieser kleine Leitfaden die Arbeit erleichtern.
Freiberufler und sämtliche Unternehmer, die ihren Gewinn aufgrund einer Ein- nahmenüberschussrechnung ermitteln (dürfen), sind von dieser Verpflichtung ausgenommen.
Die Bestandsaufnahme selbst bezeichnet man als Inventur.
Die jährlich durchzuführende Inventur dient neben der Feststellung des richtigen Jahresergebnisses auch der Überprüfung und eventuell notwendigen Richtigstellung der buchhalterischen Bestände. Was vielleicht als beiläufige Bestätigung der Zahlen aus der Buchhaltung erscheint, ist tatsächlich eine folgenschwere gesetzliche Pflicht.
Eine nicht ordnungsmäßige Inventur führt dazu, dass selbst die ansonsten nicht zu beanstandende Buchführung des Inventur- und des Folgejahres verworfen werden kann. Es droht dann die Schätzung des Jahresgewinns durch den Steuerprüfer.
Wenn an dieser Stelle zum Thema Inventur hauptsächlich auf die der Warenvorräte eingegangen wird, so weil Planung, Organisation und Durchführung dieser Bestandsaufnahme ungleich mehr Aufwand erfordert, als die sämtlicher anderen Vermögensgegenstände.
Für kleine und mittlere Betriebe könnten die folgenden Anweisungen, Merkblätter und Organisationshilfen zum Teil überdimensioniert sein. Auch sind die an eine Inventur für einen Supermarkt angelehnten praktischen Arbeitsmittel nicht ohne weiteres übertragbar auf z.B. die Lagerinventur eines Handwerksbetriebes.
Auf eine allgemeine und theoretische Darstellung der Inventur, ausführlicher mathematischer Stichproben- und Testverfahren sowie die Lösung von Bewertungsproblemen wurde in diesem Beitrag zugunsten praktischer Arbeitsmittel verzichtet.
Für Fehlerhinweise, Verbesserungsvorschläge und Kritik sind Verlag und Autor dankbar.
Bensheim im April 2016
Dipl.-Kfm. Elmar Goldstein
Grundlagen der Inventur
Welche Grundsätze sind bei der Bestandsaufnahme zu beachten?
Obwohl nicht ausdrücklich geregelt, sollen generell die Vermögensgegenstände körperlich, vollständig und einzeln aufgenommen werden. Ein Inventar muss darüber hinaus richtig und nachprüfbar sein, durch den Aspekt der Wirtschaftlichkeit ist es
jedoch insgesamt vor überzogenen Ansprüchen geschützt.
Grundsatz der körperlichen Inventur
Eine körperliche Bestandsaufnahme (die Inventur im engeren Sinne) ist ohnehin nur bei Sachgegenständen möglich. Das sind in der Regel das materielle Anlagevermögen und die Vorräte.
Forderungen, immaterielle Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten usw. können naturgemäß nicht körperlich aufgenommen werden:
Finanzanlagen sind durch geeignete Dokumente nachzuweisen. Dazu gehören Auszüge aus dem Grundbuch, Hypotheken- und Grundschuldbriefe, Depotbestätigungen, Vertragsunterlagen
Forderungen (Debitoren) und Verbindlichkeiten (Kreditoren) werden in Saldenlisten erfasst. Bei großen oder zweifelhaften Beträgen empfiehlt es sich, von Kunden und Lieferanten Saldenbestätigungen einzuholen
Kontostände bei Kreditinstituten werden durch die Auszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen, ebenso Wertpapiere in Depotverwaltung zur kurzfristigen Anlage
Körperlich aufgenommen werden hingegen die Wertpapiere in Eigenverwaltung sowie Bargeld, Besitzwechsel und Schecks.
Verbindlichkeiten, die der Kaufmann als Akzeptant eines gezogenen oder als Aussteller eines eigenen Wechsels übernommen hat, ergeben sich aus dem Schuldwechselbuch
Bei der Erfassung langfristiger Verbindlichkeiten wie z.B. Bankdarlehen zieht man die entsprechenden Vertragsunterlagen heran. Zusätzlich sollen Art und Umfang der Besicherung einer langfristigen Verbindlichkeiten dokumentiert sein
Körperliche Bestandsaufnahme von Sachanlagevermögen
Da Sachanlagen dazu bestimmt sind, dem Betrieb auf Dauer zu dienen, ändern sich ihre Bestände in geringerem Maße als bei häufig umgeschlagenen Vorräten. Allerdings unterliegen die abnutzbaren Anlagegüter einer zumindest regelmäßigen Wertveränderung durch Abschreibungen und ggf. Zuschreibungen.
Weniger als auf die Bestandsaufnahme zum Ende des Geschäftsjahres kommt es deshalb beim Anlagevermögen darauf an, wie es sich im Laufe des Jahres entwickelt hat. Diese Entwicklung sollte aufgezeichnet werden. Zu- und Abgänge des Anlagevermögens können in der Regel von den Anlagekonten der Finanzbuchhaltung abgelesen werden. Hingegen sind wertmäßige Änderungen schon wegen möglicher Bewertungswahlrechte erst beim Jahresabschluss vorzunehmen. Wenn dieses Bestandsverzeichnis z.B. als sogenannter Inventarbogen oder in Form einer Anlagenkartei bestimmten Erfordernissen genügt, können Sie auf eine körperliche Bestandsaufnahme des beweglichen Anlagevermögens zum Jahresende verzichten.
Diese Voraussetzungen sind:
die genaue Bezeichnung des Gegenstandes
der Buchwert am Bilanzstichtag
den Tag der Anschaffung oder Herstellung
die Abschreibungsmethode und die Nutzungsdauer
die Höhe der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
der Tag des Abgangs und
ggf. Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen
Dennoch sollte hin und wieder überprüft werden, ob die in der Buchhaltung ausgewiesenen Anlagengegenstände tatsächlich noch vorhanden sind.
Selbst bei sonst ordnungsmäßiger Buchführung kann es vorkommen, dass
für neu angeschaffte Maschinen keine Anlagenkarte angelegt wurde oder weil kein Zahlungsvorgang existiert und deshalb nicht verbucht ist z.B.,
das Verschrotten einer alten Maschine oder
die Entnahme eines gebrauchten Computers übersehen wird
Solche Fehler werden ggf. nur durch eine körperliche Aufnahme erkannt. Im Normalfall sollte sich jedoch aus der obigen Fortschreibung der zum Bilanzstichtag richtige Bestand ermitteln lassen.
Überprüfen Sie anhand der Anlagenkartei bzw. -datei oder dem Inventarbogen bereits vor der Fortschreibung, ob sämtliche der verzeichneten Anlagegüter noch im Betrieb eingesetzt sind. Stellen Sie fest, dass keine Anschaffung vergessen wurde:
eine Anschaffung durch private Mittel
die Übernahme aus einem Leasingvertrag oder
ein Tauschgeschäft oder Inzahlungnahme.
Zwischen 10% und 50% betrieblich genutzte Wirtschaftsgüter sind für Kaufleute willkürbar. So können Sie beispielsweise Ihren privaten Pkw, der bereits im Betrieb eingesetzt wird, als gewillkürtes Anlagegut einlegen.
Geringwertige Anlagegüter (Anschaffungs-/Herstellungskosten bis 410 EURO netto) sind nicht in das Bestandsverzeichnis aufzunehmen, wenn sie im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben werden.
Geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert von bis zu 1.000 EUR im sogenannte „Sammelpool“ müssen ebenfalls nicht aufgezeichnet werden.
Ebenfalls nicht im Anlageverzeichnis werden solche Gegenstände erfasst, bei denen ein Festwert zulässigerweise angesetzt werden darf (auf die Festbewertung soll nicht weiter eingegangen werden, da dieses in sich komplizierte Verfahren tatsächlich nur in speziellen Fällen zur gewünschten Vereinfachung führt).
Körperliche Bestandsaufnahme der Vorräte
Unter “Gegenstände des Vorratsvermögens” fallen alle Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige und fertige Erzeugnisse sowie Handelsware. Eine körperliche Bestandsaufnahme zu einem Stichtag ist nur dann nicht erforderlich, wenn eine zuverlässige Bestandsbuchführung existiert. Als zuverlässig gilt hierbei, wenn einmal im Jahr die Übereinstimmung der Sollbeständen mit den körperlich aufgenommenen Istbeständen festgestellt wird. Dies kann z.B. für jede Warengruppe zu verschiedenen Zeitpunkten zum jeweiligen Minimalbestand geschehen (siehe dazu den Stichpunkt: Permanente Inventur).
Körperlich erfasst werden die vorhandenen Mengen nach handelsüblicher Stückzahl, Längen-, Flächen- und Raummaßen sowie dem Gewicht. Verwenden Sie zur eindeutigen Identifizierung die entsprechende Kennung der Gegenstände (Serien-, Chargen-, Fahrgestellnummer). Sofern Sie dies vertreten können, wird auch die Erfassung in handelsunüblichen Größen zulässig:
Kleinteile brauchen nicht gezählt sondern dürfen abgewogen werden, wenn das Gewicht von beispielsweise 10 Stück genau ermittelt wurde. Der Bestand an gleichartig gestapelten Vorräten wie z.B. Bleche, Rohre und Papier in Stückmenge lässt