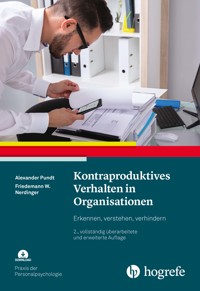
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kontraproduktives Verhalten ist ein vielfältiges und vielschichtiges Problem für Organisationen. Ob Diebstahl, Sabotage, Betrug, Mobbing, Diskriminierung oder Cyberloafing – solches Verhalten verletzt die legitimen Interessen einer Organisation und schädigt diese als Ganzes oder deren einzelne Mitglieder. Die Ursachen für kontraproduktives Verhalten liegen häufig in einem komplexen Zusammenspiel aus Persönlichkeitseigenschaften, Merkmalen der Arbeitstätigkeit, Verhaltensweisen der Führungskräfte und Normen der Organisation. Die Neubearbeitung des Bandes "Unternehmensschädigendes Verhalten erkennen und verhindern" gibt auf der Basis des aktuellen Forschungsstands einen fundierten und praxisnahen Überblick über Erklärungsmodelle und empirische Befunde zur Entstehung kontraproduktiven Verhaltens. Darauf aufbauend werden Handlungsansätze zur Diagnose und Prävention kontraproduktiven Verhaltens (z. B. Organisationsentwicklung, Führungskräftetrainings, Personalauswahl) aufgezeigt und konkrete Vorgehensweisen sowie Besonderheiten des Vorgehens bei spezifischem Fehlverhalten wie sexueller Belästigung, Mobbing oder destruktiver Führung diskutiert. Fallbeispiele, in denen unterschiedliche Aspekte des Umgangs mit kontraproduktivem Verhalten thematisiert und kommentiert werden, runden den Band ab. Die im Anhang des Buches zur Verfügung gestellten praktischen Hilfen können nach erfolgter Registrierung zusätzlich von der Hogrefe Webseite heruntergeladen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Alexander Pundt
Friedemann W. Nerdinger
Kontraproduktives Verhalten in Organisationen
Erkennen, verstehen, verhindern
2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
Praxis der Personalpsychologie
Human Resource Management kompakt
Band 15
Kontraproduktives Verhalten in Organisationen
Prof. Dr. Alexander Pundt, Prof. Dr. Friedemann W. Nerdinger
Die Reihe wird herausgegeben von:
Prof. Dr. Jörg Felfe, Prof. Dr. Benedikt Hell, Dr. Rüdiger Hossiep, Prof. Dr. Martin Kleinmann, Prof. Dr. Bettina Kubicek
Die Reihe wurde begründet von:
Prof. Dr. Heinz Schuler, Dr. Rüdiger Hossiep, Prof. Dr. Martin Kleinmann, Prof. Dr. Werner Sarges
Prof. Dr. Alexander Pundt, geb. 1978. Studium der Psychologie in Leipzig, 2004 – 2010 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der Universität Rostock. 2010 Promotion. 2011 – 2017 Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Postdoc) am Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Mannheim. Seit 2017 Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der MSB Medical School Berlin. Arbeitsschwerpunkte: Organizational Behavior, Kreativität und Innovation, Führung, Humor in Organisationen.
Prof. Dr. Friedemann W. Nerdinger, geb. 1950. Studium der Psychologie in München. 1989 Promotion. 1993 Habilitation. 1995 – 2016 Professor für Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der Universität Rostock. Seit 2016 Seniorprofessor für Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der Universität Rostock.
Die erste Auflage dieses Buches ist 2008 unter dem Titel „Unternehmensschädigendes Verhalten erkennen und verhindern“ unter der Autorenschaft von Friedemann W. Nerdinger erschienen.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten. All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © stock.adobe.com / Andrey Popov
Satz: Franziska Stolz, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2025
© 2008 und 2025Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3219-9; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3219-0)
ISBN 978-3-8017-3219-6
https://doi.org/10.1026/3219-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Die Inhalte dürfen nicht zur Entwicklung, zum Training und/oder zur Anreicherung von KI-Systemen, insbesondere von generativen KI-Systemen, verwendet werden. Das Verbot gilt nicht, soweit eine gesetzliche Ausnahme vorliegt.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet umrandete Seitenzahlen (Beispiel: 1) und in einer Seitenliste, die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Übersicht
Cover
Titel
Über die Autor:innen
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
8 Anhang
VInhaltsverzeichnis
Kontraproduktives Verhalten in Organisationen
1
Kontraproduktives Verhalten
1.1
Einordnung
1.2
Definition
1.3
Abgrenzung zu ähnlichen Begriffen und Konzepten
1.4
Bedeutung für das Personalmanagement
1.5
Betrieblicher Nutzen
1.6
Weitere Ziele
2
Theorien und Modelle
2.1
Austauschtheoretische Ansätze und Bruch des psychologischen Vertrags
2.2
Theorie affektiver Ereignisse
2.3
Stresstheoretische Ansätze: Das Stressor-Emotions-Modell
2.4
Soziologische Perspektive: „Brauchbare Illegalität“ und die drei Seiten der Organisation
3
Analyse der Bedingungen und Handlungsempfehlungen
3.1
Persönlichkeitsmerkmale
3.1.1
Das Fünf-Faktoren- und das HEXACO-Modell
3.1.2
Die dunkle Triade
3.2
Motivation kontraproduktiven Verhaltens
3.3
Stress
3.4
Führung
3.5
Kolleginnen und Kollegen
3.6
Organisation, Organisationskultur und Organisationsklima
3.7
(Un-)Gerechtigkeit
4
Vorgehen
4.1
Grundlegende Überlegungen
4.2
Diagnose und Erfassung von kontraproduktivem Verhalten
4.3
Prävention von kontraproduktivem Verhalten
4.3.1
Einführung eines Compliance Management
4.3.2
Organisationsentwicklung
4.3.3
Führung und Führungskräftetrainings
4.3.4
Personalauswahl
4.3.4.1
Das Einstellungsinterview
4.3.4.2
Integritätstests und Erfassung der „dunklen Triade“
4.4
Maßnahmen und Sanktionen bei kontraproduktivem Verhalten
4.4.1
Das Schweigen brechen
4.4.2
Kritikgespräche führen
4.4.3
Eskalation der Reaktionen/Sanktionen
4.5
Besonderheiten des Vorgehens bei spezifischem Fehlverhalten
4.5.1
Umgang mit Mobbing und Unhöflichkeit (Incivility)
4.5.2
Umgang mit Diskriminierung
4.5.3
Umgang mit sexueller Belästigung
4.5.4
Umgang mit Cyberloafing
4.5.5
Umgang mit destruktiver Führung
4.6
Fazit
5
Fallbeispiele aus der Praxis
5.1
Reaktionen auf Mobbingvorwürfe in einer Forschungsorganisation
5.2
Einführung eines Verhaltenskodex in einem multinationalen Unternehmen
5.3
Verhaltensgrundsätze in einer Fakultät für Pharmazie
5.4
Missbrauch von Telefonanlagen – Die 0900er-Nummer
6
Literaturempfehlungen
7
Literatur
8
Anhang
Hinweise zu den Online-Materialien
Checkliste zur Vorbereitung von Maßnahmen zur Bekämpfung kontraproduktiven Verhaltens
Checkliste „Verfahren gerecht gestalten“ und „Sich gerecht verhalten“
Checkliste zur Vorbereitung und Durchführung formaler Kritikgespräche
9
Sachregister
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Mittlere Anzahl an archivierten Delikten kontraproduktiven Verhaltens im Zeitverlauf nach einer Beförderungsentscheidung (nach Fine et al., 2016, S. 1724f.)
Abbildung 2: Theorie affektiver Ereignisse (nach Weiss & Cropanzano, 1996, S. 12)
Abbildung 3: Konsequenzen täglicher affektiver Ereignisse für negative emotionale Reaktionen und kontraproduktives Verhalten (nach Matta et al., 2014, S. 930)
Abbildung 4: Das Stressor-Emotions-Modell des kontraproduktiven Verhaltens (nach Spector & Fox, 2005, S. 158)
Abbildung 5: Die drei Seiten der Organisation (eigene Darstellung nach Kühl, 2020a)
Abbildung 6: Der Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung der Arbeitsumwelt für die eigene Entwicklung und der Zurückhaltung von Leistung in Abhängigkeit von der Gewissenhaftigkeit (nach Colbert et al., 2004, S. 606)
Abbildung 7: Zusammenhang zwischen Psychopathie und interpersonalem kontraproduktivem Verhalten in Abhängigkeit von politischen Fertigkeiten (nach Schütte et al., 2018, S. 1357)
Abbildung 8: Modell der Motivation des Fehlverhaltens in Organisationen (nach Vardi & Wiener, 1996, S. 157)
Abbildung 9: Zusammenhänge zwischen Stressoren und kontraproduktivem Verhalten bei einer Stichprobe von Zeitarbeitern (eigene Darstellung nach Striler et al., 2021, S. 337)
Abbildung 10: Zusammenhang zwischen Aufgabenorientierung der Führungskraft und kontraproduktivem Verhalten der Mitarbeiter in Abhängigkeit von der Mitarbeiterorientierung der Führungskraft (nach Holtz & Harold, 2013, S. 504)
Abbildung 11: Motive des Diebstahls in Organisationen (nach Greenberg, 1997, S. 89)
Abbildung 12: Beispielhafte Darstellung eines Items unter Verwendung der Unmatched Counting Technique (Block 6a mit kritischer Aussage, Block 6b ohne kritische Aussage)
Abbildung 13: Beispielhafte Darstellung eines Items unter Verwendung der Randomized Response Technique
Abbildung 14: Grober Ablauf einer Mitarbeiterbefragung im Rahmen des Auftau- und Einbindungsmanagement-Programms (in Anlehnung an Borg, 2015, S. 20)
Abbildung 15: Metaanalytische Zusammenhänge zwischen Integritätstests und kontraproduktivem Verhalten (nach Van Iddekinge et al., 2012)
Abbildung 16: Zusammenhang zwischen dem Ausgang einer Beförderungsentscheidung und anschließend auftretendem kontraproduktivem Verhalten bei Offiziersanwärtern in Abhängigkeit von deren persönlicher Integrität (nach Fine et al., 2016, S. 1726)
Abbildung 17: Alternative Formulierungen zur Vermeidung von Warum-Fragen (nach Patrzek, 2021, S. 20)
Abbildung 18: Häufigkeiten der von Personalern genannten Präventionsstrategien im Umgang mit Mobbing (nach Salin et al., 2020, S. 2630)
Abbildung 19: Häufigkeiten der von Personalern genannten Interventionsmaßnahmen im Umgang mit Mobbing (nach Salin et al., 2020, S. 2633)
Abbildung 20: Zusammenhang zwischen Stresserleben der Führungskraft und Einschätzungen destruktiver Führung durch die Mitarbeiter in Abhängigkeit von Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) (nach Pundt & Schwarzbeck, 2018, S. 486)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Zusammenhänge zwischen dem Fünf-Faktoren-Modell und kontraproduktivem Verhalten (nach Pletzer et al., 2019)
Tabelle 2: Metaanalytisch ermittelte Zusammenhänge zwischen den Ausprägungen der Dunkle-Triade-Persönlichkeitsmerkmale und kontraproduktivem Verhalten (nach O‘Boyle et al., 2012)
Tabelle 3: Zusammenhänge zwischen den Gerechtigkeitsformen und Rückzugsverhalten bzw. negativen Reaktionen (nach Colquitt et al., 2001, S. 436)
Tabelle 4: Vergleich der ermittelten Verbreitung von Mitarbeiterdiebstählen nach Erfassungsmethoden (nach Wimbush & Dalton, 1997)
Tabelle 5: Zusammenhänge zwischen den Merkmalen der dunklen Triade – gemessen über die Dark Triad of Personality at Work (TOP) – und verschiedenen kontraproduktiven Verhaltensweisen (nach Schwarzinger, 2020, S. 148)
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
142
143
144
145
146
147
11 Kontraproduktives Verhalten
1.1 Einordnung
In der Unternehmenspraxis stehen Ideen der Positiven Psychologie aktuell hoch im Kurs und entsprechende Publikationen erfreuen sich großer Beliebtheit (z. B. Rose, 2019). Vor allem seitens der Beraterbranche wird gern immer wieder betont, man wolle sich vor allem auf die Förderung des Positiven in Organisationen konzentrieren und stellt die Sinnhaftigkeit von Arbeit, Glückserleben, persönliches Wachstum oder eine Orientierung an individuellen Stärken in den Vordergrund. Dies ist im Einklang mit den erstmals von Seligman und Csikszentmihalyi (2000) formulierten Ideen, die jedoch auch einige Kritik gefunden haben. Zum einen kann man den mit der Positiven Psychologie oftmals verbundenen Neuheitsanspruch vor allem in der Personal- und Organisationspsychologie durchaus in Zweifel ziehen, zum anderen – und dies führt zum Thema dieses Buches – besteht bei einer Fokussierung auf positive Phänomene die Gefahr, wichtige Aspekte des arbeitsbezogenen Erlebens und Verhaltens auszuklammern (z. B. Fineman, 2006).
Hier setzt das vorliegende Buch an und thematisiert mit dem kontraproduktiven Verhalten einen für Organisationen sehr relevanten Ausschnitt aus dem Verhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern1. Beispiele für kontraproduktives Verhalten sind Diebstahl, Sabotage, Arbeitszeitbetrug, aber auch Verhaltensweisen wie Mobbing oder unhöfliches verbales Verhalten gegenüber Kolleginnen und Kollegen bis hin zu offenen Aggressionen und sexuellen Belästigungen. Korruption und Cyberloafing stellen aktuelle Phänomene in diesem Zusammenhang dar. Unternehmen und andere Organisationen sind auf Mitarbeitende angewiesen, die die legitimen Interessen der Organisation wahren, also kein kontraproduktives Verhalten an den Tag legen.
In der Praxis erscheint kontraproduktives Verhalten sehr häufig vor allem als ein arbeitsrechtliches Problem – diskutiert werden in diesem Zusammenhang disziplinarische Maßnahmen wie Abmahnungen, außerordentliche Kündigungen oder Verdachtskündigungen (vgl. Junker, 2022). Zweifellos sind dies für die Personalpraxis unverzichtbare Instrumente im Umgang mit solchen Verhaltensweisen. Für die Prävention kontraproduktiven Verhaltens greifen diese Instrumente jedoch zu kurz, was sich bereits darin zeigt, dass kontraproduktive Verhaltensweisen trotz der Gefahr arbeitsrechtlicher Konsequenzen immer wieder auftreten. Die Frage nach möglichen Ursachen und daraus ableitbaren Maßnahmen zur Prä2vention kontraproduktiven Verhaltens ist also vor allem eine personalpsychologische Frage.
Ziel des vorliegenden Buches ist es nun, diese Frage systematisch und auf der Basis reichhaltiger Erkenntnisse aus der empirischen personalpsychologischen Forschung zu beantworten. Das Buch stellt die vollständige Überarbeitung und erhebliche Erweiterung des in der Reihe Praxis der Personalpsychologie erschienenen Bandes Unternehmensschädigendes Verhalten erkennen und verhindern (Nerdinger, 2008) dar. Die bisherigen Inhalte werden um neuere Erkenntnisse zum Thema kontraproduktives Verhalten erweitert (z. B. Liao et al., 2021), außerdem werden die bisher eher auf die Prävention ausgerichteten Ausführungen zu Maßnahmen im Umgang mit kontraproduktivem Verhalten um die Perspektive der Intervention und Reaktion ergänzt. Neu hinzugefügt wurden auch Überlegungen und Erkenntnisse zu spezifischen kontraproduktiven Verhaltensweisen wie etwa Mobbing, sexuelle Belästigung, Diskriminierung, Cyberloafing oder destruktiven Führungsverhaltensweisen. Neben der im Themenfeld üblichen Fokussierung der Forschung auf individuelles Verhalten einzelner Organisationsmitglieder ergänzen wir in diesem Buch diese Perspektive um eine Analyse der Bedingungen der Organisation, die ein solches Verhalten begünstigen. Zum einen sind wir überzeugt, damit den in Organisationen tätigen Führungskräften oder Personalspezialisten wichtige Impulse zu geben. Zum anderen finden hier eventuell auch Forschende neue Anregungen für weiterführende Forschungsfragen. Im Einklang mit neueren Bänden der Reihe Praxis der Personalpsychologie wird der Text durch konkrete Fallbeispiele aus Organisationen abgerundet.
1.2 Definition
Kontraproduktives Verhalten tritt in den verschiedensten Formen auf, und genau das macht es so schwierig, zu einem einheitlichen Begriffsverständnis zu kommen. Aber praktisch alle Akte kontraproduktiven Verhaltens teilen folgende Merkmale (Marcus & Schuler, 2004; vgl. Nerdinger et al., 2019):
Kontraproduktives Verhalten verletzt die legitimen Interessen einer Organisation, wobei es prinzipiell deren Mitglieder oder die Organisation als Ganzes schädigen kann.
Diese Definition, die – wie es der Begriff der Kontraproduktivität nahelegt – aus der Sicht der Organisation formuliert ist, umfasst drei wesentliche Merkmale:
Unabhängig von den Ergebnissen des Verhaltens müssen absichtliche Handlungen vorliegen: Ein Gabelstaplerfahrer kann bei der Arbeit aus Versehen ein Regal rammen, wodurch dem Unternehmen ein großer Schaden entsteht. In 3diesem Fall handelt es sich um Pech oder ein Unglück, aber nicht um kontraproduktives Verhalten. Beschädigt er aber absichtlich sein Arbeitsgerät, zum Beispiel mit dem Ziel, sich eine kleine Arbeitspause zu verschaffen, liegt kontraproduktives Verhalten vor (auch wenn der Schaden relativ gering und leicht zu beheben ist).
Das Verhalten muss prinzipiell in der Lage sein, der Organisation Schaden zuzufügen, wobei dieser Schaden nicht notwendigerweise auch eintreten muss: Wenn sich eine Kraftfahrerin betrunken ans Steuer setzt, handelt sie kontraproduktiv, auch wenn sie keinen Unfall hat. Umgekehrt kann die Kreditvergabe einer Bank immer auch zu einem Verlust führen, zum Beispiel, weil die Kreditnehmerin irgendwann aus nicht vorhersehbaren Gründen nicht mehr in der Lage ist, den Kredit zu bedienen. Trotz des Schadens liegt aber in diesem Fall kein kontraproduktives Verhalten der Mitarbeiter vor, die den Kredit vergeben haben.
Das Verhalten muss den legitimen Interessen der Organisation entgegenstehen und dabei nicht durch andere, ebenfalls legitime Interessen aufgewogen werden: „Blaumachen“, d. h. sich krank zu melden, ohne krank zu sein, ist kontraproduktives Verhalten; bei Krankheit zu Hause bleiben ist dagegen nicht nur gerechtfertigt, sondern liegt im Interesse der Person und der Organisation und ist daher als produktives Verhalten zu bezeichnen.
Schließlich ist noch ein weiterer Punkt zu bedenken: Kontraproduktives Verhalten zieht nicht immer unmittelbaren Schaden nach sich, sondern kann unter Umständen zunächst sogar produktiv wirken. Gesteht zum Beispiel die Personalleiterin eines Unternehmens ihren Betriebsräten unbeschränkte Spesen ohne korrekte (nachprüfbare) Abrechnung zu, kann das zunächst für das Unternehmen durchaus produktiv wirken: Vielleicht lassen sich nicht zuletzt deshalb eine Vielzahl mitbestimmungspflichtiger Probleme reibungslos und ohne Widerstand des Betriebsrats lösen. Auf den ersten Blick scheint es sich also um ein produktives Verhalten der Personalleiterin zu handeln. Da sie damit aber gegen allgemein akzeptierte Normen verstößt, kann ihr Verhalten – wenn es denn bekannt wird – der Firma enormen Schaden zufügen, man denke hier nur an deren Imageverlust. Da aber immer damit zu rechnen ist, dass eine solche Praxis bekannt wird, muss auch dieses Verhalten letztlich zumindest als potenziell kontraproduktiv und somit als unternehmensschädigend eingestuft werden.
Nach der hier zugrunde gelegten Definition ist kontraproduktives Verhalten ein sehr weites Feld, weshalb Marcus und Schuler (2004) im vorliegenden Fall auch von allgemeinem kontraproduktivem Verhalten sprechen. Die enorme Vielfalt der mit dem hier interessierenden Begriff bezeichneten Verhaltensweisen bildet ein zentrales Problem für die Untersuchung kontraproduktiven Verhaltens. Daher wird zunächst eine Abgrenzung zu ähnlichen Konzepten versucht.
41.3 Abgrenzung zu ähnlichen Begriffen und Konzepten
Gruys und Sackett (2003) haben 87 Formen kontraproduktiven Verhaltens in der wissenschaftlichen Literatur nachgewiesen, die sich zu elf Kategorien zusammenfassen lassen, darunter u. a. Diebstahl, Beschädigung oder Zerstörung von Firmeneigentum (Sabotage etc.), Missbrauch von Informationen (Fälschung von Akten, Verrat vertraulicher Informationen), Arbeitszeitbetrug, Alkoholmissbrauch und Drogenvergehen sowie unangemessenes Sozialverhalten.
Bei dieser Vielfalt von unterschiedlichen kontraproduktiven Verhaltensweisen ist es nicht verwunderlich, dass in der wissenschaftlichen Forschung fast ebenso viele Konzepte zu ihrer Untersuchung herangezogen werden (Nerdinger et al., 2019). Meistens handelt es sich dabei jedoch um Konzepte, die ein spezifisches Erkenntnisinteresse in den Vordergrund rücken:
So werden unter dem Begriff des unzivilisierten Verhaltens („workplace incivility“) Verhaltensweisen zusammengefasst, welche die Normen des Respekts in interpersonalen Beziehungen verletzen und damit als rüdes, respektloses Verhalten bezeichnet werden können (Chris et al., 2022).
Diskriminierung hingegen beschreibt ungerechtfertigte oder schädliche Verhaltensweisen gegenüber einem Mitglied einer Gruppe allein wegen dessen Zugehörigkeit zu dieser Gruppe (Aronson et al., 2008). Im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG § 1) fallen darunter „Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität“.
Cyberloafing ist ein eher neues Phänomen, das die Nutzung von Internetzugängen der Organisation für private bzw. nicht dienstliche Zwecke während der Arbeitszeit in den Mittelpunkt des Interesses rückt (Lim, 2002).
Destruktive Führung hingegen spezifiziert das kontraproduktive Verhalten für eine bestimmte Tätergruppe und umfasst wiederholt auftretende feindselige Verhaltensweisen verbaler oder nonverbaler Art von Führungskräften gegenüber ihren Mitarbeitenden, wie sie von diesen wahrgenommen werden, wobei körperliche Gewalt hier explizit ausgenommen ist (Tepper, 2000).
In einer Metaanalyse (Marcus et al., 2016) fanden sich positive Zusammenhänge zwischen verschiedenen kontraproduktiven Verhaltensweisen, was auf substanzielle Gemeinsamkeiten hinweist. Dieser Befund rechtfertigt die Verwendung eines übergreifenden Begriffs allgemeinen kontraproduktiven Verhaltens, der alle Verhaltensweisen zusammenfasst, die in irgendeiner Weise direkt oder indirekt der Organisation bzw. deren Mitarbeiterinnen schaden.
Damit erfolgt aber eine sehr umfassende und damit notwendigerweise abstrakte Beschreibung des betreffenden Verhaltens. Der Begriff „kontraproduktives Ver5halten“ sollte daher besser im Sinne eines hierarchischen Modells als allgemeine Spitze einer Begriffspyramide betrachtet werden. Darunter finden sich etwas konkretere Gruppierungen spezifischer Verhaltensweisen, die sich in Anlehnung an Martinko et al. (2002) danach unterscheiden lassen, ob sie eher selbstdestruktives oder vergeltendes Verhalten beschreiben. Auf der konkretesten Ebene finden sich schließlich Verhaltensbeschreibungen, zu denen eher selbstdestruktive Formen wie Alkohol- oder Drogenmissbrauch, Absentismus, Passivität, Leistungszurückhaltung etc. oder vergeltende Formen des Verhaltens wie Aggressionen, Sabotage, Diebstahl oder Vandalismus zählen. Entsprechend werden im zweiten Teil dieses Buches – nach der Analyse der allgemeinen Zusammenhänge – konkrete abweichende Verhaltensweisen untersucht und Empfehlungen zu ihrer Beseitigung vorgestellt (vgl. Abschnitt 4.5).
1.4 Bedeutung für das Personalmanagement
Für die Unternehmen stellen die Folgen kontraproduktiver Verhaltensweisen Kosten dar. Dazu zählen direkte Kosten, die zum Beispiel durch die Reparatur beschädigter Vermögenswerte oder, wie im Falle des Absentismus, durch die Entgeltfortzahlung entstehen. Indirekte Kosten entstehen den Unternehmen zum Beispiel aufgrund steigender Versicherungsprämien, Produktionsausfällen, Konventionalstrafen und ähnlicher negativer Konsequenzen kontraproduktiven Verhaltens. Zudem kann solches Verhalten des Personals negativ auf das Image eines Unternehmens wirken und damit Geschäftsbeziehungen beeinträchtigen oder den Absatz der Produkte schwächen. Schließlich kann es sich auch negativ auf das Betriebsklima und die Einstellung der Belegschaft zur Arbeit und zum Unternehmen auswirken. Zum Beispiel muss der Absentismus im Sinne des ungerechtfertigten Fernbleibens von der Arbeit, den manche Beschäftigte zeigen, durch die Mehrarbeit der Kolleginnen und Kollegen kompensiert werden. Das kann bei der übrigen Belegschaft zu höherer Arbeitsbelastung bei gleichzeitig sinkender Motivation und Arbeitsmoral führen (Greenberg, 2010). Das sind mit Blick auf das Personalmanagement entscheidende Probleme, die sich mit kontraproduktivem Verhalten in der Belegschaft verbinden und deren Bewältigung zu seinen zentralen Aufgaben zählt.
Aus Sicht des Personalmanagements muss kontraproduktives Verhalten als ein sehr ernst zu nehmendes personalpsychologisches Problem betrachtet werden, wirken sich – wie im Folgenden noch genauer gezeigt wird – die beschriebenen Verhaltensweisen doch immer auch negativ auf das Zusammenleben und -arbeiten im Betrieb aus (zu den damit verbundenen ethischen Problemen vgl. Blickle & Nerdinger, 2019). Insofern eine der zentralen Aufgaben des Personalmanagements darin besteht, das Wohlbefinden der Beschäftigten zu sichern und die Arbeitsbeziehungen im Unternehmen zu stärken, haben grundlegende Kenntnisse zur Ana6lyse dieses Verhaltensbereichs, geeignete Methoden zur Diagnose kontraproduktiven Verhaltens und vor allem das Wissen über erfolgversprechende Methoden des Vorgehens bei seinem Auftreten entscheidende Bedeutung für das Personalmanagement. Gelingt es der Personalpsychologie, den Unternehmen Instrumente an die Hand zu geben, mit denen sich dieser Verhaltensbereich in diesem Sinne besser kontrollieren lässt, hätte das Personalmanagement einen erheblichen Nutzen und könnte seine zentrale Aufgabe, zu einer erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens beizutragen, besser bewältigen.
1.5 Betrieblicher Nutzen
Die Beschäftigung mit der Frage der Vermeidung bzw. Verhinderung kontraproduktiven Verhaltens hat über die genannten personalpsychologischen Aspekte hinaus einen unmittelbar einsichtigen betrieblichen Nutzen. Dies sei am Beispiel der Konsequenzen von Eigentumsdelikten verdeutlicht. So berichtet das EHI Retail Institut beispielsweise für das Jahr 2021 von Inventurdifferenzen im Einzelhandel von insgesamt ca. 4.1 Milliarden Euro, wobei davon ein Anteil von ca. 20 % (810 Millionen Euro) auf Ladendiebstähle durch Beschäftigte zurückzuführen ist (Shoez, 2023). Die Anzahl der Fälle von Diebstählen aus Büro-, Lager- oder sonstigen Diensträumen, die der Staatsanwaltschaft übergeben wurden, betrug im Jahr 2022 71 632 (Statista, 2023). Damit ist zwar seit 2018 – hier betrug die Zahl 96 504 – ein rückläufiger Trend zu erkennen, der aber vor allem durch einen relativ starken Einschnitt in den Jahren der Covid-19-Pandemie erklärbar wird. Pandemiebedingt waren deutlich weniger Menschen permanent im Büro, vermutlich deshalb ist in diesem Zeitraum auch die Zahl der Diebstähle aus Büroräumen zurückgegangen. Unterstellt man hier auf Basis der von Wimbush und Dalton (1997) in den USA ermittelten Werte einen durchschnittlichen Diebstahlswert von ca. 18 bis 22 Euro pro Vorfall, so ergibt sich eine vorsichtige Schätzung des durch Diebstähle aus Büro-, Lager- und Diensträumen in Deutschland verursachten Schadens von ca. 1.3 bis 1.4 Milliarden Euro pro Jahr. Bei solchen Schätzungen ist zusätzlich damit zu rechnen, dass Diebstähle – je verbreiteter sie sind – sich zu einer Art Norm im Unternehmen entwickeln können und die Zahlen sich ab einer kritischen Schwelle vervielfältigen können.
1.6 Weitere Ziele
Abgesehen von der Vermeidung finanzieller Schäden, die kontraproduktives Verhalten verursachen kann, ist dessen Prävention in Organisationen aus weiteren Gründen von Bedeutung. Zum einen sollte es als ein Symptom für problematische Konstellationen in der Organisation verstanden werden. Es geht also nicht nur 7darum, Organisationen durch die direkte Bekämpfung kontraproduktiven Verhaltens vor Schaden zu bewahren – obwohl dies aus wirtschaftlicher Sicht gewöhnlich der Hauptantrieb sein dürfte. Vielmehr geht es auch darum, Bedingungen zu schaffen, die sein Auftreten weniger wahrscheinlich machen. Erfolgreiche Prävention hat mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere positive Konsequenzen. Beispielsweise sind kontraproduktive Verhaltensweisen oftmals die Konsequenz schlechter Arbeitsbedingungen, ungünstiger Führung oder problematischer Organisationsstrukturen (vgl. dazu ausführlich Kapitel 3). Setzt man hier präventiv an und verbessert Arbeitsbedingungen, Führung oder Organisationsstrukturen, so leistet man damit nicht nur einen Beitrag zur Verminderung kontraproduktiven Verhaltens. Gleichzeitig wird die Beziehung zwischen dem Personal und der Organisation gestärkt, das Engagement und die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen wird gefördert, ihr Wohlbefinden gesichert und der Grundstein für kreatives und innovatives Verhalten gelegt. So können viele Maßnahmen der Prävention kontraproduktiven Verhaltens zur Gestaltung eines organisationalen Umfeldes beitragen, in dem Mitarbeiter produktiv sind und sich gleichzeitig sicher fühlen, aber auch gesund bleiben (Barling, 2023).
Neben diesen eher allgemeinen Überlegungen sei das Thema Gesundheitsförderung besonders betont. Organisationen ist gesetzlich vorgeschrieben, Arbeitsplätze regelmäßig einer Gefährdungsbeurteilung zu unterziehen und auftretende Gefährdungen nach Möglichkeit an der Ursache zu bekämpfen. In der von der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA, 2017) herausgegebenen Leitlinie zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen werden bei den Gefährdungsfaktoren unter Punkt 10.3 auch ungenügend gestaltete soziale Bedingungen genannt, worunter u. a. ungünstiges Führungsverhalten oder Konflikte gefasst werden. Im Hinblick auf kontraproduktives Verhalten bedeutet dies: Alle sozial ausgerichteten kontraproduktiven Verhaltensweisen (z. B. Mobbing, destruktive Führung, Diskriminierung, sexuelle Belästigung etc.) gelten nach dieser Leitlinie als Gefährdungsfaktoren. Die Prävention von sozial ausgerichteten kontraproduktiven Verhaltensweisen ist damit nicht nur vernünftig und wünschenswert, sondern Bestandteil der gesetzlichen Pflichten eines Arbeitgebers (was für Diskriminierung und sexuelle Belästigung zusätzlich auch auf Basis des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gilt; vgl. Abschnitt 4.5.2 und 4.5.3).
1
Zugunsten einer besseren Lesbarkeit verwenden wir im Text nicht immer geschlechtsneutrale Formulierungen oder mehrere Geschlechterformen. Deshalb weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass stets in gleicher Weise Personen jedweden Geschlechts gemeint sind.
82 Theorien und Modelle
Wie so häufig in der psychologischen Forschung, finden sich auch zur Erklärung kontraproduktiven Verhaltens mehrere verschiedene Erklärungsansätze: Psychologische Phänomene und menschliches Verhalten lassen sich eben je nach dem Blickwinkel, unter dem sie analysiert werden, unterschiedlich erklären. Betrachtet man jeweils konkrete kontraproduktive Verhaltensweisen, so finden sich entsprechend viele, sehr spezifische Modelle (vgl. Abschnitt 4.5). Im Folgenden sollen nicht solche speziellen Verhaltensweisen erklärt werden, sondern die übergreifende Klasse, d. h. das allgemeine kontraproduktive Verhalten. Dafür ist es notwendig, allgemeine Erklärungsmechanismen herauszuarbeiten. Auch auf diesem Feld finden sich unterschiedliche Herangehensweisen. Im Folgenden wird die Beziehung zur Organisation zunächst als Austausch betrachtet, dann werden negative affektive Ereignisse als Ursache kontraproduktiven Verhaltens untersucht und schließlich wird dieses Verhalten als Folge von erlebtem Stress analysiert. Abschließend wird noch ein soziologisch-systemtheoretischer Blick auf die Funktionsweise ganzer Organisationen geworfen, der ein erweitertes Verständnis des Phänomens ermöglicht.
2.1 Austauschtheoretische Ansätze und Bruch des psychologischen Vertrags
Soziale Austauschtheorien werden in der organisationspsychologischen Forschung bereits seit langer Zeit zur Erklärung des Erlebens und Verhaltens von Mitarbeiterinnen herangezogen (vgl. dazu und zum Folgenden Cropanzano et al., 2017). So basieren alle Austauschtheorien auf der Annahme, Beziehungen zwischen sozialen Akteuren ließen sich als Verkettung von Transaktionen verstehen, die – kurz- oder langfristig – gegeneinander aufgewogen werden. Das dabei wesentliche Prinzip ist das der Reziprozität. Grob gesagt lässt sich dieses Prinzip mit der Redensart „Wie du mir, so ich dir“ oder auch „Wie es in den Wald hineinruft, so schallt es heraus“ verdeutlichen (vgl. Gouldner, 1960).
Unter der Reziprozitätsnorm versteht man die „Erwartung, dass man durch Hilfe für andere Menschen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass diese einem in der Zukunft ihrerseits helfen werden“ (Aronson et al., 2008, S. 352).
Übertragen auf Organisationen weisen diese Theorien auf die Bedeutung der Austauschbeziehung zwischen Mitarbeitern und Organisation hin, bei der Ressourcen ausgetauscht werden. Seitens der Organisation werden beispielsweise 9gute Arbeitsbedingungen, interessante Aufgaben oder Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, was die Mitarbeiterinnen mit Leistung, Engagement und Loyalität belohnen, um die von der Organisation bereitgestellten Ressourcen auszugleichen (z. B. Eisenberger & Stinglhamber, 2011). Im positiven Fall führt eine gute Behandlung der Mitarbeiter durch die Organisation und die wahrgenommene organisationale Unterstützung demnach zum Zustand der Reziprozität. Dieser äußert sich in einem Gefühl, der Organisation gegenüber verpflichtet zu sein und die gute Behandlung durch die Organisation durch gesteigertes Engagement zu erwidern (Kurtessis et al., 2017). Umgekehrt würden Mitarbeiterinnen auf Nachteile oder ungerechte Behandlung durch die Organisation eher mit dem Wunsch reagieren, es ihrem Arbeitgeber in der einen oder anderen Weise „heimzuzahlen“ (Cropanzano et al., 2017). Diesen Fall kann man als negative Reziprozität bezeichnen (Mitchell & Ambrose, 2007). Kontraproduktives Verhalten wäre demnach die Reaktion auf eine schlechte Behandlung oder ein unausgewogenes Verhältnis in der Austauschbeziehung zwischen Mitarbeitern und Organisation.
Etwas spezifischer lässt sich kontraproduktives Verhalten durch das Konzept des psychologischen Vertragsbruchs erklären. In Abgrenzung zum formalen Arbeitsvertrag besteht der psychologische Vertrag „aus Verpflichtungen und Erwartungen, die über den Arbeitsvertrag hinausgehen und den Austausch in der Beschäftigungsbeziehung beschreiben“ (Raeder & Grote, 2012, S. 3), ist als solcher jedoch nicht einklagbar. Auf dieser Idee aufbauend bezeichnet der psychologische Vertragsbruch das Gefühl der Enttäuschung, welches sich einstellt, wenn die Erwartungen der Mitarbeiterinnen an die Organisation von dieser nicht erfüllt werden (Morrison & Robinson, 1997). Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Versprechungen (z. B. im Einstellungsinterview angekündigte Aufstiegsmöglichkeiten oder die Bearbeitung attraktiver Projekte) oder lediglich um Hoffnungen der Mitarbeiter handelt. Oftmals ist der Eindruck, die Organisation würde nicht halten, was sie verspricht, das Entscheidende.
Psychologischer Vertragsbruch und das damit verbundene Gefühl der Enttäuschung zeigen in der Empirie deutliche Zusammenhänge zu kontraproduktivem Verhalten. In einer Studie wurden 568 Offiziersanwärter einer Armee des mittleren Ostens untersucht (Fine et al., 2016). Nachdem die Offiziersanwärter einige Zeit in der Armee gedient hatten, wurden sie darüber informiert, ob sie für eine Beförderung in den Offiziersrang infrage kommen oder nicht. Dies geschah jedoch ohne Angabe von Gründen für die betreffende Entscheidung. Fine et al. (2016) untersuchten anhand von archivierten Berichten über individuelle Verstöße der Personen wie aggressives Verhalten, Diebstahl, Befehlsverweigerungen oder Vernachlässigung der Pflichten (z. B. Schlafen im Dienst) den Verlauf von kontraproduktiven Verhaltensweisen über die Zeit vor und nach Mitteilung der Beförderungsentscheidung. Abbildung 1 zeigt diesen Verlauf in Abhängigkeit von der Beförderungsentscheidung.
10Wie in Abbildung 1 deutlich zu erkennen ist, schlagen sich enttäuschte Erwartungen – in diesem Fall enttäuschte Karrierehoffnungen – in einem Anstieg kontraproduktiver Verhaltensweisen 1 bis 6 Monate nach der Beförderungsentscheidung nieder. In gewisser Weise lässt sich damit also untermauern, dass die nicht beförderten Offiziersanwärter das Gefühl der Enttäuschung durch vermehrt an den Tag gelegte kontraproduktive Verhaltensweisen im Sinne der negativen Reziprozität ausgleichen. Nach diesen Befunden scheint das Gefühl der Enttäuschung jedoch über die Zeit hinweg abzuflachen – zumindest konnte im Verlauf der nächsten zwei Jahre nach der Beförderungsentscheidung eine Verringerung der kontraproduktiven Verhaltensweisen festgestellt werden. Demnach kann es durchaus ein sehr langwieriger Prozess sein, bis das Gefühl der Enttäuschung überwunden ist (vgl. auch Solinger et al., 2016).
Abbildung 1: Mittlere Anzahl an archivierten Delikten kontraproduktiven Verhaltens im Zeitverlauf nach einer Beförderungsentscheidung (nach Fine et al., 2016, S. 1724f.)
Organisationen und deren Vertreter sollten daher ein waches Bewusstsein für die von den Mitarbeiterinnen wahrgenommene Qualität des sozialen Austausches entwickeln. Insbesondere gilt dies für implizite Versprechungen, die im Rahmen von Einstellungsinterviews mitunter gemacht werden, um als Organisation für vielversprechende Mitarbeiter attraktiv zu sein (Schuler & Mussel, 2016). Die Forschungen auf Basis der sozialen Austauschtheorien und insbesondere des Konzepts des psychologischen Vertragsbruchs belegen die Feinfühligkeit der Beschäftigten gegenüber Verstößen gegen die Reziprozitätsnorm und Verletzungen des psychologischen Vertrags.





























