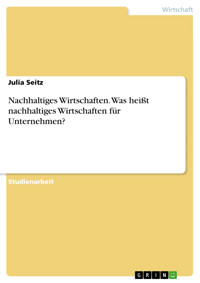45,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum Wissenschaftsverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag: Psychologie
- Sprache: Deutsch
Die Vor- und Nachteile von Vertrauensarbeitszeit werden sehr kontrovers diskutiert. Vertrauensarbeitszeit bietet den Beschäftigten eine hoch ausgeprägte Autonomie bezüglich der Arbeitszeitgestaltung. Gleichzeitig verlangt sie ihnen in Bezug auf die eigenständige Planung und Steuerung der Arbeit einiges ab; die Verantwortung für den Arbeitsprozess und die Arbeitsergebnisse ist erhöht. Es bestehe die Gefahr der unbezahlten Mehrarbeit und selbstausbeutenden Verhaltens, so die Kritiker. Unter dem Schlagwort Vertrauensarbeitszeit finden sich in der Unternehmenspraxis jedoch sehr unterschiedliche Formen und Ausprägungen. Es lohnt sich daher, einen differenzierten Blick auf Rahmenbedingungen der Vertrauensarbeitszeit zu werfen: Welche Rolle spielen etwa Kollegen, Führungskräfte und die Gestaltung von Grenzen zwischen Beruf und Privatleben? Soziologische Perspektiven werden mit arbeitspsychologischen Konzepten und Theorien verknüpft, um in theoriegeleiteten Auswertungen die empirische Evidenz zu unterschiedlichen Effekten der Vertrauensarbeitszeit zu erweitern. Im Fokus steht dabei die Aufrechterhaltung und Förderung der Gesundheit von Beschäftigten und damit auch ihre Leistungsfähigkeit im Unternehmen. Auswertungen in einer repräsentativen Panel-Befragung sowie einer Beschäftigtenbefragung weisen sowohl auf Chancen als auch auf Risiken von Vertrauensarbeitszeit hin. Für Praktiker, die im eigenen Unternehmen Vertrauensarbeitszeit einführen möchten oder bereits eingeführt haben, werden Gestaltungsempfehlungen hinsichtlich einer gesundheitsförderlichen Gestaltung von Vertrauensarbeitszeit gegeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag
Reihe Psychologie
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag
Reihe Psychologie Band 30
Julia Seitz
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser?
Eine Analyse der Ressourcen und Anforderungen bei Vertrauensarbeitszeit
Tectum Verlag
Julia Seitz
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser?
Eine Analyse der Ressourcen und Anforderungen bei Vertrauensarbeitszeit
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag
Reihe: Psychologie; Bd. 30
© Tectum – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2019
ePub 978-3-8288-6983-7
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Werk unter der ISBN 978-3-8288-4144-4 im Tectum Verlag erschienen.)
ISSN: 1861-7735
Zugleich: Dissertation an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Fachbereich 02 – Sozialwissenschaften, Medien und Sport, 2018
D77
Umschlaggestaltung: Tectum Verlag, unter Verwendung des Bildes # 64904317 von liseykina | www.shutterstock.com
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Danksagung
Ohne die folgenden Personen wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Zuerst möchte ich mich bei meinem Doktorvater Prof. Dr. Thomas Rigotti bedanken. Er hatte immer ein offenes Ohr für mich und hat von Anfang an die Herausforderung angenommen, über Fachgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Ein besonderer Dank gilt ebenfalls allen, die mir geholfen haben, meine Umfrage zu erstellen und Teilnehmer für diese zu finden. Dies waren Kollegen, weitere Wissenschaftler aus ganz Deutschland, Vertreter von Verbänden, Gewerkschaften und Unternehmen sowie Freunde und Bekannte. Hervorheben möchte ich zudem die angenehme Zusammenarbeit mit den zuständigen Personen in dem nicht namentlich zu nennenden Unternehmen, welche meine Umfrage an ihre Mitarbeiter weiterleiteten. Ohne die stets gutgelaunte fachliche und emotionale Unterstützung meiner Freunde und meiner Kollegen aus der Soziologie, der Psychologie und aus dem LOB-Projekt wäre vieles sehr viel schwieriger und sehr viel weniger lustig gewesen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Ein großer Dank geht außerdem an meine ganze Familie und insbesondere meine Eltern, die mich auf meinem Weg immer mit Rat und Tat unterstützt haben. Der letzte, aber dafür umso wichtigere Dank gilt meinem Mann Markus Geimer: für seine unendliche Geduld, seine immer wieder aufs Neue motivierenden Worte und seinen Humor.
Inhalt
1 Einleitung
2 Vertrauensarbeitszeit – Einführung zu Begriff, Verbreitung, Debatte und soziologischer Rahmung
2.1 „With great power comes great responsibility“ – wesentliche Charakteristika von Vertrauens-arbeitszeit
2.2 Die Verbreitung der Vertrauensarbeitszeit
2.3 Die (polarisierte) Debatte um Vertrauens-arbeitszeit
2.4 Soziologische Rahmung: Theoretische Anschlüsse an das Konzept der Vertrauensarbeitszeit
2.4.1 Der Arbeitskraftunternehmer – Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung und Selbstrationalisierung
2.4.2 Der flexible Mensch – Flexibilisierung als Problem
2.4.3 Der Intrapreneur – Unternehmer im Unternehmen
2.4.4 Discretionary time – Zeitautonomie neu gedacht
2.4.5 Zusammenfassung und Folgerungen
3 Ressourcen und Anforderungen der Vertrauensarbeitszeit: Psychologische Fundierung und Forschungsstand
3.1 Die Handlungsregulationstheorie
3.2 Das Job Demands-Resources-Modell
3.2.1 Prinzipien, Elemente und Entwicklung des Job Demands-Resources Modells
3.2.2 Persönliche Ressourcen innerhalb des JD-R-Modells
3.2.3 Erweiterungen des Modells: Challenge und Hindrance Demands und das Triple Match Principle
3.2.4 Kritik des Modells und Einordnung in den Anwendungsfall Vertrauensarbeitszeit
3.3 Forschungsstand und theoretische Bezüge zu spezifischen Anforderungen der Vertrauens-arbeitszeit
3.3.1 Autonomie in der Arbeit als Anforderung
3.3.2 Arbeitsvolumen
3.3.3 Entgrenzungsverhalten
3.3.4 Anwesenheitskultur
3.3.5 Anforderungen an die zeitliche Flexibilität – Primat betrieblicher Zeitinteressen
3.4 Forschungsstand und theoretische Bezüge zu spezifischen Ressourcen der Vertrauensarbeitszeit
3.4.1 Arbeitszeitautonomie
3.4.2 Handlungsspielraum
3.4.3 Soziale Unterstützung
3.4.4 Qualität der Beziehung zur Führungskraft
3.4.5 Begrenzung der Arbeitszeit / Segmentation von Arbeit und Privatleben
3.4.6 Persönliche Ressourcen – Selbstwirksamkeit und Self-Leadership
3.5 Zusammenfassung der Anforderungen und Ressourcen der VAZ
4 Konsequenzen von Arbeitszeitsystemen mit hoher Autonomie – eine Studie mit Daten des sozio-ökonomischen Panels
4.1 Forschungsstand und theoretische Bezüge zu flexiblen Arbeitszeitmodellen
4.2 Studiendesign
4.2.1 Stichprobe
4.2.2 Operationalisierung
4.2.3 Datenanalyse
4.3 Ergebnisse
4.4 Diskussion
5 Mechanismen der Vertrauensarbeitszeit – eine Studie zu Ressourcen und Anforderungen
5.1 Hypothesen zum Zusammenwirken von Ressourcen und Anforderungen und Konsequenzen für das Wohlbefinden in der Vertrauensarbeitszeit
5.1.1 Grundmodell der VAZ: Autonomie- anforderungen und Arbeitszeitautonomie
5.1.2 Grundprozess 1: Arbeitszeitautonomie als Ressource
5.1.3 Grundprozess 2: Selbstorganisation als Anforderung
5.2 Studiendesign
5.3 Ergänzende Hinweise zur Unternehmens-stichprobe
5.4 Fragebogen
5.4.1 Operationalisierung der Anforderungen
5.4.2 Operationalisierung der Ressourcen
5.4.3 Operationalisierung der abhängigen Variablen
5.4.4 Operationalisierung von Kontroll- und Kontextvariablen
5.5 Stichprobenmerkmale und deskriptive Auswertungen
5.6 Strategie der Datenanalyse
5.7 Ergebnisse der Strukturgleichungsmodelle
5.7.1 Ergebnisse zum Grundmodell der VAZ
5.7.2 Ergebnisse zum Grundprozess 1: Arbeitszeitautonomie als Ressource
5.7.3 Ergebnisse zum Grundprozess 2: Selbstorganisation als Anforderung
5.8 Diskussion
6 Schlussbemerkung
6.1 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse
6.2 Limitationen der vorliegenden Arbeit
6.3 Ansätze für weitere Forschung auf dem Gebiet der Vertrauensarbeitszeit
6.4 Handlungsempfehlungen: Wie lässt sich eine mitarbeitergerechte Version der Vertrauens-arbeitszeit gestalten?
Anhang
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Das Job Demands-Resources-Modell, entnommen aus Bakker & Demerouti, 2007: 313
Abbildung 2: Anforderungen und Ressourcen der Vertrauensarbeitszeit
Abbildung 3: Mobilität zwischen den verschiedenen Arbeitszeitsystemen 2003–2011; Quelle: SOEP, eigene Berechnungen
Abbildung 4: Interaktionsplot des Wechsels auf selbst festgelegte Arbeitszeit mit Mehrarbeit, d.h. Differenz zw. vereinbarter und tatsächlicher Arbeitszeit (zentriert um Personenmittelwert) auf die Freizeit- zufriedenheit
Abbildung 5: Interaktionsplot des Verbleibs in selbst festgelegter Arbeitszeit mit Mehrarbeit, d.h. Differenz zw. vereinbarter und tatsächlicher Arbeitszeit (zentriert um Personenmittelwert) auf die Freizeitzufriedenheit
Abbildung 6: Modellgrafik zum Grundmodell der Anforderungen und Ressourcen der VAZ
Abbildung 7: Modellgrafik zum Grundprozess 1 „Arbeitszeitautonomie als Ressource“
Abbildung 8: Modellgrafik zum Grundprozess 2 „Selbstorganisation als Anforderung“
Abbildung 9: Modell Hypothese 1 zum Einfluss von Arbeitszeit- autonomie und Selbstorganisation auf Work Engagement, Beanspruchung, Arbeits- zufriedenheit und Wohlbefinden; standardisierte Koeffizienten
Abbildung 10: Modell Hypothese 2 zum Einfluss von Arbeitsstunden und subjektivem Workload auf Beanspruchung, Arbeitszufriedenheit und Wohlbefinden
Abbildung 11: Moderation des Effekts von Arbeitszeitautonomie auf Arbeitszufriedenheit durch subjektiven Workload (Modell Hypothese 2)
Abbildung 12: Modell Hypothese 2I zum Einfluss von subjektivem Workload und Leader-Member-Exchange auf Work Engagement, Beanspruchung und Wohlbefinden
Abbildung 13: Moderation des Effekts von subjektivem Workload auf Beanspruchung durch LMX (Modell Hypothese 2I)
Abbildung 14: Modell Hypothese 3 zum Einfluss von Arbeitszeit- autonomie und Flexibilitätserwartungen auf Arbeitszufriedenheit, Beanspruchung und Wohlbefinden
Abbildung 15: Modell Hypothese 4 zum Einfluss von Anwesen- heitskultur und Arbeitszeitautonomie auf Arbeitszufriedenheit, Beanspruchung, Negative work home interference, Wohlbefinden und Freizeitzufriedenheit
Abbildung 16: Modell Hypothese 5 zum Einfluss von Arbeitszeit- autonomie und Entgrenzungsverhalten auf Arbeitszufriedenheit, Beanspruhcung, negative work home interference, Wohlbefinden und Freizeitzufriedenheit
Abbildung 17: Modell Hypothese 6 zum Einfluss von Handlungspielraum und Selbstorganisation auf Work Engagement, Beanspruchung und Wohlbefinden
Abbildung 18: Moderation des Effekts von Selbstorganisation auf Beanspruchung durch Handlungsspielraum (Modell Hypothese 6)
Abbildung 19: Modell Hypothese 7 zum Einfluss von sozialer Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte und Selbstorganisation auf Work Engagement, Beanspruchung und Wohlbefinden
Abbildung 20: Modell Hypothese 8 zum Einfluss von LMX und Selbstorganisation auf Work Engagement, Beanspruchung und Wohlbefinden unter Kontrolle von Arbeitszufriedenheit
Abbildung 21: Moderation des Zusammenhangs zwischen Selbstorganisation und Beanspruchung durch LMX (Modell Hypothese 8)
Abbildung 22: Modell Hypothese 9 zum Einfluss tatsächlicher und präferierter Segmentation (Faktor „Arbeit“) und Selbstorganisation auf Work Engagement, Beanspruchung und Wohlbefinden unter Kontrolle von Arbeitszufriedenheit
Abbildung 23: Modell Hypothese 10 zum Einfluss von Selbstwirksamkeit und Selbstorganisation auf Work Engagement, Beanspruchung und Wohlbefinden
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Prozentuale Anteile der Beschäftigten in den verschiedenen Arbeitszeitsystemen, nach Geschlecht
Tabelle 2: Mittelwert, Standardabweichung und Fallzahl; Bildungsjahre und monatliches Erwerbseinkommen, Post-Hoc-Vergleiche der Variablen zwischen den Arbeitszeitsystemen
Tabelle 3: Mittelwert, Standardabweichung, Fallzahl; vereinbarte und tatsächliche Arbeitszeit, Differenz dieser; Post-Hoc- Vergleich der Differenz zwischen den Arbeitszeitsystemen
Tabelle 4: Absolute und relative Anzahl der Beschäftigten in den verschiedenen Arbeitszeitsystemen über die Erhebungszeitpunkte
Tabelle 5: Wechsel und Verbleib in den verschiedenen Arbeitszeitsystemen zwischen den Erhebungszeit- punkten (absolute und relative Anzahl)
Tabelle 6: Dummy-Variablen in Bezug auf Wechsel und Verbleiben in Arbeitszeitsystemen
Tabelle 7: Mehrebenenmodelle (random intercept) zum Einfluss verschiedener Arbeitszeitmodelle auf Arbeits- zufriedenheit, Freizeitzufriedenheit und Gesundheit
Tabelle 8: Mehrebenenmodelle zum Einfluss des Arbeits- zeitsystems auf die Arbeitszufriedenheit, die Freizeitzufriedenheit und die subj. Gesundheit; Interaktionsterme mit Bildungsjahren auf Ebene 1
Tabelle 9: Mehrebenenmodelle zum Einfluss des Arbeits- zeitsystems auf die Arbeitszufriedenheit, die Freizeitzufriedenheit und die subjektive Gesundheit; Interaktionsterme mit Mehrarbeit auf Ebene 1
Tabelle 10: Absolute und relative Häufigkeiten demographischer und beschäftigungsbezogener Stichproben- merkmale
Tabelle 11: Mittelwerte und Standardabweichungen demographischer und beschäftigungsbezogener Stichprobenmerkmale
Tabelle 12: Mittelwerte und Standardabweichungen, interne Konsistenz, Mittelwertunterschiede der erfassten Konstrukte zwischen den Stichproben
Tabelle 13: Korrelationen zwischen den im Fragebogen erfassten Konstrukten in der Gesamtstichprobe
Tabelle 14: Faktorstruktur, Messinvarianz und weitere Hinweise zur Messung der latenten Variablen
Tabelle 15: Vergleich der Mehrfaktor- und Einfaktor-Modelle mit Gruppen verwandter Konstrukte
Tabelle 16: Modellgüte der Strukturgleichungsmodelle
Tabelle 17: Alle untersuchten Effekte der zweiten Studie im Überblick
Tabelle 18: Mittelwerte der verschiedenen Kontrollvariablen über die Erhebungszeitpunkte zur Studie in Kapitel 4
Tabelle 19: Mittelwerte der Kontrollvariablen über die unter- schiedlichen Arbeitszeitsysteme; alle Erhebungs- zeitpunkte in Summe zur Studie in Kapitel 4
Tabelle 20: Mittelwerte der abhängigen Variablen über die Erhebungszeitpunkte zur Studie in Kapitel 4
Tabelle 21: Modellvergleiche der verwendeten Konstrukte in den beiden Stichproben S und U
Tabelle 22: Parameter zu den Faktoren Präf. und Tats. Segmentation „Heim“ (Modell Hypothese 9, Studie Kapitel 5)
1 Einleitung
„Vertrauensarbeitszeit – das ist doch, wenn mein Chef darauf vertraut, dass ich mehr arbeite als ich eigentlich muss …“ Solche und ähnliche Aussagen wurden oft in Gesprächen zu dieser Arbeit zum Ausdruck gebracht. Die hier zitierte Formulierung sagt etwas aus über die vielfach negative Wahrnehmung des Konzepts „Vertrauensarbeitszeit“. Hier schwingt zum einen mit, dass man allgemein in Vertrauensarbeitszeit (im Folgenden VAZ) mehr arbeitet als vertraglich vereinbart. Zum anderen offenbart sich eine sehr negative Sicht auf die Auslegung der VAZ durch die Führungskraft. Diese erwartet hier (bzw. „vertraut darauf“), dass die Mitarbeiter1 sich verausgaben. Zudem wird der häufig positiv besetzte Begriff „Vertrauen“ hier mit einer Strategie in Zusammenhang gebracht, die die Führungskraft bzw. der Arbeitgeber einsetzen, um ihre Ziele durchzusetzen.
Bei VAZ handelt es sich auf den ersten Blick jedoch „nur“ um ein Arbeitszeitmodell, bei dem die betriebliche Arbeitszeiterfassung abgeschafft wird und welches Mitarbeitern ein erhöhtes Maß an Autonomie bzgl. der Lage, Dauer und Unterbrechungen der Arbeitszeit bietet (vgl. Böhm, Herrmann & Trinczek, 2004a). Dennoch schlägt demjenigen, der sich wissenschaftlich mit ihr beschäftigt, eine wirklich negative Sicht der VAZ, wie sie aus dem Eingangszitat spricht, nicht nur in Gesprächen, sondern auch in Publikationen zum Thema entgegen. Es kommen jedoch auch positivere Deutungen des Konzepts vor, dort wo es entweder von Beschäftigten mit positiven Erfahrungen in Verbindung gebracht wird oder dort wo Entscheider in Betrieben es aus ihrer Sicht erfolgreich implementiert haben. Doch welche Sicht ist angemessen? Wovon hängt es ab, ob VAZ negativ oder positiv wahrgenommen wird? In welchen Fällen kommen Beschäftigte gut mit VAZ zurecht? Bei diesen Fragen setzt die vorliegende Arbeit an. Sie widmet sich der Frage, ob bestimmte Charakteristika der VAZ ausgemacht werden können, die die positive oder negative Wahrnehmung im Kontext der Stressentstehung beeinflussen. Dabei soll sie nicht dabei stehen bleiben, das Modell als Ganzes zu befürworten oder abzulehnen, sondern genauer herausarbeiten, welche Faktoren innerhalb der VAZ im Stressentstehungsprozess von Bedeutung sind und welche Mechanismen hier wirksam sind. Diese Zielsetzung wird verfolgt, indem sowohl eine theoretische Einordnung als auch eine empirisch-quantitative Untersuchung vorgenommen wird.
Veröffentlichungen zum Thema VAZ beschränken sich oft auf die erste der drei oben gestellten Fragen und somit auf eine generelle Befürwortung oder Ablehnung des Modells (Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, 2014; Hoffmann & Suchny, 2016). Die empirische Forschung zum Thema VAZ ist nicht sehr umfangreich und beschränkt sich auf qualitative Studien (Böhm et al., 2004a), begrenzte Mitarbeiterbefragungen (Hoff & Priemuth, 2002; Janke, Stamov-Roßnagel & Scheibe, 2014) und hierbei oft rein deskriptive Auswertungen (Wingen, Hohmann, Bensch & Plum, 2004). Der bisher nicht klar definierte Begriff VAZ ist eines der möglichen Hindernisse, die einer Erforschung des Phänomens im Wege stehen. Um die weiteren oben aufgeworfenen Fragen zu beantworten bedarf es also einer Studie, die unter Zuhilfenahme einer weiteren Präzisierung des Begriffs zum einen viele verschiedene Aspekte der VAZ mit quantitativen Methoden untersucht und zum anderen diese miteinander in Beziehung setzen kann. Dies ist erklärtes Ziel dieser Arbeit. Genauer gefasst heißt das, dass das Konzept der VAZ einer Betrachtung im begrifflichen Schema der Ressourcen und Anforderungen zugänglich gemacht werden soll und diese Ressourcen und Anforderungen im Folgenden genauer betrachtet werden sollen. Die Arbeit widmet sich also dem Stressentstehungsprozess und somit dem Wohlergehen von Mitarbeitern in der VAZ.
Die Relevanz dieser Betrachtung ergibt sich daraus, dass das Phänomen in seiner Verbreitung zugenommen hat. Hoch flexible Arbeitszeitsysteme sind in Deutschland immer mehr im Einsatz (vgl. Matta, 2015). Aktuell haben etwa 38% der Beschäftigten in Deutschland einen Einfluss darauf, wann sie ihre Arbeit beginnen und beenden, bei hoch qualifizierten Arbeitnehmern sogar über die Hälfte (Wöhrmann et al., 2016). Da VAZ zu den hoch flexiblen Arbeitszeitmodellen gezählt werden kann, ist die Bedeutung des Konzepts nicht zu unterschätzen. Des Weiteren erfreut sich VAZ auch als „Modebegriff“ steigender Beliebtheit, so dass eine wissenschaftliche und speziell arbeitswissenschaftliche Betrachtung des Konzepts auch im Hinblick darauf sinnvoll zu sein scheint (vgl. Böhm et al., 2004a: 46f.).
Auch politisch spielt die Flexibilität der Arbeitszeit eine Rolle. Aktuell werden Bestrebungen sichtbar, die Arbeitszeitgesetzgebung zu ändern, um eine gesteigerte Flexibilität in der Arbeitszeit möglich zu machen. Dies ist beispielsweise im Koalitionsvertrag von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen nachzulesen (CDU & FDP, 2017), welcher eine Bundesratsinitiative zur Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG, 1994) erwähnt. Auf Seiten der Arbeitgeber wird dies ausdrücklich unterstützt: Die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie befürworten die Flexibilisierung (also Ausweitung) der Tageshöchstarbeitszeit sowie die Flexibilisierung (Einschränkung) der vorgeschriebenen Ruhezeiten (Nordmetall, 2017). Die Argumentationslinie ist hier, dass modernes Arbeiten sich nicht an festgelegte Zeiten halten kann und muss, nicht zuletzt auf Grund der technischen Möglichkeiten, die in vielen Fällen festgelegte Zeitkorridore obsolet erscheinen lassen. Auch im Sinne der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird argumentiert, dass diese sich besser verwirklichen ließe, wenn flexibler auf die Erfordernisse der Erwerbs- und Familienarbeit eingegangen werden könnte.
Die Perspektive, die in dieser Arbeit eingenommen wird, bezieht sich auf die Beschäftigten in VAZ. Die dahinterliegende Frage lautet: Welche Zusammenhänge bedingen gesundheitsförderliche und gesundheitsschädliche Prozesse innerhalb der VAZ für die Beschäftigten? Der Ansatz für die vorliegende Arbeit orientiert sich disziplinär an einer arbeitspsychologischen Sicht der VAZ und klammert wirtschaftswissenschaftliche oder auch politische Perspektiven bewusst aus. Dies bedeutet, dass psychische Prozesse, die in Arbeitsfeldern mit bestimmten Arbeitsbedingungen geschehen, untersucht werden (Hacker & Sachse, 2014). Die Arbeit unterscheidet sich von bisherigen Veröffentlichungen und ergänzt diese, weil sie den Versuch unternimmt, bestimmte Schlüsselkomponenten der VAZ herauszuarbeiten und in ihrer Wirkung im Stressentstehungsprozess zu untersuchen. Dies bedeutet zum einen, dass der Begriff VAZ näher eingegrenzt wird, als dies bisher zuweilen geschehen ist. Zudem werden arbeitspsychologische Theorien auf den Gegenstand der VAZ angewendet, womit eine weitergreifende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen möglich wird. Die nähere Bestimmung der Charakteristika von VAZ macht es schließlich möglich, diese auch einer empirischen Überprüfung zugänglich zu machen. Diese wurde im Rahmen einer Studie in dieser Arbeit verwirklicht. In bisherigen Studien wurde bisher meist der Fokus darauf gelegt, die VAZ mit anderen Modellen zu vergleichen.
Im Folgenden wird der Aufbau dieser Arbeit skizziert. Zunächst beschäftigt sich ein einführendes Kapitel mit der genaueren Eingrenzung des Phänomens VAZ. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, vor allem vor dem Hintergrund einer mangelnden Festlegung des Begriffs VAZ, genauer zu bestimmen, welche Komponenten die VAZ typischerweise enthält und die Gründe für die mangelnde Greifbarkeit des Begriffes herauszuarbeiten. Um die Relevanz des Phänomens einschätzen zu können, wird in der Folge eine quantitative Untersuchung der Verbreitung anhand verschiedener Studien sowie eigener Berechnungen anhand des sozioökonomischen Panels (SOEP) vorgenommen.
Über VAZ wird viel diskutiert, sowohl im privaten, als auch im öffentlichen Diskurs. Deshalb wird im Anschluss die Debatte um die VAZ skizziert, welche sich typischerweise durch die Gegnerschaft gewerkschaftlicher oder gewerkschaftsnaher Akteure auf der einen Seite und die Befürwortung von Arbeitgebern und Arbeitgeberverbänden auf der anderen Seite auszeichnet. Ziel ist es hier, die verschiedenen Argumente beider Seiten zu skizzieren und in der Folge zu einer ausgewogeneren Sichtweise der VAZ zu kommen.
Im vierten Teil des Kapitels werden soziologische Ansätze skizziert, die in verschiedener Art und Weise an das Thema VAZ anschließen. Diese beziehen sich auf Konzepte zu neuen Typen von Arbeitnehmern (Arbeitskraftunternehmer und Intrapreneur, 2.4.1. und 2.4.3.) sowie allgemeine Schilderungen von Flexibilisierungsprozessen in der heutigen Arbeitswelt (Der flexible Mensch, 2.4.2.) und schließlich auf ein neues Verständnis von Zeitautonomie (discretionary time, 2.4.4.). Ihnen gemeinsam ist die Betrachtung verschiedener Phänomene, die mit Autonomie in der Arbeit zusammenhängen. Die durchaus divergierenden Schlüsse, die aus diesen Betrachtungen gezogen werden, werden hier im Hinblick auf ihre Anschlussfähigkeit zum Phänomen VAZ diskutiert und in Beziehung zueinander gesetzt.
Das darauffolgende Kapitel wendet sich der arbeitspsychologischen Betrachtung des Forschungsgegenstandes zu. Dies beinhaltet sowohl die theoretische Fundierung als auch den Forschungsstand zum Thema VAZ. Ziel ist die Erarbeitung einer neuen Systematik, in der die VAZ genauer analysiert werden kann. Arbeitspsychologische Theorieansätze werden hier miteinander in Verbindung gebracht und so eine systematische Einordnung bestimmter Aspekte der VAZ ermöglicht. Als Ergebnis wird ein Modell der Ressourcen und Anforderungen der VAZ entwickelt, welches in Kapitel 5 als Basis für die empirische Untersuchung der VAZ dient. Einführend wird die Handlungsregulationstheorie (HRT) diskutiert (Frese & Zapf, 1994; Hacker, 2002, 2003; Semmer, 1984; Semmer, Zapf & Dunckel, 1995; Volpert, 1987; Zapf, 1993; Zapf & Semmer, 2004). Der Fokus liegt hier auf der Betrachtung der Zusammenhänge im Rahmen vom Stressentstehungsprozess (3.1.). Als weiterer theoretischer Ansatz wird das Job Demands-Resources-Modell (JD-R) eingeführt (3.2.). Hier bezieht sich die Diskussion hauptsächlich auf die Kernelemente dieses Ansatzes, der von Ressourcen und Anforderungen als Anfangspunkt der Betrachtung von Arbeitsstress ausgeht (Bakker & Demerouti, 2007, 2014; Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004; Demerouti & Bakker, 2011; Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001; Schaufeli & Taris, 2013). Unter Beachtung von Weiterentwicklungen sowie Kritik des Modells wird eine Systematik von Ressourcen und Anforderungen entwickelt, die erstens Elemente und Erklärungsansätze der HRT inkorporiert und es zweitens erlaubt, Ressourcen und Anforderungen als Komponenten des Arbeitsumfeldes in VAZ zu konzipieren.
Im zweiten Teil dieses Kapitels werden diese Komponenten folglich näher ausgeführt. Dabei wird diskutiert, warum die einzelnen Anforderungen und Ressourcen als typisch für VAZ-Arbeitsumfelder gelten können und wie sie in ihren Zusammenhängen und Auswirkungen im Stressentstehungsprozess einzuordnen sind. Dabei werden sowohl Anforderungen und Ressourcen diskutiert, welche als Kernelemente der VAZ gelten können, als auch solche, die dem Forschungsstand nach eine besondere Bedeutung in der VAZ besitzen können, aber nicht unbedingt definitorisch von Bedeutung für den Begriff der VAZ sind. Wie bereits skizziert, sind die erarbeiteten Anforderungen und Ressourcen die Basis für ein Modell der Anforderungen und Ressourcen der VAZ, welches empirisch überprüft werden soll.
Aufbauend auf der theoretischen Fundierung und der Erarbeitung des Forschungsstands erfolgt in Kapitel 4 die erste empirische Untersuchung. In dieser soll näher geklärt werden, ob flexible und insbesondere hoch flexible Arbeitszeitmodelle wie die VAZ sich günstig oder ungünstig auf Arbeitszufriedenheit, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und das Wohlbefinden auswirken. Es wird anhand von repräsentativen Daten des Sozioökonomischen Panels folglich zunächst untersucht, welche Auswirkungen von verschieden flexiblen Arbeitszeitmodellen auf verschiedene abhängige Variablen zu beobachten sind. Hier wird zwischen drei Gruppen von Modellen unterschieden: fester Arbeitszeit, flexibler Arbeitszeit und selbst festgelegter Arbeitszeit. Letztere ist hier von besonderer Bedeutung, da sie der VAZ am nächsten kommt. Basierend auf Hypothesen, die sich aus arbeitspsychologischen Theorien und dem Forschungsstand zu flexiblen Arbeitszeitmodellen ergeben, wird im Längsschnitt anhand von Mehrebenenmodellen untersucht, welche Auswirkungen die verschiedenen Modelle auf die Arbeitszufriedenheit, die Freizeitzufriedenheit und die subjektive Gesundheit haben. Außerdem wird überprüft, ob gegebene Zusammenhänge durch Bildung und durch Mehrarbeit moderiert werden, also ob das Bildungsniveau und die Mehrarbeit sich je nach Arbeitszeitsystem unterschiedlich auswirken. Das Ziel ist es also hier, zunächst Wirkungen des Arbeitszeitsystems VAZ unter verschiedenen Bedingungen auf das Wohlergehen zu untersuchen, bevor in der zweiten, folgenden Studie die Mechanismen genauer untersucht werden, welche diese Wirkungen bedingen.
Im darauffolgenden Kapitel 5 wird zunächst ein Modell der Anforderungen und Ressourcen der VAZ konzipiert. Dieses ergibt sich daraus, dass die in Kapitel 3 beschriebenen Anforderungen und Ressourcen zueinander in Beziehung gesetzt werden. Die dahinterliegende Annahme ist, basierend auf dem JD-R-Modell, dass Ressourcen die Wirkung von Anforderungen beeinflussen können und umgekehrt. Darauf aufbauend wird ein Grundmodell angenommen, das die zwei Schlüsselkomponenten der VAZ beinhaltet. Zwei Grundprozesse analysieren die verschiedenen Anforderungen im Zusammenspiel mit der im Grundmodell untersuchten Ressource bzw. verschiedene Ressourcen im Zusammenspiel mit den im Grundmodell untersuchten Anforderungen.
Die empirische Überprüfung der so generierten Hypothesen wird mit Hilfe einer Stichprobe in VAZ Tätiger verwirklicht. Hierzu wurde eine Online-Befragung durchgeführt, die die Ressourcen und Anforderungen des Modells abfragt. In Strukturgleichungsmodellen werden die verschiedenen Haupteffekte, Mediationshypothesen und Moderationshypothesen überprüft. Die Ergebnisse dieser zweiten Studie werden im Folgenden dargestellt und diskutiert.
Im letzten Kapitel dieser Arbeit werden sämtliche theoretischen und empirischen Befunde zusammengefasst. Zudem werden Limitationen der Arbeit diskutiert. Weitere Ansätze zur Erforschung der VAZ werden im Anschluss vorgestellt. Schließlich werden von den Ergebnissen dieser Arbeit einige Handlungsempfehlungen für die Praxis der VAZ abgeleitet, die eine mitarbeitergerechte, also gesundheitsförderliche Implementierung der VAZ möglich machen sollen.
Diese Arbeit entstand, wie bereits durch die Schilderung des Aufbaus ersichtlich wurde, zwischen zwei Wissenschaftskulturen. Dies begründet sich aus den divergierenden Fachhintergründen der Verfasserin (Soziologin) und des Erstgutachters und Betreuers der Arbeit (Psychologe), aber auch aus der Bereitschaft, sich nicht von den fachlichen Grenzen zweier Disziplinen einengen zu lassen und die Abwägungen zur Ausrichtung der Arbeit immer daran zu messen, ob theoretische Ansätze und Methoden dem Forschungsgegenstand gerecht werden konnten. Die Absicht, sowohl soziologische als auch psychologische Konzepte einfließen zu lassen stand der Schwierigkeit gegenüber, Verbindungslinien zwischen diesen herzustellen. Alles in allem obliegt es nun dem Leser zu entscheiden, ob dies gelungen ist.
1 Im Folgenden wird zugunsten des Leseflusses darauf verzichtet, die weibliche Form auszuschreiben. Selbstverständlich sind mit den Begriffen „Mitarbeiter“ etc. immer alle Geschlechter gemeint, es sei denn, es wird explizit eingeschränkt.
2 Vertrauensarbeitszeit – Einführung zu Begriff, Verbreitung, Debatte und soziologischer Rahmung
Im Folgenden wird zunächst der Begriff „Vertrauensarbeitszeit“ (VAZ) genauer eingegrenzt. Dabei wird auch eine für die vorliegende Arbeit geltende Definition entwickelt. Um die Bedeutung des Phänomens VAZ einschätzen zu können, wird darauf folgend die Verbreitung des Systems in Deutschland dargestellt. In der wissenschaftlichen, aber auch der politischen Debatte haben sich verschiedene Positionen zum Konzept VAZ herausgebildet. Diese verschiedenen Positionen werden im Folgenden dargestellt und in ihrem Kontext eingeordnet. Schließlich werden verschiedene soziologische Konzepte vorgestellt, die sich zwar nicht explizit mit dem Thema VAZ auseinandersetzen, in ihren zeitdiagnostischen Analysen jedoch viele Berührungspunkte mit dem Begriff und der Praxis der VAZ aufweisen.
2.1 „With great power comes great responsibility“ – wesentliche Charakteristika von Vertrauensarbeitszeit
In diesem Kapitel soll es sowohl darum gehen, den Begriff Vertrauensarbeitszeit vorläufig zu definieren, als auch bestimmte Probleme, die mit einem solchen Definitionsversuch einhergehen, zu thematisieren. Im Folgenden werden deshalb immer wiederkehrende Elemente der Vertrauensarbeitszeit zusammengefasst. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Aspekte Autonomie und Unternehmenskultur. Als Fazit wird die Bedeutung der Elemente und der genannten Bezüge erläutert und in den Gesamtkontext dieser Arbeit gestellt.
Der Begriff der Vertrauensarbeitszeit, bei welchem es sich nicht um einen geschützten Begriff handelt, wird von unterschiedlichen Akteuren in unterschiedlicher Weise definiert. Gemeinsam ist den divergierenden Definitionen jedoch, dass das prägnante Merkmal dieses Arbeitszeitmodells den Verzicht auf die Erfassung von Arbeitszeit bei abhängig Beschäftigten darstellt, die in der Folge Lage und Dauer ihrer Arbeitszeit weitgehend selbst festlegen können bzw. müssen (Bauer, Groß, Lehmann & Munz, 2004; Böhm et al., 2004a; Haipeter, Lehndorff & Schilling, 2002: 99; Hoff & Weidinger, 1999). Andreas Hoff, Arbeitszeitberater, betont insbesondere die Abkopplung der Präsenzzeit von der Arbeitszeit (Hoff & Weidinger 1999: 5). Dies bedeutet konkret, dass nur die Zeit, in der man im Hinblick auf die zugeteilten Aufgaben aktiv ist, als Arbeitszeit definiert wird (unabhängig von Aufenthaltsort, Tageszeit und Wochentag). Im Unterschied dazu wird in gängigen Arbeitszeiterfassungssystemen jegliche Zeit, die ein Mitarbeiter anwesend ist, als Arbeitszeit erfasst.
Wenn man die Vertrauensarbeitszeit von fester Arbeitszeit und flexibler Arbeitszeit mit Zeiterfassung abgrenzen möchte, so ist dies am einfachsten durch die Betrachtung der Bezugsgrößen zu bewerkstelligen, die regeln, was als „Arbeitszeit“ gilt. Sind es bei der festen Arbeitszeit vor allem die festgelegte Anfangs- und Endzeit des Arbeitstages und der Arbeitswoche, so verlagert sich dies bei flexiblen Arbeitszeiten auf die Wochen- Monats- bzw. Jahresarbeitszeit und die erfassten Anwesenheitszeiten2. Bei der Vertrauensarbeitszeit geschieht die „Messung“ der Arbeitszeit lediglich durch den inhaltlichen Bezug auf die Erreichung von arbeitsbezogenen Zielen. Dies wird nicht immer in dieser Form durchgehalten (wenn bspw. Regelungen zur Mehrarbeit getroffen werden oder die Selbstaufschreibung der Arbeitszeiten angeordnet wird), stellt jedoch das zentrale Unterscheidungskriterium der VAZ im Hinblick auf andere Arbeitszeitsysteme dar. Es erfolgt eine Abwendung von den Bezugssystemen Anwesenheit und Zeit und eine Zuwendung zu den Bezugssystemen Arbeitsinhalte und Arbeitsleistung (Böhm et al., 2004a; Hoff, 2002).
Hier muss ergänzt werden, dass der vollständige Verzicht auf Arbeitszeiterfassung mit dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG, 1994) nicht vereinbar ist. Nach §3 dieses Gesetzes darf die regelmäßige Arbeitszeit acht Stunden täglich nicht überschreiten. Alle Arbeitszeiten, die darüber hinausgehen, müssen aufgezeichnet werden und die Nachweise darüber zwei Jahre aufgehoben werden (§16) (ArbZG, 1994). Streng genommen muss eine Arbeitszeiterfassung also immer nach acht Stunden erfolgen, was natürlich dem Gedanken der VAZ entgegensteht, wenn die Arbeitsinhalte anstatt der geleisteten Arbeitszeit in den Vordergrund rücken sollen. Deshalb delegieren viele Arbeitgeber die Dokumentation der Arbeitszeit nach ArbZG an ihre Mitarbeiter, was durchaus mit dem Gesetz vereinbar ist (Hoff, 2012a). Ob dann diese Dokumentation gewissenhaft durchgeführt wird ist eine andere Frage.
In der Praxis existieren viele verschiedene Ausgestaltungen des Systems „Vertrauensarbeitszeit“. Wingen und andere zählen als die aus verschiedenen Quellen zusammengetragenen wichtigsten Elemente der VAZ folgende Merkmale auf: „Wegfall von personenbezogener Arbeitszeit- und Anwesenheitsvorgaben“, „Verzicht auf formale Arbeitszeiterfassung und -kontrolle durch Arbeitgeber“, „Erweiterte Handlungs- und Entscheidungsspielräume der Beschäftigten“, „Einhaltung und Vergütung der tariflich bzw. vertraglich vereinbarten Arbeitszeit“ und „Zielvereinbarung und Ergebnisorientierung“ (Wingen et al., 2004: 55f.). Neben den Aspekt der Arbeitszeitautonomie treten also die Autonomie der Tätigkeit an sich und die selbständige Arbeit im Hinblick auf Zielvorgaben.
Hinzu können folgende nicht zwingend notwendige, aber ergänzende Elemente kommen: „Freiwillige Zeiterfassung durch Selbstaufschreibung“, „Entkoppelung von Arbeits- und Anwesenheitszeiten“, „Frei wählbarer Arbeitsort“, „Orientierung an betriebsinternen Funktions- oder Servicezeiten“, „Wahlarbeitszeit (d.h. variabel wählbare Vertragsarbeitszeit)“, „Regelungen zum Umgang mit Überlastsituationen“, „Bezahlte Mehrarbeit“, „Langzeitkonto“ und „Urlaubsplanung und „Vertrauensurlaub““ (Wingen et al., 2004: 58ff.). Diese Elemente beziehen sich zum einen auf erweiterte Handlungsoptionen (z.B. Wahlarbeitszeit, frei wählbarer Arbeitsort, Vertrauensurlaub) sowie auf Regulierungsmechanismen, die innerhalb des Systems geschaffen werden, (so z.B. Servicezeiten, Langzeitkonto, Regelungen zum Umgang mit Überlastsituationen).
Die Aufzählung zeigt hierbei zweierlei: Einerseits gibt es klare Kriterien, die ein Arbeitszeitsystem als VAZ klassifizieren, andererseits können noch viele Elemente hinzukommen, die potentiell die jeweilige Arbeitswirklichkeit der Mitarbeiter sehr unterschiedlich ausgestalten können. Allein der Umgang mit Überlastsituationen, bzw. die Schaffung von klaren Regelungen, die diesen Umgang ausgestalten, dürfte das Belastungsempfinden der Mitarbeiter erheblich beeinflussen, je nachdem, ob Führungskräfte und Team auf die Belastungen eingehen und Ausgleiche finden oder nicht. Zusammenfassend ist zu sagen, dass VAZ vor allem dadurch charakterisiert ist, dass die Arbeitszeiten durch die Mitarbeiter autonom geregelt werden und dass außerdem die Zielerreichung und Orientierung am Arbeitsergebnis in den Vordergrund treten und die reine Anwesenheitszeit als Messgröße für die Arbeitsleistung ablösen. Diese begriffliche Grundlage macht auch die Bedeutung des in der Überschrift erwähnten Zitats „With great power comes great responsibility“ deutlich. Die erhöhte Freiheit und letztlich auch Ermächtigung der Mitarbeiter, die sich durch die eigenverantwortliche Arbeitszeitgestaltung in der VAZ ergibt, wird durch eine erhöhte Verantwortung für das Erreichen von Arbeits- bzw. unter Umständen auch Unternehmenszielen begleitet. Erhöhte Kontrolle über die eigene Arbeit wird also begleitet mit erhöhter Verantwortlichkeit für die eigene Arbeit.
Wie bereits in den beschriebenen Kernelementen der VAZ anklingt, ist ein Hauptbestandteil des Systems der Grad der Selbststeuerung, der von den Mitarbeitern in diesem Arbeitszeitsystem erwartet wird. Wie schon oben geschildert, ist der Mitarbeiter in diesem Konzept dazu angehalten, seine Anwesenheit und seine Arbeit eigenständig zu planen und zu organisieren. Den Überblick über die geleistete Arbeitszeit hat in der Konsequenz nur noch der Mitarbeiter selbst (Hoff & Weidinger, 1999: 5). Was genau aber nun als Arbeitszeit zählt, ist nicht definiert. Deshalb stellen Haipeter et al. (2002) zu Recht eine gewisse „Unschärfe“ innerhalb des Konzepts fest.
Die Einführung von VAZ geht über eine Neuregelung der Arbeitszeiterfassung weit hinaus. Nach Böhm und anderen ist die Vertrauensarbeitszeit „nicht nur ein neues3 Arbeitszeitmodell (…), sondern integraler Bestandteil eines umfassenderen betrieblichen Reorganisationskonzeptes“ (2004: 19). Das bedeutet unter anderem, dass Vertrauensarbeitszeit meist mit ergebnisorientierten Steuerungsformen wie Management by Objectives verknüpft ist (siehe auch oben genannte zentrale Elemente der VAZ). Das heißt, dass individuelle bzw. arbeitsgruppenbezogene Ziele vereinbart werden, deren Erfüllung dem einzelnen Mitarbeiter obliegt. Diese Ziele orientieren sich dabei entweder an der Erfüllung bestimmter Aufgaben oder auch an abstrakteren, quantitativen Zielen, die sich auf Umsatz- oder Gewinnerwartungen beziehen (vgl. Geramanis, 2002; Herrmann, 2005). An dieser Stelle wird (wie bereits vorher angeklungen) eine der zunächst verborgenen und dennoch vielfach erlebten Eigenschaften dieses Arbeitszeitmodells deutlich: Der oder die Beschäftigte ist dazu angehalten, die Verantwortung für seine oder ihre Arbeitsorganisation und für das Erreichen unternehmerischer Ziele selbst zu übernehmen. In diesem Zusammenhang ist immer wieder von einer „Subjektivierung der Arbeit“ (Geramanis, 2002) die Rede, oder auch vom „unselbständigen Selbständigen“ (Glißmann & Peters, 2001). Positiver formuliert, kann man aber auch von einem erheblichen Autonomie-Gewinn für Arbeitnehmer ausgehen, wenn sie die Arbeit eigenständig strukturieren und die Verteilung der Arbeitszeit frei gestalten können.
Dahinter steht ein Vertrag (im Sinne eines psychologischen Vertrags4) zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der den Austausch von erhöhter Leistungsbereitschaft gegen eine erweiterte Autonomie beinhaltet. Dieser verlangt einen neuen Typ von Arbeitnehmer, der (wie schon oben diskutiert) flexibel ist und unternehmerisch denkt (Böhm et al. 2004: 15). An dieser Stelle kann man zusammenfassen: Der Arbeitgeber verzichtet im Modell der VAZ auf die Regulierung einer bisher wichtigen Bezugsgröße in der Gestaltung der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung, nämlich der Arbeitszeit. Die Regulierung dieser Größe obliegt in der Folge dem Arbeitnehmer, d.h. es findet eine „Verlagerung der Regulierungskompetenz“ statt (Böhm et al. 2004: 17). Inwiefern und in welchem Maß eine Abnahme der betrieblichen Regulierung eine Zunahme der individuellen Regulierung mit sich bringt, wird noch zu diskutieren sein. Es stellt sich die Frage, ob eine Zunahme der individuellen Regulierung mit einer Erhöhung der Regulationsanforderungen an das Individuum im Sinne der Handlungsregulationstheorie einhergeht (u.a. Volpert, 1987; Zapf & Semmer, 2004). Weitere Ausführungen hierzu folgen in Kapitel 3 dieser Arbeit.
Wenn die VAZ nach den ausgeführten Prinzipien praktiziert wird, kann sie unter Umständen als Win-Win-Situation eingeschätzt werden. Der Arbeitgeber erhält motivierte und leistungsstarke Mitarbeiter, die das unternehmerische Risiko mittragen, während der Arbeitnehmer von einer erhöhten Zeitautonomie und Freiheiten in der Organisation der eigenen Arbeit profitiert.
Wenn von der Zeitautonomie des Individuums gesprochen wird, muss jedoch auch angemerkt werden, dass diese zwangsläufig eingeschränkt ist. Nicht nur ist die Lebenswelt und somit auch das Zeithandeln der Individuen durch andere, außerhalb der Arbeit liegende Faktoren strukturiert (z.B. durch die Familie/Partnerschaft, durch Freizeitaktivitäten). Auch die „innerbetriebliche Autonomie“ ist nicht grenzenlos, sondern wird mitbestimmt durch „bestehende Arbeits- und Kooperationsanforderungen“ und den „Abgleich mit den Zeitinteressen der KollegInnen“ (Böhm et al. 2004: 22). Außerdem bestehen, wie oben angemerkt, oftmals betrieblich festgelegte Zeitkorridore, in denen die Anwesenheit der Mitarbeiter erwartet wird (z.B. Servicezeiten). Zudem kann die Arbeitszeit als Bezugsgröße nicht vollkommen außer Acht gelassen werden. Massive Über- oder Unterschreitungen der tariflich oder vertraglich festgelegten Arbeitszeit sollen ausgeglichen werden. Dies ist ein Unterschied zu dem System der „Arbeitszeitfreiheit“, in dem es keine festgelegte Wochenarbeitszeit mehr gibt und die Leistung nur noch an Zielerreichung gemessen wird (vgl. Andresen, 2009; Hoff, 2012b). Bei einer Studie von Scherrer aus dem Jahr 2000 zeigte sich interessanterweise auch, dass über die Hälfte der betreffenden Mitarbeiter nach der Einführung von VAZ ihre Arbeitszeit weiterhin aufzeichnete. Dies kann auch als Hinweis darauf gewertet werden, dass den Flexibilitätserfordernissen innerhalb der VAZ „Sicherheits- und Nachweisbedürfnisse“ von Beschäftigten gegenüber stehen können (Wieland & Scherrer, 2002: 5).
An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie unter den Bedingungen der weitgehenden Zeitautonomie sichergestellt werden kann, dass diese weder ausgenutzt wird, um die Leistung einzuschränken, noch eine Überlastung der Mitarbeiter zur Folge hat. Als „Erfolgsvoraussetzungen“, die für die Einführung und Praxis der VAZ von zentraler Bedeutung sind, führt Hoff diesbezüglich folgende Punkte auf:
„die klare Botschaft, dass mit der Abschaffung der arbeitgeberseitigen Zeitkontrolle nicht die Abschaffung der Arbeitszeit selbst bezweckt wird, sondern der eigenverantwortliche Zeitausgleich durch den Mitarbeiter […]; die Vereinbarung eines Verfahrens, das die faire Ausbalancierung von Arbeitsaufgaben und des für ihre Erledigung benötigten Arbeitszeitbudgets insbesondere dann ermöglicht, wenn Mitarbeiter oder Führungskraft an dieser Balance zu zweifeln beginnen; und die Schaffung betriebsinterner Freiräume, in denen Vertrauensarbeitszeit ausprobiert werden kann, ohne sich ihr gleich „auf Gedeih und Verderb auszuliefern. […] Diese drei Voraussetzungen, […], bieten im übrigen sämtliche erforderlichen Ansatzpunkte für die Entwicklung einer betrieblichen „Zeitvertrauens-Kultur“ – vielleicht als Wegbereiter einer insgesamt stärker auf Vertrauen beruhenden Zusammenarbeit im Betrieb.“ (Hoff und Weidinger 1999: 2)
Die Aufzählung dieser Voraussetzungen macht die idealtypische Ausgestaltung der VAZ, wie sie von deren „Erfindern“ gedacht wurde, deutlich. Die Begriffe „Vertrauen“ sowie „Unternehmenskultur“ stellen sich als zentrale Konstrukte dar, die die Idee der VAZ stützen.
An dieser Stelle sollte zunächst auf die Verwendung des Begriffs „Vertrauen“ in Zusammenhang mit der VAZ eingegangen werden. Der Begriff Vertrauen bezieht sich hier auf die Annahme, dass unter den Bedingungen der VAZ der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer „vertraut“, dass dieser seine Aufgaben in der vertraglich vereinbarten Zeit erfüllt und somit auf die Kontrolle dessen verzichtet (Haipeter et al., 2002; Hoff & Weidinger, 1999). Das Konzept, so wie es vom Ursprung her gedacht ist, impliziert außerdem eine Unternehmenskultur, in der die Verhältnisse zwischen Führungskräften und ihren Mitarbeitern so von Vertrauen geprägt sind, dass die Mitarbeiter auf dieser Basis in Fällen von „Überlastsituationen“ in Gespräche mit ihren Vorgesetzten eintreten können und im Rahmen dieser Gespräche beispielsweise Aufgaben reduziert oder Ziele modifiziert werden können (vgl. Hoff und Weidinger 1999; Haipeter et al. 2002). Des Weiteren wird die Bedeutung des Vertrauens zwischen den Mitarbeitern betont (Hoff, 2002: 31). Diese Bedeutung speist sich daraus, dass innerhalb eines Teams Vertrauen hinsichtlich des Beitrags des Einzelnen zur Teamleistung hergestellt werden muss, welches sich in der VAZ nicht mehr allein aus der „vorzeigbaren“ erfassten Arbeitszeit ableiten lässt (vgl. Böhm et al., 2004a: 175ff.).
Aus der Vereinbarung, dass Mitarbeiter die Überlastung in vielen Fällen selbst anzeigen müssen, ergibt sich ebenfalls eine wichtige Voraussetzung für VAZ: Im Unternehmen muss eine entsprechende Kultur hergestellt werden, in der Mitarbeiter ohne Bedenken Überlastungen zugeben und anzeigen (Klein-Schneider, 2007: 57). Diese Kultur wird später in diesem Kapitel noch einmal thematisiert.
Da die VAZ keineswegs in allen Fällen und in jedem Betrieb das gleiche bedeutet und in ihrer konkreten Praxis durchaus differieren kann (vgl. Böhm et al., 2004; Haipeter et al., 2002), dürfte zu diskutieren sein, ob Vertrauen im Unternehmen tatsächlich immer einen integralen Bestandteil der VAZ konstituiert. Obwohl der Begriff Vertrauen im Namen der VAZ zu finden ist, wird die Bedeutung von Vertrauen sowie die sprichwörtliche „Vertrauenskultur“, die als Voraussetzung für eine erfolgreiche Einführung der VAZ benannt wird (s.o.), in der einschlägigen Literatur zur Erklärung des Konzepts bemerkenswert wenig thematisiert bzw. konkretisiert (Hoff, 2002, 2012b; Hoff & Priemuth, 2001; Hoff & Weidinger, 1999).
Kritische Stimmen bemängeln, dass der Begriff Vertrauen in Zusammenhang mit der VAZ nicht in seiner genuin sozialen Bedeutung verwendet wird, sondern instrumentalisiert und ökonomisch verwertet wird (Geramanis, 2002: 350). Bei diesem Vorwurf liegt aber wahrscheinlich eine unzureichende Abgrenzung des Begriffs Vertrauen vor, wie sich in den weiteren Ausführungen noch zeigen wird. Böhm und andere unterstellen den Befürwortern der VAZ gar, dass sie den Begriff Vertrauen dazu benutzten „ein positiv besetztes Label für das neue Arbeitszeitmodell zu generieren“ (2004: 23). So sehen sie denn auch eine Herausforderung darin, den Bestandteil des Vertrauens in der VAZ aus der Empirie abzuleiten und nicht aufgrund des Begriffes als gegeben anzunehmen (Böhm et al., 2004a: 23). Kritisch sehen auch Haipeter und andere den Vertrauensbegriff innerhalb der VAZ, da sie davon ausgehen, dass Vertrauen zwischen Interaktionspartnern ohne Gleichberechtigung (Führungskraft und Geführtem) bzw. bei Machtasymmetrie schwer herzustellen ist (Haipeter et al., 2002: 370).
Im Folgenden wird hier aufgrund der bisher wenig erfolgten begrifflichen Präzisierung der Versuch unternommen, Vertrauen sowohl aus soziologischer Sicht als auch als psychologischer Sicht näher zu bestimmen und dessen Elemente in Beziehung zur Vertrauensarbeitszeit zu setzen. Simmel bezeichnet Vertrauen als „mittlerer Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen um den Menschen“ (Simmel, 1958: 263). Es geht also darum, nicht die völlige Kontrolle über das Verhalten eines Interaktionspartners zu haben, jedoch gleichzeitig genügend Informationen, um vernünftigerweise anzunehmen, der Interaktionspartner verhalte sich so, wie man es erwartet. Diese Informationen sind in der Regel dadurch verfügbar, dass eine Dauerbeziehung zu demjenigen besteht, dem vertraut wird (Preisendörfer, 1995: 267). Diese Vertrauensbeziehung ist ein sehr komplexes Konstrukt und baut sich langsam und schrittweise auf (Preisendörfer, 1995). Im Widerspruch zur Vertrauensbeziehung steht es „genaue Informationen und Belege zu fordern“ (Preisendörfer, 1995: 268), wie auch bei Luhmann (1968: 32) nachzulesen ist.
In welchen Stadien der Aufbau einer Vertrauensbeziehung erfolgt, haben die beiden Psychologen Lewicki und Bunker (1995) in einem Modell der Vertrauensentwicklung in Beziehungen beschrieben. In diesem Modell gibt es folgende Arten von Vertrauen: „deterrence-based trust“, welches auf der Einhaltung von Erwartungen durch drohende Sanktionen basiert, „knowledge-based trust“, welches auf genügend Informationen basiert, die sichere Aussagen über das Verhalten anderer ermöglichen, und „identification-based trust“, welches auf der Internalisierung der Wünsche und Absichten des Interaktionspartners basiert, also eine gewisse Intimität voraussetzt (Lewicki & Bunker, 1995: 142). In den drei Formen bzw. Entwicklungsstadien des Vertrauens sind also unterschiedliche Mengen an Informationen über Interaktionspartner verfügbar. Die Autoren nehmen an, dass diese drei Stadien typischerweise in der Entwicklung von Vertrauensbeziehungen nacheinander ablaufen, wobei sich die Vertrauensbeziehung bei Vertrauensbruch auch von einem höheren in ein niedrigeres Stadium zurück entwickeln kann (Lewicki & Bunker, 1995: 144).
Wenn man diese verschiedenen Formen des Vertrauens im Kontext der VAZ betrachtet, ergibt sich Folgendes. Wenn in Vertrauensarbeitszeit lediglich deterrence-based trust erreicht werden kann, unterminiert dies die Ziele, die oftmals mit der Einrichtung von VAZ erreicht werden sollen, denn diese erfordert eine Rücknahme von Kontrollmechanismen. Wie Lewicki und Bunker beschreiben, ist diese Form des Vertrauens jedoch darauf begründet, dass Handlungen der Personen kontrolliert werden können und somit das Risiko der Unberechenbarkeit eliminiert wird (Lewicki & Bunker, 1995: 153). Im Gegensatz dazu ist diese Form der Kontrolle bei knowledge-based trust nicht notwendig, da sich das Vertrauen auf das Wissen über den anderen gründet, ohne dass Kontrolle ausgeübt werden kann oder ausgeübt werden will (Lewicki & Bunker, 1995). Diese bereits oben beschriebene Beziehung und das Wissen übereinander kann aber nur bei längerer Interaktion miteinander aufgebaut werden und ist folglich nicht möglich, wenn in Unternehmen langfristige Beziehungen zwischen Führungskraft und Geführten die Seltenheit sind (z.B. auf Grund von Fluktuation) oder die Hierarchien solche Beziehungen nicht ermöglichen, also eine gewisse Distanz in den Beziehungen gewahrt wird. Die Beschreibung der Art des Vertrauens als „Vertrauenskultur“ innerhalb der VAZ legt aber nahe, dass hier eben durchaus mindestens knowledge-based, wenn nicht sogar identification-based trust gemeint ist. Die VAZ setzt schließlich zum einen voraus, dass den Mitarbeitern Autonomie über die Arbeitszeit gewährt wird. Dies verlangt Vertrauen seitens des Arbeitgebers in die Beschäftigten. Zum anderen wird implizit erwartet, dass Mitarbeiter bei Überlastungen diese den Vorgesetzten anvertrauen (siehe oben, vgl. Klein-Schneider, 2007). Dies verlangt ein relativ hohes Maß an Vertrauen der Beschäftigten in ihre jeweiligen Führungskräfte, denn sie könnten auch die Befürchtung entwickeln, dass das Wissen über die Überlastung als Schwäche ausgelegt und mit Sanktionen bis hin zur Kündigung reagiert wird (vgl. Haipeter et al., 2002: 368f.).
Ein versteckter Kontrollmechanismus innerhalb der VAZ, nämlich die starke Ergebnisorientierung, hat durchaus das Potenzial, Vertrauensbeziehungen im Sinne von knowledge-based trust zu unterminieren. Wenn Sanktionen für die Nicht-Erreichung von Zielen möglich sind und erwartet werden, kann lediglich auf deterrence-based trust zurückgegriffen werden. Dies macht auch deutlich, dass höher entwickeltes Vertrauen in der VAZ nicht zwingend notwendig ist. Weitere mehr oder weniger offene Kontrollmechanismen, wie sie von Böhm und anderen (2004a) beschrieben wurden, die sich auf eine Kontrolle der Anwesenheit der Mitarbeiter beziehen, haben ebenfalls das Potenzial, Vertrauensbeziehungen gar nicht erst entstehen zu lassen, bzw. die weitere Entwicklung dieser zu hemmen.
Insgesamt bleibt die tatsächliche Ausprägung von Vertrauen also abhängig von der jeweiligen Ausgestaltung der VAZ und der Beziehungen im Unternehmen insgesamt. Es stellt sich die Frage, wie dieses Vertrauen hergestellt werden kann bzw. ob dies überhaupt seitens der betrieblichen Akteure angestrebt wird. Wie bereits geschildert, kann VAZ auch ohne ein hoch ausgeprägtes Vertrauen zwischen den Akteuren auskommen. Es bleibt also fraglich, ob Vertrauen im Sinne eines Verzichts auf Kontrollmechanismen und im Sinne einer fortgeschrittenen Vertrauensbeziehung definitorisch von großer Bedeutung für die VAZ ist.
Die oft erwähnte Vertrauenskultur in Unternehmen, die als Voraussetzung zur erfolgreichen Implementierung und Konsolidierung der VAZ geschildert wird, soll hier näher betrachtet werden. Unter einer Vertrauenskultur könnte man, die obigen Ausführungen im Hintergrund, verstehen, dass die Beziehungen in einem Unternehmen in hohem Maße von gegenseitigem Vertrauen geprägt sind, welches sich dadurch bemerkbar macht, dass Beschäftigte ohne erhöhte Kontrollmechanismen relativ reibungslos miteinander arbeiten. Man könnte argumentieren, dass eine derartige Ausgestaltung der Unternehmenskultur, wie sie von Befürwortern der VAZ gefordert wird, zwar von diesen als notwendige Voraussetzung gesehen wird, um das Modell überhaupt einzuführen. Sie erklären jedoch nicht im Einzelnen, wie dies zu bewerkstelligen sei. Insbesondere bei Abwesenheit von formalen Regelungen tritt „implizites kulturelles Wissen“ in den Vordergrund. Die Entstehung solcher kulturellen Wissensbestände kann natürlich auf betrieblicher Ebene gefördert werden, im Sinne eines soziologischen Verständnisses von „Organisationskultur“ kann diese jedoch nicht von oben verordnet werden, sondern wird von den Akteuren fortlaufend selbst hergestellt und reproduziert. Dabei ist die Entstehung von Subkulturen innerhalb eines Unternehmens möglich und wahrscheinlich (Böhm et al., 2004a: 34).
Man stößt hier also auf einen Widerspruch innerhalb des Konzepts der VAZ. Es wird verzichtet auf formale Regulierung zugunsten einer Regulierung durch einerseits die Selbstorganisation der Beschäftigten und andererseits einer Unternehmenskultur, die etwas mit Vertrauen zu tun hat, jedoch nicht näher beschrieben ist. Beide Faktoren, sowohl die Selbstorganisation von Beschäftigten als auch die Unternehmenskultur, werden sozusagen als Vorbedingung für das Funktionieren der VAZ formuliert. Es ist aber keinesfalls näher zu bestimmen, wie diese beiden Faktoren beeinflusst oder auch von Grund auf hergestellt werden können. Einige Hinweise hierzu liefern Wieland und Scherrer: Sie wenden zu Recht ein, dass eine Vertrauenskultur nicht als gesetzt angenommen werden kann, sondern einer langfristigen Entwicklung bedarf (vgl. auch Ausführungen zum soziologischen Verständnis von Vertrauen). So empfehlen sie die Kommunikation über Arbeitsinhalte und Ergebnisse zu steigern und „vielfältige, eigenverantwortliche Arbeitsaufgaben mit Handlungsspielräumen und Rückmeldung/Anerkennung“ zu schaffen (Wieland & Scherrer, 2002: 11). Sie sehen die Vertrauenskultur als „gemeinsame „kollektive“ Aufgabenorientierung“, die untermauert wird durch „geeignete Leitbilder und Führungsgrundsätze“ (Wieland & Scherrer, 2002: 14).
Hier stellt sich auch die Frage, mit welchen Absichten die Einführung von VAZ erfolgen kann. Mit der Einführung kann die Intention „Fehlzeiten zu reduzieren und unproduktive Anwesenheitszeiten zu vermeiden“ verknüpft sein (Haipeter et al. 2002: 362). Außerdem ist mit diesem Modell vielfach die Hoffnung verbunden, Leistung und Motivation durch die Delegation von Verantwortung zu steigern und Bürokratie durch die Abschaffung aufwändiger Zeiterfassungssysteme abzubauen (vgl. Hoff und Weidinger 1999).
Gerade weil das Konzept an vielen Stellen an aktuelle (sich auf den ersten Blick widersprechende) Trends in der Entwicklung der Arbeitswelt anschließt, sowohl an „rein ökonomische Verwertungsinteressen“ als auch an „Vorstellungen der ganzheitlichen Förderung von Beschäftigten, an Vorstellungen der Stärkung ihrer inhaltlichen und zeitlichen Handlungsautonomie“ (Böhm et al. 2004: 47), ist es in sich widersprüchlich. Außerdem entzieht es sich einer genauen inhaltlichen Bestimmung:
„Das Modell bietet interpretationsoffene Leitbegriffe (wie etwa ‚Ende der Zeitverbrauchskultur‘, ‚Selbstverantwortung‘, ‚Zeitautonomie‘, ‚Kulturentwicklung‘, ‚partizipative Führung‘), die sich der Operationalisierung und Evaluierung weitgehend entziehen. Damit enthält das Konzept Vertrauensarbeitszeit genügend ‚Unschärfe‘, um als passende Lösung für unterschiedlichste Problemlagen und Zielvorstellungen in Unternehmen genutzt werden zu können.“ (Böhm et al. 2004: 47)
Eine weitere Herausforderung an die vorliegende Arbeit besteht somit darin, die tatsächliche Praxis der VAZ eingehender zu betrachten und zu evaluieren, um konkrete Auswirkungen von einzelnen Gestaltungsaspekten des Modells auf die in VAZ-Modellen5 arbeitenden Mitarbeiter einzugrenzen. Als Beispiel hierzu sei die bereits ausgeführte Klärung der Bedeutung von Vertrauen(sherstellung) zu nennen.
Die bisherigen Ausführungen stützen sich allesamt auf Quellen aus dem deutschsprachigen Raum. International, und somit in englischsprachiger Literatur, findet sich das Konzept VAZ in dieser Terminologie nicht wieder. Die Dominanz der Begrifflichkeit ist auf die „am stärksten ausgearbeiteten konzeptionellen Überlegungen“ zur VAZ zurückzuführen, die auf die oben bereits erwähnte Arbeitszeitberatungsfirma Dr. Hoff-Weidinger-Herrmann zurückgehen (Böhm et al. 2004: 19). In der englischsprachigen Literatur werden verschiedene Begriffe diskutiert, so das „Results Only Work Environment (ROWE)“ oder die „new ways of working“ (Blok, Groenesteijn, Schelvis & Vink, 2012; Moen, Kelly, Tranby & Huang, 2011). Ersteres stellt vor allem auf die Steuerung durch Ziele ab, letzteres beinhaltet mehrere Bestandteile flexibler Arbeit: So ist hier neben der zeitlichen auch die räumliche Flexibilität von Bedeutung sowie die Technologien und Steuerungsformen, die dadurch notwendig werden. Die Forschung zu den Auswirkungen dieser Arbeitsformen scheint sich aber auch noch im Anfangsstadium zu befinden (Blok et al. 2012: 2605f.). Obwohl keine exakte Übersetzung ins Englische verfügbar ist, werden im Folgenden Befunde zu mit VAZ verwandten Modellen in die Betrachtung von Ressourcen und Anforderungen der VAZ mit einbezogen, zumal davon auszugehen ist, dass nicht das Arbeitszeitsystem an sich, sondern bestimmte Charakteristika desselben bestimmte Konsequenzen für Mitarbeiter mit sich bringen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Vertrauensarbeitszeit in ihrer Wirkung auf Arbeitnehmer zu untersuchen. Hierbei dient die VAZ als Beispiel für ein Arbeitsarrangement, das für Mitarbeiter mit hohen Anforderungen an ihre persönliche Flexibilität verbunden ist. Im Arrangement VAZ bezieht sich diese Flexibilität hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, auf die Arbeitszeitgestaltung. Das heißt jedoch nicht, dass andere Aspekte der Flexibilität, die in diesem Modell von Bedeutung sind, keinen Einfluss auf das Wohlbefinden der betroffenen Arbeitnehmer haben und auch in den empirischen Analysen eine Rolle spielen. Der Fokus der Arbeit liegt jedoch auf dem Thema Arbeitszeitautonomie, da diese als das Kernkriterium der VAZ herausgearbeitet werden konnte.
Wie oben ausgearbeitet, hat diese Arbeitszeitautonomie Folgen für die Arbeitsorganisation. Zum einen stellt sie einen vom Unternehmen bereitgestellten Handlungsspielraum dar, der als Zugewinn der Freiheit verbucht werden kann. Das Individuum ist aber zum anderen genau deshalb permanent dazu angehalten, darüber zu entscheiden, welche Zeitinteressen wie berücksichtigt werden sollten. Insofern wird unternehmerisches Denken erforderlich, zumal Arbeitsergebnisse auch oftmals an den erreichten Umsatzsteigerungen gemessen werden. Die Arbeitszeitautonomie kann man also als durchaus als zweischneidiges Schwert wahrnehmen, das dem Arbeitnehmer zum einen viel Freiheit beschert, zum anderen aber auch viel Flexibilität, strategisches Handeln und Eigenverantwortung abverlangt. Auch hier zeigt sich wieder, dass große Freiheit mit großen Anforderungen einhergeht6. Dabei ist nicht näher bestimmt, welche Interessen der Mitarbeiter bei der Festlegung seiner Arbeitszeiten wie gewichten soll. Die jeweilige Ausgestaltung der VAZ beinhaltet also auch, ob Flexibilität eher arbeitnehmer- oder eher arbeitgeber-zentriert gelebt wird (vgl. auch Costa, Sartori & Akerstedt, 2006; Lott, 2014). Je nachdem, ob dem Mitarbeiter lediglich Flexibilität in Bezug auf betriebliche Belange abverlangt wird oder ob betriebliche Belange der Autonomie des Mitarbeiters untergeordnet werden, dürften sich auch die potentiellen Auswirkungen auf das Wohlbefinden unterscheiden. Dies wird noch näher in Kapitel 3 beleuchtet.
Insgesamt lässt sich zum Wesen der Vertrauensarbeitszeit Folgendes zusammenfassen: Den Kern der Vertrauensarbeitszeit bildet der Verzicht auf Erfassung der Arbeitszeit. Des Weiteren wird den Mitarbeitern weitgehende Zeitautonomie eingeräumt, wobei der Grad der Zeitautonomie, sowie die Berücksichtigung von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen durchaus unterschiedlich ausgeprägt sein können. Im Zusammenhang mit der VAZ wird außerdem immer wieder eine Unternehmenskultur thematisiert, in der durch Vertrauen sichergestellt werden soll, dass weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer das System zu ihren Gunsten ausnutzen. So wird deutlich, dass das Konzept VAZ nicht eindeutig umrissen werden kann, denn die konkrete Ausgestaltung sowohl der Zeitautonomie als auch der Unternehmenskultur kann innerhalb des Systems sehr unterschiedlich ausfallen. Aus diesem Grund sollten dessen konkrete Merkmale im Einzelfall empirisch erfasst und in Beziehung zueinander gesetzt werden.
2.2 Die Verbreitung der Vertrauensarbeitszeit
Um die bisher erfolgten Einschätzungen des Systems VAZ ins Verhältnis zu dessen quantitativer Bedeutung zu setzen, erfolgt hier eine Diskussion der Verbreitung dieses Systems. Dies ist unerlässlich, um einschätzen zu können, wie die quantitative Bedeutung des Phänomens allgemein bzw. hinsichtlich verschiedener Merkmale von Beschäftigten einzuordnen ist. Da der Begriff VAZ in Deutschland geprägt wurde und außerdem Modelle in anderen Ländern nur schwer mit den hiesigen zu vergleichen sind, beziehen sich die folgenden Ausführungen auf die Verbreitung der VAZ in Deutschland. Einige Anhaltspunkte zur Verbreitung in Europa werden ergänzt, wobei hier nicht genau nachvollzogen werden kann, ob es sich tatsächlich um Vertrauensarbeitszeit handelt. Schlüsse werden nur auf Grund bestimmter Merkmale der diskutierten Arbeitszeitsysteme gezogen. Zur Betrachtung der Verbreitung der VAZ gibt es zwei unterschiedliche Zugänge. Es kann zum einen die Frage gestellt werden, wie hoch der Anteil der Unternehmen ist, die VAZ praktizieren. Dies erlaubt aber keine Rückschlüsse auf die Anzahl von VAZ betroffener Arbeitnehmer. Dafür muss die Frage gestellt werden, wie hoch der Anteil der Arbeitnehmer ist, die in VAZ arbeiten. Beide Herangehensweisen vermitteln jedoch einen Eindruck über die Bedeutung des Phänomens, weshalb sie im Folgenden nacheinander eingenommen werden. Zunächst erfolgt eine Einschätzung des Anteils der Unternehmen, die VAZ praktizieren.
Einleitend muss hier noch ergänzt werden, dass die Verbreitung der VAZ an einem bestimmten Maßstab gemessen werden sollte. Die Verbreitung hat sozusagen einen natürlichen Grenzwert, da in vielen Berufen und Branchen dieses Arbeitszeitmodell nicht angewandt werden kann. Als Beispiele seien hier das Gesundheitswesen, der Einzelhandel und die öffentliche Sicherheit genannt. In diesen Bereichen ist die Sicherstellung der Anwesenheit der jeweiligen Personen zu festgelegten Zeiten integraler Bestandteil der Tätigkeit. Deshalb wäre die hohe Arbeitszeitautonomie, wie sie in der VAZ gewährt wird, hier kaum zu verwirklichen.
Vor dem Hintergrund dieser Randbedingung kann jedoch eine Einschätzung der Verbreitung vorgenommen werden. Die Verbreitung der VAZ in deutschen Unternehmen ist nur schwer zu bestimmen, da wenige Befunde aus repräsentativen Daten vorliegen. Nach einer Befragung von Personalmanagern wurde 2001 in 40% der Betriebe im Modell Vertrauensarbeitszeit gearbeitet, wobei in lediglich 29% der Betriebe alle Beschäftigten davon betroffen waren (Hoff & Priemuth, 2001; zitiert nach Haipeter et al. 2002). Diese Befragung kann jedoch keinesfalls als repräsentativ bezeichnet werden7. Es wird in der Literatur immer wieder ein Trend zur Vertrauensarbeitszeit hin beschrieben, dieser lässt sich jedoch nicht ohne weiteres belegen. Wingen und andere kommen beim Vergleich verschiedener Erhebungen und Datenquellen zu dem Ergebnis, dass ca. ein Viertel der Unternehmen VAZ, zumindest in Teilen, eingeführt haben. Dabei ergibt sich bezüglich der Unternehmensgröße und der Branchen der Unternehmen mit VAZ ein heterogenes Bild, so dass nicht gefolgert werden kann, dass VAZ nur in bestimmten Unternehmenstypen von Bedeutung ist. Allerdings bemerken sie einschränkend, dass keineswegs alle Unternehmen das gleiche Verständnis des Konzepts VAZ teilen. Vor allem die individuelle Zeitautonomie und größere Handlungs- und Entscheidungsspielräume werden nicht immer in der Praxis eingeführt (Wingen et al., 2004: 73ff.).
Zum Anteil der Beschäftigten in VAZ in Deutschland kann folgendes zusammengefasst werden: Immer wieder zitiert wird eine repräsentative Befragung zur Arbeitszeit, nach deren Ergebnissen 8% der Beschäftigten im Jahr 2003 im Modell Vertrauensarbeitszeit arbeiteten (Bauer et al., 2004: 19). Eine Befragung aus dem Jahr 2003 ergab, dass in Deutschland etwa ein Drittel der Beschäftigten über ein gewisses Maß an Selbststeuerung ihrer Arbeitszeiten verfügte, 34% dieser Beschäftigten hatten keine festen Anwesenheitszeiten (Bauer et al., 2004: 94). Bei 42% in dieser Gruppe erfolgte eine Zeiterfassung durch den Betrieb, bei 22% wurden die Arbeitszeiten selbst aufgeschrieben und bei 36% erfolgte gar keine Zeiterfassung (Bauer et al., 2004: 98). Dies würde bedeuten, dass von Mitarbeitern mit flexibler Arbeitszeit über die Hälfte in Modellen arbeiten, die der Vertrauensarbeitszeit entsprechen. Matta kommt in ihrer Studie mit Daten des SOEP (sozioökonomisches Panel) auf eine Verbreitung von Arbeitszeitkonten von etwas über 20%, und von selbst festgelegter Arbeitszeit von etwa 12% bei Arbeitnehmerinnen und etwa 17% bei Arbeitnehmern für das Jahr 2011 (Matta, 2015: 263). Laut den neuesten Zahlen des European Working Conditions Survey verfügten 2015 20% der Beschäftigten in Europa über flexible Arbeitszeiten in Form von Gleitzeit, 6% konnten ihre Anfangs- und Endzeiten gänzlich selbst bestimmen (European Union, 2015: 5). Dies lässt schließen, dass in der EU 6% der Arbeitnehmer in VAZ-ähnlichen Systemen arbeiten. Im Vergleich zu den Staaten der EU insgesamt gibt es in Deutschland also eine deutlich höhere Verbreitung von flexiblen Arbeitszeitsystemen und insbesondere der VAZ.