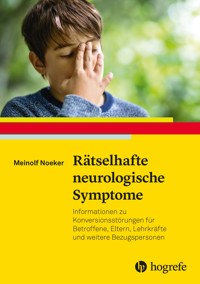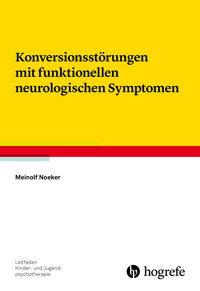
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Störungen mit funktionellen neurologischen Symptomen, besser bekannt unter dem traditionellen Begriff der Konversionsstörungen, reichen weit in die Geschichte der Psychotherapie zurück und haben bis heute nichts von ihrer Rätselhaftigkeit verloren. Sie präsentieren sich mit neurologisch imponierenden Symptomen, die jedoch ohne biomedizinischen Befund und Erklärung bleiben. Drei Gruppen stehen im Vordergrund: Bewegungsstörungen (z.B. Gangstörungen oder Lähmungen), sensorische Störungen (z.B. Sehschwäche bis hin zu funktioneller Blindheit) sowie dissoziative Anfälle, die an eine Epilepsie denken lassen, jedoch ein vollständig normales EEG zeigen. Die Abgrenzung pädiatrischer und neurologischer Differenzialdiagnosen ist medizinisch komplex. Der Leitfaden informiert zunächst über den Stand der Forschung zu Symptomatik, Klassifikation und Differenzialdiagnose. Diagnostische Verfahren legen den Fokus auf eine strukturierte Anamnese des Symptomverlaufs, die vorausgehenden individuellen und familiären Entwicklungsbedingungen, aktuelle Auslösefaktoren und die psychosozialen Folgebelastungen. Die Leitlinien zur Therapie eröffnen ein breites Spektrum verhaltensmedizinischer und psychotherapeutischer Interventionen. Ausgehend von einem für die Familie schlüssigen Störungskonzept umfasst die individualisierte Therapie eine Kombination aus symptomzentrierten und konfliktorientierten Ansätzen. Dazu zählen u.a. die Diagnosemitteilung, Psychoedukation, die Bearbeitung exzessiver Krankheitsangst, Aktivierung und Mobilisierung, Kontingenzmanagement, Interventionen bei Schulabsentismus, Imagination und Mentales Training, Achtsamkeitsbasierte Verfahren, Selbstkontrollverfahren bei Anfällen, Physiotherapie sowie konfliktorientierte Verfahren der Teilearbeit und Stuhltechniken. Verschiedene Praxismaterialien und Fallbeispiele erleichtern die Umsetzung der Leitlinien im klinischen Alltag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Meinolf Noeker
Konversionsstörungen mit funktionellen neurologischen Symptomen
Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie
Band 32
Konversionsstörungen mit funktionellen neurologischen Symptomen
Prof. Dr. Meinolf Noeker
Die Reihe wird herausgegeben von:
Prof. Dr. Manfred Döpfner, Prof. Dr. Charlotte Hanisch, Prof. Dr. Nina Heinrichs, Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann, Prof. Dr. Paul Plener
Die Reihe wurde begründet von:
Manfred Döpfner, Gerd Lehmkuhl, Franz Petermann
Prof. Dr. Meinolf Noeker, geb. 1958. 1977 – 1984 Studium der Psychologie in Bonn. 1985 – 1990 Tätigkeit in der Abteilung für Pädiatrische Onkologie der Unikinderklinik Bonn. 1990 – 1991 Mitarbeiter im Bereich Klinische Psychologie der Universität Bremen. 1991 Promotion. 1991 – 2011 Leitung des Psychologischen Dienstes am Zentrum für Kinderheilkunde der Universität Bonn. 2008 Habilitation. Seit 2012 Krankenhausdezernent LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), Münster. Psychologischer Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene und seit 1995 als Dozent, Supervisor und Selbsterfahrungsleiter (Verhaltenstherapie) tätig.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: Sabine Rosenfeldt, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2023
© 2023 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2313-5; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2313-6)
ISBN 978-3-8017-2313-2
https://doi.org/10.1026/02313-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
|V|Einleitung: Grundlagen und Aufbau des Buches
Konversionsstörungen bzw. Störungen mit funktionellen neurologischen Symptomen umfassen ein breites Spektrum von auf den ersten Blick sich neurologisch präsentierenden Symptombildern. Die medizinisch-diagnostische Abklärung erbringt jedoch regelmäßig keinen hinreichenden Nachweis einer somatisch-neurologischen Verursachung. Drei Gruppen stehen im Vordergrund: Bewegungsstörungen, wie z. B. Gangstörungen oder Lähmungen der Extremitäten, sensorische Störungen, wie z. B. eine Sehschwäche bis hin zu einer Blindheit, sowie Anfälle, die zunächst an eine Epilepsie denken lassen, aber auch während des Anfalls ein vollständig normales EEG zeigen.
Gemeinsam ist diesen symptomatisch so unterschiedlichen Störungsbildern regelmäßig ein Zusammenhang mit psychisch wirksamen Entstehungs- und Auslösebedingungen. Diese können im aktuellen Befund ein breites Spektrum an aktuell wirksamen Belastungen, Bedrohungseinschätzungen, nicht auflösbaren Konfliktkonstellationen oder nicht mitteilbaren Bedürfnisse umfassen. In der Eigen- und Familienanamnese kann sich ein ebenso breites Spektrum an Vulnerabilitätsfaktoren zeigen. Ebenso gemeinsam ist ihnen der Störungsmechanismus der Dissoziation. Die Dissoziation betrifft hier eine Entkoppelung der bewussten und willkürlichen Steuerungsfunktion des zentralen Nervensystems von den körperlichen motorischen oder sensorischen Funktionen in der Peripherie. Sie werden daher auch als dissoziative Störungen vom Körpertypus zusammengefasst. Sie weisen Gemeinsamkeiten in den Störungsmechanismen mit den dissoziativen Störungen des Bewusstseinstypus auf, die sich z. B. als Derealisations- oder Depersonalisationserleben manifestieren. In beiden Fällen ist das normale, koordinierte Zusammenwirken von mentalen Subsystemen entkoppelt, also dissoziiert.
Die Untersuchung und Behandlung von Konversionsstörungen stand spätestens seit den Arbeiten des jungen Sigmund Freud paradigmatisch am Anfang der modernen Psychotherapiegeschichte. Sie haben bis heute nichts von ihrer Rätselhaftigkeit verloren. Kaum eine Störungsgruppe zeigt so eindrucksvoll die untrennbare funktionelle Einheitlichkeit von psychologischen und zentralen wie peripheren neurologischen Signalverarbeitungsmechanismen auf. Prozesse der Wahrnehmung und Verarbeitung affektiv „aufgeladener“, sich in der Körpersphäre zeigender und dennoch bewusst nicht prägnant wahrnehmbarer bzw. verbalisierbarer Empfindungen sind charakteristisch für Konversionsstörungen. Damit ergeben sich über die kognitive Verhaltenstherapie hinausgehend konzeptionelle und therapeutische Brückenschläge einerseits zu den aktuellen psychotherapeutischen Entwicklungen der dritten Welle der Verhaltenstherapie und der mentalisierungsbasierten Strömungen. Andererseits ergeben sich neue Anknüpfungspunkte zu den frühen, weiterhin wertvollen und zu Unrecht fast vergessenen Traditionen der Instinkt- und Reflexpsychologie, der psychologischen Evolutionsbiologie und den aktuellen neurobiologischen Netzwerkmodellen. Die differenzierte Ausarbeitung dieser Brückenschläge und Anknüpfungspunkte steht noch in den Anfängen. Sie sind bis jetzt weder elaboriert ausgearbeitet und erst recht nicht hinreichend empirisch hinterlegt. Dennoch darf die intensivierte Forschung in diesen Schnittstellen als sehr aussichtsreich gelten. Die Rätsel um die Konversionsstörungen aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert kehren damit in einem neuen Forschungsumfeld zurück und erfahren eine gewisse Neuauflage. Erneut haben die Konversionsstörungen „das Zeug dazu“, zu einer Modellerkrankung für die Aufschlüsselung mancher ganz grundständiger Funktionsprinzipien des sich entwickelnden Gehirns und der sich entwickelnden Psyche des Kindes zu werden.
Die jüngeren Entwicklungen in den Klassifikationssystemen ICD und DSM lassen erkennen, dass der Terminus der Konversionsstörung wohl in näherer Zukunft aufgegeben werden wird. Ähn|VI|lich wie bei den klassischen Störungsbildern der Hysterie oder der somatoformen Störung können auch mit dem Begriff der Konversionsstörung überkommende Störungsmodelle und auch herabsetzende Konnotationen verknüpft werden. Die Klassifikationssysteme gehen hier zu rein deskriptiven Termini wie „Störungen mit funktionellen Symptomen“ bzw. „Funktionelle neurologische Störungen“ über. Im Titel des vorliegenden Bandes sind der klassische Konversionsbegriff und die neuere Bezeichnung miteinander verknüpft worden. Der Terminus der Konversionsstörungen wird fortgeführt, weil er aktuell den meisten Klinikern noch am besten vertraut ist und in der Kommunikation mit Kollegen schnell deutlich macht, an welche Verdachtsdiagnose gedacht wird. Die Terminologie „funktionelle neurologische Symptome“ ist aufgegriffen worden, um eine Anschlussfähigkeit an die zukünftige Entwicklung der Störungsbegriffe zu gewährleisten. Im Text sollen die Begriffe synonym verstanden werden.
Der Leitfaden beinhaltet insgesamt fünf Kapitel:
1 Im ersten Kapitel wird der Stand der Forschung zu Definition, Symptomatik, Klassifikation, Epidemiologie und Verlauf, zu Risikofaktoren sowie zu ätiologischen Modellen vorgestellt.
2 Im zweiten Kapitel werden die Leitlinien zur klinischen, handlungsleitenden Diagnostik und Therapie beschrieben. Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei die interdisziplinäre Differenzialdiagnostik zur Sicherung der Diagnose sowie das Vorgehen bei der Diagnosemitteilung, der Edukation zum Störungsbild sowie die unterschiedlichen Facetten der psychotherapeutischen Intervention.
3 Im dritten Kapitel werden die Verfahren beschrieben, die für die Diagnostik insbesondere der vorausgehenden, begleitenden und nachfolgenden psychischen Komorbiditäten sowie zur Verlaufskontrolle eingesetzt werden können.
4 Im vierten Kapitel werden hilfreiche diagnostische und therapeutische Materialien vorgestellt. Einen Schwerpunkt bilden Materialien zur Edukation und Aufklärung in Laiensprache zur Vermittlung dieser schwer verständlichen Störungsbilder an die Familie.
5 Im fünften Kapitel wird anhand von zwei Fallbeispielen die Umsetzung der Leitlinien in die klinische Praxis dargestellt. Ein Fallbeispiel bezieht sich auf die Therapie eines Kindes mit dissoziativen Anfällen, das andere auf ein Kind mit einer Bewegungsstörung im Sinne eines Kraftverlustes bis hin zu einer Lähmung.
Ergänzt wird dieser Band durch einen Ratgeber für betroffene Jugendliche, Eltern, Lehrer und andere Bezugspersonen (Noeker, in Vorb.). Der Ratgeber informiert über Symptomatik, Verlauf und Interventionsmöglichkeiten bei dissoziativen Störungen und Konversionsstörungen.
Zur leichteren Lesbarkeit wird im gesamten Leitfaden das generische Maskulinum verwendet.
St. Katharinen und Münster, Dezember 2022
Meinolf Noeker
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Grundlagen und Aufbau des Buches
1 Stand der Forschung
1.1 Symptomatik
1.2 Entwicklung des Konversionsbegriffs und Grenzen des empirisch gesicherten Wissens
1.3 Klassifikation
1.4 Epidemiologie und Gesundheitsökonomie
1.5 Komorbide Störungen
1.6 Risikofaktoren, Ätiologie und Pathogenese
1.7 Integrative Störungsmodelle
1.8 Verlauf
1.9 Therapie
2 Leitlinien
2.1 Leitlinien zur Diagnostik und Verlaufskontrolle
2.1.1 Strukturierung des diagnostischen Vorgehens
2.1.2 Anamnese und Exploration von Symptomatik und Funktionsbeeinträchtigungen
2.1.3 Diagnostik dissoziativer Bewegungsstörungen
2.1.4 Diagnostik dissoziativer Anfälle
2.1.5 Somatisch-neurologische Hinweiszeichen
2.1.6 Psychologische und verlaufsbezogene Hinweiszeichen
2.1.7 Abgrenzung von sonstigen Anfallsereignissen
2.1.8 Abgrenzung psychischer Störungsbilder
2.1.9 Abgrenzung von Formen abweichenden Krankheitsverhaltens
2.1.10 Exploration der psychosozialen Auswirkungen der Konversionssymptomatik
2.1.11 Verhaltensanalyse umschriebener, symptomatischer Episoden
2.1.12 Verhaltensbeobachtung der Eltern-Kind-Interaktion
2.1.13 Exploration des subjektiven Störungskonzeptes
2.1.14 Exploration von auslösenden Konflikt- und Belastungsfaktoren bei der Störungsgenese
2.1.15 Generieren von Störungshypothesen
2.2 Leitlinien zur Therapie
2.2.1 Diagnosemitteilung, Patientenaufklärung, Psychoedukation
2.2.2 Vermeidung einer verkürzten Diagnosemitteilung im Sinne einer alleinigen Traumafolgestörung
2.2.3 Klärung und Eingrenzung exzessiver Krankheitsangst
2.2.4 Mobilisierung und schulbezogene Interventionen
2.2.5 Imagination, Hypnotherapie und Mentales Training
2.2.6 Physiotherapie: Übergeordnete Behandlungsprinzipien
2.2.7 Physiotherapie: Spezielle Techniken für spezielle motorische Symptombilder
2.2.8 Training der Kommunikation des Störungsbildes und Regulation der Angst vor Stigmatisierung
2.2.9 Anleitung der Eltern zu angemessenen Reaktionen bei akuten Konversionssymptomen
2.2.10 Achtsamkeitstraining und Selbstkontrolle akuter Konversionsreaktionen
2.2.11 Auswahl übergeordneter psychotherapeutischer Therapiestrategien
2.2.12 Teilearbeit: Nutzung einer therapeutischen Dissoziation zur Überwindung der pathologischen Dissoziation
3 Verfahren zur Diagnostik und Therapie
3.1 Diagnostische Verfahren
3.1.1 Störungsspezifische Tests zur Differenzialdiagnostik und Komorbiditäten
3.1.2 Elternfragebögen und Familiensystemtests
3.1.3 Inventare zur Belastungsverarbeitung und Verhaltensentwicklung
3.2 Verfahren zur Therapie
3.2.1 Mind-Body-Programm
3.2.2 Multimodales stationäres Behandlungsprogramm
4 Materialien
M01 Leitfaden für die Anamnese, Exploration und Hypothesenbildung vorrangig in der psychotherapeutischen Praxis
M02 Kernbotschaften der Diagnosemitteilung und Behandlungsvereinbarung am Beispiel dissoziativer Anfälle
M03 Metapher für die Edukation bei dissoziativem Anfall: Absturz eines PC
M04 Metapher bei dissoziativem Anfall: Kurzschluss im Haus
M05 Metapher bei motorischen Störungen: Verstimmtes Klavier
M06 Metapher bei motorischer Lähmung: Ein Auto, das bei Frost im Winter nicht anspringt
M07 Arbeitsblatt für Eltern: Das Kaninchen und die Schlange
M08 Arbeitsblatt für Eltern: Was könnte los sein?
M09 Arbeitsblatt für Kinder und Jugendliche: Was könnte los sein?
5 Fallbeispiele
5.1 Marc (11 Jahre) – Dissoziative Anfälle
5.2 Thorsten (13 Jahre) – Funktionelle neurologische Bewegungsstörung
6 Literatur
|1|1 Stand der Forschung
1.1 Symptomatik
Kernsymptome
Konversionsstörungen umfassen Störungen der willentlichen und bewussten Steuerung von körperlichen Funktionen in den Bereichen der motorischen Bewegung, der sensorischen Empfindung sowie der dissoziativen Krampfanfälle ohne umschriebene organisch-neurologische Erklärung. Bei den Bewegungsstörungen können sehr eindrückliche Lähmungen oder auffällige Bewegungsmuster zum Beispiel der oberen oder unteren Extremitäten trotz vollkommen intakter Reizweiterleitung vorliegen. Bei den sensorischen Störungen kann es zum Beispiel zu einer Sehschwäche oder sogar einem Sehverlust kommen, obwohl augenärztlich und neurologisch eine normale, physiologische Funktionsfähigkeit aller zum Sehen erforderlichen anatomischen Strukturen und Sehnerven im Auge und zentral in der Sehrinde bestätigt wird. Allen, im beobachtbaren Beschwerdebild vielfach sehr individuell ausgestalteten Symptomen liegt eine Entkoppelung, also Dissoziation der mentalen, bewussten und dem Willen zugänglichen Steuerungseinheiten des Gehirns von den peripheren motorischen bzw. sensorischen Einheiten vor, die einen Bewegungsimpuls ausführen bzw. einen Wahrnehmungsinput aufnehmen und weiterleiten. Auch bei nichtepileptischen, dissoziativen Anfällen liegt eine solche Entkoppelung vor. Sie können vordergründig wie „normale“ epileptische Anfälle aussehen und werden daher vielfach auch mit solchen verwechselt. Sie sind aber ursächlich vollständig anders bedingt und strikt von diesen abzugrenzen. So weisen die Gehirnströme während eines dissoziativen Anfalls keine hypersynchrone Aktivität auf, sie zeigen also im Unterschied zu einem epileptischen Anfall ein vollständig normales EEG.
Diese Dissoziation von Bewusstsein und peripherer Motorik bzw. Sensorik rückt die Konversionsstörungen in die Nähe der dissoziativen Störungen des Bewusstseinstypus. Auch bei den dissoziativen Störungen des Bewusstseinstypus liegen solche Phänomene der Entkoppelung zwischen mentalen Subsystemen vor. Bei den Störungen des Bewusstseinstypus bestehen diese dissoziativen Entkoppelungen jedoch nicht in einem Splitting zwischen zentralen und peripheren Strukturen und Funktionen, sondern innerhalb von zentralen mentalen Einheiten. Dies kann zum Beispiel eine Entkoppelung des Bewusstseins von Gedächtnisfunktionen wie einem dissoziativen, retrograden Verlust der Erinnerung an biografisch wichtige Ereignisse sein. Ein weiteres Beispiel ist ein Depersonalisationserleben, bei dem bestimmte Empfindungen als fremd und der eigenen Person als nicht zugehörig erlebt werden.
Dieser gemeinsame Mechanismus einer Entkoppelung und des sich Verselbständigens von mentalen Subsystemen, die im gesunden Regelzustand integriert zusammenarbeiten, führt die dissoziativen Störungen vom Bewusstseinstypus und die dissoziativen Störungen vom Konversionstypus in der Klassifikation des ICD in die Störungsgruppe der dissoziativen Störungen zusammen (ICD F44). Die analogen dissoziativen Mechanismen lassen ähnliche und teilweise einheitliche Pa|2|thomechanismen vermuten, auch wenn die beobachtbare klinische Präsentation von Störungen des Bewusstseinstypus und des Konversionstypus sich sehr unterschiedlich darstellt.
Die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung der beiden dissoziativen Störungsgruppen folgt nun stärker den stark unterschiedlichen Symptompräsentationen als den gemeinsamen dissoziativen Störungsmechanismen. Die diagnostische und therapeutische Versorgung des Bewusstseinstypus erfolgt von der Erstdiagnostik bis zur langfristigen Psychotherapie vorrangig im kinder- und jugendpsychiatrischen bzw. -psychotherapeutischen Setting. Die Erstversorgung von Störungen des Konversionstypus erfolgt nicht zuletzt wegen der notwendigen differenzialdiagnostischen Abgrenzung von neurologischen Grunderkrankungen im medizinischen bzw. pädiatrischen und hier meistens kinderneurologischen bzw. kinderepileptologischen Setting bzw. in der Neurologie und Epileptologie bei erwachsenen Patienten (Popkirov, 2020).
Klinische Symptomatik und therapeutisches Setting unterscheiden sich also ungeachtet ähnlicher basaler Störungsmechanismen gravierend voneinander. Da dissoziative Anfälle epileptischen Anfällen ähneln, werden Patienten normalerweise Neurologen oder Epilepsie-Überwachungseinheiten vorgestellt. Nach einer umfassenden neurologischen Untersuchung wird der Patient für die laufende Behandlung an psychiatrische-psychotherapeutische Dienste überwiesen.
Konversionsstörungen weisen unterschiedliche Verlaufsmuster auf. Manche Störungen remittieren spontan, viele können durch Therapie überwunden werden, manche chronifizieren aber auch, entweder weil sie keiner adäquaten Behandlung zugeführt werden oder weil diese nicht erfolgreich verläuft. Familien suchen eher selten Psychotherapie auf, vielmehr suchen sie ähnlich zu Patienten mit somatoformen Störungen vorrangig medizinische Praxen und Kliniken auf – in der Hoffnung auf eine organmedizinische Diagnose. Ein solches Inanspruchnahmeverhalten erhöht das Risiko einer Chronifizierung. Im Ergebnis wird die Einleitung einer fachspezifischen Behandlung verfehlt. Die therapeutische Arbeit an einem angemessenen Störungs- und Behandlungskonzept wird so zu einer essenziellen Herausforderung und Voraussetzung für eine Akzeptanz sich anschließender psychotherapeutischer Interventionen im engeren Sinne.
Symptomspektrum
Am Beispiel einer Bewegungsstörung können zusammenfassend folgende Anhaltspunkte zur Stützung der Diagnose einer Konversionsstörung angeführt werden: eine mitunter bizarr wirkende Symptomatik exzessiver Langsamkeit oder Bewegungsmuster, eine Beteiligung vorwiegend der unteren Extremitäten, ein begleitender Tremor, ein zur Symptomatik relativ massiv ausgeprägtes Funktionsdefizit, vorangegangene Episoden von Konversionssymptomatik in der Eigen- und/oder Familienanamnese, ein Modell für die Symptombildung im Umfeld der betroffenen Person, multiple Klagen über Körperbeschwerden beziehungsweise früher eingetretene Phasen von Symptomremission mit Lösung einer zeitgleich bestehenden Konfliktsituation. Oftmals bildet ein unbedeutendes physisches Trauma den Auslöser einer Konversionssymptomatik, Spontanremissionen sind nicht selten.
|3|Es wäre verkürzt, allein aufgrund einer psychischen Störung in der Anamnese auf eine Konversionsstörung anstelle einer genuinen neurologischen Störung zu schließen (Perez, Edwards et al., 2021a; Sunde, Hilliker & Fischer, 2020). In der Zusammenschau mit den neurologischen und epileptologischen Befunden verdichtet sich die Hypothese einer Konversionsstörung aus psychologisch-psychiatrischer Sicht vielfach, wenn sich nachweisen lässt:
dass eine dazu prädisponierte Person (im Sinne einer Vulnerabilität, die sich lebensgeschichtlich herausgebildet hat) die Symptomatik entwickelte;
dass ein auslösender Faktor, eine Belastung, ein Trauma, ein Konflikt in zeitlich engem Zusammenhang mit der aufkommenden Symptomatik steht;
dass ein (langjähriger) Verlauf durch Kontextfaktoren (Konflikte, Krankheitsgewinn, Anreizfaktoren, eventuell iatrogene Faktoren) und systemische Einflussfaktoren (Schulumfeld, Familie) vermutlich aufrechterhalten wurde.
Die Patienten sind insbesondere im Rahmen der Erstabklärung eher in organmedizinisch ausgerichteten (hier pädiatrischen bzw. neuropädiatrischen) und nicht in psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlungssettings anzutreffen.
1.2 Entwicklung des Konversionsbegriffs und Grenzen des empirisch gesicherten Wissens
Begriffsgeschichte
Bis heute weisen die Begriffe „Dissoziation“ und „Konversion“ eine ausgeprägte terminologische und konzeptionelle Unschärfe auf, die nach weiterer wissenschaftlicher Präzisierung verlangt. Sehr restriktive wie extensive bis hin zu fast inflationären Verwendungen der Begrifflichkeiten finden sich. Im Kontrast zur eher sparsam vergebenen Diagnose einer dissoziativen Störung bzw. Konversionsstörung werden „Dissoziation“ und „Konversion“ sehr breit zur Beschreibung und Erklärung für Bewältigungsreaktionen bei extremem Stress und Traumatisierung verwendet. Im Gegensatz zur Tiefenpsychologie haben die empirische Klinische Psychologie, die Bio- und Neuropsychologie sowie die Psychotherapieforschung der Erforschung der Dissoziation und Konversion über viele Jahrzehnte nur wenig Beachtung geschenkt. Zu dieser Zurückhaltung mag eine Skepsis beigetragen haben, dass die Begrifflichkeit untrennbar von der tiefenpsychologischen Konflikttheorie durchdrungen und empirisch nicht losgelöst von dieser Denktradition zu untersuchen sei.
Die Wurzeln der Konzepte zu Dissoziation und Konversion gehen bis in das 19. Jahrhundert zurück und standen damals in enger Beziehung zum Störungsbild der Hysterie, die als Modellerkrankung für die Ausdifferenzierung der Behandlungstechniken der Hypnose und der Tiefenpsychologie fungierte. Der Psychiater Janet (1889), ein Schüler von Charcot, führte den Begriff „Dissoziation“ als Reaktion auf die Erinnerung an ein real erlittenes Trauma ein. Im Jahre 1895 führten Freud und Breuer dieses Konzept zunächst in ihren „Studien zur Hysterie“ weiter.
|4|Ausgehend von diesen frühen Wurzeln haben die Konzepte der Dissoziation und der Konversion die Terminologie und Störungstheorien der Psychoanalyse und der tiefenpsychologisch fundierten Psychosomatik bis heute stark beeinflusst (vgl. Kasten) und durchdringen diese implizit bis in aktuelle Arbeiten und Lehrbücher (z. B. Becker, 2021; Kapfhammer, 2018; O’Connor & Reuber, 2021; Wöller, 2022; Wöller & Kruse, 2018).
Tiefenpsychologisches Konzept der Konversionsstörung und des primären Krankheitsgewinns
Konversion als Umwandlung eines psychischen Konflikts in körperliche Symptombildung.Freud und Breuer (1895) verstanden unter der Konversion einen psychischen Mechanismus der Umsetzung der Erregung unerträglicher seelischer Vorstellungen in die körperliche Sphäre („rätselhafter Sprung aus dem Seelischen in die somatische Innervation“; „Bei der Hysterie erfolgt die Unschädlichmachung der unerträglichen Vorstellung dadurch, dass deren Erregungssumme ins Körperliche umgesetzt wird, wofür ich den Namen der Konversion vorschlagen möchte.“). Diese Umwandlung eines unbewussten, psychischen Konfliktes in eine körperliche Symptomatik reduziere quälende Angst. Die Konversion neutralisiert einen psychischen Konflikt im Bewusstsein und bietet den sogenannten primären Krankheitsgewinn. Im Unterschied zum sehr viel bekannteren, sekundären Krankheitsgewinn besteht dieser nicht in einer äußeren Vergünstigung, sondern in der intrapsychischen Angstabwehr und Spannungsreduktion.
Empirische wie diagnostische Unbeweisbarkeit eines Konversionsmechanismus. Diese tiefenpsychologische Konzeption ist – ungeachtet ihres vielleicht in klinischen Einzelfällen heuristischen Wertes – aus empirisch-wissenschaftlicher Sicht kritisch zu bewerten. Im Rahmen der psychologischen Exploration und Anamneseerhebung führt dies mitunter zu einem logischen Zirkelschluss. Es ergibt sich nämlich die Frage, ob der Verdacht auf das Vorliegen einer Konversionsstörung eher bestätigt werden kann, wenn der Patient gravierende psychische Konflikte formuliert oder wenn er dies umgekehrt eben genau nicht tut. Das Konversionskonzept basiert auf der Grundannahme, dass der Patient keinen psychischen Konflikt benennen kann, da die Konversion genau darauf basiert, den unaushaltbaren Konflikt aus dem Bewusstsein fernzuhalten. Kann der Patient den Konflikt benennen, so wäre der Konflikt bewusstseinszugänglich und damit würde die Notwendigkeit für eine konversionsneurotische Symptomproduktion entfallen.
Umgekehrt ist schwer nachvollziehbar, genau bei den Patienten eine psychogene Konversionsstörung zu unterstellen, die in der Anamnese von einem weitgehend konfliktfreien Leben berichten. Daraus ergibt sich das Dilemma, dass ein solches Störungskonzept im Rahmen der diagnostischen Exploration weder zu verifizieren noch zu falsifizieren ist, wenn sowohl die Anwesenheit wie die Abwesenheit von berichteten Konflikten als Beleg für das Vorliegen einer Konversionsstörung gewertet werden kann. Im Ergebnis ist die Diagnose damit empirisch nicht überprüfbar.
Heute ergibt sich die Relevanz des Dissoziations- und Konversionsbegriffes weniger aus dem Bezug zu den eher seltenen Entitäten der dissoziativen Störungen und Konversionsstörungen. Vielmehr gelten in der tiefenpsychologischen Tradi|5|tion Dissoziation und Konversion als Pathomechanismen mit Bedeutung für eine Vielzahl von Störungsbildern. Dissoziative Mechanismen der Verarbeitung bedrohlicher Informationen bzw. dissoziative (Abwehr-)Mechanismen betreffen damit auch eine gestörte Affektregulation zum Beispiel bei emotional-impulsiven Persönlichkeitsstörungen (z. B. Borderline-Typus) oder bei emotional überflutenden, traumatischen Belastungserfahrungen (z. B. Posttraumatische Belastungsstörung). Bei der Verwendung des Begriffs der Dissoziation ist daher jeweils darauf zu achten, ob eine Störungsentität oder ein Störungsmechanismus gemeint ist.
Grenzen des empirisch gesicherten Wissens
Die Reihe Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie ist grundsätzlich dem Anspruch verpflichtet, die allgemein akzeptierten Standards in der Diagnostik und Therapie einzelner psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter zu vermitteln. Diese Standards gründen sich auf die jeweils zum behandelten Störungsbild vorliegenden und empirisch begründbaren Wissensbestände. Verglichen mit diesen Standards stellt sich der Forschungsstand zu den Konversionsstörungen hinsichtlich der empirischen Datenlage als weitgehend lückenhaft und hinsichtlich der Theoriebildung als überwiegend hypothetisch und spekulativ dar (Perez et al, 2021a). Noch mehr als bei erwachsenen Patienten gilt dieser Befund sehr viel eindrücklicher für die Patienten im Kindes- und Jugendalter.
1.3 Klassifikation
Konversionsstörungen als dissoziative Störung in der ICD
Die Konversionsstörungen bilden gemeinsam mit den dissoziativen Bewusstseinsstörungen in der ICD-10 die Gesamtgruppe der dissoziativen Störungen. Dissoziative Störungen vom Konversionstypus umfassen die dissoziativen Bewegungsstörungen (F44.4), dissoziative Krampfanfälle (F44.5), dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (F44.6) sowie dissoziative Störungen (Konversionsstörungen), gemischt (F44.7). Die Merkmale dieser Untergruppen führt Tabelle 1 auf. Als allgemeine diagnostische Kriterien fordert die ICD-10 für die Diagnosestellung einer dissoziativen Störung:
Kein Nachweis einer körperlichen Krankheit, welche die für diese Störung charakteristischen Symptome erklären könnte (es können jedoch körperliche Störungen vorliegen, die andere Symptome verursachen),
einen überzeugenden zeitlichen Zusammenhang zwischen den dissoziativen Symptomen und belastenden Ereignissen, Problemen oder Bedürfnissen.
|6|Tabelle 1: Die Klassifikation der Konversionsstörungen innerhalb der Störungsgruppe der dissoziativen Störungen in der ICD-10
Spezifische Konversionsstörung
Merkmale
F44.4 Dissoziative Bewegungsstörungen
Die häufigsten Formen zeigen den vollständigen oder teilweisen Verlust der Bewegungsfähigkeit eines oder mehrerer Körperglieder. Sie haben große Ähnlichkeit mit fast jeder Form von Ataxie, Apraxie, Akinesie, Aphonie, Dysarthrie, Dyskinesie, Anfällen oder Lähmungen.
F44.5 Dissoziative Krampfanfälle
Dissoziative Krampfanfälle können epileptischen Anfällen bezüglich ihrer Bewegungen sehr stark ähneln. Zungenbiss, Verletzungen beim Sturz oder Urininkontinenz sind jedoch selten. Ein Bewusstseinsverlust fehlt oder es findet sich stattdessen ein stupor- oder tranceähnlicher Zustand.
F44.6 Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen
Die Grenzen anästhetischer Hautareale entsprechen oft eher den Vorstellungen des Patienten über Körperfunktionen als medizinischen Tatsachen. Es kann auch unterschiedliche Ausfälle der sensorischen Modalitäten geben, die nicht Folge einer neurologischen Läsion sein können. Sensorische Ausfälle können von Klagen über Parästhesien begleitet sein. Vollständige Seh- oder Hörverluste bei dissoziativen Störungen sind selten, meistens findet sich eine psychogene Schwerhörigkeit oder Taubheit.
F44.7 Dissoziative Störungen, gemischt
Kombinationen der unter F44.0 bis F44.6 beschriebenen Störungen.
F44.82 Vorübergehende dissoziative Störungen in der Kindheit und Jugend
Ohne nähere Angabe
F44.8 Andere näher bezeichnete dissoziative Störungen
Ohne nähere Angabe
F44.9 Nicht näher bezeichnete dissoziative Störungen
Ohne nähere Angabe
Konversionsstörung als somatische Belastungsstörung im DSM-5
Bei der Neuordnung psychischer Störungen im DSM-5 wurden die Konversionsstörungen in der Kategorie „Somatische Belastungsstörung und verwandte Störun|7|gen“ eingruppiert (im amerikanischen Original: „Somatic Symptom Disorder“). Diese neue diagnostische Kategorie fasst nun Störungsbilder zusammen, die vorher im DSM-IV-TR oder auch in der ICD-10 verschiedenen anderen Störungsgruppen zugeordnet waren und nun unter dem gemeinsamen Aspekt des Vorliegens körperlicher Symptome im Kontext einer psychischen Störung zusammengefasst werden. Dazu zählen
die somatische Belastungsstörung,
die Krankheitsangststörung,
die Konversionsstörung (Störung mit funktionellen neurologischen Symptomen),
psychologische Faktoren, die eine körperliche Krankheit beeinflussen,
die vorgetäuschte Störung,
die andere näher bezeichnete somatische Belastungsstörung und verwandte Störungen sowie die nicht näher bezeichnete somatische Belastungsstörung und verwandte Störungen.
Verknüpfung dissoziativer und somatoformer Störungsmechanismen
Innerhalb der Gruppe der somatischen Belastungsstörungen bleiben grundlegende Unterschiede zwischen den Konversionsstörungen einerseits und den „klassischen“ somatoformen Störungen andererseits bestehen. Die bei der Konversionsstörung betroffenen Systeme der Motorik und Sensorik stehen vorrangig unter zentralnervöser und damit grundsätzlicher bewusster und willentlicher Kontrolle. Die somatoformen Störungen dagegen betreffen vorrangig solche Organsysteme, die nicht der bewussten Wahrnehmung und willentlichen Steuerung unterliegen. Dies gilt besonders für die Störungskategorie der somatoformen autonomen Funktionsstörung (F45.30) mit den Unterkategorien des oberen und unteren Gastrointestinaltraktes, des respiratorischen Systems und des urogenitalen Systems. Diese autonom-vegetativ innervierten Organsysteme sind schon im gesunden, physiologischen Zustand von den Bewusstseinsfunktionen weitgehend „dissoziiert“ und unterliegen keiner willkürlichen und bewussten Kontrolle. Eine gewisse Ausnahme stellt die Atmung dar, die normalerweise autonom-vegetativ gesteuert wird, aber auch willentlich verändert werden kann. Mit den somatoformen Störungsbildern teilen die Konversionsstörungen eine körperlich imponierende Symptomatik ohne hinreichende organmedizinische Begründbarkeit („somato-form“) sowie vielfach eine mehr oder weniger hartnäckige Weigerung der Patienten oder Eltern, die medizinische Aussage zu akzeptieren, dass keine ausreichende körperliche Ursache für die Symptomatik nachzuweisen ist. Ähnlich wie bei somatoformen Störungen resultiert ein abweichendes und exzessives Krankheitsverhalten sowie häufig eine hypochondrische Fehlverarbeitung im Sinne einer ausgeprägten Angst vor einer unentdeckten, ernsten neurologischen oder internistischen Grunderkrankung sowie ein intensives Inanspruchnahmeverhalten von medizinischen Praxen und Kliniken.
Auf der anderen Seite rückt die Entkoppelung motorischer und sensorischer Funktionen von den Bewusstseinsfunktionen und der willkürlichen Steuerung die Konversionsstörungen wiederum nahe an die dissoziativen Störungen des Bewusstseins |8|heran. Diese gemeinsamen Mechanismen stützt die Klassifikationssystematik in der ICD-10, die den Bewusstseinstypus und den Körpertypus zusammenführt. Denn auch bei der Konversionsstörung erlebt der Patient eine Fragmentierung in mindestens zwei Bewusstseinsanteile: ein dem Bewusstsein nicht zugänglicher Anteil, der die Symptomatik „produziert“ und ein anderer Anteil im Sinne des Alltagsbewusstseins, der diesen Funktionsausfall distanziert beobachtet, als entfremdend erlebt und nicht kontrollieren kann. So wie bei den dissoziativen Störungen des Bewusstseinstyps bestimmte Einzelfunktionen innerhalb des Bewusstseins voneinander getrennt sind, so ist bei den Konversionsstörungen das zentrale Bewusstsein von der peripheren Motorik und Sensorik dissoziiert. In klassifikatorischer, ätiologischer und therapeutischer Hinsicht nehmen die Konversionssymptome damit eine Brückenfunktion zwischen den somatoformen und dissoziativen Störungen ein (Noeker, 2008a, 2010, 2011).
1.4 Epidemiologie und Gesundheitsökonomie
Prävalenz
Genaue epidemiologische Daten zur Häufigkeit dissoziativer Anfälle bei Kindern und Jugendlichen liegen nicht vor. Bis heute fehlen populationsbasierte Erhebungen. In der Literatur werden nur klinische und damit sehr selektive Kollektive beschrieben. Die meisten Studien stammen aus neurologischen bzw. epileptologischen Zentren und umfassen vielfach nur solche Fälle, bei denen mittels Video-EEG die Diagnose bestätigt werden konnte. Daher existiert wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer von Patienten, die fälschlich als Epileptiker geführt und behandelt werden (Reuber, 2008). Dänischen Krankenkassendaten zufolge hat die Diagnosestellung zwischen 1996 und 2014 kontinuierlich zugenommen. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 10 bis 20 % aller Kinder bzw. 10 bis 58 % aller Erwachsenen, die in Epilepsiezentren vorgestellt werden, dissoziative Anfälle aufweisen (Montenegro et al., 2008; Rotge et al., 2009):
Demnach liegt der häufigste Altersbereich zwischen 7 und 15 Jahren, mit einem Durchschnittsalter von 12,5 Jahren. Kein Kind wurde jünger als 7 Jahre gesehen. Die Hauptsymptome waren: motorische Schwäche (63 %), abnorme Bewegungen (43 %), nichtepileptische Anfälle (40 %), Anästhesie/Parästhesie (32 %), verringerte Sehschärfe (29 %), Sehverlust (23 %), Lähmung der Gliedmaßen (22 %), Sprachverlust (19 %) und Hörverlust (8 %). Bei 69 % der Kinder gab es mehr als ein Kernsymptom. Etwa drei Viertel aller jungen Patienten mit dissoziativen Krampfanfällen sind weiblich. Epidemiologische Untersuchungen unter Verwendung strukturierter klinischer Interviews, die eine kategoriale Zuordnung zu den Diagnosen nach ICD-10 bzw. DSM-5 erlauben würden, liegen bislang für das Kindes- und Jugendalter nicht vor.
In einer türkischen Studie zeigten sich als Risikofaktoren für dissoziative Anfälle und weitere Konversionsstörungen bei jugendlichen Patienten die Her|9|kunft aus einem ländlichen Gebiet, eine zerrüttete Familienkonstellation, eine längere Trennung von den Eltern, Kommunikationsprobleme und emotionale Ausdruckshemmung in der Familie, hohe Angstwerte und eine positive Familienanamnese für Konversionsstörungen oder andere psychopathologische Auffälligkeiten bei der Mutter (Ercan, Varan & Veznedaroglu, 2003).
Gesundheitsökonomische Last durch verzögerte Diagnose und Fachtherapie
Kinder mit dissoziativen Anfällen, bei denen fälschlicherweise eine Epilepsie diagnostiziert wird, erhalten unnötige diagnostische Untersuchungen und eine Gabe von Antiepileptika (Valente, Alessi, Vincentiis, Santos & Rzezak, 2017). Die diagnostische Verzögerung liegt bei Kindern im Durchschnitt bei einigen Wochen bis zu 3,5 Jahren. Die Verzögerung ergibt sich durch mehrere Faktoren: Unkenntnis der Störung, Ausblenden dieser Differenzialdiagnose bei der Abklärung eines Verdachts auf Epilepsie, fehlende Verfügbarkeit eines Video-EEGs, fehlende Akzeptanz der Diagnose bei der Familie, die man dann ohne weitere Konsequenzen „ziehen lässt“. Eine verzögerte Diagnosestellung verschlechtert die Behandlungsprognose. Die Zuweisungswege zur adäquaten neurologisch-pädiatrisch-psychiatrisch-psychotherapeutischen Erstdiagnostik sind bei Kindern nicht klar vorgezeichnet, sondern hängen vielfach von einer entsprechenden Vertrautheit der erstbehandelnden Dienste mit dem Störungsbild ab (Stephen, Fung, Lungu & Espay, 2021). Jemand muss an das mögliche Vorliegen einer funktionellen neurologischen Störung denken, um dann möglichst frühzeitig die richtigen Überweisungswege zu bahnen. In der Praxis können die Überweisungswege sehr „verschlungen“ sein, bis das Kind eine fachkompetente Diagnostik und Therapie erhält. Dies ist gesundheitsökonomisch nachteilig und für Patienten wie Familien zermürbend und Vertrauen erodierend. So kann die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Professionalität des Behandlungspersonals ausgehöhlt werden, die später bei korrekter Diagnosemitteilung dringend benötigt wird.
Eine Studie in den USA hat bei erwachsenen Patienten die Kosten der medizinischen Inanspruchnahme ein Jahr vor und ein Jahr nach Erhalt der Diagnose von dissoziativen Anfällen in einem Epilepsiezentrum untersucht (Ahmedani et al., 2013). Nach Diagnosestellung konnte ein Rückgang der Krankenhauseinweisungen und der Besuche in Notaufnahmen und damit eine durchschnittliche Kostenreduktion in Höhe von durchschnittlich 1800 Dollar pro Patient erreicht werden. Mindestens eine Halbierung der durchschnittlichen Jahreskosten kann erreicht werden, wenn im Vergleich zur Standardbehandlung (TAU) eine umfangreiche neurologische Abklärung inklusive einer stationären Video-EEG-Überwachung, neuropsychiatrische Verlaufstermine und zehn Stunden kognitiv-behaviorale Therapie angesetzt werden. Damit ergibt sich – analog zu unerkannten und chronifizierten Verläufen bei somatoformen Störungen (Noeker, 2018a) – ein überzeugender gesundheitsökonomischer Vorteil einer konsequent betriebenen Differenzialdiagnostik und Zuführung zu einer störungsgerechten Therapie.
|10|1.5 Komorbide Störungen
Spektrum komorbider psychischer Störungen
Die wenigen vorhandenen Studien legen nahe, dass ein signifikanter Anteil der Kinder mit dissoziativen Anfällen eine komorbide psychische Störung aufweist:
Vincentiis et al. (2005) identifizieren bei fast der Hälfte der Kinder mit dissoziativen Anfällen mindestens eine psychische Störung basierend auf DSM-IV.
Schwingenschuh, Pont-Sunyer, Surtees, Edwards und Bhatia (2008) finden nur bei 16 % der untersuchten Kinder keine psychischen Störungen.
Im Vergleich zu ihren Geschwistern weisen Jugendliche mit dissoziativen Anfällen hochsignifikant häufiger eine Angststörung (83,6 % vs. 34,3 %), eine Depression (43,6 % vs. 14,3 %) und eine PTBS-Diagnose (25,5 % vs. 2,9 %) auf (Plioplys et al., 2014).
Wyllie, Glazer, Benbadis, Kotagal und Wolgamuth (1999) finden bei Anwendung der DSM-IV-Kriterien bei etwa einem Drittel von 34 Kindern und Jugendlichen im Alter von 9 bis 18 Jahren mit einer gesicherten Diagnose eines dissoziativen Anfalls eine schwere Depression, bipolare Störung oder Dysthymia. Bei 25 Patienten (74 %) handelte es sich um Mädchen.
Begleitende dissoziative Bewusstseinsstörungen
Konversionsstörungen umfassen häufig auch Merkmale der dissoziativen Störung des Bewusstseinstypus. Diese Bewusstseinsstörungen erreichen meistens keine eigene Störungswertigkeit im Sinne der Klassifikationssysteme, sondern präsentieren sich eher auf subklinischem Niveau. Sie sind also eher dimensional angeordnet als kategorial distinkt abgrenzbar und wirken als verlaufsmodulierende Begleitphänomene. Aufgrund ihrer pathogenetischen Nähe zur Konversionsstörung sind sie für die Therapieplanung besonders beachtenswert.