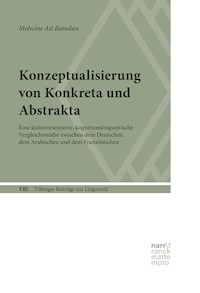
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tübinger Beiträge zur Linguistik (TBL)
- Sprache: Deutsch
Was bedeutet Solidarität? Was bedeutet solidarite? In beiden Fallen handelt es sich um die Frage nach der Bedeutung abstrakter Sachverhalte, die trotz ihrer vermeintlichen Aquivalenz an der lexikalischen Oberflache jeweils eine unterschiedliche kulturellem Perspektivik reprasentieren. Die vorliegende Studie untersucht mittels eines vergleichenden Wortassoziationsexperimentes, das die assoziativen Reaktionen von insgesamt 750 Sprecher:innen des Deutschen, Französischen und arabischen auf 12 konkrete und 12 abstrakte Begriffe umfasst, inwieweit sich Konkreta und Abstrakta im Hinblick auf ihre kulturspezifische Konzeptualisierung unterscheiden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mohcine Ait Ramdan
Konzeptualisierung von Konkreta und Abstrakta
Eine kulturorientierte, kognitionslinguistische Vergleichsstudie zwischen dem Deutschen, dem Arabischen und dem Französischen
DOI: https://doi.org/10.24053/9783823395560
© 2022 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 0564-7959
ISBN 978-3-8233-8556-1 (Print)
ISBN 978-3-8233-0369-5 (ePub)
Inhalt
Danksagung
Im Anfang war das Wort {…}
JOH 1,1-4
Es ist unmöglich aufzuzählen, wer in welchem Umfang Einfluss auf die Fertigstellung dieses Dissertationsprojekts genommen hat. Ein langer Weg steht dahinter und an dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mit Rat und Tat zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.
Dank gebührt in erster Linie meinem Doktorvater und langjährigen Mentor Herrn Prof. Jörg Roche, der die Verwirklichung meines Promotionsvorhabens an der LMU möglich machte und mir auf diesem Wege mit einer umfassenden, wissenschaftlichen und akademischen Betreuung immer zur Seite stand. Bei Frau Prof. Claudia Maria Riehl bedanke ich mich ebenso für ihre Unterstützung in verschiedenen Phasen dieser Arbeit. Wissenschaftliches Feedback ist mir von meiner Zweitbetreuerin Frau Prof. Daniela Marzo, die die Realisierung dieser Arbeit mit wertvollen Hinweisen und Verbesserungsvorschlägen begleitete, zu teil geworden und nicht zuletzt auch von Prof. Hans Jörg Schmid und Prof. Alexander Ziem. Alle haben mit ihrer wissenschaftlichen Expertise wesentliche linguistische Impulse für diese Arbeit gesetzt.
Der Deutsche Akademische Austauschdienst ermöglichte mit einem Promotionsstipendium für drei Jahre den Start des Dissertationsrojekts vor meinem Antritt der Assistentenstellen am Institut für Deutsch als Fremdsprache und am Institut für Grundschulpädagogik und Didaktik an der LMU in München. Ohne diese finanzielle Unterstützung hätte die vorliegende Arbeit nicht durchgeführt werden können. Waren entlang des Weges kollegiale, freundschaftliche und moralische Unterstützung sowie fachlicher Rat vonnöten, konnte ich mir keine besseren Gesprächspartner*innen als Nicole Weidinger, Matthias Springer, Christian Meyer und Teresa Gruber wünschen. Ihre verständigen Fragen und kritisch-konstruktiven Kommentare habe ich als große Bereicherung und Hilfe empfunden. Auch die Gespräche mit den Kollegen des STABLAB der LMU in München waren für die Umsetzung der Studie unabdingbar, wie auch die Unterstützung von Ruth Ho‘aba, die mit gewohnter Ruhe, Genauigkeit und großem Interesse Korrekturen und weitere entlastende Aufgaben übernommen hat. Allen diesen Personen danke ich für ihre Anregungen und ihren Rückhalt.
Mein größter Dank gilt freilich den 706 Untersuchungsteilnehmer*innen aus Deutschland, Frankreich und Marokko, die mit ihren 43328 Wortassoziationen den Untersuchungsgegenstand der Arbeit bereitstellten und den Zugang zur konzeptuellen Welt ihrer Sprachen ermöglichten. Ich danke ihnen für die Zeit und Energie, die sie für das Experiment aufgebracht haben.
Mit viel Geduld, Liebe und Verständnis haben mir in dieser Zeit viele weitere Menschen beigestanden. Mein persönlicher Dank gebührt hierfür meinen Kollegen, Freunden und meinen Geschwistern. Ihr Beistand war in vielen Phasen der Verzweiflung eine unermessliche Erleichterung und der Treibstoff, aus dem ich täglich schöpfen konnte. Mein innigster Dank richtet sich an meine Eltern, die mich immer zum Ziel der Promotion ermuntert haben und davor in jeder Phase meiner persönlichen Entwicklung sowie in meinem schulischen und akademischen Werdegang meine Entscheidungen bedingungslos unterstützt haben.
Fischbachau, 15.12.2021
1Einleitung
1.1Interkulturelle Semantik
Grundvoraussetzung für eine sinnvolle menschliche Kommunikation in einer Sprachgemeinschaft ist ein vergleichbar gemeinsames konzeptuelles Wissen über die Welt und ein gemeinsamer Bedeutungsvorrat im Langzeitgedächtnis. Dieses Wissen erwerben Menschen über ihre gesamte Lebensdauer hinweg durch ihr konkretes Handeln in immer wiederkehrenden Situationen und in ihrer Interaktion mit anderen Menschen, Organismen, Artefakten, sozialen Institutionen etc. in einer Sprachgemeinschaft. Über diese wiederholten Situationen verfestigen sich Wissensaspekte im Gedächtnis und unterstützen somit die Erschließung der Bedeutung einer sprachlichen Äußerung in einer konkreten Handlungssituation. Verfestigtes semantisches Wissen ist kulturgebunden und kann das Verständnis einer sprachlichen Äußerung in vertrauten neuen Situationen leiten. Das heißt, dass das Verständnis und die Nutzung einer lexikalischen Einheit Vertrautheit mit kulturellen Schemata erfordert, die die kommunikative Interaktion zwischen Individuen in einer Sprachgemeinschaft regeln. Auch wenn dieses semantische Wissen nicht immer deckungsgleich mit den konkreten Situationen ist, in denen es eingesetzt wird, passt es doch oft gut genug, um die Bedeutung zu erschließen (Schmid 2018:218).
Die kulturspezifischen verstehensrelevanten Wissensaspekte, die unsere Bedeutungskonstitutionsprozesse leiten, unterscheiden sich von Sprachgemeinschaft zu Sprachgemeinschaft und treten in unterschiedlichen Formen auf. Sie werden meistens nicht durch die lexikalische Oberfläche der Sprache zum Vorschein gebracht und können deshalb zu gravierenden Problemen, vor allem in der interkulturellen Kommunikation, führen. Die diversen Erscheinungen kultureller Geprägtheit von Sprache reichen von Text- bzw. Diskursebenen bis hin zu den kleinsten sinntragenden Einheiten einer Sprache. Sie umfassen somit sämtliche Sprachbereiche wie die Semantik, Pragmatik sowie Grammatik, und lassen sich bis zur begleitenden Gestik und Mimik einer Sprache verfolgen (vgl. Roche 2013:12ff.). Ohne das Vorhandensein kompatibler kulturadäquater Begriffe bzw. Konzepte über die Welt bleibt die Bedeutung verdeckt. Erkennbar wird die Relevanz dieser elementaren Grundlage oft in interkulturellen Gesprächssituationen, in denen trotz des Beherrschens einer Fremdsprache die Kommunikation aufgrund fehlender Vertrautheit mit kulturellen Besonderheiten schwerfällt.
Trotz der universellen Ausrichtung der meisten kognitiven Ansätze bei der Modellierung der lexikalischen Bedeutung als kognitive semantische Repräsentation rückt der kulturelle Aspekt in den Vordergrund. Busse (2007) spricht in der semantischen Forschung von der Notwendigkeit einer „Entsubjektivierung des verstehensrelevanten Wissens“. Damit meint er,
dass Wissen keine Privatangelegenheit einzelner Individuen mehr ist, und dass man das Bemühen um eine Erforschung dieses Wissens nicht einfach mit dem stereotypen Hinweis darauf erledigen kann, dass man ja in die Köpfe der Menschen nicht hineinsehen könne, wie es immer noch viele Linguisten fälschlicherweise glauben. Was Menschen in ihren Köpfen haben, mag privat sein. Der Weg, auf dem es hineingekommen ist […], ist aber ein sozialer, kulturell vermittelter Weg. Verstehensrelevantes Wissen ist in beschreibbarer Weise sozial konstituiert und aufgrund gesellschaftlich organisierter, kulturell determinierter Bewegungen und Prinzipien strukturiert. Insofern mögen die das Verstehen vorbereitenden Schlussfolgerungsprozesse (Inferenzleistungen) einzelner Subjekte durchaus individuell sein, das epistemische Material und die Schlussmuster, die dabei benutzt werden, sind unhintergehbar sozial (BUSSE 2007:78 Hervorhebung Ait Ramdan).
Die Forschung in den kognitiven Wissenschaften hat beispielsweise gezeigt, wie sich konzeptuelle Strukturen von einer kulturellen und sprachlichen Gruppe zur anderen unterscheiden können (Sharifian/Palmer 2007, Sharifian 2017). Im Rahmen der kognitiven Semantik gibt es eine Reihe von Studien, die kulturvergleichende Akzente setzen (vgl. Kövecses 2018, 2005, Schröder 2012). Um diese kulturell geprägten konzeptuellen Charakteristika einer Sprache zu eruieren und zu quantifizieren, beziehen sich Kognitionswissenschaftler wie Kulturpsychologen und Kognitionsanthropologen auf kognitive analytische Organisationseinheiten wie Schemata (Shore 1996) oder metaphorische Konzepte (Kövecses 2018). Der Fokus dieser Forschungsarbeiten ist im Gegensatz zu den meisten Arbeiten in diesem Bereich die Kognition einer Gruppe und nicht eines Individuums.
Vor allem in kontrastiv angelegten Arbeiten in der lexikalischen Semantik nimmt die kulturelle Perspektivik menschlicher Kognition bei der Darstellung von Bedeutung eine gewichtige Rolle ein, um semantische Divergenzen zwischen verschiedenen Sprachen ans Licht zu bringen (vgl. Sharifian 2017, Ait Ramdan 2013, Roche 2013, Schröder 2012, Kövecses 2005, Roche/Roussy-Parent 2006,). Roche geht beispielsweise davon aus, „dass grundsätzlich alle Begriffe, so alltäglich, einfach oder problemlos sie an der Oberfläche auch erscheinen mögen, eine bestimmte linguakulturelle Perspektivik repräsentieren“ (vgl. Roche 2013:21). Kulturspezifische Bedeutungsnuancen, die im Sprachgebrauch nicht ersichtlich werden, illustriert Kramsch mit dem Begriff GAME bzw. JEU in seiner Verwendung im Französischen und im nordamerikanischen Englisch wie folgt:
The word game in American English is associated in its social context mostly with the words sports, competition, win, lose, team, rules, whereas the word jeu is associated in the French cultural imagination mostly with such words as loisir [leisure], s‘amuser [to have fun], enfants [children], pas sérieux. (KRAMSCH 1988:106)
1.2Kulturspezifische Semantik von Konkreta und Abstrakta
Inwieweit sich die kulturelle Prägung von einer lexikalischen Einheit zu einer anderen unterscheidet und inwiefern dies mit dem Grad der ontologischen Beschaffenheit sowie dem Grad ihrer Konkretheit bzw. Abstraktheit zusammenhängt, wurde bisher von der Forschung nicht hinreichend mit empirischen Befunden berücksichtigt (vgl. Fraas 1998, 2000, Barsalou 2005, Borghi/Binkofski 2014). Insbesondere kann allgemein festgestellt werden, dass der Semantik abstrakter Wörter, wie etwa Freiheit oder Gerechtigkeit, im Forschungsprogramm der kognitiven Linguistik weniger Beachtung geschenkt wurde. BARSALOU (2008:634) begründet das folgendermaßen:
Because the scientific study of concepts has primarily focused on concrete concepts, we actually know remarkably little about abstract concepts, even from the perspective of traditional cognitive theories.
Dass zwischen konkreten und abstrakten lexikalischen Einheiten einer Sprache semantische Differenzen bestehen, lässt sich aus einer langen psycholinguistischen Forschungstradition ableiten, die robuste Unterschiede zwischen Konkreta und Abstrakta bezüglich ihres Erwerbs, ihrer Verarbeitung sowie ihrer kognitiven Repräsentation feststellt (Paivio 1965, Barsalou 2008). Diese Unterschiede sind in der Psycholinguistik unter dem Label Konkretheitseffekt (engl. concreteness effect) bekannt. Dieser Effekt beschreibt die Einflüsse, die die Konkretheit oder Abstraktheit eines lexikalischen Konzepts auf deren kognitive Verarbeitung oder Speicherung mit sich bringt. Die Distinktion von Konkreta und Abstrakta basiert hier in erster Linie darauf, dass sich Konkreta typischerweise auf räumlich und physikalisch wahrnehmbare Referenzen in der Realität beziehen wie etwa Stuhl, Straße und Ball, während abstrakte lexikalische Einheiten wie Freiheit, Wahrheit oder Sicherheit sich auf Prozesse oder Zustände beziehen und zu ihrem Verständnis eine Reihe von situativbezogenen, soziokulturellen Informationen sowie einen hohen Grad an introspektiven Informationen erfordern (Barsalou/Wiemer-Hastings 2005). Abstrakta bilden daher keine perzeptuell wahrnehmbaren Gegenstände unserer Welt, sondern analytische Entwürfe der menschlichen Kognition, die sich in der soziokulturellen Erfahrung ergeben (Barsalou/Wiemer-Hastings 2005, Fraas 1998) und stellen deshalb ein klassisches Problem für Theorien dar, die das Wissen modalitätsspezifisch begründen (Borghi/Binkofski 2014, Barsalou 1999, 2003). Zur hochgradig kulturellen Prägung der Bedeutung abstrakter Begriffe hypothesieren beispielsweise Borghi/Binkofski:
Due to the fact that language plays a major role in the representation of ACWs [abstract concepts and word meanings], we hypothesize that they are more affected by differences between languages than concrete concepts and words, that is, that their meaning will change more depending on the cultural and linguistic milieu in which they are learned (BORGHI/BINKOFSKI 2014:21).
Anknüpfend an diese Hypothese versucht die vorliegende Arbeit, den Einfluss kultureller Faktoren auf die Konzeptualisierung von Konkreta und Abstrakta aufzuzeigen und aus kognitiver Sicht exemplarisch zu modellieren und zu quantifizieren. Ausgehend von der These, dass Konkreta und Abstrakta aufgrund ihrer ontologischen Beschaffenheit auch epistemische Konzeptualisierungsspezifika aufweisen, wird in der vorliegenden Untersuchung der Frage nachgegangen, inwieweit sich diese beiden Konzeptarten im Hinblick auf ihre Konzeptualisierung unterscheiden und in welchem Umfang sich eine kulturelle Prägung bei beiden Konzeptarten abzeichnet.
1.3Inhalt und Aufbau der Arbeit
Diese Fragen werden in der vorliegenden Arbeit mittels eines Wortassoziationsexperiments mit 750 Sprechern des Deutschen, Französischen und Arabischen beantwortet. Wortassoziationsexperimente eignen sich vor allem gut für die Zielsetzung der vorliegenden Studie, weil sie deckungsgleich mit psycholinguistischen und semantischen Theorien, wie etwa der Frame-Semantik oder der konzeptuellen Metapherntheorie, sind, die dieser Arbeit als Grundlage dienen. Wortassoziationen rufen außerdem schnell und unkompliziert Sprachdaten hervor, die sich leichter für quantitative Analysen eignen als diskursive Sprachdaten bzw. Textkorpora. Typischerweise werden Wortassoziationsexperimente auch zur Messung von Stereotypie eingesetzt (Fitzpatrick et al. 2015). Der Grad der Stereotypie gibt an wie ähnlich die Reaktion eines Individuums mit denen in einem Referenzsatz ist. Hieraus lassen sich gruppenbezogene semantische Netzwerke generieren, die Aufschluss über den Grad der Übereinstimmung zwischen Angehörigen verschiedener Sprachgemeinschaften geben oder die Ausprägung verschiedener gruppenspezifischer Variablen wiedergeben.
Auch zur Aufdeckung kulturspezifischer Differenzen zwischen mehreren Sprachen wurden Wortassoziationsexperimente eingesetzt (vgl. Roche 2013, Sharifian 2017). Sie bieten einen tiefen Einblick in die assoziative Struktur semantischer Netze und zeigen damit intersubjektive, kultur- und sprachbezogene Bedeutungsaspekte auf. Deshalb scheinen sie auch zur Aufdeckung der kulturspezifischen Prägung von Konkreta und Abstrakta hilfreich. In der vorliegenden Studie wird dieses Design angewandt, um die Differenzen zwischen Konkreta und Abstrakta im Deutschen, Französischen und Arabischen statistisch zu quantifizieren, und um einen Einblick in die Konzeptualisierung beider Konzeptarten sowie in ihre kulturellen Spezifika zu bekommen.
Für diesen Zweck werden in der vorliegenden empirischen Untersuchung sämtliche Aspekte erläutert, die hinter der dichotomen Unterscheidung zwischen Konkreta und Abstrakta stehen. Diesem Grundsatz folgend gliedert sich die folgende Arbeit in zwei Hauptteile: Im ersten Teil (Kapitel 2 bis 5) werden die psycholinguistische Evidenz, die kognitiven Grundlagen der Bedeutungskonstitution sowie die wichtigsten theoretischen Modelle der Framesemantik und der konzeptuellen Metapherntheorie im Hinblick auf die Konzeptualisierung von Konkreta und Abstrakta in den Blick genommen. Im zweiten Teil (Kapitel 6 bis 8) wird anhand der gewonnenen Daten aus dem oben genannten Wortassoziationsexperiment die kulturspezifische Prägung von Konkreta und Abstrakta mittels der Kontrastierung des Deutschen mit dem Französischen und Arabischen untersucht.
Zuerst wird im zweiten Kapitel die Evidenz der Differenzierung zwischen Konkreta und Abstrakta ausgehend von empirischen Befunden psycho- und neurolinguistischer Studien erläutert. Diese Dichotomie lässt sich vor allem durch die Unterschiede beim Erwerb rechtfertigen. So zeigen Studien sowohl zum Erst- als auch zum Fremdspracherwerb, dass Konkreta früher und schneller als Abstrakta erworben werden. Außerdem werden in diesem Kapitel Studien sowie theoretische Modelle vorgestellt, wie die „Dual-Coding“-Theorie von Paivio (vgl. Paivio 1965, 1969, 1986) und die „Context-Availability“-Theorie von Schwanenflugel et al. (1988, 1992), die die Verarbeitung von Konkreta und Abstrakta fokussieren und Unterschiede zwischen beiden Konzeptarten jeweils auf unterschiedliche Verarbeitungswege und Repräsentationssysteme zurückführen.
Aus diesen Unterschieden resultieren verschiedene Überlegungen zur kognitiv-semantischen Repräsentation dieser beiden Konzepte sowie zu ihrer sprachspezifischen Konzeptualisierung. Daher wird im dritten Kapitel folgerichtig der Frage der kognitiven Repräsentation des semantischen Wissens nachgegangen. Hier werden kognitive zeichentheoretische Grundlagen, die gemeinsam für Konkreta und Abstrakta gelten, skizziert, sowie das Konzeptualisierungsverständnis dieser Arbeit, das auf einem kognitiven Verständnis basiert, in dem sowohl einzelsprachlichen als auch enzyklopädischen Bedeutungsaspekten Rechnung getragen wird. Diese Sichtweise dynamischer Bedeutungskonstruktion entspricht dem enzyklopädischen gebrauchsbasierten Ansatz von Langacker, nach dem lexikalische Bedeutung weder frei noch fest ist (Langacker 2008:39). Bedeutung ist hiernach an ein gewisses Maß an Wissen, Konventionen und an bestimmte Erfahrbarkeitskanäle gebunden. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel schema- und assoziationstheoretische Grundlagen der Bedeutungskonstitution sowie die Konventionalisierung von semantischen kulturgeprägten Bedeutungsaspekten in einer Sprachgemeinschaft behandelt. Dies dient dazu, einen theoretischen Rahmen zu schaffen, vor dessen Hintergrund die kulturelle Prägung von Konkreta und Abstrakta ersichtlich wird.
Um einen analytischen Zugang zu den konzeptuellen Strukturen von Konkreta und Abstrakta zu erhalten, bietet sich insbesondere der framesemantische Ansatz an, der im vierten Kapitel beleuchtet wird. Semantische Frames werden hier herangezogen, um die kognitive Repräsentation des lexikalischen semantischen Wissens zu modellieren und Verstehens- sowie Interpretationsprozesse zu erklären (1977, 1982, 1985, Konerding 1993, Ziem 2008, 2014a und b, Busse 2012). Frames gelten als schematische Einheiten par exellence. In ihnen schlagen sich alle kognitiven, schematheoretischen und assoziativen Grundlagen nieder, die einem enzyklopädischen und konventionalisierten Bedeutungsverständnis gerecht werden.
Um die semantischen Besonderheiten von Abstrakta zu berücksichtigen, werden im fünften Kapitel die Grundzüge der konzeptuellen Metapherntheorie erläutert, die Metaphern nicht als stilistisch auffällige Sprachbilder begreift, sondern vielmehr als kognitiven Mechanismus, durch den abstrakte Bedeutungen mithilfe von Konkreta konzeptualisiert werden. Dieses Kapitel versucht auf die Frage zu antworten, wie die Konzeptualisierung abstrakter Begriffe nach diesem Ansatz erfolgt und inwiefern metaphorische Konzepte als analytische Einheiten zur Entschlüsselung kultureller Differenzen in verschiedenen Sprachen brauchbar sind (s. Sharifian 2017).
Im empirischen Teil der Arbeit werden nach einer eingehenden Ableitung der Forschungsfragen und Hypothesen in Kapitel 6 das Untersuchungsdesign der vorliegenden Arbeit in Bezug auf die Versuchspersonen, die Auswahl der Stimuli und den Untersuchungsverlauf sowie weitere methodische Aspekte erläutert. Darüber hinaus werden relevante Wortassoziationsexperimente skizziert, deren Ergebnisse auf die kulturbedingte Konzeptualisierung von Konkreta und Abstrakta hindeuten. Durch diverse quantitative statistische Maße werden in Kapitel 7 die Unterschiede abgebildet, die Konkreta und Abstrakta in und zwischen den drei untersuchten Sprachen aufweisen und auf eine kulturspezifische Konzeptualisierung hindeuten. Diese Ergebnisse werden anschließend vor dem Hintergrund weiterer Studien und Untersuchungen diskutiert.
2Konkreta und Abstrakta in der Psycholinguistik
Im vorliegenden Kapitel wird die Evidenz der Differenzierung zwischen Konkreta und Abstrakta auf der Grundlage von empirischen Befunden psycho- und neurolinguistischer Studien erläutert. Im Fokus steht die dichotome Unterscheidung zwischen Konkreta und Abstrakta, die sich vor allem durch die Unterschiede beim Erwerb und bei der Verarbeitung beider Konzeptarten rechtfertigen lässt. So werden Konkreta im Vergleich zu Abstrakta früher erworben und schneller verarbeitet (vgl. Wode 1988, 1993, Schröder et al. 2003). Auch Studien zum Erwerb von Konkreta und Abstrakta in einer Fremdsprache zeigen große Vorteile bezüglich Memorisierungs- und Verarbeitungsleistungen für Konkreta (Altarriba/Basnight-Brown 2011).
Zwei prominente Ansätze aus der Psycholinguistik versuchen, diese Unterschiede zu modellieren. Die „Dual-Coding“-Theorie von Paivio (vgl. Paivio 1965, 1969, 1986) sieht die Robustheit der Verarbeitung von Konkreta durch deren Repräsentation in zwei Wissensspeicherungssystemen begründet. Konkreta verfügen hiernach über eine doppelte Kodierungsmöglichkeit: eine perzeptuelle und eine sprachliche. Dies macht ihre Verarbeitung gegenüber Abstrakta schneller und effizienter. Im Gegensatz dazu geht die „Context-Availability“-Theorie von Schwanenflugel et al. (1988, 1992) davon aus, dass der Nachteil bei der Verabeitung von Abstrakta durch deren hohe Kontextabhängigkeit entsteht. Insofern ist der Unterschied zwischen Konkreta und Abstrakta durch qualitative Besonderheiten auf der Ebene der Konzeptualisierung gegeben.
Trotz dieser Erklärungsansätze lässt sich ausgehend von einer dichotomen Betrachtungsweise keine genaue Abgrenzung zwischen beiden Konzeptarten ermitteln. Die meisten Studien gehen von dem Merkmal der perzeptuellen Darbietung als Distinktionsmerkmal aus, um den Unterschied zwischen Konkreta und Abstrakta zu belegen. Eine weitere Alternative zur dichotomen Sichtweise ist die, dass Abstrakta und Konkreta ein Kontinuum darstellen und sich Begriffe hinsichtlich ihrer Konkretheit bzw. Abstraktheit graduell unterscheiden. Konkretheit und Abstraktheit können dabei nur als grobe Einteilungsmuster herangezogen werden (Keil 1989, Borghi/Binkofski 2014).
In diesem Kapitel wird daher der Frage nachgegangen, auf welchen empirischen Evidenzen und theoretischen Modellierungsversuchen die Unterscheidung zwischen Konkreta und Abstrakta basiert und wie eine Unterteilung zwischen beiden Konzeptarten vorgenommen werden kann.
2.1Erwerb von Konkreta und Abstrakta
2.1.2Erwerb in der Fremdsprache
Da aus den vorliegenden Ergebnissen zum Erwerb von Konkreta und Abstrakta in der L1 bekannt ist, dass die Konkretheit bzw. Abstraktheit eines lexikalischen Konzepts die Lernleistung stark beeinflusst, lenkten Altarriba/Basnight-Brown (2011) in einer explorativen Studie ihr Augenmerk auf den Erwerb in der Fremdsprache. Um die festgestellten Unterschiede zum Erwerb von Konkreta und Abstrakta überprüfen zu können, wurden im Experiment Emotionswörter als Sonderkategorie hinzugefügt. Obwohl der Fokus auf den Unterschied beim Erwerb von Emotionswörtern und Nicht-Emotionswörtern gelegt wurde, lassen sich aus den Ergebnissen Unterschiede zwischen Konkreta und Abstrakta klar ableiten. Insgesamt wurde die Studie mit 60 englischsprechenden Lernenden des Spanischen als Fremdsprache durchgeführt. Die Besonderheiten beim Erwerb der drei genannten Kategorien wurden exemplarisch anhand von 24 spanischen Wörtern, 8 Konkreta (zum Beispiel [JOYA], [JEWEL]), 8 Abstrakta (zum Beispiel [VIRTUD], [VIRTUE]) und 8 Emotionswörtern (zum Beispiel [ENOJADO], [ANGRY]) untersucht. Nach einer initialen Lernphase, in der die Versuchspersonen mit den 24 neu zu erlernenden Wörtern vertraut gemacht wurden, erfolgte ein Übersetzungs-Wiedererkennungstest, in dem die Versuchspersonen in einer bestimmten Zeit über die Korrektheit von dargebotenen Übersetzungspaaren entscheiden sollten. Darüber hinaus wurde in einem Stroop-Interferenz-Test (engl. stroop color-word task) überprüft, inwieweit die Versuchspersonen die erlernten Wörter mit Farben assoziieren können, denn jedes Wort wurde in der Lernphase in einer bestimmten Farbe dargeboten. Die Versuchspersonen sollten die Farben bestimmen, mit denen die Wörter in der Lernphase versehen wurden. Eine Varianzanalyse der Ergebnisse hinsichtlich der variablen Reaktionszeit und Korrektheit zeigt, dass Konkreta mit Abstand häufiger korrekte Reaktionen und kürzere Reaktionszeiten erzielt haben. Hierbei ist anzumerken, dass bei den emotional beladenen Stimuli eine längere Reaktionszeit markiert wurde, und hinsichtlich der Korrektheit der Antworten Abstrakta und Emotionswörter keine großen Unterschiede aufwiesen (vgl. Altarriba/Basnight-Brown 2011:449f.). Ausgehend von den Ergebnissen dieser Studie stellen die beiden Autoren fest, dass die Unterschiede beim Erwerb auf Differenzen konzeptueller Art zwischen den beiden Kategorien zurückzuführen sind (Altarriba/Basnight-Brown 2011:451).
2.2Konkretheitseffekt und Verarbeitung von Konkreta und Abstrakta
2.2.1Der Konkretheitseffekt: Psycho- und neurolinguistische Evidenz
Die Konkretheit bzw. Abstraktheit eines lexikalischen Konzepts als Einflussfaktor lässt sich nicht nur beim Erwerb lexikalischer Einheiten beobachten. Psycholinguistische Untersuchungen in den letzten 70 Jahren haben daneben große Differenzen in der Verarbeitung von konkreten und abstrakten lexikalischen Konzepten nachgewiesen (vgl. Balota et al. 1991:193–197, Borghi/Binkofski 2014). Diese Differenzen ließen sich mit unterschiedlichen Testverfahren sowohl für die Sprachrezeption als auch -produktion bestätigen. Die festgestellten Unterschiede zwischen Konkreta und Abstrakta bei der Sprachverarbeitung sind unter dem Label Konkretheitseffekt (engl. concreteness effect) bekannt geworden. Dieser Effekt besagt, dass lexikalische Konzepte, die auf wahrnehmungsbasierte Entitäten referieren, schneller und effizienter verarbeitet werden als Konzepte, die nicht wahrnehmungsbasiert sind.
Der hohe Erklärungswert der Konkretheit als Einflussfaktor auf die Verarbeitung und Lernbarkeit lexikalischer Konzepte geht auf Allan Paivio zurück, der bei seinen Untersuchungen zum Paar-Assoziations-Lernen feststellen konnte, dass die Konkretheit eines Begriffs einen enormen lernerleichternden Effekt mit sich bringt (vgl. Paivio 1969, 2007). Sein Forschungsprogramm diente als Grundbaustein für eine Reihe weiterer Untersuchungen, die sich mit dem Konkretheitseffekt beschäftigen. Hier zeigen sich bei fast allen Untersuchungen, die auf der lexikalischen Ebene operieren, dass Konkreta robustere Verarbeitungs- und Memorisierungsleistungen als Abstrakta erzielen. Dies zeigt sich beispielsweise bei Studien zu Erinnerungstests (engl. free-recall) (Paivio et al. 1968, Rubin/Friendly 1986, Tse/Altarriba 2009), Wiederherstellung der Reihenfolge (engl. recollection) (Romani et al. 2008, Peters/Daum 2008), lexikalischer Entscheidung (engl. lexical decision) (James 1975, Kroll/Merves 1986, Bleasdale 1987, Borghi et al. 2011), Übersetzung (Altarriba/Basnight-Brown 2011) und semantischer Kategorisierung (engl. semantic categorization) (Tyler et al. 2001).1
Den Konkretheitseffekt bei der Verarbeitung von Konkreta und Abstrakta unterstützen darüber hinaus neurolinguistische Befunde, die ausgehend von elektroenzephalografischen (EEG) und bildgebenden Messverfahren (engl. neuroimaging) Unterschiede bei der neuronalen Aktivierung von Konkreta und Abstrakta festgestellen. Von einem einheitlichen Verarbeitungsprozess kann dabei nicht ausgegangen werden, weil bei Konkreta und Abstrakta nicht die gleichen neuronalen Aktivierungsprozesse vorliegen. PULVERMÜLLER (2013:465) sieht den Unterschied zwischen Abstrakta und Konkreta darin begründet, dass
[…] the variability of the sensorimotor patterns that foster semantic grounding, which is typically low for concrete and high for abstract symbols. This difference in correlation structure may yield different neuronal and cognitive mechanisms for concrete and abstract meaning.
Weiss (1997) konnte nachweisen, dass die Verarbeitung von akustisch präsentierten konkreten und abstrakten Nomina unterschiedliche EEG-Kohärenzmuster hervorruft. Durch ihr Experiment konnte festgestellt werden, dass bei der Verarbeitung von Konkreta mehr Gehirnregionen kooperieren als bei der Verarbeitung von Abstrakta. Der Grund dafür lässt sich dadurch erklären, dass sie Gegenstände beschreiben, „deren Konzepte im semantischen Netzwerk durch taktile, visuelle, akustische, aber auch olfaktorische, gustatorische und motorische Komponenten repräsentiert sind“ (Weiss 1997:131). Im Gegensatz dazu stellt Weiss fest, dass die Repräsentation von Abstrakta sich nicht auf eine multimodale Wissensbasis stützen kann.
Des Weiteren deuten Forschungsergebnisse zum Neuroimaging auf eine modalitätsspezifische Kortexaktivierung bei der Verarbeitung von lexikalischen Konzepten, die taktile, olfaktorische, visuelle, auditive oder gustatorische Eigenschaften aufweisen (vgl. auch Goldberg et al. 2006, Simmons et al. 2005, Kiefer et al. 2008). Hier zeigen sich neben der Überlappung und der gemeinsamen Aktivierung von manchen Gehirnzentren bei der Verarbeitung von lexikalischen Konzepten kategorienspezifische Aktivierungseffekte, die unterschiedliche Kohärenzmuster bei Abstrakta und Konkreta hervorrufen.
Category-specific semantic effects also appear for regions far beyond the hub candidates, in and close to modality-specific – or, more accurately, modality-preferential – sensory and motor areas. In superior temporal auditory and inferior temporal visual areas, sound and visually related words such as bell and grass yield the strongest activation, and focal lesions can cause semantic and conceptual deficits for these categories. Category specificity is present in and close to the piriform and anterior insular olfactory cortex, where odor words such as ‘cinnamon’ lead to greater activation than control words do; in the gustatory cortex in anterior insula and frontal operculum, where taste words such as ‘sugar’ lead to relatively strong activation; and in the ventral, lateral, and dorsal motor system, including primary motor and premotor, along with adjacent prefrontal and anterior parietal areas. In motor cortex, a fine-grained semantic map reflects the body-part relationship of action-related words, phrases, and sentences, and potentially additional features of the action schemas these signs relate to semantically (PULVERMÜLLER 2013:264).
Hayes/Kraemer (2017) bestätigen zudem, dass sensorische Bereiche bei der Verarbeitung von Konkreta stärker aktiviert werden, während bei Abstrakta und Funktionswörtern eine stärkere fokale Aktivierung des perisylvischen Kortexes (Sprachregionen) dominiert.
[B]rain regions (located in sensorimotor cortex and nearby association cortex) that are preferentially responsive to information within a specific sensory modality – play a prominent role in information processing and semantic retrieval […]. Such networks consist of simultaneously activated brain regions representing the properties of a given concept – for example, seeing a tool activates left hemisphere areas including the ventral fusiform cortex, parietal cortex, and ventral premotor cortex (vPMC), regions associated with visual object identification (form, color, shape etc.), and manipulation, respectively (HAYES/KRAEMER 2017:2).
Ein weiterer Nachweis für das Vorliegen eines Konkretheitseffekts liefern Forschungsergebnisse von Binder et al. (2005). Mithilfe der ereigniskorrelierten funktionellen Magnetresonanztomographie (engl. event-related functional magnetic resonance imaging efMRI





























