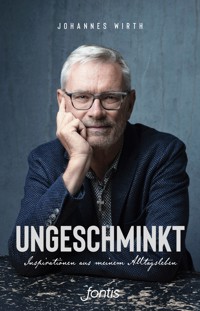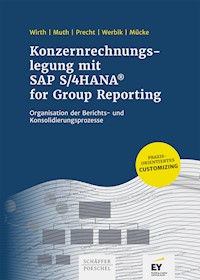
144,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Mit SAP S/4HANA® for Group Reporting können die Daten aller Konzerngesellschaften harmonisiert und auf einer Plattform vereinigt werden. Das Buch erläutert, wie das Programm die Berichts- und Konsolidierungsprozesse unterstützt. Es stellt die Systemarchitektur, die Integration in die SAP S/4HANA®-Landschaft und weitere zentrale Elemente des Customizings dar. Anhand einer Fallstudie zeigt es den gesamten Konsolidierungsprozess von der Datenübernahme bis zur Kapitalkonsolidierung auf. Abschließend erklärt es die systemgestützte Anwendung der Equity-Methode und die Erstellung der Kapitalflussrechnung. Die Autor:innen sind renommierte Expert:innen im Konzernrechnungswesen. Sie verfügen über jahrelange Erfahrung in der Beratung und kennen die Anforderungen an eine leistungsstarke Konsolidierungssoftware aus Kundensicht. Profitieren Sie von ihrem Wissen und nutzen Sie alle Vorteile, die Ihnen die innovative Software bietet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 620
Ähnliche
[IX]Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtImpressumVorwortAbbildungsverzeichnisAbkürzungsverzeichnis1 Fallstudie und grundlegende Anmerkungen2 Eckpunkte der Abschlusserstellung mit SAP® GR 2.1 Schaffung eines Konzerninformationssystems2.2 Integratives Konzept der Softwarelösung2.3 Der Prozess der konsolidierten Rechnungslegung im Überblick (Datenflusskonzept)2.4 Chancen und Ziele eines harmonisierten Rechnungswesens2.4.1 Kommunikationsaspekt2.4.2 Schaffung eines einheitlichen Datenbestandes2.4.3 Schaffung einer effizienten Berichtsplattform2.4.4 Abschlussorientierte Vergütungssysteme2.5 Wichtige Organisationsmerkmale für eine harmonisierte Berichtslandschaft2.5.1 Wirksame Verzahnung der Berichtsanlässe2.5.2 Integrierte Positionspläne2.5.3 Einheitliches Konzept von Berichtseinheiten und Konsolidierungskreisen 2.6 Matrixkonsolidierung 2.6.1 Grundzüge der Matrixkonsolidierung 2.6.2 Technik der Matrixkonsolidierung in SAP GR 2.6.3 Kapitalkonsolidierung in einer Matrixumgebung 2.7 Berichtsanlässe und Abschlusskalender in einem intern/extern harmonisierten Berichtswesen3 Komponenten und Navigation3.1 Onpremise- und Cloud-Umgebung3.2 Grundzüge der Bedienung3.3 Daten- bzw. Konsolidierungsmonitor 3.4 Interaktion mit Standard-Office-Produkten4 Funktionale Grundlagen der Softwarelösung4.1 Zentrale Stammdaten4.1.1 Globale Parameter4.1.2 Abschlussperioden und Real-Time-Konsolidierung4.1.3 Konsolidierungsversion 4.1.4 Konsolidierungseinheiten 4.1.5 Konsolidierungskreise 4.1.6 Scope- versus Hierarchiemodell 4.1.7 Zuordnung von Konsolidierungseinheiten zu Konsolidierungskreisen4.1.8 Konzernhierarchisierung aus Blickwinkel der Management-Steuerung4.1.9 (Konzern-)Positionen4.1.10 Konten und Positionen – ein integrativer Ansatz4.1.11 Kontierungstypen 4.1.12 Bewegungsarten/Unterposition4.1.13 (Konzern-)Positionsplan – das Rückgrad des gruppenweiten konsolidierten Berichtswesens4.2 Verwendete Buchungslogik4.2.1 Kontierungsebenen 4.2.2 Belegarten4.2.3 Ergebniseffekt4.2.4 Latente Steuern im Konsolidierungsprozess 4.2.5 Saldovortrag4.3 Änderungsprotokollierung im Bereich der Stammdaten4.4 Werkzeuge der automatisierten Konsolidierung4.4.1 Regelbasierte versus herstellerseits programmierte Konsolidierungslogik 4.4.2 Aufbau und Gestaltung von Umgliederungsmethoden 5 Prozess der Konsolidierungsvorbereitung 5.1 Überblick5.2 Einheitlicher Konzernpositionsplan und Kontenmapping 5.3 Prozess der Meldedatenerfassung5.3.1 S/4HANA-integrierte Konsolidierungseinheiten5.3.2 Nicht in S/4HANA-integrierte Konsolidierungseinheiten 5.3.3 Exkurs: SAP GR Data Collection App5.3.4 Steuerungsdaten zur maschinellen Kapitalkonsolidierung (Zusatzmeldedaten) 5.3.5 Meldedaten auf Basis der IFRS-Rechnungslegung und unter Verwendung der Konzernsicht 5.4 Manuelle Buchungen und maschinelle Umgliederungen 5.5 Stille Reserven/Lasten-Verwaltung bei erworbenen Konsolidierungseinheiten 5.5.1 Grundlagen der Verwaltung stiller Reserven/Lasten5.5.2 Konkurrierende Umsetzungskonzepte 5.5.3 Umsetzung der stillen Reserven/Lasten-Buchhaltung über manuelle Buchungen5.5.4 Exkurs: Stille Reserven/Lasten in der Measurement Period gem. IFRS 35.6 Datenanreicherung für Zwecke der Anhangberichterstattung5.7 Prozess der Intercompany-Abstimmung5.7.1 Intercompany-Abstimmung und effiziente Eliminierung von konzerninternen Geschäftsvorfällen5.7.2 Technische und organisatorische Optimierungsmöglichkeiten5.7.3 Grundzüge der Intercompany-Matching- und -Abstimmung-Lösung (ICMA)5.7.4 Customizing der Komponente Intercompany-Matching- und -Abstimmung5.7.5 IC-Matchinglauf und Analyse des Matching-Ergebnisses5.7.6 Customizing eines Abstimmungsfalls5.7.7 Anwendung von Abstimmsachverhalten im Abschlussprozess5.7.8 Betriebswirtschaftliche Behandlung von Intercompany-Differenzen5.7.9 IC-Abstimmung und hieraus resultierende Konsolidierungsbuchungen 5.8 Währungsumrechnung5.8.1 Grundlagen5.8.2 Konzept der funktionalen Währung5.8.3 Umrechnung nach der Zeitbezugsmethode5.8.4 Umrechnung nach der modifizierten Stichtagskursmethode 5.8.5 Grundsatzfragen der systemgestützten Währungsumrechnung5.8.6 Vorgabe der Wechselkursrelationen5.8.7 Customizing einer Währungsumrechnungsmethode5.8.8 Währungsumrechnung im Bereich der Gewinn- und Verlustrechnung5.8.9 Währungsumrechnung im Bereich des Eigenkapitals5.8.10 Stille Reserven/Lasten und Währungsumrechnung5.8.11 Besonderheiten des unterjährigen Erwerbs von Tochterunternehmen5.8.12 Rundung5.8.13 Zuordnung einer Währungsumrechnungsmethode5.8.14 Protokoll der Währungsumrechnung5.9 Prüfung der Meldedaten (Validierungen)5.9.1 Überblick5.9.2 Technische Validierung 5.9.3 Betriebswirtschaftliche Validierung6 Konsolidierungsprozess 6.1 Maßnahme Änderung Konsolidierungskreis6.2 Schuldenkonsolidierung6.2.1 Umsetzung der Schuldenkonsolidierung über Umgliederungsmaßnahmen6.2.2 Exkurs: Automatischer Belegstorno im Kontext der IC-Konsolidierung6.2.3 Durchführung der Schuldenkonsolidierung unter Verwendung von SAP ICMA-Eliminierungsmethoden6.3 Aufwands- und Ertragskonsolidierung6.3.1 Innenumsatzeliminierung6.3.2 Beteiligungsertragseliminierung6.3.3 Sonstige Aufwands- und Ertragseliminierung6.4 Zwischenergebniseliminierung im Vorratsvermögen6.4.1 Betriebswirtschaftliche Anforderungen an die Zwischenergebniseliminierung6.4.2 Bestandsermittlung als zentrale Fragestellung der Zwischenergebniseliminierung6.4.3 Buchhalterische Abbildung der Zwischenergebniseliminierung6.4.4 Schaffung der Konzernsicht unmittelbar in S/4HANA6.4.5 Zwischenergebniseliminierung unter Verwendung von berichtsbasierten Berechnungslogiken6.4.6 Zwischenergebniseliminierung auf Basis von Umgliederungsregeln6.5 Kapitalkonsolidierung6.5.1 Grundzüge der Vollkonsolidierung6.5.2 Wahl zwischen regelbasierter und vorgangsbasierter Kapitalkonsolidierung6.5.3 Einrichten der maschinellen, vorgangsbasierten Kapitalkonsolidierung6.5.4 Einrichten von Kapitalkonsolidierungsmethoden 6.5.5 Vorgänge der Kapitalkonsolidierung und deren Reihenfolge der Abarbeitung6.5.6 Vorgangsbasierte Verarbeitung der Erstkonsolidierung6.5.7 Goodwillverarbeitung auf Basis der Anforderungen der internationalen Rechnungslegung 6.5.8 Fortschreibung konzernfremder Gesellschafter während der Konzernzugehörigkeit (Vorgang Folgekonsolidierung)6.5.9 Erwerbsschritte bei bestehendem Controlverhältnis (Vorgang sukzessiver Erwerb)6.5.10 Grundzüge der Endkonsolidierung eines Tochterunternehmens und buchhalterische Umsetzung6.5.11 Systemgestützte Endkonsolidierung eines Tochterunternehmens6.5.12 Kapitalkonsolidierung unter Berücksichtigung von Währungsumrechnung6.6 Equity-Methode6.6.1 Grundkonzept der Equity-Methode6.6.2 Customizing der maschinell unterstützten Equity-Methode6.6.3 Equity-Methode im Zugangszeitpunkt6.6.4 Equity-Fortschreibung in GuV und OCI 7 Kapitalflussrechnung7.1 Betriebswirtschaftliche Grundlagen7.2 Systemseitige Umsetzung7.2.1 Organisation der systemgestützten Kapitalflussrechnung7.2.2 Ausgewählte Geschäftsvorfälle, die im Zuge der Erstellung der Kapitalflussrechnung zu bereinigen sind7.2.3 Gliederung aller Position/Bewegungsartenkombinationen der Bilanz- und GuV nach dem Aktivitätsformat7.2.4 Kapitalflussrechnung und Währungsumrechnung7.2.5 Zahlungswirksame Zu- und Abgänge aus dem Konsolidierungskreis 8 Konzernsimulation und Konzernplanung8.1 Das Versionskonzept als zentrales Umsetzungsinstrument im Bereich der Simulation und Plankonsolidierung 8.2 Konzernsimulation8.2.1 Parallele Konzernwährung8.2.2 Änderung von Beteiligungsstrukturen8.2.3 Währungssimulation8.3 Konzernplanung8.3.1 Plankonsolidierung 8.3.2 Integration der operativen Unternehmenplanung in die KonzernplanungLiteraturhinweiseStichwortverzeichnisHinweis zum Urheberrecht:
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft - Steuern - Recht GmbH
[IV]Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-5377-6
Bestell-Nr. 11121-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-5378-3
Bestell-Nr. 11121-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-5379-0
Bestell-Nr. 11121-0150
Johannes Wirth/Andreas Muth/Oliver Precht/Anna Werbik/Jan Christian Mücke
Konzernrechnungslegung mit SAP S/4HANA® for Group Reporting
Dezember 2021
© 2021 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
schaeffer-poeschel.de
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart
Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Einen Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
[V]SAP®, ABAP®, ASAP®, SAP® Business Explorer® (SAP® BEx), SAP® BusinessObjects™, SAP® BusinessObjects™ Explorer, SAP® BusinessObjects™ Web Intelligence®, SAP Business Workflow®, SAP® BW/4HANA®, SAP C/4HANA®, SAP® Crystal Reports®, SAP EarlyWatch®, SAP Fiori®, SAP HANA®, SAP Lumira®, SAP NetWeaver®, SAP® R/3®, SAP® Replication Server®, SAP® Roambi®, SAP S/4HANA®, SAP S/4HANA® Cloud, SAP® SQL Anywhere®, SAP Strategic Enterprise Management® (SAP® SEM®), sind die Marken oder eingetragenen Marken der SAP SE oder ihrer verbundenen Unternehmen in Deutschland und mehreren anderen Ländern.Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.
Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.
Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat, Flash, PostScript und Reader sind eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken, eingetragene Marken oder werden vom Massachusetts Institute of Technology (MIT), European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) oder der Keio University als nicht geschützte Begriffe beansprucht.
Microsoft, Windows, Windows Phone, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight und Visual Studio sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
QR Code ist eine eingetragene Marke von Denso Wave Incorporated.
Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.
Die in diesem Werk wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen etc. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein und als solche den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.
Die Darstellung in diesem Buch gibt die persönliche Meinung der Autoren wieder und ist keine offizielle Publikation von EY. Das Werk ist mit Unterstützung von EY entstanden. EY ist jedoch nicht Herausgeber des Werks oder sonst presserechtlich dafür verantwortlich.
[VII]Vorwort
Die Konzernrechnungslegung und die Konzernsteuerung sind eng mit der Frage der Softwareunterstützung verbunden. Ab einer gewissen Konzerngröße bzw. Komplexität der internen Leistungsströme ist die Nutzung IT-gestützter Prozesse nicht mehr wegzudenken, um die Anforderungen an Ordnungsmäßigkeit (externe Rechnungslegung) bei gleichzeitig gewünschter Flexibilität (interne Rechnungslegung) umzusetzen. Die über die Jahre erfolgte Fortentwicklung der Systeme/Systemlandschaften führte zudem nicht nur zu einer steten Verbesserung der Prozessstabilität, sondern es wurde auch deutliche Prozesseffizienz hinzugewonnen.
In der Vergangenheit war die Heterogenität der Buchhaltungssysteme einer Gruppe ein wesentlicher, limitierender Faktor bei der Schaffung einer leistungsfähigen Reporting-Landschaft. Einhergehend mit der Einführung von SAP S/4HANA® kommt es in vielen Konzernen zu einem deutlichen Harmonisierungsschub; über eine One-ERP- bzw. eine Central-Finance-Architektur sind vielfach sogar alle wesentlichen Konzerngesellschaften einer Gruppe auf einer Plattform vereinigt.
Über die Komponente SAP S/4HANA for Group Reporting sind auch die Prozesse der konsolidierten Rechnungslegung in einer solchen Gesamtarchitektur integriert. D. h., der transaktionale Buchungsstoff mit seinen umfangreichen Detailinformationen (ACDOCA) ist ohne nennenswerte Zusatzarbeiten der (Konzern-)Konsolidierung zugänglich und alle zentralen Detailinformationen stehen nachfolgend auch für eine gruppenweite Berichterstattung zur Verfügung. Das verwendete Datenmodell ermöglicht zudem ein intern/extern harmonisiertes Reporting bis zur Gruppenebene.
Die Autoren erläutern, welche Prozessunterstützung durch SAP S/4HANA for Group Reporting erwartet werden kann. In diesem Zusammenhang werden die Systemarchitektur, die Integration in die SAP S/4HANA-Landschaft, aber auch weitere zentrale Elemente des Customizing der neuen Konsolidierungslösung erläutert. Der zweite Schwerpunkt umfasst die schrittweise Darstellung des Konsolidierungsprozesses, d. h., auf der Grundlage einer Fallstudie wird der gesamte Konsolidierungsprozess von der Datenübernahme bis hin zur Kapitalkonsolidierung vorgestellt. Ferner werden u. a. auch die systemgestützte Anwendung der Equity-Methode und die Erstellung einer Kapitalflussrechnung beleuchtet.
Das Buch trägt weder den Charakter eines (kompletten) Customizing-Leitfadens noch eines Lehrbuchs. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Erörterung der praxisgerechten Nutzung der Softwarelösung für typische Themenfelder der konsolidierten Rechnungslegung. Neben der Darlegung der Systemfunktionalitäten bzw. der betriebswirtschaftlichen Hintergründe findet der Leser auch eine Würdigung anhand der Umsetzung des verwendeten Beispielsachverhalts. Das Buch ist insofern ein guter Ratgeber in der Implementierungsphase der Lösung, wenn es darum geht, die Stärken der Lösung optimal zu nutzen, aber auch um fehlende bzw. nicht ausreichende Systemfunktionalitäten durch geeignete Workarounds zu ergänzen. Durch den Ver[VIII]gleich mit der konzeptionellen Herangehensweise in anderen SAP-Produkten (aus dem hier in Rede stehenden Bereich), ist das Buch auch ein wertvoller Leitfaden für eine Systemauswahl.
U. a. werden folgende Sachverhalte aufgegriffen:
Möglichkeiten und Grenzen der innovativen MatrixkonsolidierungUmsetzung eines Near Time-orientierten gruppenweiten BerichtswesensProzess der Datenerhebung für die Anhangberichterstattung unter Nutzung der Data Collection AppProzess der IC-Abstimmung unter Nutzung der Komponente SAP® Intercompany-Matching und -Abstimmung (SAP ICMA)Automatische, vorgangsbasierte Kapitalkonsolidierung: Von der Erst- bis zur EndkonsolidierungMöglichkeiten einer unmittelbar in S/4HANA erfolgenden ZwischenergebniseliminierungKapitalflussrechnung mit Referenzmöglichkeit auf die zugrunde liegende GuV- bzw. BilanzinformationMöglichkeiten und Grenzen des neuen Versionskonzeptes im Kontext von KonzernsimulationenDer Hersteller investiert nicht unerhebliche Ressourcen in den Ausbau der Komponente SAP S/4HANA for Group Reporting. Bereits ein kurzer Blick auf die Roadmap des Herstellers verdeutlicht die beeindruckende Änderungsdynamik. Unser Buchprojekt hat uns – vergleichbar einem Einführungsprojekt – diese Änderungsgeschwindigkeit stets vor Augen geführt. War eine Fragestellung im alten Release möglicherweise nur über einen Workaround umsetzbar, bringt ein neues Release neue Funktionalitäten. Sehr plastisch wird diese Frage am Beispiel der Zwischenergebniseliminierung, denn in dem von uns verwendeten Release 2020 war eine Umsetzung der Fragestellung nur über einen bedingt praxistauglichen Workaround möglich. Ein Blick in das Release 2021 zeigt eine deutliche und weitreichende, aber auch notwendige Produktweiterentwicklung. Bzgl. einer Projektorganisation ist diese Situation ausreichend zu würdigen und in Diskussionen sollte der Releasestand einer Information immer einbezogen werden.
Die Autoren würden sich freuen, wenn das vorliegende Werk eine Hilfe bei der Optimierung konsolidierter Berichtsprozesse durch Softwareeinsatz wird und den Austausch zu anwenderspezifischen Lösungen häufiger Praxisfragen fördert.
Unser Dank gilt der Abteilung Consulting der Ernst & Young GmbH, namentlich Maren Riecker, Marc Junker und Andreas Reiser. Durch ihre Unterstützung ist umfangreiches Wissen aus der praktischen Arbeit eingeflossen, um so einen tiefen Einblick in die Funktionalitäten und Interdependenzen vermitteln zu können. Wir danken dem Schäffer-Poeschel Verlag und insbesondere Frau Ruth Kuonath für den reibungslosen Ablauf der Drucklegung.
Saarbrücken, Stuttgart, Eschborn, Hannover im November 2021
Johannes WirthAndreas MuthOliver PrechtAnna WerbikJan Christian Mücke[XV]Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:Strukturierung des Nordstar-KonzernsAbbildung 2:Struktur der konsolidierten Rechnungslegung in S/4HANAAbbildung 3:Prozess der derivativen KonzernabschlusserstellungAbbildung 4:Berichtsanlässe in einem intern/extern harmonisierten KonsolidierungssystemAbbildung 5:Legale und Management-Strukturierung des Nordstar-KonzernsAbbildung 6:Konzept der MatrixkonsolidierungAbbildung 7:Matrixkonsolidierung in SAP GRAbbildung 8:Firmenwerttragende Cash-Generating Units unter Verwendung von SAP GR-bezogenen Profit-Centern – Teil 1Abbildung 9:Firmenwerttragende Cash-Generating Units unter Verwendung von SAP GR-bezogenen Profit-Centern – Teil 2Abbildung 10:Firmenwerttragende Cash-Generating Units unter Verwendung von SAP GR-bezogenen Profit-Centern – Teil 3Abbildung 11:AbschlusskalenderAbbildung 12:Nutzung des ›klassischen‹ Implementation Guide (IMG) zum Customizing in der Onpremise-VarianteAbbildung 13:SAP GR Desktop – Teil 1Abbildung 14:DatenmonitorAbbildung 15:SAP GR Desktop – Teil 2Abbildung 16:SAP GR Desktop – Teil 3Abbildung 17:Datenmonitor und StatusübersichtAbbildung 18:Übersicht der MaßnahmenprotokolleAbbildung 19:Customizing von Maßnahmen – Teil 1Abbildung 20:Customizing von Maßnahmen – Teil 2Abbildung 21:Customizing von Maßnahmengruppen – Teil 1Abbildung 22:Customizing von Maßnahmengruppen – Teil 2Abbildung 23:KonsolidierungsmonitorAbbildung 24:Globale ParameterAbbildung 25:Berichtsperioden im Kontext unterschiedlicher Berichtsanlässe.............................Abbildung 26:Customizing von Konsolidierungseinheiten – Teil 1Abbildung 27:Customizing von Konsolidierungseinheiten – Teil 2Abbildung 28:Customizing von KonsolidierungskreisenAbbildung 29:Scope- versus Hierarchiekonzept im Vergleich..........................................................Abbildung 30:Nordstar-KonsolidierungskreisAbbildung 31:Ableitung der Einbeziehungsart in der KonsolidierungskreishierarchieAbbildung 32:Konsolidierungskreis und unwesentliche Berichtseinheiten....................................Abbildung 33:Konsolidierungs-Profit-Center-Hierarchie..................................................................Abbildung 34:Customizing von Positionen – Teil 1[XVI]Abbildung 35:Customizing von Positionen – Teil 2Abbildung 36:Customizing von Positionen – Teil 3Abbildung 37:Customizing von Positionen – Teil 4Abbildung 38:Customizing von Positionen – Teil 5Abbildung 39:Sachkonten und Positionen – ein integrativer AnsatzAbbildung 40:Systemseitige Zuordnung von Sachkonten zu PositionenAbbildung 41:KontierungstypAbbildung 42:Verwendete Bewegungsarten im Bereich des langfristigen VermögensAbbildung 43:Voll- bzw. hilfsverspiegelte BilanzpositionenAbbildung 44:Verwendete Bewegungsarten im Bereich des EigenkapitalsAbbildung 45:Customizing von BewegungsartenAbbildung 46:Aufbau von PositionshierarchienAbbildung 47:Zeit- und versionsabhängige Parameter im Kontext des PositionsplansAbbildung 48:Grundaufbau des verwendeten PositionsplansAbbildung 49:Positionsstruktur im Bereich des EigenkapitalsAbbildung 50:KontierungsebenenAbbildung 51:Customizing von Belegarten – Teil 1Abbildung 52:Customizing von Belegarten – Teil 2Abbildung 53:Customizing der Belegart: automatischer BelegstornoAbbildung 54:Strukturierung des Konsolidierungsprozesses über BelegartenAbbildung 55:ErgebniseffektAbbildung 56:Ergebniseffekt – CustomizingAbbildung 57:Customizing der Belegart: latente SteuernAbbildung 58:Buchungspositionen für die Abbildung latenter SteuernAbbildung 59:Saldovortrag und SaldovortragsperiodeAbbildung 60:Saldovortrag von statistischen PositionenAbbildung 61:Customizing Saldovortrag – Teil 1Abbildung 62:Customizing Saldovortrag – Teil 2Abbildung 63:Schematische Darstellung einer regelbasierten KonsolidierungAbbildung 64:Umgliederungsmethode – Teil 1Abbildung 65:Umgliederungsmethode – Teil 2Abbildung 66:Regelbasierter Ansatz mit sich saldierenden Effekten auf einer VerrechnungspositionAbbildung 67:Umgliederungsmethode – Teil 3Abbildung 68:Selektion für UmgliederungAbbildung 69:Schematischer Zusammenhang zwischen Methoden, Selektionen und AttributenAbbildung 70:Selektion für Umgliederung – Festlegung des OperatorsAbbildung 71:Umgliederungsmethode – Teil 4Abbildung 72:UmgliederungsmaßnahmeAbbildung 73:Umgliederung zur Hilfsverspiegelung von Positionen – Teil 1Abbildung 74:Umgliederung zur Hilfsverspiegelung von Positionen – Teil 2[XVII]Abbildung 75:Umgliederung zur Hilfsverspiegelung von Positionen – Teil 3Abbildung 76:Umgliederung zur Hilfsverspiegelung von Positionen – Teil 4Abbildung 77:Customizing der Konsolidierungseinheit: Datentransfermethode für S/4HANA-integrierte EinheitenAbbildung 78:Maßnahme Freigabe universelle BelegeAbbildung 79:Maßnahme Validierung universeller BelegAbbildung 80:Customizing der Konsolidierungseinheit: Datentransfermethode für nicht-integrierte EinheitenAbbildung 81:Aufbau einer UploadmethodeAbbildung 82:Starten der Datentransfermethode über den DatenmonitorAbbildung 83:Meldedaten der CU2200 – Novellia für die Periode 09/2020Abbildung 84:Systemprotokoll zur DatenübernahmeAbbildung 85:SAP Group Reporting Data Collection – Teil 1Abbildung 86:SAP Group Reporting Data Collection – Teil 2Abbildung 87:SAP Group Reporting Data Collection – Teil 3Abbildung 88:Übersicht zu den (aktuell) vorhandenen Vorgängen der vorgangsbasierten KapitalkonsolidierungAbbildung 89:Substitution als Möglichkeit einer automatischen VorgangserkennungAbbildung 90:Unmittelbare Erfassung von kapitalkonsolidierungsrelevanten Steuerungsinformationen in den MeldedatenAbbildung 91:Erfassung von kapitalkonsolidierungsrelevanten Steuerungsinformationen über eine eigene Belegart 0BAbbildung 92:Maßnahme für manuelle Buchungen und zugeordnete BelegartenAbbildung 93:Customizing einer Belegart für manuelle Buchungen (Belegart 11)Abbildung 94:Erstellung einer manuellen BuchungAbbildung 95:Upload von extern vorbereiteten manuellen BuchungenAbbildung 96:Upload von zusätzlichen Dokumenten bei der Erfassung manueller BelegeAbbildung 97:Neubewertungsbilanz der CU2000 – Tyconia zum 30.09.2020Abbildung 98:Umsetzungskonzepte zur Verwaltung stiller Reserven/LastenAbbildung 99:Stille Reserven der CU2000 – Tyconia im ÜberblickAbbildung 100:Buchungsbeleg zur Zugangsbilanzierung von Patent 4711 (01.07.2020)Abbildung 101:Buchungsbeleg zur Folgebilanzierung von Patent 4711 (30.09.2020)Abbildung 102:Manuelle Datenerfassung von AnhanginformationenAbbildung 103:Einblick in die verwendete Matching-Methode ZN500Abbildung 104:Matching-Methode Z500 – zugeordnete Matching-RegelnAbbildung 105:Konzeptioneller Zusammenhang zwischen Matching-Methoden und Matching-RegelnAbbildung 106:Customizing einer Matching-Regel – Teil 1Abbildung 107:Customizing einer Matching-Regel – Teil 2Abbildung 108:IC-Matchinglauf und IC-Matching-ErgebnisseAbbildung 109:Customizing eines Abstimmungsfalls – Übersicht der AnzeigegruppenAbbildung 110:Abstimmungsfall – Auswahl einer Anzeigegruppe im Abstimmungsprozess[XVIII]Abbildung 111:Abstimmungsfall – Darstellung einer Anzeigegruppe (Customizing)Abbildung 112:Übersicht zum AbstimmstatusAbbildung 113:Abstimmstatus zur übergeordneten AnzeigegruppeAbbildung 114:Analyse von AbstimmsaldenAbbildung 115:IC-Abstimmung im Bereich der GuV – in KonzernwährungAbbildung 116:IC-Abstimmung im Bereich der GuV – in TransaktionswährungAbbildung 117:Statusverwaltung über den Arbeitsschritt Abstimmungsabschluss verwaltenAbbildung 118:Beispielsachverhalt zur IC-Abstimmung einer Schuldbeziehung in Fremdwährung (Fall 1)Abbildung 119:Beispielsachverhalt zur IC-Abstimmung einer Schuldbeziehung in Fremdwährung (Fall 2)Abbildung 120:IC-Abstimmung und die Verwendung von gesonderten WertberichtigungspositionenAbbildung 121:Modifizierte StichtagskursmethodeAbbildung 122:Uploadfunktionalität für WechselkursrelationenAbbildung 123:Manuelle Erfassung von WechselkursrelationenAbbildung 124:Schematischer Zusammenhang zwischen Methoden, Selektionen und Attributen im Bereich der WährungsumrechnungAbbildung 125:Methodenschritte der WährungsumrechnungsmethodeAbbildung 126:Währungsumrechnungsmethode: Umrechnung von Änderungen von Vermögenswerten außerhalb des AnfangsbestandsAbbildung 127:Für Methodenschritt 011 relevante BewegungsartenAbbildung 128:Währungsumrechnungsmethode: Umrechnung des Anfangsbestands von VermögenswertenAbbildung 129:Varianten der Umrechnung der GuVAbbildung 130:Währungsumrechnungsmethode: Umrechnung der GuVAbbildung 131:Umrechnung des Eigenkapitals mit historischen KursenAbbildung 132:Währungsumrechnungsmethode: historische Umrechnung des EigenkapitalsAbbildung 133:Stille Reserven und WährungsumrechnungAbbildung 134:Unterjähriger Erwerb eines Tochterunternehmens und notwendige Anpassungen an die KonzernsichtAbbildung 135:Währungsumrechnung und unterjähriger ErwerbAbbildung 136:Währungsumrechnungsmethode: Umrechnung von neu erworbenen TochterunternehmenAbbildung 137:Währungsumrechnungsmethode: RundungsschritteAbbildung 138:Rundungsschritte und SelektionenAbbildung 139:Protokoll der Währungsumrechnung – Anlistung von ausgewählten Positionen der AktivseiteAbbildung 140:Protokoll der Währungsumrechnung – Anlistung der EigenkapitalpositionenAbbildung 141:Protokoll der Währungsumrechnung – Anlistung der WährungsumrechnungsdifferenzenAbbildung 142:Customizing von Validierungsregeln[XIX]Abbildung 143:Validierungsregel zum Abgleich des Jahresüberschusses – Teil 1Abbildung 144:Validierungsregel zum Abgleich des Jahresüberschusses – Teil 2Abbildung 145:Parametrisierung eines Alias im Rahmen einer ValidierungsregelAbbildung 146:Verlinkung auf Kontierungsrichtlinie im Kontext einer ValidierungsregelAbbildung 147:Aggregiertes Protokoll der ValidierungAbbildung 148:Detailprotokoll der ValidierungAbbildung 149:ValidierungsergebnisanalyseAbbildung 150:Betriebswirtschaftliche Anwendungsbereiche der Maßnahme Änderung KonsolidierungskreisAbbildung 151:Kreisabhängige Zuordnung der Erwerbs- und AbgangszeitpunkteAbbildung 152:Customizing der Maßnahme Änderung KonsolidierungskreisAbbildung 153:Anpassung der Bewegungsarten an die Konzernsicht durch die Maßnahme Änderung KonsolidierungskreisAbbildung 154:Automatischer Belegstorno – interperiodische ZusammenhängeAbbildung 155:Customizing der Belegart 2G: automatischer BelegstornoAbbildung 156:Konzeptioneller Zusammenhang zwischen Abstimmungsfall und EliminierungsmethodenAbbildung 157:Customizing einer EliminierungsmethodeAbbildung 158:Customizing einer Eliminierungsmethode – Differenzierung nach AnzeigegruppenAbbildung 159:Customizing einer BuchungsregelAbbildung 160:Konzept der BilanzausgleichspositionAbbildung 161:Maßnahme für eine ICMA-basierte EliminierungsmethodeAbbildung 162:Belegart für eine ICMA-basierte EliminierungsmethodeAbbildung 163:Beispielsachverhalt zur IC-Abstimmung einer Schuldbeziehung in Fremdwährung (Net-Investment-Sachverhalt)Abbildung 164:Beispielsachverhalt zur Innenumsatzeliminierung (Periode 9/2020)Abbildung 165:Innenumsatzeliminierung nach dem Gesamtkostenverfahren (GKV)Abbildung 166:Innenumsatzeliminierung nach dem Umsatzkostenverfahren (UKV)Abbildung 167:Innenumsatzeliminierung im System für Periode 9/2020Abbildung 168:Datenbankanlistung zur Innenumsatzeliminierung für die Periode 9/2020Abbildung 169:Innenumsatzeliminierung im System für die Periode 12/2020Abbildung 170:IC-Abstimmung im Kontext der Beteiligungsertragseliminierung für die Periode 9/2020Abbildung 171:SAP ICMA basierte IC-Abstimmung im Zusammenhang mit der DividendenausschüttungAbbildung 172:Datenbankanlistung für die BeteiligungsertragseliminierungAbbildung 173:IC-Abstimmung zur sonstigen Aufwands- und Ertragseliminierung (Periode 9/2020)Abbildung 174:SAP ICMA basierte IC-Abstimmung im Zusammenhang mit der sonstigen Aufwands- und Ertragseliminierung[XX]Abbildung 175:Datenbankanlistung zur sonstigen Aufwands- und Ertragseliminierung in Periode 9/2020Abbildung 176:Anwendungsbereiche der ZwischenergebniseliminierungAbbildung 177:Verfahren der Zwischenergebniseliminierung im VorratsvermögenAbbildung 178:Beteiligung konzernfremder Gesellschafter an erfolgswirksamen Konsolidierungseffekten der ZwischenergebniseliminierungAbbildung 179:Zwischenergebniseliminierung der Lieferbeziehung Tyconia/Nordstar per 30.09.2020Abbildung 180:Zwischenergebniseliminierung der Lieferbeziehung Tyconia/Nordstar per 31.12.2020Abbildung 181:Innenumsatz- und Zwischenergebniseliminierung für die Lieferbeziehung Tyconia/Nordstar per 31.12.2020Abbildung 182:Zwischenergebniseliminierung der Lieferbeziehung Tyconia/Nordstar per 31.03.2021Abbildung 183:Zwischenergebniseliminierung und LieferkettenAbbildung 184:Bestandsdaten für die Zwischenergebniseliminierung (Periode 9/2020)Abbildung 185:Gewinnzuschlagssätze für die Zwischenergebniseliminierung (Periode 9/2020)Abbildung 186:Buchungen im Buchungstemplate per 30.09.2020Abbildung 187:Customizing der Belegart für die Zwischenergebniseliminierung – Teil 1Abbildung 188:Customizing der Belegart für die Zwischenergebniseliminierung – Teil 2Abbildung 189:Buchungsprotokoll zur Zwischenergebniseliminierung (Periode 9/2020)Abbildung 190:Customizing der Umgliederungsmethode – Methodenschritte pro LieferbeziehungAbbildung 191:Customizing der Umgliederungsmethode – AuslöserAbbildung 192:Customizing der Umgliederungsmethode: ProzentsatzAbbildung 193:Customizing der Umgliederungsmethode – Von- bzw. Nach-KontierungAbbildung 194:Kapitalkonsolidierung in Abhängigkeit vom Zugang des TochterunternehmensAbbildung 195:Varianten der IFRS-Goodwill-BilanzierungAbbildung 196:Customizing der Kapitalkonsolidierung – ÜberblickAbbildung 197:Customizing der Kapitalkonsolidierung – Nutzung der KapitalkonsolidierungAbbildung 198:Customizing der Kapitalkonsolidierung – Globale EinstellungenAbbildung 199:Customizing der Kapitalkonsolidierung – goodwillbezogene BuchungspositionenAbbildung 200:Customizing der Kapitalkonsolidierung – goodwillbezogene Buchungspositionen (Gesamtüberblick)Abbildung 201:Customizing der Kapitalkonsolidierung – Buchungspositionen zur Erfassung eines negativen UnterschiedsbetragsAbbildung 202:Customizing der Kapitalkonsolidierung – statistische KapitalpositionenAbbildung 203:Customizing der Kapitalkonsolidierung – Buchungspositionen für konzernfremde Gesellschafter.[XXI]Abbildung 204:Customizing der Kapitalkonsolidierung – sonstige spezielle Positionen festlegen – Teil 1Abbildung 205:Customizing der Kapitalkonsolidierung – relevante Positionen bzgl. der Ergebnisanteile konzernfremder GesellschafterAbbildung 206:Konzepte zur Ermittlung des EndkonsolidierungserfolgsAbbildung 207:Customizing der Kapitalkonsolidierung – sonstige spezielle Positionen festlegen – Teil 2Abbildung 208:Selektion des kapitalkonsolidierungsrelevanten EigenkapitalsAbbildung 209:Customizing der Kapitalkonsolidierung – sonstige spezielle Positionen festlegen – Teil 3Abbildung 210:Customizing der Kapitalkonsolidierung – Methodendefinition – Teil 1Abbildung 211:Customizing der Kapitalkonsolidierung – Methodendefinition – Teil 2Abbildung 212:Customizing der Kapitalkonsolidierung – Reihenfolge der Abarbeitung von VorgängenAbbildung 213:Steuerungsdaten zur Kapitalkonsolidierung – manuelle VorgangsumsortierungAbbildung 214:Erstkonsolidierung der CU2000 – TyconiaAbbildung 215:Steuerungsdaten zur Kapitalkonsolidierung – Erstkonsolidierung (Beteiligungsinformationen)Abbildung 216:Steuerungsdaten zur Kapitalkonsolidierung – Erstkonsolidierung (Kapitalinformationen)Abbildung 217:Maßnahmenprotokoll zum Vorgang Erstkonsolidierung der CU2000 – Teil 1Abbildung 218:Maßnahmenprotokoll zum Vorgang Erstkonsolidierung der CU2000 – Teil 2Abbildung 219:Datenbankanlistung bzgl. der statistischen Kapitalpositionen aus der Erstkonsolidierung der CU2000Abbildung 220:Belegart für die manuelle Goodwill-Allokation auf Cash-Generating UnitsAbbildung 221:Goodwillverwaltung unter Beachtung der Anforderungen aus IAS 36Abbildung 222:Manuelle Buchung zur Allokation des Goodwill aus dem Erwerb der CU2000 in der Periode 9/2020Abbildung 223:Substitution als Möglichkeit einer automatischen VorgangserkennungAbbildung 224:Maßnahmenprotokoll zum Vorgang Folgekonsolidierung der CU2000 in der Periode 9/2020 – Teil 1Abbildung 225:Maßnahmenprotokoll zum Vorgang Folgekonsolidierung der CU2000 in der Periode 9/2020 – Teil 2Abbildung 226:Datenbankanlistung bzgl. der statistischen Buchungen im Kontext des Vorgangs Folgekonsolidierung der CU2000 in der Periode 9/2020Abbildung 227:Anteilsaufstockung bei der CU2000 – TyconiaAbbildung 228:Steuerungsdaten der Kapitalkonsolidierung – Vorgang sukzessiver ErwerbAbbildung 229:Maßnahmenprotokoll zum Vorgang sukzessiver Erwerb der CU2000 in der Periode 12/2020 – Teil 1Abbildung 230:Maßnahmenprotokoll zum Vorgang sukzessiver Erwerb der CU2000 in der Periode 12/2020 – Teil 2[XXII]Abbildung 231:Statistische Positionen zum Eigenkapital und Goodwill und deren Änderung durch den Vorgang sukzessiver ErwerbAbbildung 232:Datenbankanlistung: Veränderung der statistischen Kapitalpositionen durch den Vorgang sukzessiver ErwerbAbbildung 233:Maßnahmenprotokoll zum Vorgang Folgekonsolidierung der CU2000 in der Periode 12/2020Abbildung 234:Verkaufsvorgang aus Konzernsicht (Endkonsolidierung)Abbildung 235:Behandlung eines Goodwill in der Endkonsolidierung gemäß IAS 36.86Abbildung 236:Betriebswirtschaftliche Durchführung der Endkonsolidierung.Abbildung 237:Ermittlung des Endkonsolidierungserfolgs ausgehend vom Erfolg aus Sicht des EinzelabschlussesAbbildung 238:Systemgestützte Durchführung einer EndkonsolidierungAbbildung 239:Endkonsolidierung der Tyconia – Festsetzung der Periode der EndkonsolidierungAbbildung 240:Maßnahme Änderung Konsolidierungskreis bei der Abgangsverarbeitung der CU2000 (Kontierungsebene 00, Space)Abbildung 241:Endkonsolidierung und erwirtschaftetes EigenkapitalAbbildung 242:Sonderlogik bei der Ausbuchung von erwirtschaftetem EigenkapitalAbbildung 243:Maßnahme Änderung Konsolidierungskreis bei der Abgangsverarbeitung der CU2000 (Kontierungsebene 10, Belegart 1Z)Abbildung 244:Maßnahme Änderung Konsolidierungskreis bei der Abgangsverarbeitung der CU2000 (Kontierungsebene 20)Abbildung 245:Maßnahmenprotokoll zum Vorgang Vollabgang der CU2000 in der Periode 03/2021Abbildung 246:Maßnahmenprotokoll zum Vorgang Vollabgang der CU2000 (Ausgangssituation)Abbildung 247:Manuelle Buchung zur Anpassung der Statistik im Kontext der EndkonsolidierungAbbildung 248:Maßnahmenprotokoll zum Vorgang Vollabgang der CU2000 (angepasste Verarbeitung)Abbildung 249:Betragsmäßige Ermittlung des Endkonsolidierungserfolgs und notwendige Korrekturen im Kontext der OCI-BehandlungAbbildung 250:Fortgeschriebene Neubewertungsbilanz der CU2200 – Novellia (30.09.2020)Abbildung 251:Goodwillermittlung und Systematik der währungsbedingten FortschreibungAbbildung 252:Kapitalkonsolidierung der CU2200 – NovelliaAbbildung 253:Maßnahmenprotokoll zum Vorgang Erstkonsolidierung der CU2200 – NovelliaAbbildung 254:Manuelle Buchung zur Alloaktion des Goodwill der CU2200 auf eine Cash-Generating UnitAbbildung 255:Währungsumrechnungsmethode: goodwillbezogene UmrechnungAbbildung 256:Datenbankanlistung: währungsbedingte Fortschreibung des Goodwill der CU2200 in der Periode 9/2020Abbildung 257:Technik der Equity-Methode im Überblick[XXIII]Abbildung 258:Elemente der at Equity-FortschreibungAbbildung 259:Customizing der Equity-Methode – MeldeumfängeAbbildung 260:Customizing der Equity-Methode – MeldepositionenAbbildung 261:Customizing der Equity-Methode – Buchungspositionen – Teil 1Abbildung 262:Customizing der Equity-Methode – Buchungspositionen – Teil 2Abbildung 263:Customizing der Equity-Methode – Buchungspositionen – Teil 3Abbildung 264:Customizing der Equity-Methode – Methodendefinition – Teil 1Abbildung 265:Equity-Methode im mehrstufigen KonzernAbbildung 266:Customizing der Equity-Methode – Methodendefinition – Teil 2Abbildung 267:Stille Reserven der CU3000 – Equaton zum 01.10.2020Abbildung 268:Maßnahmenprotokoll zum Vorgang Erstkonsolidierung der CU3000 in der Periode 12/2020Abbildung 269:Fortschreibung der CU3000 – Equaton nach der Equity-Methode auf den 31.12.2020Abbildung 270:Maßnahmenprotokoll zum Vorgang Folgekonsolidierung der CU3000 in der Periode 12/2020Abbildung 271:Datenbankanlistung zur StatistikAbbildung 272:Manuelle Buchung zur Beteiligungsfortschreibung in Höhe der anteiligen OCI-Bewegungen (Buchung auf der Y100/CU1000)Abbildung 273:Ermittlung und Darstellung der KapitalflussrechnungAbbildung 274:Kapitalflussrechnung und die Gliederung nach dem AktivitätsformatAbbildung 275:Customizing von MeldepositionenAbbildung 276:Customizing von Positionen: Zuordnung Attribut Cash Flow SelektionAbbildung 277:Customizing einer MelderegelAbbildung 278:Meldepositionenshierachie für die KapitalflussrechnungAbbildung 279:Zusammenhang zwischen Meldepositionen, Melderegeln und MeldepositionshierarchienAbbildung 280:Cash Flow aus der laufenden GeschäftstätigkeitAbbildung 281:Cash Flow aus der InvestitionstätigkeitAbbildung 282:Cash Flow aus der FinanzierungstätigkeitAbbildung 283:Festlegung der Datenherkunft bei der Definition einer VersionAbbildung 284:Übersicht VersionstypenAbbildung 285:Protokollübersicht bei der Ausführung der KapitalkonsolidierungAbbildung 286:Berichterstattung in einer parallelen KonzernwährungAbbildung 287:Customizing Version – Änderung von BeteiligungsstukturenAbbildung 288:Arbeitsschritt Bewegungsdaten kopierenAbbildung 289:Granularität des PositionsplansAbbildung 290:Varianten der softwareseitigen Unterstützung der operativen Unternehmensplanung und die Übernahme der Plandaten in SAP GR[XXV]Abkürzungsverzeichnis
AKAnschaffungskostenAPIApplication Programming InterfaceBWBusiness Information WarehouseBWABewegungsart(en)CDSCore Data ServicesCGUCash Generating Unit (Zahlungsmittelgenerierende Einheit)csvStructured Query Language (Datenbanksprache)DKDurchschnittskursEAVErgebnisabführungsvertragEE-SteuersätzeSteuersatz vom Einkommen und ErtragETLExtract, Transform, LoadERPEnterprise-Resource-Planning (Unternehmensressourcenplanung)EUEuropäische UnionFAITFachausschuss für Informationstechnologie (FAIT) des IDWFWFunktionale WährungGKVGesamtkostenverfahrenGRSAP® S/4HANA for Group ReportingGuVGewinn- und Verlustrechnung als Teil der Gesamtergebnisrechnungh. M.herrschende MeinungHB-IIHandelsbilanz II als nach konzerneinheitlichen Grundsätzen bewertete und gegliederte BilanzHB-IIIHandelsbilanz III als zusätzlich zur HB II um die aus der Neubewertung stammenden fortgeschriebenen stillen Reserven und Lasten ergänzte BilanzHGBHandelsgesetzbuchIASInternational Accounting Standard (Internationaler Rechnungslegungsstandard – Bezeichnung bis 2003)IASBInternational Accounting Standard BoardICIntercompanyICMASAP® Intercompany-Matching und -AbstimmungICMRSAP® Intercompany Matching and ReconciliationIDWInstitut der WirtschaftsprüferIFRSInternational Financial Reporting Standard (Internationaler Rechnungslegungsstandard – Bezeichnung seit 2003)i. H. v.in Höhe vonIPIntegrated PlanningIMGImplementation Guidei. S. d.Im Sinne des/derKiFoVerbrauchsfolgeverfahren: Konzern in – First outKWKonzernwährungMKMittelkursMSMicrosoft®M&AMergers and AcquisitionsNCINon-controlling Interest (Anteile nichtkontrollierender Gesellschafter)[XXVI]OCIOther Comprehensive Income (Übrige direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen)PPAKaufpreisallokation (Purchase Price Allocation)PDFPortable Document FormatPGProduktgruppe (Zwischenergebniseliminierung)PoCPercentage of Percentage (Teilgewinn-Realisierung)SACSAP® Analytics CloudSKSchlusskursSKVJSchlusskurs VorjahrSQLStructured Query Language (Datenbanksprache)TWTransaktionswährungUKVUmsatzkostenverfahrenWURWährungsumrechnungZMGEzahlungsmittelgenerierende Einheit (Cash Generating Unit)[1]1Fallstudie und grundlegende Anmerkungen
Das vorliegende Buch bezieht sich primär auf die Darstellung der Systemfunktionalitäten aus dem Bereich der intern/extern harmonisierten konsolidierten Rechnungslegung. Die Möglichkeiten der integrierten Planung werden kurz am Ende des Buches in einem gesonderten Kapitel vorgestellt.
In einem ersten Schwerpunkt werden konzeptionelle Grundlagen hinsichtlich der Arbeit mit SAP® S/4HANA for Group Reporting (im Folgenden kurz: SAP GR), aber auch zentrale Elemente des Customizing erläutert. Der zweite Schwerpunkt umfasst die schrittweise Darstellung des Konsolidierungsprozesses. Auf der Grundlage einer Fallstudie wird der gesamte Konsolidierungsprozess von der Datenübernahme bis hin zur Kapitalkonsolidierung vorgestellt. Ferner werden die systemgestützte Anwendung der Equity-Methode und Erstellung einer Kapitalflussrechnung beleuchtet. Es ist hervorzuheben, dass das vorliegende Buch nicht den Charakter eines Customizing-Leitfadens bzw. eines Lehrbuchs trägt. Es werden vielmehr nur die Systemfunktionalitäten bzw. betriebswirtschaftlichen Hintergründe beleuchtet, die für die Umsetzung des konkreten Beispielsachverhalts in der betrachteten Softwarelösung erforderlich sind.
Abbildung 1: Strukturierung des Nordstar-Konzerns
Wir verwenden für die Darstellung der Systemfunktionalitäten die in Abbildung 1 dargestellte Konzernstruktur. Zur Darstellung der interperiodischen Zusammenhänge wird sich ferner der Beispielsachverhalt über einen Zeitraum von drei Quartalen erstrecken. Hierzu beginnen wir im dritten Quartal 2020, um auch Fragen des Saldovortrags in die Betrachtung einzubeziehen. Folgende Eckpfeiler der Fallstudie sind hervorzuheben:
Für den Nordstar-Konzern wird ein IFRS-Konzernabschluss in der Währung Euro (EUR) erstellt.Für Zwecke der Darstellung der unterjährigen Berichterstattung verwenden wir die Periodizität Quartal.Ein großer Teil der Erläuterungen erfolgt auf der Grundlage der Mutter-Tochter-Beziehung zwischen der (Konzern-)Mutter Nordstar und der inländischen Tochtergesellschaft Tyconia. Die Tyconia ist eine 80 %ige Beteiligung der Nordstar. Die Beteiligung wurde am 01.07.2020 [2]erworben und es wird unterstellt, dass auch seit diesem Zeitpunkt die Beherrschungsmöglichkeit der Nordstar i. S. v. IFRS 10 besteht.»Traditionell« trägt die Nordstar die Gesellschaftsnummer CU1000. In unserem aktuellen Buch ist die Einheit eine S/4HANA-integrierte Gesellschaft. Buchungskreise können dort nur mit vierstelligen Kodierungen definiert werden. Vor diesem Hintergrund wird die Nordstar in Bildschirmabgriffen und den damit einhergehenden Erläuterungen die Gesellschaftsnummer Y100 tragen.Das inländische Tochterunternehmen CU2000 – Tyconia ist eine nicht integrierte Gesellschaft und wir laden die Meldedaten über das Datentransferverfahren flexibler Upload in das System.Anhand der Gesellschaft CU2200 – Novellia verdeutlichen wir Ihnen ausgewählte Einzelfragen der Einbeziehung von nicht in der Berichtswährung geführten Tochterunternehmen. Die Novellia wurde ebenfalls am 01.07.2020 gekauft und die Nordstar hält unmittelbar eine Beteiligung i. H. v. 80 %. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Großbritannien und die Meldedaten werden in der funktionalen Währung britisches Pfund (GBP) geliefert.Die CU3000 – Equaton ist die Basis für die Erläuterung der maschinell unterstützten Equity-Methode. Die Equaton wird als assoziiertes Unternehmen eingestuft und die Nordstar hält unmittelbar eine Beteiligung i. H. v. 30 %.Im Hinblick auf beteiligungsverändernde Maßnahmen ist des Weiteren eine Anteilsaufstockung der Nordstar an der Tyconia zu Beginn des vierten Quartals 2020 (01.10.2020) hervorhebenswert. Hierdurch werden die bestehenden nicht-kontrollierenden Gesellschafter ausgekauft und der Konzern hält fortan eine 100 %ige Beteiligung. Mit Ende des ersten Quartals 2021 wird zusätzlich die Tyconia endkonsolidiert.Ferner gelten folgende weitere betriebswirtschaftliche Prämissen:
Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.Wir gehen davon aus, dass aufgrund einer Konzernrichtlinie die Geschäftsvorfälle aus Sicht des den Konzernabschluss aufstellenden Mutterunternehmens bilanziert wurden und somit keine Anpassungsbuchungen im Konsolidierungsprozess erforderlich sind.Der von der Muttergesellschaft gehaltene Beteiligungsbuchwert an der jeweiligen Tochtergesellschaft wird at cost geführt.Alle Konsolidierungseinheiten mit Ausnahme der CU2200 werden in der Währung EUR geführt.Systemseitige Zusatzinformationen:
Die Ausführungen basieren auf der Onpremise-Variante der Software und hier auf dem S/4HANA-Release 2020.SAP GR ist ein Kernbestandteil von S/4HANA und wir gehen auch auf die SAP-Integration ein. Vor diesem Hintergrund haben wir die Muttergesellschaft Nordstar als S4/HANA-integrierte Gesellschaft ausgestaltet.Die anderen Gesellschaften sind nicht-integrierte Gesellschaften und die Meldedaten werden über einen flexiblen Upload importiert.Zentral für die Arbeit mit der Software ist der SAP Fiori Launchpad. Die dort vorzufindenden Kacheln bezeichnet der Hersteller als Apps bzw. SAP Fiori-App; wir verwenden hierfür den Begriff Arbeitsbereich.[3]2Eckpunkte der Abschlusserstellung mit SAP® GR
2.1Schaffung eines Konzerninformationssystems
Das Thema Konzernrechnungslegung und Konzernkonsolidierung ist seit geraumer Zeit ein Arbeitsbereich, der sich nicht mehr allein auf die reine Pflichterfüllung im Bereich der externen Rechnungslegung bezieht. Nicht zuletzt um die typischerweise von der Unternehmensführung gewünschte einheitliche »Finanzwesensprache« zu sprechen, wendet sich auch die interne Steuerungsrechnung – das (Group-)Controlling – Konzepten zu, die sich stärker am Zahlenwerk des externen Rechnungswesens ausrichten und in den Berichtsprozessen einheitlich bis auf Gesamtkonzernebene durchstrukturiert sind. Demzufolge gewinnt auch hier der Gedanke der Konzernkonsolidierung an Bedeutung. Beispielhaft sei an dieser Stelle an einen mehrstufigen Produktionsprozess erinnert, der sich über mehrere Tochterunternehmen und Segmente erstreckt. Aus dem Blickwinkel des Controllings liegt der Fokus auf der Ermittlung der effektiven Herstellungskosten, die unter anderem eine Bereinigung der entlang der (konzerninternen) Wertschöpfungskette bestehenden Gewinnaufschläge beinhaltet. Diese Fragestellung ist auch im Kontext der Konzernrechnungslegung von zentraler Bedeutung und Gegenstand der Zwischenergebniseliminierung. Sprechen die beiden Teildisziplinen die gleiche »Finanzwesensprache«, so wird augenscheinlich, dass ein integriertes Miteinander die Leistungsfähigkeit der Rechnungswesenressourcen, aber auch die Datenqualität deutlich erhöht, während sich gleichzeitig der Aufwand der Organisation nicht unwesentlich verringert. Gerade im IFRS-Umfeld wird diese Verzahnung der beiden (Teil-)Disziplinen des Rechnungswesens explizit gefordert. Entsprechend dem Management-Approach der IFRS-Rechnungslegung, der seinen Niederschlag in IAS 36 (Impairment) und IFRS 8 (Segmentberichterstattung) findet, ist das Zahlenwerk der internen Steuerung – in den gesetzten Grenzen – auch Gegenstand der externen Berichterstattung und muss zudem konsistent in beide Richtungen überleitbar sein.
Eine effiziente Unternehmenssteuerung richtet zudem nicht nur einen fundierten Blick auf das »Ist«, sondern benötigt auch eine vorausschauende Unternehmensplanung. Schreibt die Planung die zu erreichenden Ziele fest, ist in einem zweiten Schritt ein sinnvoller Soll-Ist-Vergleich unerlässlich. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor hierfür ist, dass auch im Bereich der Budget- und Mittelfristplanung die gleiche »Finanzwesensprache« gesprochen und die gleiche Gliederungsstruktur verwendet wird.
Eine gemeinsame »Finanzwesensprache« spiegelt nicht nur die Verwendung der gleichen Rechnungslegungsgrundsätze, wie die der IFRS- oder der deutschen HGB-Normen, wider. Vielmehr geht es auch um die Schaffung eines einheitlichen Datenmodells und Datenbestands. Nur so sind die einzelnen Teildisziplinen des integrierten Rechnungswesens miteinander sinnvoll verzahnt und ermöglichen eine Kommunikation auf Basis des gleichen Wert- und Mengengerüsts.
[4]Korrespondierend mit den sich wandelnden betriebswirtschaftlichen Anforderungen ändern sich auch die Anforderungen an eine Softwareunterstützung. Aus dem Blickwinkel des Konzernberichtswesens wird nicht mehr nur ein Werkzeug benötigt, welches den Prozess der externen Konzernrechnungslegung zuverlässig unterstützt. Vielmehr wird ein Werkzeug benötigt, welches darüber hinaus die konsolidierte Managementberichterstattung, einen konsolidierten Planungsprozess sowie Konzernsimulationen integriert abbildet und unterstützt.
Des Weiteren ist Konzernrechnungslegung keine eigenständige Disziplin, sondern basiert auf den operativen Geschäftsvorfällen der in den Konsolidierungskreis eingehenden Unternehmen. Folglich ist es wünschenswert, dass die Rechenwerke möglichst einfach ineinander übergeleitet und analysiert werden können. Sinnvollerweise geschieht dies mittels einer einheitlichen Systemplattform, wobei gerade in Konzernen mit heterogenen Geschäftsfeldern die Möglichkeit bestehen muss, dass die spezifischen Besonderheiten der einzelnen Bereiche ausreichend berücksichtigt werden können.
S/4HANA unterstützt genau einen solchen integrativen Ansatz, der im Folgenden dargestellt wird. Im weiteren Fortgang dieses Kapitels werden ferner einige Eckpunkte erläutert, die ein intern/extern harmonisiertes Rechnungswesen kennzeichnen. Dies sind zugleich wichtige Fragestellungen, die im Vorfeld einer Systemimplementierung zu erörtern sind.
2.2Integratives Konzept der Softwarelösung
Das Konzernrechnungswesen benötigt eine konzernweite Datenplattform, um seine Aufgaben zu erfüllen. In Abhängigkeit vom jeweiligen Konzern bestehen hierbei deutliche Unterschiede im Automatisierungsgrad der Datenanlieferung, welcher von manueller Erfassung, über halbautomatische Anlieferung mittels sog. Upload-Dateien, bis hin zur vollautomatischen Übernahme reicht. In der ›klassischen‹ Prozesswelt erfolgen Datenanlieferungen regelmäßig auf Basis von Extraktions-Transfer-Ladeprozessen (kurz: ETL-Prozessen). Wie noch zu zeigen ist, liegt hier eine weitreichende Innovation von S/4HANA.
Die Schaffung einer leistungsfähigen, konzernweiten Datenplattform hängt des Weiteren von der verwendeten Datenbanktechnologie und der Frage ab, ob auf dieser neben den Themen der Rechnungslegung auch andere Berichtsanforderungen umgesetzt werden sollen. Dreh- und Angelpunkt war/ist hierfür die Business Warehouse-Technologie, die seit Anfang dieses Jahrtausends verwendet wird. Mit einem Business Warehouse wird eine konzernweite Zusammenführung aller relevanten Daten in einer Datenbank realisiert, wobei die Daten über leistungsfähige ETL-Werkzeuge auch aus heterogenen Systemen repliziert und auf Basis einheitlicher Datenstrukturen in das Business Warehouse geladen werden (können). Auf der Grundlage des Business Warehouse erfolgt die Konzernrechnungslegung, aber auch andere gruppenweite Berichtsanforderungen können auf dieser Plattform realisiert werden. Die Konsolidierungslösung SAP BCS der SAP SE folgt insbesondere diesem Konzept.
[5]Stand in vielen Konzernen über die Jahre ein Business Warehouse im Mittelpunkt eines konzernweiten Berichtswesens, könnte es in den nächsten Jahren mit dem neuen Produkt ›S/4HANA‹ der SAP SE zu einem Paradigmenwechsel kommen. Aufbauend auf der rasanten Entwicklung im Bereich der Rechnerleistung und der Speicherhaltung ist es möglich geworden, ein konzernweit einheitliches ERP-System aufzubauen, welches im Arbeitsspeicher verarbeitet wird und mit seiner innovativen Datenablagekonzeption enorme Analyse- und Auswertungschancen mit sich bringt. Durch die in Echtzeit und in hoher Detaillierung vorhandenen Informationen des Finanz- und Rechnungswesens erweitert sich der Fokus von einer rein retrospektiven Datenverarbeitung hin zu entscheidungsunterstützenden und prognoseorientierten Prozessen.
So verwendet der Softwarehersteller mit SAP HANA (High-Performance Analytic Appliance) eine Datenbanktechnologie, die u. a. durch die Datenhaltung im Arbeitsspeicher (In-Memory-Technologie), aber auch durch den Verzicht von vordefinierten und hoch aggregierten Indizes/Aggregaten gekennzeichnet ist. Isoliert gesehen ist SAP HANA zunächst eine reine Datenhaltungskomponente; der Kern der Innovation liegt darin, dass diese gleichzeitig den Unterbau des neuen SAP ERP-Systems bildet. Mit dieser Produktneuentwicklung wird gerade im Bereich des Accounting und Controlling die Businesslogik optimiert, was sich auch deutlich auf das Datenmodell auswirkt. In diesem Zusammenhang wurde eine Vielzahl von im System vorhandenen Datenhaltungstabellen durch eine zentrale Tabellenfamilie, dem Universal Journal, abgelöst. Mit dem Universal Journal werden bisher notwendigerweise verteilt und redundant abgelegte Daten aus dem Hauptbuch, der Anlagenbuchhaltung, dem Controlling, der Ergebnisrechnung und dem Konsolidierungsvorbereitungsledger in einem Einkreissystem vereint. Eine große Zahl von (modulspezifischen) Einzelposten- und Summentabellen wurde abgeschafft.
Für jeden accounting-relevanten Geschäftsvorfall wird ein integrierter Buchungsbeleg angelegt, der alle vorhandenen Detailinformationen, insbesondere auch aus dem Controlling, beinhaltet. Kerntabelle der universellen Belegtabellen-Familie (Universal Journal) ist die ACDOCA (Accounting Documents Actuals). In dieser Tabelle werden einzelpostengenau alle Geschäftsvorfälle gespeichert, die von im S/4HANA-System-integrierten Tochterunternehmen erfasst werden. Welche umfangreichen Informationen für einen Geschäftsvorfall zusammengetragen werden, zeigt der Umfang der herstellerseitig ausgelieferten Tabelle mit ca. 350 Feldern, wobei auch anwenderseitige Erweiterungen möglich sind. Aus dem Blickwinkel von Accounting und Controlling wird durch die Form der Datenhaltung eine ›Single Source of Truth‹ geschaffen, welche die bislang notwendigen Abstimmmaßnahmen zwischen den beiden Teilbereichen des Rechnungswesens vermeidet. Zudem kann die Datenhaltung für eine Vielzahl neuer Analysemethoden genutzt werden. Bspw. wird so eine automatische Suche in diesen immensen Datenbeständen möglich, um unerwartete Muster und Zusammenhänge zu erkennen; interessante Auswertungen sind bspw. das Erkennen von Betrugsfällen (fraud detection) oder das Erkennen von Anomalien bei der umsatzsteuerlichen Erfassung von Geschäftsvorfällen.
Die SAP SE geht mit dem S/4HANA Finance for Group Reporting (im Folgenden kurz: SAP GR) einen (neuen) Weg und integriert die Konsolidierungskomponente in das S/4HANA-System (vgl. [6]Abb. 2). Folglich kann die Konsolidierung auf die transaktionalen Daten der Tabelle ACDOCA realtime zugreifen, um diese in einer Near-time-Variante in der Konsolidierung zu verwenden. Mit anderen Worten: Für einen Abschlussstichtag werden alle relevanten Abschlussinformationen von Konzernunternehmen auf der Granularität von Geschäftsvorfällen selektiert und – sofern erforderlich – in die Währungsumrechnung einbezogen. Aufgrund der neuen Datenhaltung müssen fortan auch für Zwecke der Währungsumrechnung Belege erzeugt werden, wobei diese – wie im Falle der Währungsumrechnungsdifferenz – nicht immer transaktionsgenau, sondern auch als Aggregat in SAP GR gebucht werden.
Mittels der in SAP GR vorhandenen programmierten und/oder regelbasierten Konsolidierungsroutinen erfolgt dann die Durchführung der Konsolidierungsmaßnahmen. Damit die Daten sowohl für die externe wie interne Rechnungslegung genutzt werden können, werden die Konsolidierungsbuchungen auch transaktionsgenau im Universal Journal abgelegt, jedoch in einer anderen Tabelle, der ACDOCU (vgl. Abb. 2), die strukturell der Tabelle ACDOCA entspricht, jedoch im Unterschied zur letztgenannten nur ca. 100 Felder enthält, die in Zusammenhang mit der Konsolidierung potenziell relevant sind. Das Datenmodell der ACDOCU kann ferner um eigene Felder erweitert werden, was insbesondere für branchenspezifische Berichtserfordernisse von Bedeutung ist. Beachtlich ist, dass die in Abbildung 2 vorgenommene Aufteilung der Gesellschaften in integrierte und nicht-integrierte Gesellschaften nur zu Demonstrationszwecken erfolgt; im eigentlichen Beispielsachverhalt ist nur die CU1000 – Nordstar eine S/4HANA-integrierte Gesellschaft.
Abbildung 2: Struktur der konsolidierten Rechnungslegung in S/4HANA
[7]SAP GR ist eine Lösung, um auch die konsolidierten Berichtsprozesse auf eine neue Basis zu stellen. Die volle Leistungsfähigkeit entfaltet die neue Architektur, wenn der gesamte Konzern in einem S/4HANA-System abgebildet wird. Technologisch kann dies dergestalt erfolgen, dass konzernweit effektiv nur noch ein einheitliches S/4HANA-System genutzt wird. In der Praxis wird dieses Konzept möglicherweise die finale Ausbaustufe einer IT-seitigen Transformation sein. Gerade in heterogenen Vorsystemlandschaften mit branchenspezifischen Besonderheiten, aber auch unter Berücksichtigung länderspezifischer Besonderheiten ist mit dem Central-Finance-Konzept ein weiterer Ansatz denkbar.
In einem Central-Finance-Konzept wird auch ein zentrales S/4HANA Finance-System betrieben, aber die bisherigen SAP- und Non-SAP-ERP-Systeme fungieren weiter als Datenlieferant, d. h. die dort erfassten Geschäftsvorfälle werden real-time in das zentrale S/4HANA Finance-System repliziert. So entsteht auch in dieser Systemumgebung in der universellen Beleg-Tabelle ACDOCA ein konzernweiter und vollumfassender ›Datensee‹.
Beachtlich ist der Hinweis, dass es stets möglich ist, andere Fremdsysteme, die nicht die Datengranularität einer ACDOCA verarbeiten können, auch auf einer aggregierten Summensatzebene in die konsolidierte Rechnungslegung mit einzubeziehen; die Datenspeicherung erfolgt in der ACDOCU. Eine Anwendungsmöglichkeit für diesen Importweg stellt neben den technischen Erwägungen die Einbeziehung von at Equity-konsolidierten und quotal einzubeziehenden Gemeinschaftsunternehmen dar.
2.3Der Prozess der konsolidierten Rechnungslegung im Überblick (Datenflusskonzept)
SAP GR ist eine Komponente, die der Konzernabschlusserstellung dient. Gemeint sind damit die aus legalem Blickwinkel zu erstellenden Abschlüsse, die konsolidierten Abschlüsse für Zwecke der Management-Ist-Berichterstattung, aber auch der Plankonsolidierung, wobei die Planung bzw. die Erfassung der Planwerte konzeptionell entweder über die SAP Analytics Cloud, über eine BW-basierte Methodik oder auf Basis eines Tabellenkalkulationsprogramms erfolgt. Darüber hinaus ist SAP GR ein wichtiges und hilfreiches Werkzeug, um Simulationen auf Gruppenebene durchzuführen. Dies umfasst einfache Simulationen von Währungsänderungen bis hin zu simulierten Änderungen der Unternehmensstruktur.
Das volle Integrationspotenzial kann insbesondere dann ausgeschöpft werden, wenn sowohl die Einzelabschlüsse aller in den Konzernabschluss einzubeziehenden Gesellschaften als auch der Konzernabschluss selbst in einem einzigen S/4HANA-System erstellt werden; nur dann stehen sämtliche Einzelabschlussinformationen ohne redundante Datenüberleitungen in der Konzernrechnungslegung zur Verfügung. Aus Blick der Konzernrechnungslegung bedeutet dies, dass man direkt lesend auf diese Informationen einzelpostengenau zugreifen und sie in bislang unbekannte Auswertungsmöglichkeiten einbeziehen kann. Dadurch, dass nicht-integ[8]rierte Unternehmen ihre Meldedaten sehr feingranular in die ACDOCU melden können, stehen aber auch in heterogenen Konzernen umfangreiche Datenbestände zur Verfügung.
Der Prozess der Erstellung konsolidierter Abschlüsse entspricht von der Grundstruktur dem bekannten Prozessbild einer derivativen Konzernabschlusserstellung (vgl. Abb. 3). Beim genaueren Hinsehen werden aber Innovationen und Besonderheiten sichtbar, die es in diesem Kapitel zu beleuchten gilt. Ziel dieses Kapitels ist die Vermittlung eines Gesamtverständnisses hinsichtlich der Architektur und der Datenflüsse in SAP GR.
Unterschiedliche Berichtsanlässe angepasst verarbeiten
Über das Versionskonzept ist es möglich, verschiedene Berichtsanlässe nebeneinander und in Bezug auf Meldedaten und Konsolidierungstechniken in unterschiedlicher Granularität zu verarbeiten (vgl.Kap. 2.5.1 und 4.1.3).
Abbildung 3: Prozess der derivativen Konzernabschlusserstellung
Abgrenzung des Konsolidierungskreises
Ein Konsolidierungskreis bildet die Sachgesamtheit aller Konsolidierungseinheiten ab, die nach den Vorgaben der IFRS-Rechnungslegung neben dem Mutterunternehmen als Tochterunternehmen, gemeinschaftliche Tätigkeiten, Gemeinschaftunternehmen bzw. als assoziierte [9]Unternehmen in den konsolidierten Abschluss einzubeziehen sind. Die vorstehenden Anforderungen der IFRS-Rechnungslegung können auf Basis der vorstehend genannten Einbeziehungsformen systemseitig abgebildet werden.
Besteht ein Konzern aus einer Hierarchie von Konsolidierungskreisen, d. h., wird mindestens ein (legaler) Teilkonzern berichtet, wird nicht die Konzernstruktur in einem Modell abgebildet, in dem neben dem Gesamtkonzern auch alle Teilkonzerne enthalten sind (Hierarchie-Modell). Vielmehr ist für jeden Konsolidierungskreis, für den ein konsolidierter Abschluss benötigt wird, ein eigener und zudem von anderen Kreisen unabhängiger Konsolidierungskreis zu definieren (Scope-Modell).
Aus dem Blickwinkel der intern/extern-harmonisierten Rechnungslegung ist auf die Funktionalität der Matrixkonsolidierung hinzuweisen. Es handelt sich hierbei um eine neuartige Konzeption, die sich von der bekannten Matrix-Funktionalität des SAP BCS unterscheidet. Die Konzeption beschreiben wir in Kapitel 2.6.2.
Bereitstellung der für die Konzernrechnungslegung relevanten Meldedaten
Die Übernahme der Meldedaten war in der Vergangenheit stets mit einer Duplizierung von Meldedaten verbunden, denn diese wurden in einem unterschiedlichen Automatisierungsgrad in die Konsolidierungsapplikation geladen. Diese bekannten Prozesse sind in SAP GR weiterhin vorhanden, was gerade für heterogene Vorsystemlandschaften von großer Bedeutung ist. Die Berichtspakete werden in Abhängigkeit vom Berichtsanlass, wodurch diese auch hinsichtlich des Datenumfangs variieren können, geladen und in der universellen Belegtabelle ACDOCU gespeichert. Aus technischer Sicht ist anzumerken, dass hierbei der Saldo einer Position differenziert nach seinen Aufrisseigenschaften als Beleg in der Tabelle ACDOCU gespeichert wird.
Die große Innovation von SAP GR liegt in der Behandlung der integrierten Einheiten, d. h. solche, die aus einem zentralen S/4HANA bzw. aus einer Central-Finance-Architektur kommen. Diese werden nun durch eine Freigabe in die Konsolidierung übernommen. Der weitere – wesentliche – Vorteil liegt darin, dass der gesamte Datenbestand aus der einzelgesellschaftlichen (IFRS-)Rechnungslegung für gruppenweite Auswertungen zur Verfügung steht.
Wie aus SAP EC-CS und SAP BCS bekannt, kommt es bei der Datenübernahme generell zu einer technischen Validierung, d. h. es wird geprüft, ob die jeweiligen Meldedaten dem in der Konsolidierung geforderten Datenmodell entsprechen. Zentral für diese Prüfung ist der Kontierungstyp (vgl. Kap. 4.1.11). Für integrierte Einheiten ist eine Besonderheit zu beachten, denn für diese erfolgt die technische Validierung über einen gesonderten Validierungsschritt.
Über die sog. SAP Group Reporting Data Collection App, die zusätzlich zu SAP GR lizenziert werden kann, besteht die Möglichkeit zur Anreicherung der Meldedaten. Hierzu gehören insbesondere Anhangangaben, wobei es sich hierbei – im aktuellen Releasestand – nicht um textalische Informationen handeln kann. Gerade an dieser praxisrelevanten Stelle wird sich die [10]Softwarelösung aber noch weiter entwickeln. Das MS-Excel-Add-in SAP Analysis for Microsoft Office kann gut auf der Auswerte- und Analyseebene genutzt werden. Soll jedoch eine »in die Datenbank schreibende Funktion« zur Anwendung gelangen, ist dies nur im Kontext eines SAP BPC- oder SAP IP-Datenmodells möglich. Soll nachfolgend ein Übertragen in das SAP GR benötigt werden, muss die Datenübernahme via API (Application Programming Interface) erfolgen.
Bei der Datenübernahme ist festzulegen, wie die Verwaltung der stillen Reserven/Lasten bei einem erworbenen Tochterunternehmen erfolgen soll. Hier wird systemseitig der sog. Push-Down-Ansatz favorisiert, bei dem die stillen Reserven/Lasten aus dem Erwerb von Tochterunternehmen bereits in den IFRS-Ledger (S/4HANA oder andere Vorsysteme) heruntergedrückt werden. Ansonsten kann die stille Reserven-Verwaltung systemgestützt nur über manuelle Buchungen erfolgen.
Währungsumrechnung
Moderne Berichtswerkzeuge für multinationale Gruppen müssen gerade aus dem Blick der Währung flexibel sein. Dies gilt für die Festlegung der Konzernwährung, auch Kreiswährung genannt. Des Weiteren müssen Gesellschaften, deren funktionale Währung abweicht, in die Konzern- bzw. Kreiswährung umgerechnet werden. Wir beschreiben, welche Prozesse relevant sind, wenn die Hauswährung einer Berichtseinheit von der funktionalen Währung abweicht. Der Schwerpunkt liegt aber auf der Anwendung der modifizierten Stichtagskursmethode. SAP GR stellt hierbei eine position/bewegungsartengenaue Umrechnung sicher und unterstützt hierdurch auch die effiziente Erstellung von Kapitalflussrechnungen. Aus technischer Sicht wurde ein großer Teil des erforderlichen Customizing organisatorisch geändert und wesentliche Einstellungen finden sich nun im Stammsatz der Position.
Hervorhebenswert ist die Technik der historisierten Umrechnung im Bereich des Eigenkapitals. Diese ermöglicht einerseits die Ermittlung von Währungsumrechnungsdifferenzen; durch die damit verbundenen Detailinformationen ist andererseits auch eine gute Analyse hinsichtlich des Zustandekommens der Währungsumrechnungsdifferenzen möglich. Datenbasis ist hierfür u. a. ein mit den Zusatzmeldedaten aus SAP EC-CS und SAP BCS vergleichbares Konzept.
Aus technischer Sicht ist des Weiteren hervorzuheben, dass im Zusammenhang mit der Währungsumrechnung auch Belege in der Tabelle ACDOCU erstellt werden.
IC-Konsolidierung und IC-Abstimmung
Die Intercompany-Konsolidierung, gemeint sind die Schuldenkonsolidierung und die Themenblöcke der Aufwands- und Ertragseliminierung, ist ein praxisrelevanter Themenbereich, der regelmäßig auch zeit- und ressourcenintensiv ist.
Gerade in diesem Prozessschritt kommt es zu wesentlichen Neuerungen. Diese beginnen im wichtigen IC-Abstimmungsprozess. Ob das herstellerseitig propagierte Continuous Accounting (kontinuierlicher Prozess der Konzernberichterstattung) für in S/4HANA integrierte Ge[11]sellschaften auf Praxisakzeptanz stoßen wird, wird die Zeit zeigen. Gemeint ist damit, dass im Zeitpunkt der Erfassung eines IC-Sachverhalts bereits zwischen den einzelgesellschaftlichen Buchhaltern eine Abstimmmaßnahme durchgeführt wird. Als Innovation ist die Integration einer IC-Abstimmplattform (SAP ICMR; Intercompany Matching and Reconciliation) in das Produkt zu bezeichnen. Im deutschsprachigen Raum verwendet der Hersteller hierfür die Abkürzung (Intercompany-Matching und -Abstimmung) und im Folgenden verwenden auch wir die Abkürzung ICMA.
Gesellschaften aus dem zentralen S/4HANA können hiermit hochautomatisiert und auf Einzelpostenebene die Verbundbeziehungen prüfen und Fehler korrigieren. Praxisrelevant ist auch die Möglichkeit der Einbindung von nicht-integrierten Gesellschaften in den Prozess, wobei dieser dann regelmäßig auf Saldenebene erfolgen wird. Werden echte und unechte Differenzen identifiziert, können diese flexibel eliminiert werden. Je nach Ausgangssituation kann dies über eine Buchung im S/4HANA (ACDOCA) oder über eine Konsolidierungsbuchung (ACDOCU) erfolgen.
Wird SAP ICMA nicht verwendet, kann in SAP GR die IC-Eliminierung vorgenommen werden. Hervorzuheben ist hierbei, dass es sich um einen regelbasierten Prozess handelt. Technisch werden hierzu – wenngleich in leicht abgewandelter Form – die Umgliederungsmaßnahmen aus dem SAP EC-CS verwendet. Da diese nur auf Ebene der Konzernwährung arbeiten, ist insbesondere keine Einbindung der Transaktionswährung bei der Verarbeitung möglich.
Konsolidierungsbuchungen
Konsolidierungsmaßnahmen können über manuelle Buchungen, maschinelle Umgliederungen oder herstellerseitig programmierte Konsolidierungsmaßnahmen verarbeitet werden; letztgenannter Punkt bezieht sich primär auf die Kapitalkonsolidierung. Jede Wertänderung wird durch einen eindeutigen Buchungsbeleg charakterisiert, der zudem eine eindeutige Belegnummer trägt.
Im Kontext von Buchungen wird unverändert auf die aus der traditionellen SAP-Konsolidierung bekannte Reporting-Logik zurückgegriffen und für die Anwendung auf mehrere Konsolidierungsdimensionen erweitert. Hierdurch ist es möglich, Buchungen allgemeingültig zu formulieren und diese dementsprechend in mehreren Konsolidierungskreisen anzuwenden, ohne gleichzeitig den Kreisbezug zu verlieren; das fundamentale Buchungsverständnis wird in Kapitel 4.2 thematisiert.
Zwischenergebniseliminierung
S/4HANA eröffnet für diesen Bereich, der sowohl für die externe als auch die interne Rechnungslegung relevant ist, interessante Perspektiven.
Erstrecken sich Wertschöpfungsprozesse über mehrere Tochterunternehmen, ist es in S/4HANA möglich, eine zusätzliche Bewertung einzuführen, die nicht auf den zwischen den Tochterunternehmen vereinbarten Intercompany-Transferpreisen basiert, sondern die effektiv auf der jeweiligen Stufe der Wertschöpfungskette angefallenen Herstellkosten verwendet. Über diese [12]Vorgehensweise ist auf Konzernebene keine Zwischenergebniseliminierung notwendig; des Weiteren werden die erzeugten Produkte und Dienstleistungen unmittelbar mit ihren Konzern-Herstellungskosten bewertet. Bereits in der ACDOCA wird somit die Konzernsicht angewendet. Das Konzept besticht aus betriebswirtschaftlicher Sicht; technisch ist aber anzumerken, dass alle Unternehmen entlang der Lieferkette im gleichen S/4HANA-System geführt werden müssen, damit die Bewertungssicht »Konzern« zutreffend abgebildet wird.
In SAP GR gibt es im aktuellen Release keine Funktionsbausteine zur Durchführung einer Zwischenergebniseliminierung. Der Hersteller wird aber zeitnah diese wesentliche Lücke schließen. Wie man den Themenbereich aus unserer Sicht aktuell verarbeiten kann, stellen wir in den Kapiteln 6.4.5 und 6.4.6 vor.
Kapitalkonsolidierung
Für den Bereich der Kapitalkonsolidierung hat der Hersteller ein Wahlrecht geschaffen. Entweder wird auch hier eine umgliederungsbasierte Konsolidierung verwendet oder der Anwender entscheidet sich für die automatische Kapitalkonsolidierung, die in wesentlichen Konzept- und Verarbeitungsmerkmalen derjenigen aus dem SAP EC-CS bzw. dem SAP BCS entspricht. Wir verwenden die praxiserprobte und einheitlich vom Hersteller gewartete maschinelle, vorgangsbasierte Kapitalkonsolidierung. In einem Beispielsachverhalt zeigen wir Ihnen darüber hinaus den Prozess der Kapitalkonsolidierung im Wege der Vollkonsolidierung von der Erstkonsolidierung bis zur Endkonsolidierung und beleuchten hierbei auch eine zwischenzeitliche Erhöhung des Beteiligungsprozentsatzes (sukzessiver Erwerb).
Saldovortrag
SAP GR verwendet ein Datenmodell, welches aus SAP EC-CS und SAP BCS bewährt ist. Das Datenmodell besteht aus 16 bzw. 12 Berichts- und 4 Sonderperioden, die untereinander verbunden sind. In SAP GR erfolgt eine periodische Datenhaltung, d. h. jede Periode umfasst nur die in dieser Periode erfolgten Geschäftsvorfälle. Für eine Date-to-Date- bzw. eine Year-to-Date-Analyse stehen alle relevanten Details zur Verfügung. Über den Saldovortrag erfolgt die Verbindung zwischen den Geschäftsjahren. Hierbei werden die auf der ACDOCU vorhandenen Salden in die Saldovortragsperiode 000 übertragen, was ebenfalls in Form von Buchungen erfolgt. Beachtlich ist, dass anwenderseitig nicht in dieser Saldovortragsperiode gebucht werden kann.
Berichtswesen
Bereits das Standardberichtswesen von SAP GR erfüllt alle zentralen Berichtserfordernisse eines gruppenweiten Reportings. Des Weiteren ist es möglich, das MS-Excel-Add-in SAP Analysis for Microsoft Office zu verwenden, um das nicht nur im Controlling sehr beliebte Werkzeug für Analyse- und Auswertungsaufgaben in die Systemarbeit zu integrieren.
Wenn es um ein grafisch unterstütztes Berichtswesen geht, kann zudem SAP Analytics Cloud (SAC) als browserbasierte Anwendung genutzt werden.
[13]2.4Chancen und Ziele eines harmonisierten Rechnungswesens
Der Begriff »Harmonisierung von externem und internem Rechnungswesen« umfasst in einer weitgefassten Definition die ganzheitliche Gestaltung der Planung, Steuerung und Kontrolle der Unternehmensperformance zugrunde liegenden Managementberichterstattung (internes Rechnungswesen) sowie der IFRS-Finanzberichterstattung (externes Rechnungswesen). Dabei wird sowohl eine terminologische, inhaltliche als auch systemtechnische, prozessuale und organisatorische Vereinheitlichung beider Bereiche des Rechnungswesens verfolgt. Wie vorstehend dargestellt, erlangt ein integrierter Ansatz in der IFRS-Rechnungslegung aufgrund des in einigen Standards implementierten Management-Approach eine große Bedeutung. Aber auch außerhalb der IFRS-Rechnungslegung existieren Gründe, die eine Harmonisierung des internen/externen Rechnungswesens als sehr sinnvoll erscheinen lassen; vier dieser Gründe werden nachfolgend skizziert.
2.4.1Kommunikationsaspekt
An erster Stelle ist der Kommunikationsaspekt zu nennen. Es ist sinnvoll, eine (möglichst) einheitliche Terminologie für die sowohl im internen als auch im externen Rechnungswesen vorzufindenden Inhalte zu schaffen. Eine einheitliche terminologische Basis fördert die Verständlichkeit und erhöht damit auch die Akzeptanz innerhalb des Unternehmens. Insbesondere sollte durchgängig eine führende Ergebnisgröße Verwendung finden, die sowohl im internen als auch externen Berichtswesen eingesetzt wird (z. B. operatives Ergebnis, EBIT oder EBITDA).
In engem Zusammenhang hierzu steht die inhaltliche Analyse, Überarbeitung und Zusammenführung der verwendeten Rechenkonzepte, sodass z. B. das im Rahmen der wertorientierten Steuerung (Value Based Management) erforderliche investierte Kapital auf Basis der extern kommunizierten Bilanzdaten ermittelt und etwaige Überleitungspositionen auf ein Minimum reduziert werden können.
2.4.2Schaffung eines einheitlichen Datenbestandes
Eine wesentliche Zielsetzung ist die Verfügbarkeit eines systemgestützten und einheitlichen Datenbestandes (Single Point of Truth). Nur so ist sichergestellt, dass internes und externes Rechnungswesen durchgängig auf einen integrierten Datensatz (mit einheitlichen Kontierungsobjekten) zugreifen und manuelle Schnittstellen bzw. Überleitungsrechnungen (weitgehend) vermieden werden. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Bandbreite der seitens des Rechnungswesens abzudeckenden Aufgaben i. d. R. keine vollständige Harmonisierung erlaubt, sodass auf ein Minimum von Überleitungsrechnungen in einigen Teilbereichen regelmäßig nicht verzichtet werden kann.
[14]2.4.3Schaffung einer effizienten Berichtsplattform
Während der genannte Kommunikationsaspekt mit der konzeptionellen Angleichung der innerhalb des internen und externen Berichtswesens verwendeten Rechenmodelle zu einer deutlichen Reduzierung der zu steuernden Brückenpositionen und Überleitungsarbeiten beiträgt, erhöht die Schaffung einer harmonisierten Berichtsplattform u. a. den Automatisierungsgrad, sodass weniger auf manuelle Schnittstellen zurückgegriffen werden muss.
Gerade der systemtechnischen Integration kommt eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu, da heute weite Bereiche des internen und externen Rechnungswesens systemgestützt verarbeitet werden. Insofern gilt es, eine Bestandsaufnahme und Beurteilung der vorhandenen Applikationen vorzunehmen und bei Bedarf Altsysteme abzuschalten bzw. durch für ein integriertes Arbeitsumfeld besser geeignete Alternativsysteme zu substituieren.
Dabei ist der Blick über die Konzernebene hinaus auch auf die Bedarfe der nachgelagerten Hierarchieebenen (Segmente, Geschäftsbereiche, Profit-Center) zu richten, die insbesondere im Bereich der Managementberichterstattung häufig geschäftsbereichs- oder Profit-Centerspezifische Berichtsanforderungen formulieren. In Abhängigkeit von der Gewichtung dieser spezifischen zu den originären Konzernberichtsbedarfen kann sowohl eine zentrale als auch eine dezentrale Systemarchitektur vorteilhaft sein. Allerdings ist bei zunehmender Eigenständigkeit der nachgelagerten Hierarchieebenen tendenziell ein dezentraler Ansatz zu empfehlen, bei dem das originäre Konzernsystem bei Bedarf auf den untergeordneten Berichtsebenen um individuelle, aber integrierte Satellitensysteme ergänzt wird.
Das primäre Ziel der Schaffung einer effizienten Berichtsplattform besteht darin, Systeme, Prozesse und Organisationsstrukturen mittels eines ganzheitlichen Ansatzes zu betrachten und etwaige Ineffizienzen im Rechnungswesen abzubauen. So bestehen regelmäßig isoliert voneinander betriebene, teilweise redundante Altsysteme und nicht zuletzt die damit in Verbindung stehenden Arbeitsabläufe und Berichtsprozesse bergen große Optimierungspotenziale. Die Schaffung einer Berichtsplattform ist folglich nicht nur eine systemtechnische Fragestellung. Vielmehr ist damit auch die Chance verbunden, im Zuge der prozessualen Harmonisierung die Arbeitsabläufe sowohl des internen als auch des externen Berichtswesens zu analysieren, zu vereinheitlichen und zu straffen. Insbesondere bisher (teil-)redundant durchgeführte Tätigkeiten können so vermieden und die Effizienz in beiden Bereichen des Rechnungswesens gesteigert werden. Neben der Vermeidung von Doppelarbeiten eröffnen i. d. R. auch die mit Abstimmungs- bzw. Überleitungstätigkeiten verbundenen Prozessaktivitäten deutliches Optimierungspotenzial.
Die im Zuge der inhaltlichen Harmonisierung vorgenommenen Anpassungen sind dabei auch in die entsprechenden Bilanzierungs- und Controllinghandbücher/-richtlinien einzuarbeiten, um auf diese Weise die zügige Durchsetzung innerhalb der Gesamtorganisation zu unterstützen.