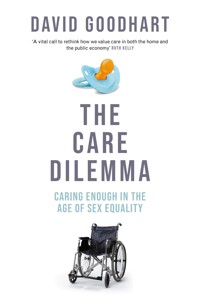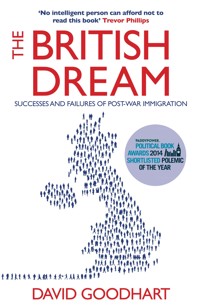15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie viele Akademiker brauchen wir? - Welche Berufe unsere Gesellschaft zusammenhalten
Es muss erst eine Pandemie ausbrechen, damit wir merken, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Worauf es wirklich ankommt, was »systemrelevant« ist. Die tägliche Versorgung mit Lebensmitteln ist es, und die verlässliche medizinische Betreuung. Verkäuferinnen und Pflegekräfte - die neuen Helden des Alltags. So lange, bis sich dieser wieder normalisiert. Wir leben in einer Gesellschaft, in der kognitive, analytische Fähigkeiten am höchsten bewertet werden, höhere Bildung für möglichst viele ist erklärtes Ziel. An den Schalthebeln der Macht sitzen überwiegend akademisch Ausgebildete, sie bestimmen den Kurs stark nach ihren Interessen und Wahrnehmungen. Doch das hat seinen Preis: Eine Gesellschaft, die die Berufe der Hand und des Herzens, also Handwerk und soziale Berufe, geringschätzt und schlecht bezahlt, droht aus der Balance zu geraten. Der Kopf hat zu viel Einfluss erlangt, so David Goodhart. In seiner provozierenden Analyse zeigt er auf, warum das problematisch ist und wo wir ansetzen müssen, um die Gewichte zu verschieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wie viele Akademiker brauchen wir? – Welche Berufe unsere Gesellschaft zusammenhalten
Es muss erst eine Pandemie ausbrechen, damit wir merken, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Worauf es wirklich ankommt, was »systemrelevant« ist. Die tägliche Versorgung mit Lebensmitteln ist es, und die verlässliche medizinische Betreuung. Verkäuferinnen und Pflegekräfte – die neuen Helden des Alltags. So lange, bis sich dieser wieder normalisiert. Wir leben in einer Gesellschaft, in der kognitive, analytische Fähigkeiten am höchsten bewertet werden, höhere Bildung für möglichst viele ist erklärtes Ziel. An den Schalthebeln der Macht sitzen überwiegend akademisch Ausgebildete, sie bestimmen den Kurs stark nach ihren Interessen und Wahrnehmungen. Doch das hat seinen Preis: Eine Gesellschaft, die die Berufe der Hand und des Herzens, also Handwerk und soziale Berufe, geringschätzt und schlecht bezahlt, droht aus der Balance zu geraten. Der Kopf hat zu viel Einfluss erlangt, so David Goodhart. In seiner provozierenden Analyse zeigt er auf, warum das problematisch ist und wo wir ansetzen müssen, um die Gewichte zu verschieben.
David Goodhart, geboren 1956, ist britischer Journalist und Autor mehrerer Sachbücher zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Ende der Achtziger- und Anfang der Neunzigerjahre war er Deutschlandkorrespondent der Financial Times. In seinem letzten Buch The Road to Somewhere. Die populistische Revolte und die Zukunft der Gesellschaft beschäftigte er sich mit den Gründen für das Erstarken des Populismus in westlichen Ländern.
»Eine nachdenklich stimmende Analyse.« Financial Times über The Road to Somewhere
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
DAVIDGOODHART
KOPFHANDHERZ
Das neue Ringen um Status
Warum Handwerks- und Pflegeberufe mehr Gewicht brauchen
Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Head Hand Heart. The Struggle for Dignity and Status in the 21st Centurybei Allen Lane, London.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Copyright © der Originalausgabe 2020 David GoodhartCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenRedaktion: Jonas WegererUmschlaggestaltung: total italic, Thierry Wijnberg (Amsterdam/Berlin)Umschlagabbildungen: © AndreyPopov/iStock und © fandijki/shutterstockSatz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-25877-1V001www.penguin-verlag.de
Für meine Kinder,in der Hoffnung, dass sie endlich einmal etwas lesen, das ich geschrieben habe
Inhalt
Vorwort zur deutschen Ausgabe
TEIL 1: DASPROBLEM
Kapitel 1: Die Vorherrschaft des Kopfes
Kapitel 2: Der Aufstieg der kognitiven Klasse
Kapitel 3: Kognitive Kompetenz und Leistungsgesellschaft
TEIL 2: DIEKOGNITIVEÜBERNAHME
Kapitel 4: Das Zeitalter der Auslese
Kapitel 5: Der Aufstieg des Wissensarbeiters
Kapitel 6: Die Diplomdemokratie
TEIL 3: HANDUNDHERZ
Kapitel 7: Das Schicksal der Hand
Kapitel 8: Das Schicksal des Herzens
TEIL 4: DIEZUKUNFT
Kapitel 9: Der Niedergang des Wissensarbeiters
Kapitel 10: Kognitive Vielfalt und die Zukunft derArbeit
Dank
Anmerkungen
Ausgewählte Literatur
Register
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Dieses Buch entstand weitgehend vor Beginn der Coronakrise. Doch die Pandemie und ihre absehbaren Nachwehen haben direkte Auswirkungen auf sein Thema – die ungleiche Verteilung von Status und Anerkennung, die in den letzten Jahrzehnten zu einem herausragenden Merkmal wohlhabender Gesellschaften geworden ist. Zum einen hat die Krise Undenkbares denkbar gemacht: Wenn wir das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben über Monate hinweg anhalten, einschränken und gemeinsam einen Teil der Lasten schultern können, dann ist es vielleicht genauso denkbar, das Statusungleichgewicht in unserer nach Bildung geschichteten postindustriellen Gesellschaft um einige Grade zu korrigieren.
Den meisten von uns geht es darum, so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren, doch die von der Krise schwer getroffenen Nationen Europas und Nordamerikas stehen vor großen Umbrüchen. Auf das Thema dieses Buchs bezogen wird Corona auf unterschiedliche Weise dazu beitragen, Hand und Herz – sprich: handwerkliche, nicht-akademische Berufe und Tätigkeiten in Erziehung und Pflege – wieder aufzuwerten und ihnen etwas von dem Ansehen zurückzugeben, das sie in den zurückliegenden Jahrzehnten an den Kopf – sprich: kognitive Tätigkeiten – verloren haben.
Auf der Makroebene wird heute eine neue Form der Globalisierung denkbar, die von einem der humorvolleren Slogans der Krise auf den Punkt gebracht wird: Proletarier aller Länder, vereinigt euch: Ihr habt nichts zu verlieren als eure Lieferketten. Eine umfassende Entglobalisierung ist weder wünschenswert noch wahrscheinlich, wir haben unsere Lektionen aus dem Protektionismus der Dreißigerjahre gelernt. Der »Hyperglobalisierung«, wie sie der Wirtschaftswissenschaftler Dani Rodrik nennt, die vor allem Konzernen, Finanzmärkten und hochmobilen Akademikern dient, können wir aber dennoch einige Zügel anlegen. In Europa schlug in der Krise die Stunde des Nationalstaats und des nationalen Gesellschaftsvertrags, während in den Vereinigten Staaten die relative Schwäche des Zentralstaats augenfällig wurde. In der nächsten Phase der Globalisierung werden Nationalstaaten wieder mehr Mitsprache einfordern. Einige der langen und anfälligen Lieferketten werden gekürzt und gekappt werden. Die Billig-Globalisierer, die Fabrikschließungen zwar bedauern, sie aber als Preis für die günstigeren Produkte von Amazon in Kauf nehmen, werden einen zunehmend schweren Stand haben. Denn die meisten von uns sind nicht nur Konsumenten, sondern auch Produzenten, und vielleicht sind wir dazu bereit, ein paar Euro mehr für ein Mobiltelefon hinzublättern, wenn es im eigenen Land produziert wurde.
Diese Sichtweise hatte schon vor der Krise vermehrt Anhänger gewonnen. Schon 2019 erfuhr der Welthandel unter dem Eindruck des Handelskriegs zwischen China und den Vereinigten Staaten eine leichte Abschwächung. Das bestehende Modell der Hals-über-Kopf-Globalisierung hat zu viele Verlierer hervorgebracht, nicht zuletzt unsere globale Umwelt.
In den zurückliegenden beiden Generationen wurde der Westen von Zentrifugalkräften beherrscht, die zwar auf der einen Seite globale Öffnung und individuelle Freiheiten begünstigten, auf der anderen jedoch kollektive Bande schwächten und dafür sorgten, dass die Kopfarbeit ein unverhältnismäßig großes Stück vom Kuchen erhielt, während Hand und Herz an Status und Einkommen verloren. In sämtlichen wohlhabenden Nationen hat die Wissensökonomie die Bildungselite an die Spitze der Statushierarchie befördert und die kognitiv Begabten reichlich beschenkt, doch zugleich haben viele andere Menschen Sinn und Zugehörigkeitsgefühl verloren.
Die jüngsten, sicher auch durch die Pandemie beförderten Entwicklungen lassen allerdings vermuten, dass wir nun an der Schwelle zu einer stärker zentripetalen Phase stehen, in der sich Nationalstaaten festigen und wirtschaftliche und kulturelle Offenheit zurückgenommen wird. In dieser Phase werden Regionalismus, gesellschaftliche Stabilität und Solidarität an Bedeutung gewinnen, während die Skepsis gegenüber den Ansprüchen der kognitiven Klasse wie auch unsere Sensibilität für die Zumutungen der modernen Leistungsgesellschaft steigen wird.
Als ich 2019 mit der Arbeit an diesem Buch begann, hätte ich mir nicht vorzustellen gewagt, dass der Beitrag der Arbeitnehmer, die ich hier als »Herz« und »Hand« bezeichne, in Ländern wie Deutschland oder Großbritannien geradezu zum Sinnbild der Krisenbewältigung werden würde. Die Bürger applaudierten nicht nur dem medizinischen Personal, sondern auch den Menschen, die sonst unbemerkt die Grundfunktionen unseres Alltags aufrechterhalten – die Mitarbeiter von Supermärkten, die Busfahrer und Lieferanten, die Menschen, die unsere Waren in die Läden und unsere Medikamente in die Apotheken bringen, die Menschen, die unseren Haushaltsmüll entsorgen. In einer Umkehr der Statushierarchie kam es mit einem Mal auf jene Menschen an, die nicht studiert haben und kognitiv weniger geschult sind.
Doch die tiefsten Spuren könnte die Denkpause hinterlassen, die der Lockdown uns und unserer hektischen Leistungsgesellschaft verordnet hat. Viele von uns, vor allem die besser ausgebildeten Menschen, die im Home Office arbeiten konnten, mussten sich darüber Gedanken machen, worauf es ihnen im Leben wirklich ankommt. Mit der Unterbrechung unserer geschäftigen mobilen Existenz nahmen viele von uns zum ersten Mal ihre Nachbarn richtig wahr und fühlten sich in einer physischen Gemeinschaft verortet. Dieses neue Gefühl der Verwurzelung und Beziehung und die neue Wahrnehmung unserer eigenen Sterblichkeit können in rührselige Sentimentalität oder ängstliche Risikoscheu ausarten. Es gibt durchaus Menschen, die nicht möchten, dass der Lockdown endet. Andere wünschen sich dagegen verzweifelt ihre früheren Freiheiten zurück, und gerade in Deutschland war der Protest gegen die Einschränkungen oftmals lauter als anderswo in Europa. Einige erwarten für die Zeit nach der Krise nicht etwa eine mitfühlendere, fürsorglichere Gesellschaft, sondern Exzesse des Hedonismus und Individualismus, eine Neuauflage der Wilden Zwanziger.
Doch im Mittelpunkt der Krise standen die Bereiche Pflege und Erziehung, und allein deshalb ist eine wirtschaftliche und politische Neuorientierung zu erwarten. So wie selbst konservative Politiker ihre Haltung zur Staatsverschuldung überdenken mussten, könnten wir nun unsere Vorstellungen von Produktivität und Wirtschaft insgesamt auf den Prüfstand stellen. Schon heute geben wohlhabende westliche Gesellschaften einen erheblichen Anteil ihres Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit und Erziehung aus, und dieser wird infolge der Krise vermutlich noch wachsen. Dabei werden wir feststellen, dass es in vielen Bereichen des Gesundheitssektors, ob in Krankenhäusern oder Altenheimen, eben nicht darum geht, die Produktivität zu steigern, sondern vielmehr darum, sie zu senken. Es geht darum, die Zahl der Betten pro Pflegekraft zu reduzieren, nicht zu erhöhen. Wenn Deutschland in der ersten Phase besser durch die Krise kam als seine europäischen Nachbarn, dann auch deshalb, weil das deutsche Gesundheitswesen über mehr Kapazitäten verfügt als die meisten anderen.
Wenn wir den Gesundheitssektor aufwerten und stiefmütterlich behandelte Bereiche wie die Altenpflege besser finanzieren wollen, dürfen wir die häusliche Pflege und die frühkindliche Erziehung nicht außen vor lassen. Damit werden große Fragen nach der Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau aufgeworfen und danach, wie sich die Arbeit in Haushalt und Familie aufwerten lässt, ohne die Freiheiten zurückzunehmen, die sich Frauen in den vergangenen Jahrzehnten erkämpft haben. Unsere in der Krise erzwungene Häuslichkeit hatte reichlich Spannungen, Trennungen und selbst Gewalt zur Folge. Aber sie hat viele von uns auch an den Wert der Familie und ihrer Erziehungs- und Pflegearbeit erinnert.
Deshalb bin ich der Ansicht, dass Hand und Herz durch die Krise gestärkt wurden und gegenüber dem Kopf wieder leicht an Status gewonnen haben. Oder um es politisch auszudrücken, ich beobachte, dass die Krise vor allem in Europa ein ungewöhnliches Bündnis hervorgebracht hat zwischen der konservativen Präferenz für Region, Land und Familie auf der einen Seite und einer sozialdemokratischen Präferenz für höhere Staatsausgaben und einen gewissen Kollektivismus, verbunden mit einem neuen Umweltbewusstsein. Doch wie Sie diesem Buch entnehmen können, hatte ich dies bereits vor der Coronakrise vermutet, weshalb ich mich der Covid-Bestätigungs-Verzerrung schuldig bekenne: der Neigung, die eigenen Erwartungen an die Zukunft durch die Pandemie bestätigt zu sehen.
Dieser Argumentation könnte man nun zwei Argumente entgegenhalten. Erstens könnte man darauf verweisen, dass der Kopf durch die Krise keineswegs einen Dämpfer erhielt, weil Experten – namentlich Virologen, Mediziner oder Impfstoffforscher – ihre Bedeutung für die Gesellschaft unter Beweis gestellt und die populistische Wissenschaftsskepsis weitgehend widerlegt haben. Und zweitens könnte man anführen, dass die digitalen Plattformen der großen Technologiekonzerne, die während der Krise noch stärker in den Mittelpunkt unseres Alltags gerückt sind, der Inbegriff der entkörperlichten Welt der Datenverarbeitung sind und die Ideologie des Kopfes bestätigen.
Beide Einwände sind berechtigt, doch ich bezweifle, dass sie schwer genug wiegen, um meine These von der Corona-Umverteilung zu widerlegen. Der erste Einwand würde mein Problem mit der Expertenkultur falsch verstehen. Experten aus den Bereichen Naturwissenschaft, Technik oder Medizin stoßen nur auf geringe Skepsis (in den Vereinigten Staaten mehr als in Europa). Der eigentliche Unmut richtet sich vor allem gegen Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaftler sowie Akademiker ganz allgemein, die ihre oftmals liberalen Ansichten über die europäische Integration oder Massenzuwanderung gern als objektive Wahrheiten verkaufen.
Und die digitalen Plattformen haben in der Krise zwar ihren Wert unter Beweis gestellt, doch dabei haben sie weniger die Botschaft der Mobilität und Globalisierung vermittelt, die wir so oft mit ihnen verbinden. Facebook und WhatsApp-Gruppen erwiesen sich vielmehr als wichtige Kommunikationskanäle für reale und regional verortete Gemeinschaften. Dabei waren sie derart unentbehrlich, dass sie sich neben Wasser und Strom als lebenswichtige Grundversorger etablieren konnten und sicherlich bald derselben Aufsicht unterliegen werden. Doch das ist eine andere Geschichte.
Die These dieses Buchs ist einfach: In den vergangenen Jahrzehnten haben wir in den wohlhabenden Nationen ein sehr begrenztes Spektrum von Fähigkeiten – die kognitiv-analytischen »Kopf-Kompetenzen« – zu stark honoriert, und zwar finanziell wie gesellschaftlich. Wir haben die Definition eines gelungene Lebens zu eng gefasst und den Weg dorthin mit dem Studium zu schmal gestaltet. In den Vereinigten Staaten und Großbritannien ist diese Unwucht am größten. Im skandinavischen und deutschsprachigen Raum gibt es dieses Ungleichgewicht ebenfalls, auch wenn es einige Gegengewichte bislang in Grenzen gehalten haben.
Dank des dualen Ausbildungssystems, um das Deutschland in aller Welt beneidet wird, genießen handwerkliche und andere Ausbildungsberufe größeres Ansehen als vergleichbare Tätigkeiten in den Vereinigten Staaten und Großbritannien, und institutionalisierte Arbeitnehmervertretungen tun das Ihre für die Mitarbeiter von größeren Unternehmen. Viele Angehörige der Mittelschicht, die ein Studium aufnehmen könnten, ziehen eine Ausbildung vor. Der frühere Kanzler Gerhard Schröder absolvierte erst eine Lehre, eher er studierte. Drei der Minister in Angela Merkels Kabinett, darunter auch Gesundheitsminister Jens Spahn, machten nach dem Abitur zunächst eine Lehre und schlossen erst dann ein Studium an. Bis vor Kurzem war der Anteil der Hochschulabsolventen in Deutschland relativ niedrig und das Land hatte weniger Universitäten von Weltrang als zum Beispiel die Vereinigten Staaten, Großbritannien oder Frankreich. Dazu kommt, dass sich Wohlstand und Bevölkerung regional gleichmäßiger verteilen als beispielsweise in Großbritannien, und dass 70 Prozent der Bevölkerung in Städten mit weniger als 100 000 Einwohnern leben. Es gibt kein Zentrum, das Kompetenz und Vermögen derart an sich ziehen und so für die Ideologie des Kopfes, der sozialen Mobilität und Abstraktion stehen würde wie London. In Deutschland genießen »Normalbürger« größeres Ansehen als in Großbritannien. Dort verlassen die kognitiv gesegneten Jugendlichen mit 18 Jahren ihre Heimatstädte, um sich in London und anderen Metropolen zu sammeln. In Deutschland haben dagegen viele international führende Unternehmen ihren Sitz in Ortschaften, von denen im Ausland kaum jemand gehört hat, zum Beispiel Adidas in Herzogenaurach, Miele in Gütersloh oder SAP in Walldorf.
In Deutschland ist die wirtschaftliche Ungleichheit heute zwar weniger stark ausgeprägt als in Großbritannien, doch dank des Wachstums des Finanzsektors und der Agenda 2010 hat sie in den letzten Jahren auch hier deutlich zugenommen. Durch die europäische Vereinheitlichung der Studiengänge im Rahmen des Bologna-Prozesses ist auch die Hochschullandschaft in den letzten Jahren angelsächsischer geworden, und mehr Schulabgänger nehmen ein Studium auf, der Anteil der Studierenden ist auf fast 40 Prozent angestiegen. Dies könnte zu Lasten des dualen Ausbildungssystems gehen, indem es ihm fähigen Nachwuchs entzieht, und auf diese Weise wie in den Vereinigten Staaten und Großbritannien die Kluft zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern vergrößern.
Die gerechte Verteilung von Status und Anerkennung ist ein Problem sämtlicher modernen Gesellschaften. Wir benötigen Eliten und elitäre Institutionen, doch wir benötigen mehrere Eliten und Zugänge und müssen dafür sorgen, dass eine große Bandbreite von menschlichen Fähigkeiten angemessene Anerkennung erhält. Es ist der Populismus, in dem unter anderem die Frustration darüber zum Ausdruck kommt, dass sich das demokratische Versprechen der politischen Gleichheit nicht in einer gerechteren Verteilung von Status und Anerkennung niederschlägt. Zu viele Menschen fühlen sich von unserer liberalen und kognitiven Leistungsgesellschaft ausgeschlossen. Diese Unwucht müssen wir ausgleichen.
Zum Teil wird dies nahezu zwangsläufig erfolgen, denn schon vor der endgültigen Durchsetzung der Künstlichen Intelligenz stellt sich heraus, dass die Wissensökonomie weit weniger Wissensarbeiter benötigt als bisher angenommen. Gleichzeitig wird der Anteil der menschlichen Dienstleistungen, allen voran in der Pflege, dramatisch ansteigen. Bezahlung und Status der Pflegedienstleister, vor allem in Altenpflegeheimen, werden sich verbessern müssen, damit dieser lebenswichtige Sektor für Arbeitnehmer attraktiver wird.
In unserer offenen und streitbaren Gesellschaft wurden die Debatten und Meinungsverschiedenheiten auch während der Pandemie ausgetragen, doch unter der Oberfläche herrschte ein größerer Konsens als üblich. Daher stehen die Chancen gut, dass es uns gelingt, in der Folge dieser Krise bei der Verteilung von Status und Anerkennung ein breiteres Spektrum von menschlichen Fähigkeiten zu berücksichtigen und das in diesem Buch eingeforderte ausgewogenere Verhältnis von Kopf, Hand und Herz herzustellen. Die traurige Alternative wäre, dass die Narben der Krise unsere alten Gräben und Ressentiments vertiefen.
TEIL 1
DASPROBLEM
Kapitel 1
Die Vorherrschaft des Kopfes
Wir müssen etwas gänzlich Ungewohntes tun: Wir müssen unsere Verachtung für diejenigen überwinden, die von der Leistungs- und Wettbewerbsethik benachteiligt werden.
Kwame Anthony Appiah
Was ist in den wohlhabenden Demokratien des Westens nur schief gelaufen? Politische Gräben. Wirtschaftlicher Stillstand. Schwindende Solidarität. Enttäuschung, Depression und Einsamkeit. Sinnkrise. Schon vor der Coronakrise hatte sich in der westlichen Politik Mutlosigkeit breitgemacht. Es herrschte das Gefühl vor, dass es in den von anonymen globalen Kräften gebeutelten Ländern mehr Verlierer als Gewinner gebe, dass die Öffentlichkeit durch soziale Medien vergiftet werde und dass es die Politik versäumt hatte, dem größer werdenden Bedürfnis nach Stabilität und Zugehörigkeit Rechnung zu tragen.
Und doch gibt es für viele dieser Punkte eine umfassende Erklärung, die so offensichtlich ist, dass sie viel zu oft übersehen wird. In den vergangenen Jahrzehnten wurden im Namen von Effizienz, Gerechtigkeit und Fortschritt Formen des Wettbewerbs eingeführt, in denen die Besten erfolgreich sind, während sich der große Rest als Versager fühlen darf.
Wer aber sind diese Besten? Menschen mit einem hohen Maß an kognitiven Fähigkeiten, oder zumindest Menschen, die das Bildungswesen als solche ausweist. Eine spezifische menschliche Fähigkeit – das kognitiv-analytische Denken, mit dessen Hilfe wir Prüfungen bestehen und im Beruf effizient Informationen verarbeiten – ist zur Messlatte für den Wert eines Menschen an sich geworden. Wer eine große Portion davon mitbekommen hat, gehört zu einer neuen kognitive Klasse – ich nenne sie Massenelite – , die heute die Gesellschaft nach ihrem eigenen Bild neu erschafft. Oder um es zugespitzt auszudrücken: Die Schlauen haben zu viel Macht.
Ist das anders als früher? Waren nicht schon vor siebzig Jahren, in den deutlich weniger komplexen Gesellschaften der Nachkriegszeit, die Führungskräfte in Politik und Wirtschaft durchschnittlich intelligenter als der Rest? Das mag sein, aber mit dem gewichtigen Unterschied, dass damals auch andere Fähigkeiten als das analytische Denken Wertschätzung genossen. Bildung war noch nicht das Schlüsselkriterium für die Zuordnung zu einer gesellschaftlichen Schicht. In den Siebzigerjahren hatten die meisten Menschen bestenfalls einen höheren Schulabschluss, und noch in den Neunzigerjahren kamen viele Fachkräfte ohne Studium aus.
Heute dagegen sind »die Besten und Talentiertesten« erfolgreicher als »die Anständigen und Fleißigen«, um es in politischen Floskeln auszudrücken. Eigenschaften wie Persönlichkeit, Integrität, Erfahrung, gesunder Menschenverstand, Mut und Fleiß sind zwar keineswegs bedeutungslos geworden, doch sie finden heute viel weniger Anerkennung. Die Unterbewertung dieser Tugenden trägt zu etwas bei, das Konservative gern als »moralische Deregulierung« bezeichnen: Es gilt heute nicht mehr viel, einfach nur ein anständiger Mensch zu sein, und es wird immer schwieriger, aus einem normalen und guten Leben Zufriedenheit und Selbstachtung zu beziehen, zumal in den unteren Regionen der Einkommensverteilung.
Unbemerkt ist etwas Wesentliches aus dem Lot geraten: das Gleichgewicht von »Kopf«, »Hand« und »Herz« beziehungsweise der Fähigkeiten, die man unter diesen Begriffen zusammenfassen könnte. Noch lässt sich nicht absehen, ob die Coronakrise ein entscheidender Anstoß ist, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, doch es ist dringend nötig. Keiner dieser drei Bereiche kommt ohne den anderen aus, doch die moderne Wissensökonomie begünstigt allenthalben die akademisch qualifizierte »Arbeit des Kopfes«, während sie der »Arbeit der Hand« immer weniger Geld und Anerkennung zukommen lässt. Gleichzeitig wird die »Arbeit des Herzens«, sprich Alten- und Krankenpflege sowie Kindererziehung, die in der Vergangenheit von Frauen innerhalb der Familie übernommen wurde, bis heute unterbewertet, und das obwohl diese Care-Arbeit in unserer Gesellschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt; an dieser Unterbewertung ändert auch der Applaus nichts, den sie auf dem Höhepunkt der Coronakrise erhielt.
Unsere Wirtschaft und Gesellschaft bot einst Platz für ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Kompetenzen – in den Lehrberufen, in der Landarbeit, in der Armee, in der Kirche und im privaten Bereich der Familie. Heute werden dagegen vor allem die Angehörigen der kognitive Klasse, also die Akademiker begünstigt. Dass dabei alte Strukturen und Lebensformen aufgebrochen wurden, war durchaus eine Voraussetzung für eine freiere und offenere Gesellschaft, vor allem für Frauen. Darüber sollten wir jedoch nicht vergessen, dass diese alten Strukturen auch Anerkennung boten, die nicht an Voraussetzungen geknüpft war, und dass sie Männern und Frauen mit anderen als kognitiv-analytischen Stärken Lebenssinn und Erfüllung gaben. Denn um Anerkennung zu finden, genügte es schon, an seinem Platz seinen Mann oder seine Frau zu stehen.
Einst hatten die verschiedenen Klassen, Gruppen und Regionen ihre eigenen Eliten, Hierarchien und Maßstäbe. Heute dagegen gibt es in den meisten Gesellschaften des Westens nur noch eine einzige, gemeinsame Elite, eine Massenelite, deren Angehörige alle dasselbe Nadelöhr der Universität durchlaufen haben und dem oberen Viertel der Fach- und Führungskräfte angehören. An der Spitze verschmelzen diese nationalen zu einer quasi globalen Elite von Menschen, die an denselben Universitäten studiert haben, für dieselben Unternehmen und Institutionen arbeiten und dieselben Medien konsumieren.
Lange waren kognitiv-analytische Fähigkeiten auch mehr oder weniger nach dem Zufallsprinzip über die gesamte Gesellschaft verteilt, und nur eine kleine Minderheit besuchte Universitäten, Priesterseminare oder andere elitäre Bildungseinrichtungen. In den vergangenen Jahrzehnten begann jedoch im Westen ein gewaltiger Ausleseprozess, an dessen Ende die meisten Jugendlichen, die eine höhere Schule besuchten, danach auch an die Universität gingen. Alle anderen Formen der Ausbildung wurden demgegenüber abgewertet, und ohne Studium wurde der Aufstieg auf der Karriereleiter immer schwerer.
Doch das bedeutet noch nicht, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, die tatsächlich nur Leistung belohnt. Noch immer hängt der berufliche Erfolg eines Menschen stark mit dem Einkommen und Bildungshintergrund seiner Eltern zusammen. Eltern mit Hochschulabschluss sind besser vernetzt und können ihren Kindern eher helfen, ein Studium aufzunehmen und eine angesehene berufliche Laufbahn einzuschlagen, selbst wenn die schulischen Leistungen eher mittelmäßig sind. Außerdem haben sie die nötigen Mittel, um in eine solche Ausbildung zu investieren. Die meisten westlichen Gesellschaften sind allerdings offen genug, dass auch viele der kognitiv Fähigen aus unteren sozialen Schichten durch Bildung aufsteigen können (womit sie auch zugleich die Machtverhältnisse legitimieren). Das Ergebnis ist letztlich eine in Teilen erbliche Leistungsgesellschaft, wie wir sie vor allem in den Vereinigten Staaten sehen.*
Angehörige der kognitiven Klasse könnten an dieser Stelle einwenden, dass schon immer Menschen mit besonderen kognitiven Fähigkeiten an der Spitze des Fortschritts standen und dass moderne, technisch hochstehende Gesellschaften mehr intelligente (und vor allem im Umgang mit Computern und Software geschulte) Kräfte benötigen als je zuvor. Sie könnten auch auf den sogenannten Flynn-Effekt (benannt nach dem neuseeländischen Politologen James Flynn) verweisen, demzufolge seit Jahrzehnten alle Menschen intelligenter werden – im Verlaufe des 20. Jahrhunderts ist der durchschnittliche Intelligenzquotient immer weiter gestiegen, was vor allem mit verbesserten Lebensbedingungen und der Anpassung des menschlichen Gehirns an immer anspruchsvollere kognitive Tätigkeiten zusammenhängt.1 Sie könnten daher argumentieren, dass alles im Lot ist, solange die genannten gesellschaftlichen Verzerrungen durch Investition in die Bildung beseitigt werden und Menschen jedweder Herkunft Zugang zur kognitiven Klasse erhalten.
Dem stimme ich jedoch nicht zu. Mit Bezug auf Soziologen wie Michael Young, Charles Murray oder Daniel Bell – einer Sozialist, einer konservativ, der Dritte ein Mann der Mitte – würde ich vielmehr argumentieren, dass in der sogenannten Leistungsgesellschaft lediglich eine Form der Herrschaft durch eine andere ersetzt wurde. Es ist zwar durchaus richtig, dass das Wissen der Motor unserer Zivilisation bleibt und dass es in unserer immer stärker auf Daten basierenden Wirtschaft sicher nicht an Bedeutung verlieren wird. (Nicht zuletzt die Coronakrise unterstreicht, wie wichtig kognitive Kompetenz etwa in der Medizin ist, allen voran in der Entwicklung von Impfstoffen, Medikamenten und der epidemiologischen Prognose. Wobei die Krise zugleich deutlich macht, wie sehr wir auf die nicht-kognitive Hand- und Herzarbeit angewiesen sind.) Und es stimmt auch, dass durch eine Öffnung der Bildung diese einer breiteren Bevölkerung zugänglich gemacht wurde. Nicht zuletzt mag auch die Erfolgsformel der Leistungsgesellschaft, die der Soziologe Michael Young in seiner dystopischen Satire Es lebe die Ungleichheit als IQ + Leistung aufgestellt hat, sicher ein geeigneteres Auswahlkriterium sein, als es Seilschaften und Vitamin B sind. Eine kognitive Klasse, die ihr Talent für Innovationen nutzt, ist einer erblichen Aristokratie allemal vorzuziehen und leistet einen größeren Beitrag zum Wohlstand. So weit gehe ich mit: Eine Leistungsgesellschaft hat durchaus einiges für sich. Sie macht menschliche Fähigkeiten nutzbar, schafft eine dynamische und wohlhabende Gesellschaft, die fairer zu sein scheint als die Alternativen, und eröffnet Chancen für Benachteiligte.
Und doch, wo Türen geöffnet werden, werden andere geschlossen, in diesem Fall für Menschen, die nicht das Glück oder die Fähigkeiten haben, eine Universität zu besuchen – und das ist selbst in den wohlhabenden Industrienationen die Mehrheit. Dazu kommt, dass unsere Bildung und angeborene Intelligenz genauso wenig unser eigenes Verdienst sind wie unsere Herkunft aus einer wohlhabenden Familie. Intelligenztests und Prüfungen mögen kognitive Kompetenzen ermitteln, doch sie sagen nichts über andere Fähigkeiten wie soziale Intelligenz oder Vorstellungskraft aus, die wir ebenso mit einem tüchtigen Menschen in Verbindung bringen. Wie ich in Kapitel 3 zeigen werde, ist Intelligenz ein komplexes, unscharfes und kontextabhängiges Phänomen, doch das ändert nichts daran, dass im Westen diese abstrakteste aller Formen des Denkens besonders hoch im Kurs steht.
Schon vor sechzig Jahren zeigte Michael Young in seiner Kritik der Leistungsgesellschaft, dass sich Menschen mit überdurchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten den Menschen mit unterdurchschnittlicher Intelligenz gegenüber weniger verpflichtet fühlen, als es die Reichen gegenüber den Armen tun. Die Leistungsgesellschaft zieht also einen tiefen Graben zwischen Gewinnern und Verlierern des Bildungswesens und macht die Verlierer psychisch anfälliger für die Folgen ihrer Schlechterstellung.
Auf Kompetenz aufbauende Hierarchien wird es immer geben. Doch wir müssen unterscheiden zwischen einem leistungsbezogenen Auswahlverfahren für bestimmte Tätigkeiten und einer Leistungsgesellschaft. Die Auswahl nach Leistung ist wünschenswert: Wir wollen schließlich unser Atomprogramm in die Hände kompetenter Kernforscher geben. Die Leistungsgesellschaft ist dagegen keine gesunde Gesellschaftsform, sondern im Gegenteil die Ursache für breite Unzufriedenheit.
Das wirft zwei Fragen auf. Ist eine Auslese nach Leistung möglich ohne Leistungsgesellschaft? Ich glaube ja, denn die eine Messlatte für den Wert eines Menschen existiert nicht. Für die Qualitäten eines Menschen gibt es andere Maßstäbe als nur jene der kognitiven Leistungselite. Für das Wohl der Menschheit ist vielmehr eine breite Palette von Fähigkeiten nötig.
Die zweite Frage wird oft von Menschen aufgeworfen, die aus benachteiligten Gruppen in die Elite aufgestiegen sind: Die Leistungsgesellschaft mag nicht perfekt sein, aber ist sie nicht allemal besser als die Rückkehr zu einer erblichen Aristokratie? Natürlich ist sie das – und wir wollen die Uhr ja auch nicht zurückdrehen. Aber wenn sich eine gute Gesellschaft durch Aufstiegschancen für alle auszeichnet, wie Politiker rechts und links der Mitte in den vergangenen Jahren nicht müde werden zu betonen, dann haben wir ein Problem, wenn »Intelligenz Intelligenz gebiert«. Wir wollen nämlich eine Elite, die so offen und durchlässig ist, wie eine gerechte Gesellschaft dies verlangt. Und dabei sollte es möglich sein, auch anderen als kognitiven Fähigkeiten ihre verdiente Anerkennung und ihren Lohn zukommen zu lassen.
Es ist durchaus umstritten, wie nahe wir diesem Anspruch kommen können und welches Maß an Aufstiegschancen wir von einer gerechten Gesellschaft erwarten können, wie ich noch in Kapitel 3 zeigen werde. Alles hängt davon ab, inwieweit die Herkunft auch weniger Begabte begünstigt und inwieweit Erfolg tatsächlich von der persönlichen Leistung abhängt. Da beides eine Rolle spielt, und da wir nach wie vor in einer relativ freiheitlichen Gesellschaft leben, in der Eltern ihre Privilegien an ihre Kinder weitergeben können, ist die Leistung des Einzelnen nicht das einzige Kriterium, und die Gefahr einer erblichen Elite bleibt bestehen. In der Praxis neigt unsere Leistungsgesellschaft zur Oligarchie.
Über einen der schwierigsten Drahtseilakte der offenen modernen Gesellschaft wird leider nur selten gesprochen: Wie können wir unserer kognitiven Leistungsgesellschaft Zügel anlegen und verhindern, dass besondere kognitive Leistungen mit einem Übermaß an Status und Einkommen belohnt werden, ohne gleichzeitig die Intelligentesten und Ehrgeizigsten abzuschrecken? Intelligenz mag sich selbst Lohn genug sein, doch das ändert nichts daran, dass der Beitrag hochbegabter Menschen besondere Anerkennung verdient.
Alle Menschen empfinden es als befriedigend, wenn sie etwas gut können und gut machen. Dabei geht es in Ordnung, wenn komplexere und verantwortungsvollere Tätigkeiten wie der Entwurf eines Gebäudes oder die Entwicklung eines neuen Medikaments besser entlohnt werden als zum Beispiel die Zustellung von Paketen. Es ist allerdings auch klar, dass viele Tätigkeiten, die ein Studium voraussetzen, erheblich weniger nützlich und produktiv sind als andere, weniger qualifizierte Tätigkeiten. Wer wollte zum Beispiel behaupten, dass ein Accountmanager in einem Unternehmen für Finanz-PR wichtiger ist als eine Busfahrerin oder ein Altenpfleger? Viele Tätigkeiten in hochdotierten Branchen wie dem Rechts- und Finanzwesen laufen auf Nullsummenspiele hinaus – die eine Seite gewinnt, die andere verliert, ohne dass die Gesellschaft irgendeinen Nutzen davon hätte.
Eine gesunde Gesellschaft muss einen Ausgleich finden zwischen der Ungleichverteilung der Anerkennung, die sich durch den Wettbewerb um hochdotierte Tätigkeiten ergibt, und dem Gleichheitsgrundsatz einer demokratischen Zivilgesellschaft, nach dem jeder Mensch dieselbe Anerkennung verdient. Es ist ein Spannungsverhältnis zwischen wirtschaftlicher Ungleichverteilung und politischer Gleichheit. Um heftige Ressentiments zu verhindern, sollte eine demokratische Gesellschaft daher eine Vielfalt von Fähigkeiten anerkennen und entlohnen, und zwar kognitive wie nicht-kognitive. Außerdem muss sie auch denjenigen Menschen Sinn und Anerkennung bieten, die sich in Schule und Beruf nicht hervortun können oder wollen. Schließlich wird rein definitionsgemäß die Hälfte der Bevölkerung kognitiv immer unter dem Durchschnitt liegen.
In den vergangenen Jahren ist ein solches Gleichgewicht allerdings stark aus dem Lot geraten. Es entsteht der Eindruck, dass es der alten Industriegesellschaft bei allen Mängeln besser gelungen ist, ihren Bürgern Status und Anerkennung zukommen zu lassen, als unserer heutigen sogenannten postindustriellen Gesellschaft. Gerade in Parteien links der Mitte sind viele überzeugt, dass sich die Ungleichverteilung von Vermögen und Einkommen durch Umverteilung und Investition in die Bildung beseitigen ließe. Dabei hat sich trotz aller gegenteiliger Behauptungen das Einkommensgefälle im Westen gar nicht so sehr verschärft.2 Wenn die wirtschaftliche Ungleichverteilung hinter der Politikverdrossenheit und dem Aufstieg des Rechtspopulismus stünde, wieso sind diese Entwicklungen dann auch in den Ländern Skandinaviens zu beobachten, wo die Einkommensunterschiede so gering sind wie nirgendwo sonst?
Es stimmt, dass eine Stagnation der Löhne schwerer zu ertragen ist, wenn eine kleine Minderheit, allen voran im Finanzsektor, von der Sparpolitik ausgenommen ist. Und die Vermögensverteilung wird dank der steigenden Immobilienpreise im reichen Westen zu einer Art Erbaristokratie; so ist zum Beispiel in Großbritannien jeder fünfte Angehörige der Nachkriegsgeneration Millionär, während junge Menschen keinen Fuß in den Immobilienmarkt bekommen.3 Doch all das lässt das wichtigere, aber schwerer zu fassende Thema Selbstwertgefühl außer Acht. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Angus Deaton, der sich mit dem Phänomen des »Todes durch Verzweiflung« (durch Alkoholismus und Drogenmissbrauch verschuldete Selbstmorde und Todesfälle) in den Vereinigten Staaten beschäftigt, ist verwundert, wie wenig die finanzielle Lage der Opfer mit diesen Schicksalen zu tun hat. Ähnlich kommt die aktuelle Glücksforschung zu dem Schluss, dass Einkommen kaum Einfluss auf unser Glücksempfinden hat.
Ich bezeichne mich selbst als Sozialdemokraten und möchte in einer gerechteren Gesellschaft leben. Meiner Ansicht nach ist eine wichtige Ursache unseres Problems die Unterbewertung nicht-kognitiver Tätigkeiten. Wenn wir den Pflege- und Erziehungsberufen mehr Anerkennung und Einkommen zugestehen würden, dann würde sich das Einkommen automatisch gleichmäßiger über die gesamte Gesellschaft verteilen, und unser Wirtschaftswachstum wäre stabiler.
Die westliche Philosophie von Platon bis Descartes und das Christentum sehen im Geist den Ort der Wahrheit und im Körper den Ursprung aller Begierden und Unmoral. Arbeiten mit Körper und Emotionen, zum Beispiel die Erziehung der Jungen und die Pflege der Alten, genießen daher weniger Ansehen und sind zudem überwiegend weibliche Tätigkeiten. Viel zu oft setzen wir kognitive Fähigkeiten und Leistungen mit dem Wert eines Menschen an sich gleich. Das schleicht sich auch in unsere alltäglichen Beurteilungen ein. Zeitungen berichten eher über den Unfalltod einer 22-jährigen Medizinstudentin als über den eines 22-jährigen Friseurs. Wie oft sagen wir beispielsweise über einen neuen Bekannten, er sei »so intelligent«, wenn wir etwas Positives über ihn sagen wollen. Und wie oft beschreiben wir einen Menschen dagegen als großzügig oder weise?
Auch in der Politik herrscht eine eindeutige Tendenz zur Überbewertung des Kopfes. Kognitive und analytische Fähigkeiten und Erfolg in der Wissensökonomie hängen eng mit den freiheitlichen Werten der Autonomie, Mobilität und Modernität zusammen – dem Gegenteil der Provinzialität. Kreative und intelligente Menschen wünschen sich den freien Austausch von Ideen über alle Grenzen hinweg. Außerdem haben sie ein größeres Interesse an räumlicher Mobilität, die ihnen internationale Karrierechancen eröffnet. Diese Denkgewohnheiten herrschen in der kognitiven Klasse vor, weshalb es Studierten oft schwer fällt, konservativ denkende Menschen zu verstehen.
Verortet oder mobil?
In meinem letzten Buch The Road to Somewhere beschäftigte ich mich mit den widersprüchlichen Werten der britischen Gesellschaft, die sich letztlich auch im Ergebnis der Brexit-Abstimmung niedergeschlagen haben. Auf der einen Seite stehen hochmobile Akademiker (25 bis 30 Prozent der Gesellschaft), die oft weit von ihrem Geburtsort entfernt leben, Offenheit und Autonomie schätzen und gut mit gesellschaftlicher Mobilität und Innovation zurechtkommen. Auf der anderen Seite stehen stärker verortete Menschen. Sie machen etwa die Hälfte der Gesellschaft aus, haben keinen Hochschulabschluss, sind verwurzelter, schätzen Sicherheit und Vertrautes, und legen größeren Wert auf die Zugehörigkeit zu regionalen und nationalen Gruppen. (Eine dritte Gruppe teilt Werte beider Lager.)
Mobile Menschen haben in der Regel keine Schwierigkeiten im Umgang mit gesellschaftlichen Veränderungen, da sie eine »erworbene Identität« haben, das heißt, sie beziehen ihr Selbstverständnis aus ihren akademischen und beruflichen Leistungen. Diese Menschen können sich überall einfügen. Stärker verortete Menschen haben dagegen eher eine »zugeschriebene Identität«, das heißt, sie sind stärker an einem Ort oder in einer Gruppe verwurzelt, weshalb ihnen rasche Veränderungen eher zu schaffen machen.
Die Grenze zwischen diesen beiden Gruppen ist fließend und keinesfalls mit kognitiven Unterschieden gleichzusetzen. Es gibt unterdurchschnittlich intelligente Mobile und überdurchschnittlich intelligente Verortete. Ganz abgesehen davon, dass keine Einigkeit darüber herrscht, was kognitive Fähigkeiten überhaupt sind und ob sie sich mithilfe von Intelligenztests und Prüfungen ermitteln lassen. Jeder von uns kennt hochgradig kompetente Menschen, die in der Schule kein Bein auf den Boden bekommen, und andere mit Bestnoten, die ansonsten nicht sonderlich hell im Kopf scheinen.
Der Graben zwischen den Mobilen und Verorteten wurde durch die immer stärkere Verengung auf kognitive Kompetenzen in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend tiefer. Doch wie der Autor und Zeichner David Lucas überzeugend darlegt, braucht die Gesellschaft neben den kognitiven Fähigkeiten der Wissensökonomie auch Handwerker, Techniker und andere Berufe sowie die Fantasie der Künstler und die emotionale Intelligenz der sozialen Berufe.4 Seiner Ansicht nach hat die Unterbewertung von Herz und Hand eine Schieflage bewirkt und Millionen von Menschen ausgegrenzt. Diese Verzerrung ist nicht nur mitverantwortlich für viele unserer politischen Krisen und psychischen Probleme, sondern auch für den Arbeitskräftemangel in Pflegeheimen und Krankenhäusern.
Natürlich sollten kluge Menschen egal welcher Herkunft so weit kommen, wie es ihnen ihre Talente erlauben. Und für die Klügsten ist eben die Universität der beste Ort, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Allerdings gibt es auch viele intelligente und kreative Menschen, deren Intelligenz sich in nicht-akademischer Form äußert, die nicht für ein Studium geeignet sind und besser beraten sind, direkt einen Beruf zu ergreifen. Doch im Westen wird das Bild von der Traumkarriere heute allzu oft mit Studium und akademischen Berufen identifiziert. Da nimmt es nicht wunder, dass in den Vereinigten Staaten 93 Prozent der Kongressabgeordneten und 99 Prozent der Senatoren mindestens einen Bachelor-Abschluss haben. In Großbritannien können mehr als 90 Prozent der Abgeordneten des Unterhauses ein abgeschlossenes Studium vorweisen, während es in den Siebzigerjahren noch weniger als die Hälfte waren. In Deutschland, so fand eine Studie der Tageszeitung Die Welt heraus, hatten im Jahr 2019 82 Prozent der Bundestagsabgeordneten einen Hochschulabschluss, während es in der Gesamtbevölkerung nur 18 Prozent sind.
Politiker aller Richtungen vertreten dieses Bildungsmodell. In einer hochgelobten Rede zur Ungleichheit verkündete Präsident Obama: »Ein Hochschulabschluss ist der sicherste Weg in die Mittelschicht.« Und linke Demokraten wie Bernie Sanders oder Elizabeth Warren gehen gar so weit, »Studium für alle« zu fordern.
Auf Gebieten wie Recht, Medizin und Technologie sind so Monopole entstanden, die einigen wenigen Menschen mit großer kognitiver Kompetenz und dem praktischen Knowhow für digitale Pionierleistungen – Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk – traumhafte Einkünfte bescheren. Auf sie folgt eine größere Gruppe von gut ausgebildeten Menschen, die an führenden Universitäten studiert haben und die für diese Spitzenjobs nötige Intelligenz und Persönlichkeit mitbringen. Dann kommt das Fußvolk der kognitiven Klasse, die Massenelite. Diese Menschen haben studiert, weil sie von Eltern und Lehrern angeleitet oder von finanziellen Anreizen gelockt wurden, oder weil es schlicht zu wenig Alternativen gibt. In Großbritannien hat heute die Mehrheit der Unter-Dreißigjährigen einen Hochschulabschluss. Viele haben wertvolle Qualifikationen erworben und eine erfolgreiche Laufbahn eingeschlagen, doch allzu viele haben wertlose Studienabschlüsse und arbeiten in Tätigkeiten, die kein Studium erfordern (gleichwohl haben sie sich im Studium mit Schulden belastet).
Die Angehörigen dieser letzten Gruppe sind nicht unbedingt intelligenter als der Rest der Bevölkerung. Ihre Zugehörigkeit zur kognitiven Klasse verdanken sie vielmehr ihrer Herkunft, gesellschaftlichen Gepflogenheiten und Eigenschaften wie Selbstdisziplin und Fleiß, die schulischen Erfolg ermöglichen. Trotzdem hegen gerade die Angehörigen dieser Massenelite oftmals Erwartungen an ihren beruflichen Status, die in ihren recht alltäglichen Tätigkeiten nicht erfüllt werden.
Sich an der Universität mit Sanskrit oder Goethe zu beschäftigen, kann natürlich eine große persönliche Bereicherung darstellen. Doch gerade in den Geisteswissenschaften geht es weniger darum, konkretes Wissen zu erwerben, als vielmehr darum, einem potenziellen Arbeitgeber zu signalisieren, dass man ein bestimmtes Profil mitbringt. Der erworbene akademische Grad übersetzt sich in einen Rang in der Unternehmenshierarchie. Aber wenn ein Hochschulabschluss die Voraussetzung für berufliche Anerkennung ist, warum sollte man ihn Pflegekräften und Polizisten dann verweigern? Die Folge ist eine Titelinflation, »die sich endlos fortsetzt, bis man von Hausmeistern eine Promotion und von Babysittern ein Diplom im Kinderhüten verlangt«, wie Bildungssoziologe Randall Collins schreibt.5
In Großbritannien wurden in den vergangenen Jahren Anstrengungen unternommen, den Schulabgängern, die kein Studium aufnehmen wollen, bessere Möglichkeiten anzubieten und Unternehmen zur Schaffung von Ausbildungsplätzen zu motivieren. Doch häufig können die Ausbildungsberufe an Ansehen nicht mit dem Studium mithalten, und das Fehlen von technischen und handwerklichen Auszubildenden hat einen Fachkräftemangel zur Folge. 2017 gaben 42 Prozent der britischen Arbeitgeber an, sie hätten Schwierigkeiten, ihre Facharbeiterstellen zu besetzen.6
Die Herzarbeit, insbesondere Tätigkeiten in der Altenpflege und der Kinderbetreuung, ist besonders unterbewertet und oftmals auch unterbezahlt. In Großbritannien verdienen Pflegekräfte rund 17 000 Pfund (20 000 Euro) im Jahr, und selbst in London verdienen Tagesmütter pro Kind nur 6 Pfund (etwa 7 Euro) pro Stunde. Der Frauenbewegung geht es heute in erster Linie darum, die gläserne Decke zu durchbrechen und auf dem Arbeitsmarkt mit Männern zu konkurrieren. Weniger setzt sie sich dagegen für die Aufwertung von traditionellen Frauenberufen im sozialen Sektor ein. Frauen haben heute weit mehr Berufschancen als in den Fünfziger- und Sechzigerjahren, weshalb sich immer weniger für diese Bereiche entscheiden. Aber nur wenige Männer springen in die neue Lücke. Die Folge ist ein Arbeitskräftemangel im gesamten sozialen Sektor.
Natürlich sind Kopf, Hand und Herz keine Gegensätze, sondern sie spielen immer zusammen. Herz und Kopf kommen in diplomierten Pflegern zusammen, die einfache ärztliche Aufgaben übernehmen. Und viele Handwerker wie Heizungsmonteure, Automechaniker und IT-Fachkräfte müssen kognitive Diagnosen durchführen, die kaum hinter denen eines Arztes zurückstehen.
Mobil verortet
Unsere Kultur wird zunehmend von der Abstraktion und Distanziertheit des Kopfes beherrscht. Google und Facebook propagieren bewusst ein nicht-verortetes und globales Selbstverständnis. Am schönsten bringt das der AirBnB-Slogan »Weltweit Zuhause« auf den Punkt. Das Internet und die sozialen Medien helfen uns zwar, in der Coronakrise und auch unter normalen Umständen Kontakt und Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Andererseits schnüren die digitalen Plattformen die Kleinanbieter immer weiter ab, sie verringern den menschlichen Kontakt und das Gefühl der Zugehörigkeit zu konkreten Orten. Die unterbewerteten Hand- und Herzkompetenzen fördern dagegen regionale Bindungen und Zugehörigkeit.
Im gesamten Westen greifen psychische Erkrankungen um sich – ein wichtiger Indikator für die Verschlechterung der Lebensqualität. Nach Erkenntnissen der Glücksforschung hat unsere seelische Gesundheit einige unabdingbare Voraussetzungen: einen Lebenssinn; das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein; und das Bewusstsein, von anderen gebraucht zu werden. Unsere Bindungen – Liebe, wechselseitige Beziehungen und der Dienst für andere – vermitteln uns ein Sinngefühl. Mit anderen Worten: Unser Lebenssinn fällt in die Domäne des Herzens. Auch die Hand spielt hier freilich eine Rolle. Produktive Hand- und Kopfarbeit auf einem Bauernhof oder in einer Fahrradwerkstatt vermitteln das befriedigende Gefühl, Teil von etwas zu sein, an einen konkreten Ort zu gehören und mehr zu sein als ein körperloser Geist, ein Hirn im Einmachglas. Körperliche Arbeit kann auch geistig befriedigend sein, wie der Philosoph Matthew Crawford in seinem Buch Ich schraube, also bin ich beschreibt. Doch in der modernen westlichen Welt werden Erfolg und Glück zunehmend mit räumlicher Mobilität, der Überwindung von Raum und Zeit sowie von Bräuchen und Gepflogenheiten in Verbindung gebracht.
Tatsache ist, dass der Zutritt in die Welt der kognitiven Überflieger oftmals räumliche Mobilität voraussetzt, vor allem während des Studiums. Die ehemalige britische Bildungsministerin Justine Greening brachte es auf den Punkt, als sie 2017 sagte: »Meine gesamte Jugend in Rotherham hindurch habe ich mich nach etwas Besserem gesehnt; nach einer besseren Arbeit, nach einem Eigenheim, nach einem interessanten Beruf, nach spannenden Aufgaben. Ich habe gewusst, dass es etwas Besseres geben musste.«7 Dass Stadtluft frei macht, glaubte man wohl schon immer. Doch die Selbstverständlichkeit, mit der eine Ministerin annimmt, man könne als ehrgeiziger Mensch in einer Stadt mit 120 000 Einwohnern und in dreißig Minuten Entfernung zur Millionenstadt Sheffield keine Erfüllung finden, erklärt viele der Probleme unserer modernen Gesellschaft. Städte wie Rotherham verlieren jährlich 20 bis 30 Prozent der klügsten 18-Jährigen an Universitätsstädte. Viele kommen nie zurück und verschärfen damit das Gefälle im Land. Denn wie Peter Lampl von Sutton Trust, einer britischen Stiftung zur Förderung der gesellschaftlichen Mobilität, feststellt: »Die Mobilsten haben oft am ehesten Erfolg.« (Daher will der Sutton Trust auch Angehörigen von wirtschaftlich benachteiligten Gruppen zur »Mobilitätsprämie« verhelfen.)8
Der amerikanische Autor Michael Lind beschreibt dies als einen Gegensatz zwischen Drehscheiben und Herzland: In den Ersteren sind Akademiker und akademische Dienstleistungen angesiedelt, in Letzteren die Fertigung und Massendienstleistungen. Die Drehscheiben sind liberal, hier lebt ein Großteil der ethnischen Minderheiten, und gleichzeitig zeichnen sie sich durch eine erstaunliche Ungleichheit aus: In New York City ist die Kluft zwischen den Ärmsten und den Reichsten so groß wie in Swaziland.9 Dank des Zentralismus und der übermächtigen Hauptstadt London hat auch Großbritannien seine Provinz sträflich vernachlässigt. Ähnliches ist in Frankreich zu beobachten, wo die Gelbwesten unter anderem eine stärkere Anerkennung der Provinz einfordern, oder im Osten Deutschlands.
Aber nicht alle wollen oder müssen sich entwurzeln und mobil werden. Und selbst wenn, es könnten in der kognitiven Klasse nicht alle nach oben kommen. Was aber alle brauchen, ist ein Platz in der Gesellschaft, von dem aus sie ihren Beitrag leisten können, auch wenn sie nicht zur Elite gehören. Wie Joan C. Williams in ihrem Buch White Working Class schreibt, verspüren in den Vereinigten Staaten viele Angehörige der Arbeiterschicht »gar nicht den Wunsch, zur oberen Mittelschicht mit ihrer ganz anderen Kultur zu gehören. Sie wollen lieber ihren Werten und ihrer Gemeinschaft treu bleiben, nur vielleicht mit einem besseren Einkommen.« Gerade in den Vereinigten Staaten ist die räumliche Mobilität in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gesunken. In seinem Buch The New Class War schreibt Michael Lind, 57 Prozent aller Amerikaner hätten nie außerhalb ihres Bundesstaats gelebt, und 37 Prozent blieben sogar in ihrem Geburtsort wohnen. Eine von der New York Times veröffentlichte Analyse ergab, dass der erwachsene Durchschnittsamerikaner maximal 30 Kilometer von seiner Mutter entfernt lebt.10 Die Zahl der Menschen, die zum Arbeiten in einen anderen Regierungsbezirk pendeln, hat sich seit den Fünfzigerjahren halbiert und liegt heute bei nur noch 4 Prozent der Bevölkerung.11
Damit kommen wir zu einer zentralen Herausforderung demokratischer Politik im Westen: Wie kann man eine offene Gesellschaft und Elite schaffen und gleichzeitig stabile und sinnstiftende Gemeinschaften fördern? Wie können ehrgeizige Menschen ihre Aufstiegswünsche verwirklichen, ohne dass diejenigen, die ihren Geburtsort nicht verlassen, sich zurückgesetzt fühlen? Wie kann man denen, die bleiben, dieselbe Chance auf ein erfolgreiches und erfülltes Leben geben wie denen, die gehen?
Die digitale Vernetzung erleichtert es den Mobilen, den Kontakt zu halten, während sie den Verorteten das Gefühl vermitteln kann, dass sie nicht gehen müssen, um teilzuhaben. Doch die von Mobilen dominierte politische Klasse hat dieses Dilemma verkannt und ein Vierteljahrhundert lang vor allem ihre eigenen Interessen im Blick gehabt: Sie hat die Mobilität gefördert, auf eine Öffnung von Wirtschaft und Gesellschaft gedrängt und die Hochschulbildung ausgebaut. An die Stelle der Arbeitsethik, die Pflicht und Dienst in den Mittelpunkt stellte und viele Berufe so lange getragen hat, trat immer öfter ein moralischer Führungsanspruch. Im politischen Ziel der Mobilität kommt oft auch eine Art Selbstverliebtheit der kognitiven Klasse zum Ausdruck: »Auch ihr könnt so werden wie wir.« Dahinter steckt häufig die Überzeugung, dass jeder andere Lebensentwurf weniger wert ist.
Gleichzeitig ignorierte die politische Klasse einige der politischen Grundbedürfnisse der Verorteten: den Wunsch nach stabilen Gemeinschaften und sicheren Landesgrenzen; die Forderung nach einem nationalen Gesellschaftsvertrag; den Vorzug von Bürgerrechten gegenüber Menschenrechten; und die Weiterentwicklung, aber nicht die Abschaffung der Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Außerdem verkennt die politische Klasse das Bedürfnis nach Sinn und Anerkennung bei Menschen, die nicht zur kognitiven Klasse gehören. Vorstellungen wie die Würde der Arbeit oder der Dienst am Gemeinwohl eines Landes scheinen heute antiquiert. Für Menschen mit Hochschulabschluss kann Arbeit zwar sinn- und identitätsstiftend sein, doch die Hälfte der Briten sieht in ihr nicht mehr als einen Broterwerb und sucht ihren Lebenssinn in anderen Bereichen.
Weil hochqualifizierte Mobile oft besser kommunizieren und mit Informationen umgehen, reden sie sich gern ein, dass ihre Werte vernünftig und selbstverständlich sind. Dabei stellen sie jedoch nur ihre eigenen Prioritäten oben an und unterfüttern sie nachträglich mit Beweisen – das bezeichnet man als motivierte Argumentation. Außerdem neigen sie zur Gruppendenke. Wie blind diese machen kann, zeigt sich zum Beispiel darin, dass diese kognitive Klasse weder die Reaktion der Irakis auf die Invasion, noch die Finanzkrise des Jahres 2009, das Ergebnis der Brexit-Abstimmung oder die Wahl von Donald Trump vorhergesehen hat. Dieser Liste könnte man auch die mangelnde Vorbereitung auf Epidemien wie Corona anfügen, da ein solches Ereignis schon lange vorhergesagt wurde. Die kognitive Elite der Naturwissenschaft und Medizin genießt nach wie vor hohes Ansehen und wird sicher infolge der Coronakrise weiter an Status gewinnen. Doch gegenüber Politik-, Wirtschafts- und Gesellschaftsexperten, die ihre politisch motivierten Ansichten als objektive Erkenntnisse verkaufen wollen, wird die Skepsis groß bleiben.
In Großbritannien und den Vereinigten Staaten ist das Gleichgewicht zwischen Kopf, Hand und Herz noch stärker aus dem Lot geraten als im übrigen Europa, wo die Traditionen der Gemeinschaften sowie »praktische und berufliche Intelligenz« und nicht-akademische Tätigkeiten noch etwas höher im Kurs stehen. In Großbritannien und den Vereinigten Staaten stützt man sich zudem stärker auf Intelligenztests, die vorgeben, angeborenes Talent zu ermitteln, und nicht Leistung und erarbeitetes Wissen. Daher ist es kein Wunder, dass dort die Gegenreaktion auf die Vorherrschaft der kognitiven Klasse, obwohl der Anteil der Hochschulabsolventen hier am höchsten ist, am heftigsten ausfällt – siehe Brexit und Trump.
Das Ende der Vorherrschaft des Kopfes
Auf den folgenden Seiten werde ich der Frage nachgehen, wie sich jeder der drei großen Kompetenzbereiche Kopf, Hand und Herz seit Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelt hat. Außerdem umreiße ich die Debatte um die Natur und Verteilung der kognitiven Kompetenz und die Aussagekraft von Intelligenztests. Daneben gehe ich auch ein wenig auf meinen eigenen Entwicklungsgang als Journalist ein, der Politik anfangs durch die utilitaristische und wirtschaftliche Brille verfolgt hat und in den vergangenen zehn Jahren das Bedürfnis der Menschen nach Sinn und Anerkennung immer stärker in den Mittelpunkt gerückt und die Bedeutung von Emotionen und Erzählungen in der Politik und im Alltag erkannt hat. Wie der israelische Historiker Yuval Noah Harari schreibt, haben wir in der modernen Welt Sinn gegen Macht eingetauscht. Doch zu viele Menschen haben das Gefühl, den Sinn verloren und keine Macht bekommen zu haben. Hinter all dem steht die Frage nach unseren Werten. Was ist ein menschlicher Wert? Was ein kultureller Wert? Jonathan Sacks, ehemaliger Oberrabbiner der israelischen Gemeinde in Großbritannien, klagte einst, ohne Gott definierten wir menschliche Werte zunehmend nach Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, während wir die Frage nach Sinn und Werten in die Privatsphäre verlagern.
Wenn sich in den vergangenen Jahren die Methoden der kognitiven Messung durchgesetzt haben, dann auch deshalb, weil sie den Eindruck der Gerechtigkeit und Objektivität vermitteln. Auch die Akademisierung der Bildung hängt damit zusammen, dass sich schriftliche Aufgaben einfacher bewerten und messen lassen als handwerkliche oder sprachliche Kompetenzen. Das hat zur Folge, dass Akademiker oft sogar in Positionen den Vorzug erhalten, für die Menschen mit sozialer Intelligenz oder langer fachlicher Erfahrung geeigneter wären, etwa bei der Leitung eines Kaufhauses.
Ist ein besseres Gleichgewicht von Kopf, Hand und Herz möglich? Natürlich. Menschliche Werte und Normen unterliegen dem Gesetz von Angebot und Nachfrage und können sich erstaunlich schnell ändern, wie wir gerade in der Coronakrise erleben. In den meisten europäischen Staaten beträgt die Staatsquote rund 40 Prozent, und die Privatwirtschaft reagiert sensibel auf Haltungen und Werte der Öffentlichkeit. Man muss sich nur ansehen, welchen Einfluss Themen wie Gleichberechtigung und Umweltschutz in den vergangenen Jahren auf die Politik von Konzernen gewonnen haben. Eine der Triebkräfte des Wandels ist der politische Druck von Wählern, die die Interessen der kognitiven Klasse nicht teilen. Es gibt aber auch andere Entwicklungen, die vermuten lassen, dass der Wettbewerb zwischen Kopf, Hand und Herz in Zukunft wieder ausgeglichener wird.
Der amerikanische Journalist Nicholas Carr zeigt in seinem Buch Surfen im Seichten einen für den Kopf unerfreulichen Trend auf, wenn er argumentiert, dass uns das Internet verdummt.12 Er behauptet, beständiger Kontakt mit dem Internet programmiere unser Gehirn so, dass es immer Neues verlange und sich zunehmend schlechter konzentrieren könne. Auf einigen Gebieten kann das nützlich sein, doch insgesamt bedeute es einen spürbaren Verlust an sprachlicher Kompetenz, Gedächtnis und Konzentration.
Es gibt allerdings auch positive Entwicklungen, die zu einer Stärkung von Hand und Herz beitragen werden. Beide haben zwar im Vergleich zum Kopf in den vergangenen Jahrzehnten an wirtschaftlicher Bedeutung eingebüßt, doch sie bleiben ein wichtiger menschlicher Motor. Nehmen wir nur das zunehmende Interesse am Kochen. In den Medien nimmt es heute deutlich breiteren Raum ein als vor drei Jahrzehnten, und darin zeigt sich, wie gern Menschen, die ihre Hände sonst nur noch zur Bedienung der Computertastatur gebrauchen, etwas mit den Händen machen. Ähnliches gilt für Garten-, Renovierungs- oder Reparaturarbeiten. Auch Rentner suchen sich nach ihrer Pensionierung zumeist körperliche Tätigkeiten – einen Sport oder ein Hobby, das mit Handarbeit zu tun hat. Die prominente Stellung von Sport und den Künsten in der Öffentlichkeit ist ein weiterer Hinweis. Diese Tätigkeiten setzen zwar oft auch eine erhebliche kognitive Kompetenz voraus, doch sie basieren auf Hand und Herz und verlangen eher handwerkliches und körperliches als analytisches Können. Für Männer der Unterschicht ist ein Ausweg noch immer der Sport, und für Frauen ist es die Schönheit – die junge Frau aus der Arbeiterschicht, die von einer Modelagentur entdeckt wird oder Instagram-Influencerin wird. Freizeit und Ritual hängen ohnehin fast immer mit Hand und Herz zusammen, auch wenn der Kopf natürlich überall mitspielt. In einigen Nischen der Wirtschaft werden handwerkliche Produkte wiederentdeckt, vor allem in der Lebensmittelproduktion, die Käufer sind oftmals junge Akademiker.
In einigen der großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Trends scheint eine Verschiebung von Kopf zu Hand und Herz geradezu angelegt. Die Wissensökonomie bietet künftig nur noch den fähigsten Wissensarbeitern Platz; die wachsende Sorge um die Umwelt fördert die regionale Produktion und die arbeitsintensivere biologische Landwirtschaft; und die Alterung der Gesellschaft macht einen Ausbau verschiedener Formen der Pflege unabdingbar. Diese und andere Entwicklungen werden durch die Coronakrise beschleunigt, die uns vor Augen führt, wie sehr unser Alltag von Hand und Herz, also von Arbeitskräften ohne Studium abhängt. Im kommenden Jahrzehnt wird sich die Politik einer konkreten Entwicklung stellen müssen: Die Parteien der Mitte sehen es als gegeben an, dass die Zahl der sicheren Arbeitsplätze für Hochschulabsolventen weiter zunimmt. Von dieser Annahme gehen Bildungs- und Gesellschaftspolitik aus, doch sie ist mit großer Wahrscheinlichkeit falsch.
Die Wissensökonomie benötigt kein wachsendes Heer von Wissensarbeitern (mehr dazu in Kapitel 9). Zwar werden noch immer fähige Spitzenanwälte gebraucht, doch die Aufgaben des akademischen Fußvolks erschöpfen sich schon heute überwiegend in Routinen und digitaler Fließbandarbeit. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman beobachtete dies schon 1996. In seinen Kolumnen für die New York Times stellte er sich vor, aus der hundert Jahre entfernten Zukunft in eine Gegenwart zurückzublicken, in der die Informationsbearbeitung immer weiter an Bedeutung verliert: »Die Propheten des Informationszeitalters scheinen die Grundlagen der Wirtschaftstheorie vergessen zu haben. In einer von Information überfluteten Welt hat die Information nur einen geringen Marktwert. Wenn eine Volkswirtschaft besonders effizient in der Herstellung eines bestimmten Produkts wird, dann verliert diese Tätigkeit an Wert.«13
Nach Beobachtungen der britischen Forscher Philip Brown und Hugh Lauder nimmt der Anteil der Konzernarbeitsplätze, die in besonderem Maße kognitive und analytische Kompetenz verlangen, stark ab, nur 10 bis 15 Prozent der Mitarbeiter haben »eine Denkerlaubnis«. Gerade die stärker standardisierten Aspekte der kognitiven Arbeit in Recht, Medizin, Verwaltung und so weiter sind in naher Zukunft von der Künstlichen Intelligenz oder von der Auslagerung in Billiglohnsektoren bedroht. Ein Buchhalter lässt sich einfacher durch ein Programm ersetzen als ein Müllfahrer oder eine Kindergärtnerin.
Das alles lässt vermuten, dass sich der rasche Ausbau der Hochschulen, den wir in den vergangenen dreißig Jahren gesehen haben, bald wieder umkehren könnte. In Großbritannien arbeitet bereits heute ein Drittel aller Hochschulabsolventen fünf Jahre nach dem Abschluss ihres Studiums in einer Tätigkeit, die kein Studium erfordert. Wer nicht gerade an einer Eliteuniversität studiert hat, hat gegenüber Nicht-Akademikern nur noch einen vernachlässigbaren Gehaltsvorsprung. Die Enttäuschung vieler junger Hochschulabsolventen, die das Gefühl haben, dass ihnen der versprochene Zutritt zu einer sicheren und angesehenen Karriere verwehrt wurde, ist einer der Gründe für den Linksruck der Labour Party in Großbritannien und der Demokraten in den Vereinigten Staaten.
Daher muss die Facharbeit wieder aufgewertet werden. Großbritannien produziert seit Jahrzehnten zu viele Akademiker und zu wenige Techniker, die die Welt noch immer am Laufen halten. Diese Lücke konnte lange nur durch den Zuzug von Fachkräften aus der Europäischen Union geschlossen werden. Weniger ausgeprägt ist dieser Trend in Deutschland, Österreich und den Niederlanden, wo die Berufsausbildung nach wie vor stark verankert ist. Doch selbst in Deutschland ist der Anteil der Hochschulabsolventen in den vergangenen Jahren stark gestiegen.
Bislang hat die Automatisierung vor allem in der Industrie Arbeitsplätze gekostet, doch mit dem Aufkommen der Künstlichen Intelligenz sind auch immer mehr Angestellte betroffen. Die Verdrängung, die selbst Akademiker erleben, könnte zu einer Wiederentdeckung der Hand- und Herzbranchen führen. Der Wirtschaftswissenschaftler Richard Baldwin sieht in seinem Buch The Globotics Upheaval vorher, dass auch die Akademiker, die sich gegen den Populismus gewehrt haben, bereit sein werden, eine neue Statusverteilung zu akzeptieren, wenn ihre Arbeit erst wegrationalisiert wurde. Gleichzeitig werden sich durch das Gesetz von Angebot und Nachfrage Löhne, Arbeitsbedingungen und Ausbildung in den Hand- und Herzbranchen verbessern. Denn von der Autoreparatur über die Paketzustellung bis zur Kinderbetreuung lassen sich die wenigsten alltäglichen Dienstleistungen ins Ausland verlagern oder an Roboter delegieren. Die minderqualifizierte Beschäftigung wird nicht verschwinden, wie viele Wirtschaftswissenschaftler meinen. Finanzminister Gordon Brown sagte 2006 vorher, im Jahr 2020 werde es in Großbritannien nur noch 600 000 Hilfsarbeiterstellen geben. Je nachdem, wie man »Hilfsarbeiter« definiert, werden es kommendes Jahr jedoch eher 8 Millionen sein.
Wenn sich im Westen der Produktivitätszuwachs in den vergangenen Jahren verlangsamt hat, dann auch deshalb, weil die durch die Automatisierung freigesetzten Arbeitskräfte oft in Tätigkeiten mit geringer Produktivität landen. Oder wie der Economist schreibt: »Der technische Fortschritt verdrängt die Beschäftigten in Branchen und Tätigkeiten, in denen kaum Produktivitätszuwächse möglich sind: Konzertmusiker, Käseproduktion im Kleinbetrieb oder Hausangestellte der Superreichen.«14 Oder medizinisches Personal auf einer Intensivstation, könnte man ergänzen.
Es werden immer Menschen gebraucht, die Büros reinigen, in Supermärkten die Regale auffüllen, in Cafés bedienen, bestellte Waren ausliefern, auf dem Feld arbeiten oder Autos und Computer reparieren. Onlinehändler wie Amazon sorgen zwar dafür, dass im Einzelhandel Stellen verloren gehen, doch dafür schaffen sie neue Arbeitsplätze in Auslieferzentralen und Zustellfirmen. Einige der Arbeiten könnten sicher von Maschinen oder Migranten übernommen werden, sodass die heimischen Arbeitnehmer in der Hierarchie aufsteigen könnten. Doch angesichts der europäischen Ablehnung gegen die Masseneinwanderung wäre es angebrachter, die Arbeit so zu gestalten, dass sie attraktiver für die Einheimischen wird. Einige dieser Tätigkeiten sind natürlich körperliche Schwerarbeit, doch wenn sie gut bezahlt werden und sich die Arbeitnehmer fair behandelt und respektiert fühlen (wie dies Zusteller und Mitarbeiter von Supermärkten während der Coronakrise erleben durften), können auch sie Sinn und Identität stiften. Wobei Menschen natürlich auch in anderen Lebensbereichen Sinn finden können, etwa in Familie, Sport oder Freizeitaktivitäten.