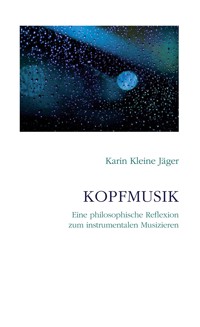
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In instrumentalen Lernprozessen bleibt das subjektive Erleben der Schüler meist unberücksichtigt. Vor diesem Hintergrund analysiert Karin Kleine Jäger philosophisch argumentierend die Tradition der Abwertung sinnlicher Qualitäten gegenüber den geistigen Aspekten der Musik. Bis heute führt dies dazu, dass Form und Struktur der Musik selbstverständliche Ausgangspunkte der Unterrichtspraxis sind. Das theoretische Fundament eines Unterrichts, der die Körperlichkeit der Musizierenden konsequent berücksichtigt, wird anschließend auf der Grundlage phänomenologischer Überlegungen detailliert beschrieben. So zeigt die Phänomenologie auf, wie wir als Gesamtorganismus immer schon leiblich auf die erklingende Musik bezogen sind, noch bevor wir über sie nachdenken. Instrumentale Fähigkeiten basieren demnach elementar auf unserer Leiblichkeit. Wird auf diese Weise die ursprüngliche Funktion von Musik als Körpersprache deutlich, verändert sich musikalisches Lernen. Nun wird es notwendig, die Musik auch im Unterricht in der unmittelbaren Erfahrungsdimension zu belassen. Zudem verwandeln sich instrumentale Bewegungen: Eine kontrollierte motorische Ausführung der Instrumentaltechnik kann immer mehr als leibliche Geste erlebt werden. In der Empfindung von uns selbst als körperlicher Einheit erfassen wir die musikalische Bedeutung jetzt ganz unmittelbar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 81
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
I. Einleitung
1. Der Körper im Hintergrund unseres Handelns
2. Körper- und Leibperspektive
3. Aufbau der Untersuchung
II. Der kontrollierte Körper
1. Musikalische Körperwelten
2. Zivilisierte Menschen
3. Einflüsse der Philosophie
III. Phänomenologische Deutungen
1. Musikalisches Erleben und Verstehen
2. Ursprüngliche Intentionalität
3. Die instrumentale Bewegung als Geste
3.1. Einheit von Ausdruck und Bedeutung
3.2. Zeitlichkeit
3.3. Zwischenleiblichkeit
4. Phänomenologische Schlussbetrachtung
IV. Implikationen für die Praxis
1. Erfahrungsweisen musikalischen Handelns
2. Neuorientierung im Instrumentalunterricht
V. Fazit
VI. Literatur
Anhang
Kafka beschreibt seinen »Er« als das einzige Wesen, das zwischen Vergangenheit und Zukunft steht. Ihn und ihn allein trifft die volle Wucht der Kräfte, die ihn von beiden Seiten gleichzeitig bedrängten. […] Der Mann kämpft nicht mit der Zeit, sondern mit den Bildern, die er sich von der Zeit gemacht hat. Er wird nicht von den Mächten Vergangenheit und Zukunft bedrängt, sondern von der Macht, die er seinen eigenen Worten eingeräumt hat. Vergangenheit und Zukunft fallen über ihn her wie der Geist aus der Flasche, aber er merkt nicht, daß es nur ein Papiergeist ist, auf dem die Worte »Vergangenheit« und »Zukunft« geschrieben stehen. Ringsum von Worten und Bildern bedrängt, träumt er nicht davon, Raum und Zeit in Gedanken zu transzendieren, […] sondern den Traum, die Sprache zu transzendieren – in einer Wachheit, die nicht mit Denken gleichzusetzen ist und die nicht das Bedürfnis hat, sich als »Wachheit« zu artikulieren.
In diesem Traum erfüllt der Richter wieder die Bedeutung des mittelfranzösischen Worts nomper (der Nicht-Gleiche) – der Mann wird wirklich zu einem Nicht-Gleichen, wenn er davon träumt, über seinen Gegnern zu stehen. Er ist nicht mehr gleich, weil sie Bilder sind und er ein Mensch. Er sieht, daß sie weder tiefgründig noch banal sind und daß er allein verdient, tiefgründig oder banal genannt zu werden, wenn er sich ihrer bedient.
Louis E. Wolcher, Die Sprache der Zeit
Prolog
An einem stürmischen Herbsttag stehe ich am Meer, bin Teil eines Geschehens, welches mich in den Bann zieht. Ich spüre den Sturm, dem ich mich entgegenstelle und auf den ich körperlich reagieren muss, um im Gleichgewicht zu bleiben. Die Wellen und die Schaumkronen betrachtend habe ich keinen Fixpunkt vor Augen, empfinde mein Sehen als ein Erleben der sich ständig mir annähernden Bewegung. Die Gischt trifft meine Haut, eine immer wiederkehrende Begegnung mit Nässe und Kälte. Der Himmel über mir und das Wasser unter mir umgeben mich mit einem Blau, welches nicht nur Farbe, sondern eine eigene Präsenz zu besitzen scheint und keinen Anfang und kein Ende hat. Meine Füße und durch sie hindurch mein ganzer Körper spüren das Vibrieren des Bodens durch die rhythmisch anlandenden Wellen. Das Heulen des Sturms, das Donnern der Wellen erfüllen mich von Kopf bis Fuß.
Indem ich all dies wahrnehme, gibt es kein Innen und kein Außen. Der Sturm ist nicht dort und ich bin hier – ich werde eins mit all dem. Kein Gedanke, der mich trennt von meinem Erleben, kein Nachdenken über Windstärke oder Wolkengattung, Ort oder Zeit. So erlebe ich mich als untrennbaren Teil des Sturms, empfinde mich vollkommen lebendig in dieser Begegnung.
Einige Schritte weiter könnte ich den Sturm geschützt durch Mauern, Glas und Ziegel in einem Haus erleben. Erleben? Nein, denn dort wäre es kein Erleben mehr. Ich könnte den Sturm beobachten, alles wäre reduziert auf meine visuelle Wahrnehmung. Kein Fühlen der Gischt auf meiner Haut, kein Austarieren meines Körpergewichts gegen den Wind, kein ohrenbetäubendes Dröhnen durch Wind und Wellen, kein Blau, welches mich vollständig umgibt. Stattdessen ein Fensterausschnitt Sturm. Am Ufer stehend erfahre ich Sturm, hinter dem Fenster wird er zu einer Beobachtung, welche nicht lange im Gedächtnis haften bleibt. Dort teilt sich mir nichts mehr mit.
Musik kann – wie in der Begegnung mit dem Sturm – lebendig werden. Lebendig in der Weise, dass es kein Innen und Außen, kein Musik und Mensch mehr gibt, sondern nur noch eine alles zusammenschließende Begegnung. Musik reduziert sich dann nicht mehr auf ein akustisches Phänomen, sondern wird zu einem den ganzen Menschen angehenden Ereignis. Alternativ blicken wir auf die Musik durch das geschlossene Fenster: von ihr getrennt durch all unsere theoretischen Vorstellungen und Gedanken.
Wie aber lässt sich das Fenster öffnen?
I. Einleitung
1. Der Körper im Hintergrund unseres Handelns
Spielen wir ein Instrument, basiert diese Fähigkeit auf einer Eigenschaft des Menschen, über die wir kaum nachdenken: Erst der Umstand, über einen Körper zu verfügen, versetzt uns in die Lage, Klänge zu produzieren. Der Körper ist für uns im Instrumentalspiel das Medium, durch welches wir mit unserer Umwelt in Beziehung treten. Nur mit seiner Hilfe halten und bewegen wir unser Instrument, nutzen den Atem zur Klangerzeugung und sind in der Lage, die Musik zu hören. Auf diese Weise übernimmt der Körper eine wesentliche Aufgabe im Zusammenspiel mit unserem Instrument.
Thomas Edison behauptete, die Aufgabe seines Körpers bestehe lediglich darin, sein Gehirn zu transportieren.1 Diese sicher nicht ganz ernst zu nehmende Einschätzung weist dennoch auf eine Entwicklung hin, die sich auch auf dem Gebiet der Erforschung musikalischer Lernprozesse beobachten lässt. Die Neurowissenschaften gehen heute davon aus, dass musikalisches Lernen ein vollständig physiologisch determinierter Vorgang ist. Sie beschreiben, wie Rezeptorzellen des Menschen auf physische Reize reagieren und daraufhin sensorische Neurone Informationen an das Zentralnervensystem leiten. Durch die Wahrnehmung ausgelöste neuronale Erregungsmuster lassen dann im Laufe der Zeit stabile neuronale Repräsentationen entstehen, so dass Lernen auf einer Veränderung der synaptischen Übertragung beruht.2 Die neurowissenschaftliche Forschung thematisiert den Körper demnach allein physiologisch basiert, menschliches Erleben und Wahrnehmen werden zu biologischen Prozessen. Die körperliche Involviertheit des Musizierenden3 reduziert sich somit auf seine messbaren Bewusstseinszustände, die als identisch mit bestimmten Beschaffenheiten des Gehirns angesehen werden.4 Diese werden dann z.B. als Zeichen der Verarbeitung und Analyse musikalischer Aspekte, des assoziativen Verstehens musikalischer Bedeutung oder der Planung und Ausführung instrumentaler Bewegungen interpretiert.5 Insgesamt wird der musizierende Körper zu einer objektiv bestimmbaren Realität, in der er sich, wie andere Dinge auch, durch ebenfalls objektive Merkmale beschreiben lässt.
Menschen sind somit Lebewesen, die sich ihren eigenen Körper als ein von sich getrenntes Objekt vorstellen können. Auch beim Spielen eines Instruments sind sie in der Lage, ihren Körper aus einer distanzierten Beobachterperspektive wahrzunehmen, um seine Bewegungen am Instrument zu steuern. Sie erleben ihn nun wie andere Dinge auch. Allerdings wird ihnen auf diese Weise nicht mehr bewusst, dass sie in jedem Moment ein Gesamtorganismus sind und folglich auch ›als Körper‹ handeln. ›Als Körper‹ beziehen sie sich im Alltag ständig unmittelbar auf ihr gegenwärtiges Erleben, ohne dies aus einem reflexiven Abstand zu betrachten. ›Als Körper‹ sind sie Ausgangspunkt zahlreicher Bewegungen und Handlungen: Hören sie ein Geräusch, bemerken sie ihre Ohren nicht; fahren sie Auto, denken sie über all das, was ihr Körper in dem Moment realisiert, ebenfalls nicht nach. Erst wenn sie sich wieder gedanklich mit ihrem Körper beschäftigen oder er versagt oder schmerzt, erscheint er ihnen erneut als ein verfügbares Objekt.6
Obwohl uns dieser Perspektivwechsel zwischen objektiviertem und unbemerkt bleibendem Körper so anstrengungslos gelingt, lernen wir im Instrumentalunterricht hauptsächlich eine dieser beiden Formen kennen. Die objektivierende Sicht auf das musikalische Geschehen dominiert und verhindert, dass der Körper im Instrumentalspiel verborgen bleibt. Solch ein unmittelbares Erleben ist jedoch grundlegende Voraussetzung für ein Musizieren, welches der ursprünglichen Bedeutung von Musik gerecht wird: Nur dann kann ein musikalischer Ausdruck andere Menschen ansprechen und Grundlage von Kommunikation und Dialog werden. Auf diese Weise entsteht eine gemeinsame, auf Körperlichkeit basierende und noch nicht reflektierte Verbundenheit.7
Aber obwohl allen Menschen problemlos eine komplexe Tätigkeit wie das Führen eines PKW´s gelingt, ohne dabei die eigenen Körperbewegungen bewusst steuern zu müssen, wird dies im Instrumentalspiel nicht gelernt. Nur Einzelnen gelingt dann der Zugang zu einem musikalischen Erleben, welches Musik, die wir auch tatsächlich so nennen dürfen, entstehen lässt.
Um Ursachen und Auswege aus dieser Situation erkennen zu können, begegnen sich hier Musik und Philosophie. Die Bedeutung der oben angesprochenen Perspektiven für das instrumentale Musizieren lässt sich so mit Hilfe des Verständnisses der Philosophie analysieren. Da es sich bei diesen Perspektiven jedoch um nichts anderes als um die Formen unseres natürlichen Erlebens handelt, versuchen wir zu verstehen, was an jedem Tag automatisch, aber völlig unbemerkt geschieht.
1 Thomas Alva Edison, zitiert nach Fuchs, Thomas. Leib, Raum, Person. Entwurf einer phänomenologischen Anthropologie, Stuttgart: Klett-Cotta 2000, S. 17.
2 Vgl. Gruhn, Wilfried. »Am Anfang ist das Ohr«, in: Musik - Pädagogisch - Gedacht. Reflexionen, Forschungs- und Praxisfelder, (hrsg. von Martin Daniel Loritz), Augsburg: Wißner 2011, S. 42-54.
3 Aus Gründen des besseren Verständnisses wird auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.
4 Vgl. Fuchs, Thomas. Leib, Raum, Person. Entwurf einer phänomenologischen Anthropologie, Stuttgart: Klett-Cotta 2000, S. 17.
5 Vgl. Koelsch, Stefan/Fritz, Tom. »Musik verstehen - Eine neurowissenschaftliche Perspektive«, in: Musikalischer Sinn. Beiträge zu einer Philosophie der Musik, (hrsg. von Alexander Becker/Matthias Vogel), Frankfurt am Main: Suhrkamp 2007 und Koelsch, Stefan/Schröger, Erich. Neurowissenschaftliche Grundlagen der Musikverarbeitung (2007), online verfügbar: http://www.stefan-koelsch.de/papers/Koelsch-Schroeger-Musikpsychologie_20070221.pdf (Stand: 30.08.2019).
6 Vgl. Fuchs: Leib (2000), S. 16.
7 Vgl. ebd., S. 24.
2. Körper- und Leibperspektive
Die Fähigkeit des Menschen, seinen eigenen Körper als Objekt auffassen zu können, war vermutlich evolutionär nicht vorgesehen. Dass wir uns dennoch dieses Vermögen aneignen konnten, ist das Ergebnis zahlreicher Entwicklungsschritte, von denen einige wesentliche im weiteren Verlauf erläutert werden. Grundsätzlich aber basiert diese Form des Denkens auf unserem fundamentalen Glauben an die Realität einer objektiven Welt. Denn die Welt, die wir wahrnehmen, halten wir für etwas vollkommen Objektives, wir erfassen sie »in einem naiven Glauben an eine unvermittelt gegebene Außenwelt«.8





























