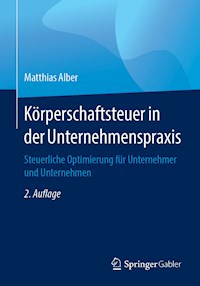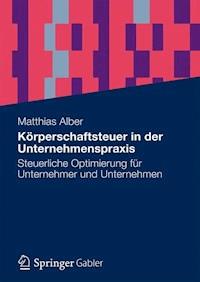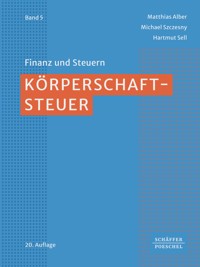
69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Finanz und Steuern
- Sprache: Deutsch
Der Band behandelt alle wesentlichen Themengebiete der Körperschaftsteuer wie verdeckte Gewinnausschüttungen, verdeckte Einlagen, Zinsschranke gemäß § 8a KStG, Organschaft, Liquidation, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, ferner die Vorschriften zu sachlichen Steuerbefreiungen bei Beteiligungen an anderen Körperschaften und zu deren Ausnahmefällen gemäß § 8b KStG, zu den Verlustabzugsbeschränkungen nach § 8c KStG, dem Verlustvortrag nach § 8d KStG und zur Anwendung des Halb-/Teileinkünfteverfahrens auf der Ebene der Anteilseigner. Die 20. Auflage berücksichtigt wichtige Rechtsänderungen unter anderem durch das Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz, das ATAD-Umsetzungsgesetz und das Gesetz zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb und zur Änderung weiterer Gesetze. Das Lehrbuch empfiehlt sich für Studierende in den Bachelor- und insbesondere den Masterstudiengängen, zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung, die Prüfung für Steuerfachwirte sowie als Nachschlagewerk für Praktiker in der Steuerberatung, in den Betrieben und in der Finanzverwaltung. Rechtsstand: 1. Februar 2024
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1295
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtImpressumAutorenVorwort zur 20. AuflageAbkürzungsverzeichnisTeil A Stellung und Entwicklung des KörperschaftsteuerrechtsTeil B Steuerpflicht1 Anwendungsbereich des Körperschaftsteuergesetzes1.1 Allgemeines1.2 Maßgeblichkeit der Rechtsform1.2.1 Einpersonen-GmbH1.2.1.1 Selbständige Körperschaftsteuerpflicht1.2.1.2 Durchgriff durch die Rechtsform?1.2.2 GmbH & Co. KG1.3 Abgrenzungsregel des § 3 Abs. 1 KStG1.4 Zielsetzung des Körperschaftsteuergesetzes2 Bedeutung der unbeschränkten und beschränkten Steuerpflicht3 Unbeschränkte Steuerpflicht3.1 Die einzelnen Steuersubjekte3.1.1 Kapitalgesellschaften3.1.1.1 Aktiengesellschaft3.1.1.2 GmbH3.1.1.3 Sonstige Kapitalgesellschaften3.1.2 Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KStG)3.1.3 Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KStG)3.1.4 Sonstige juristische Personen des privaten Rechts (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 KStG)3.1.4.1 Begriff der juristischen Person3.1.4.2 Arten der sonstigen juristischen Personen des privaten Rechts3.1.5 Nichtrechtsfähige Personenvereinigungen und Vermögensmassen (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG)3.1.5.1 Keine Erfassung der Personengesellschaften3.1.5.2 Nichtrechtsfähige Zweckvermögen3.1.5.3 Vereine ohne Rechtspersönlichkeit3.1.5.4 Andere Zweckvermögen des privaten Rechts3.1.5.5 Ausländische Körperschaften3.1.6 Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 KStG)3.1.6.1 Allgemeines3.1.6.2 Begriff des Betriebs gewerblicher Art 3.1.6.2.1 Begriffsmerkmale3.1.6.2.2 Unmaßgebliche Merkmale (§ 4 Abs. 1 Satz 2 KStG)3.1.6.3 Versorgungsbetriebe (§ 4 Abs. 3 KStG)3.1.6.4 Betriebe gewerblicher Art als juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 4 Abs. 2 KStG)3.1.6.5 Verpachtung von Betrieben gewerblicher Art (§ 4 Abs. 4 KStG)3.1.6.6 Hoheitsbetriebe (§ 4 Abs. 5 KStG; R 4.4 KStR)3.1.6.7 Abgrenzung der Hoheitsbetriebe von Wirtschaftsbetrieben3.1.6.8 Einzelfragen zur Gewinn- und Einkommensermittlung bei BgA3.1.6.8.1 BFH-Urteil vom 15.01.2015 (I R 48/13) zu gemischt veranlassten Aufwendungen3.1.6.8.2 Gemischt genutzte Wirtschaftsgüter des BgA und des hoheitlichen Bereichs3.1.6.8.3 Verdeckte Gewinnausschüttung bei BgA und Vereinbarungen zwischen BgA und ihren Trägerkörperschaften3.1.6.9 Zusammenfassung von BgA3.1.6.9.1 Grundsätze3.1.6.9.2 Verlustnutzungen bei zusammengefassten BgA (§ 8 Abs. 8 KStG)3.1.6.10 Einkommensermittlung bei Betrieben gewerblicher Art (R 8.2 KStR)3.1.7 Das Optionsrecht für Personengesellschaften zur Körperschaftsteuer (§ 1a KStG)3.1.7.1 Hintergrund3.1.7.2 Anwendungsbereich des Optionsmodels3.1.7.3 Der Weg in die Körperschaftsteuer3.1.7.4 Folgen einer Option für die laufende Besteuerung3.1.7.5 Rückoption3.2 Geschäftsleitung oder Sitz im Inland bei Körperschaften i. S. d. § 1 KStG3.2.1 Allgemeines3.2.2 Geschäftsleitung (§ 10 AO)3.2.3 Sitz (§ 11 AO)3.3 Umfang der sachlichen Steuerpflicht3.3.1 Grundsatz3.3.2 Einschränkungen3.3.3 Doppelbesteuerungsabkommen4 Beschränkte Steuerpflicht4.1 Allgemeines4.2 Ausländische Körperschaften (§ 2 Nr. 1 KStG)4.2.1 Allgemeines4.2.2 Kreis der Steuerpflichtigen4.2.3 Die inländischen Einkünfte (§ 8 Abs. 1 KStG, § 49 EStG)4.2.3.1 Allgemeines4.2.3.1.1 Isolierende Betrachtungsweise (§ 49 Abs. 2 EStG)4.2.3.1.2 Einschränkungen durch Doppelbesteuerungsabkommen4.2.3.1.3 Abgeltung der Körperschaftsteuer durch Steuerabzug4.2.3.1.4 Ermittlung der Einkünfte4.2.3.2 Inländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 49 Abs. 1 Nr. 1 EStG)4.2.3.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG)4.2.3.3.1 Einkünfte gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 2a EStG4.2.3.3.2 Einkünfte gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e EStG4.2.3.3.3 Vermietung und Veräußerung von inländischem Grundbesitz, Sachinbegriffen und Rechten (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f EStG)4.2.3.4 Inländische Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 49 Abs. 1 Nr. 3 EStG)4.2.3.5 Inländische Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 49 Abs. 1 Nr. 5 EStG)4.2.3.6 Inländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 49 Abs. 1 Nr. 6 EStG)4.2.3.7 Inländische Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften (§ 49 Abs. 1 Nr. 8 EStG)4.2.3.8 Inländische Einkünfte gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 9 EStG4.2.3.9 Beschränkte Steuerpflicht bei umgekehrt hybriden Fällen, § 49 Abs. 1 Nr. 11 EStG4.2.3.10 Veranlagung, Steuersatz4.3 Sonstige beschränkt steuerpflichtige Körperschaften usw. (§ 2 Nr. 2 KStG)4.3.1 Kreis der Steuersubjekte4.3.2 Voraussetzungen und sachlicher Umfang der Steuerpflicht4.3.3 Ausschluss der Veranlagung, Abgeltungswirkung4.4 Partielle Steuerpflicht gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 KStG4.4.1 Systematische Einordnung4.4.2 Voraussetzungen und sachlicher Umfang der Steuerpflicht4.4.3 Einschränkungen der partiellen Steuerpflicht5 Zusammenfassender Überblick »Persönliche Steuerpflicht«6 Beginn, Ende und Wechsel der Steuerpflicht6.1 Beginn6.1.1 Juristische Personen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1–4 KStG)6.1.1.1 Vorgründungsgesellschaft6.1.1.2 Vorgesellschaft6.1.1.3 Unechte Vorgesellschaft6.1.1.4 Keine vertragliche Rückbeziehung der Gründung?6.1.1.5 Heilung von Formmängeln6.1.1.6 Steuerliche Behandlung von Gründungskosten6.1.2 Nichtrechtsfähige Körperschaften6.2 Ende der Steuerpflicht6.2.1 Grundsatz6.2.2 Verschmelzung (§ 2 UmwG), Spaltung (§ 123 UmwG) und Vermögensübertragung (§ 174 UmwG)6.2.3 Formwechselnde Umwandlung von Kapitalgesellschaften (§§ 226–250 UmwG)6.2.4 Verlegung von Sitz und/oder Geschäftsleitung in das Ausland6.2.5 Wegfall des Bezugs inländischer Einkünfte7 Persönliche Steuerbefreiungen (§§ 5, 6 KStG)7.1 Geltungsbereich7.2 Allgemeiner Regelungsinhalt7.3 Maßgebender Zeitpunkt bzw. Zeitraum für die Voraussetzungen der Steuerfreiheit7.4 Umfang der Steuerbefreiung7.4.1 Vollständige subjektive Befreiung7.4.2 Ausschluss der Befreiung für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (§ 14 AO)7.4.2.1 Allgemeines7.4.2.2 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb7.4.2.3 Zweckbetriebe7.4.2.4 Partielle Steuerpflicht steuerabzugspflichtiger Einkünfte (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 KStG)8 Einzelne Steuerbefreiungen8.1 Berufsverbände ohne öffentlich-rechtlichen Charakter (§ 5 Abs. 1 Nr. 5 KStG)8.1.1 Abgrenzung zu den öffentlich-rechtlichen Berufsverbänden8.1.2 Voraussetzungen der Befreiung8.2 Politische Parteien (§ 5 Abs. 1 Nr. 7 KStG)8.3 Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Körperschaften (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG)8.3.1 Voraussetzungen (Überblick)8.3.1.1 Begünstigte Zwecke8.3.1.2 Gemeinsame Voraussetzungen (§§ 55–63 AO)8.3.1.2.1 Selbstlosigkeit (§ 55 AO)8.3.1.2.2 Ausschließlichkeit (§ 56 AO)8.3.1.2.3 Unmittelbarkeit (§ 57 AO)8.3.1.2.4 Steuerlich unschädliche Betätigungen (§ 58 AO)8.3.1.2.5 Übereinstimmung von Satzung und tatsächlicher Geschäftsführung (§§ 59–63 AO)8.3.1.2.6 Rücklagen- und Vermögensbildung (§ 62 AO)8.3.1.2.7 Umfang der Steuervergünstigung (§§ 64–68 AO)8.3.2 Verfahren8.3.2.1 Turnusmäßige Überprüfung8.3.2.2 Freistellungsbescheid und Bestätigungsverfahren bei Spenden (§ 60a AO)8.3.2.3 VeranlagungTeil C Einkommen1 Grundlagen der Besteuerung1.1 Bemessungsgrundlage1.2 Für die Besteuerung bedeutsame Zeiträume1.2.1 Veranlagungszeitraum1.2.2 Ermittlungszeitraum1.2.3 Wirtschaftsjahr1.2.3.1 Betroffener Personenkreis1.2.3.2 Wahl des Abschlusszeitpunkts1.2.3.3 Umstellung des Wirtschaftsjahres1.2.3.3.1 Allgemeines1.2.3.3.2 Einvernehmen mit dem Finanzamt1.2.3.3.3 Herbeiführung und Versagung des Einvernehmens1.2.3.3.4 Maßgebliche Umstellungsgründe1.2.3.3.5 Unmaßgebliche Gründe1.2.3.3.6 Rumpfwirtschaftsjahr1.2.3.3.7 Liquidation1.2.3.3.8 Zuordnung des Gewinns/Verlustes1.3 Zurechnung des Einkommens1.3.1 Grundsatz1.3.2 Zurechnung bei wirtschaftlichem Eigentum/Treuhandverhältnissen1.3.3 Insolvenz1.3.4 Betriebe gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG) und wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (§ 14 AO)2 Einkommensermittlung2.1 Ableitung des Einkommensbegriffs aus dem Einkommensteuergesetz2.1.1 Grundregel2.1.2 Einkunftsarten2.1.3 Einkünfte bei nach dem Handelsgesetzbuch zur Buchführung verpflichteten Körperschaften2.1.4 Zu- und Abflüsse außerhalb der Einkunftsarten2.2 Verlustausgleich2.3 Einkunftsermittlung2.4 Steuerfreie Einnahmen nach dem EStG und anderen Gesetzen2.4.1 Allgemeines2.4.2 Freibeträge für Veräußerungsgewinne2.5 Nichtabziehbare Ausgaben nach dem EStG und anderen Gesetzen2.5.1 Abzugsverbot nach § 3c Abs. 1 EStG2.5.2 Nichtabziehbare Betriebsausgaben2.5.3 Geldbußen und ähnliche Rechtsnachteile2.5.3.1 Vorbemerkung2.5.3.2 Ersatz von Geldbußen usw. an Arbeitnehmer und an Gesellschafter2.5.3.3 Fallgruppen des Abzugsverbots2.5.3.4 Rückzahlung von Sanktionen2.5.3.5 Kein Werbungskostenabzug2.5.3.6 Verfahrenskosten2.5.4 Hinterziehungszinsen2.5.5 Gewerbesteuer2.5.6 Abzugsverbot für hybride Konstellationen gemäß § 4k EStG3 Besondere Vorschriften des KStG zur Einkommensermittlung3.1 Allgemeines3.2 Abziehbare Aufwendungen nach § 9 KStG3.2.1 Überblick3.2.2 Kosten der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen3.2.3 Gewinnanteile des Komplementärs einer KGaA3.2.4 Ausgaben für steuerbegünstigte Zwecke (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG)3.2.4.1 Allgemeines3.2.4.2 Begünstigte Zwecke3.2.4.3 Spendenhöchstbeträge3.2.4.4 Kein Abzug von Spenden an politische Parteien als Betriebsausgaben oder Werbungskosten3.2.4.4.1 Ermittlungszeitraum für Spenden3.2.4.4.2 Maßgebliches Einkommen3.2.4.5 Sachspenden3.2.4.6 Verzicht auf Aufwendungsersatz3.2.4.7 Einschränkung des Spendenabzugs3.2.4.8 Vertrauenstatbestand und Haftungsregelung3.2.4.9 Spendenvortrag für Zuwendungen oberhalb der Höchstbeträge3.3 Nichtabziehbare Aufwendungen3.3.1 Allgemeines3.3.2 Subjektiver Geltungsbereich3.3.3 Objektiver Anwendungsbereich3.3.4 Verhältnis zu § 12 EStG3.3.5 Körperschaftsteuerbelastung der nichtabziehbaren Aufwendungen3.4 Aufwendungen zur Erfüllung von Satzungszwecken3.4.1 Grundgedanke der Vorschrift3.4.2 Persönlicher Geltungsbereich3.4.3 Satzungsmäßige Zwecke3.4.4 Vorbehalt des Spendenabzugs3.5 Nichtabziehbare Steuern3.5.1 Begriff3.5.2 Umsatzsteuer auf verdeckte Gewinnausschüttungen3.5.3 Ausländische Steuern3.5.4 Mit Steuern zusammenhängende Leistungen3.5.5 Durchführung des Abzugsverbots3.5.6 Rückstellung für latente Körperschaftsteuer3.5.7 Erstattung nichtabziehbarer Steuern3.5.8 Erstattung von mit Steuern zusammenhängenden Leistungen3.6 Geldstrafen und ähnliche Rechtsnachteile3.6.1 Grundsätze3.6.2 Umfang des Abzugsverbots3.7 Aufsichtsratvergütungen3.7.1 Allgemeines3.7.2 Personenkreis und Gremien i. S. v. § 10 Nr. 4 KStG3.7.3 Überwachungsfunktion3.7.4 Begriff und Umfang der Vergütungen3.7.5 Durchführung des Abzugsverbots3.8 Ermittlung des zu versteuernden Einkommens4 Einkommensermittlung bei nach dem Handelsgesetzbuch zur Führung von Büchern verpflichteten Körperschaften4.1 Einkommensermittlung als Gewinnermittlung4.2 Handelsbilanz- und Steuerbilanzgewinn4.2.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag4.2.2 Bilanzgewinn/Bilanzverlust4.3 Abweichungen zwischen Handelsbilanz- und Steuerbilanzgewinn4.4 Gesellschaftliche Vermögensmehrungen und -minderungen4.4.1 Gesellschaftliche Einlagen4.4.1.1 Übersicht verschiedener gesellschaftsrechtlicher Einlagen4.4.1.2 Verdeckte Einlagen (R 8.9 KStR)4.4.1.2.1 Begriff der verdeckten Einlage4.4.1.2.2 Nutzungs- und Gebrauchsüberlassung4.4.1.2.3 Gesellschafterdarlehen, Verzicht auf Pensionsanwartschaft4.4.1.2.4 Auswirkungen verdeckter Einlagen auf der Ebene der Kapitalgesellschaft4.4.1.2.5 Auswirkungen verdeckter Einlagen beim Anteilseigner4.4.1.2.6 Verzicht auf nicht mehr voll werthaltige Forderung4.4.1.2.7 Mittelbare verdeckte Einlage4.4.1.2.8 Verzicht auf Pensionsanwartschaft4.4.1.2.9 Korrespondierende Besteuerung4.4.1.2.10 Kapitalgesellschaft als Erbe ihres Gesellschafters4.4.2 Vermögensminderungen4.4.2.1 Einkommensverteilung4.4.2.2 Kapitalherabsetzung4.5 Verdeckte Gewinnausschüttungen4.5.1 Wesen und Zielsetzung der verdeckten Gewinnausschüttung4.5.2 Begriff4.5.2.1 Keine gesetzliche Definition4.5.2.2 Entwicklung der Merkmale durch Rechtsprechung und Verwaltung4.5.2.3 Zuwendung an einen Gesellschafter4.5.2.4 Zuwendungen an dem Gesellschafter nahestehende Personen4.5.2.5 Ursächlichkeit des Gesellschaftsverhältnisses4.5.2.6 Unmaßgebliche Merkmale4.5.2.7 Steuerliche Zurechnung einer verdeckten Gewinnausschüttung4.5.2.8 Rückgewähr einer verdeckten Gewinnausschüttung4.5.2.9 Vorteilsausgleich4.5.2.10 Erstausstattung der Kapitalgesellschaft4.5.2.11 Rückwirkungsverbot bei beherrschender Beteiligung4.5.2.11.1 Inhalt des Rückwirkungsverbots4.5.2.11.2 Zivilrechtliche Wirksamkeit4.5.2.11.3 Betroffener Personenkreis4.5.2.12 Wettbewerbsverbot4.5.2.13 Zivilrechtliche Wirksamkeit von Vereinbarungen zwischen Gesellschaft und dem Gesellschafter4.5.2.13.1 Form der Vereinbarung4.5.2.13.2 Fehlende Vereinbarung bei beherrschenden Gesellschaftern4.5.2.13.3 Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung für Änderung und Aufhebung des Geschäftsführer-Dienstvertrags4.5.2.14 Selbstkontrahierungsverbot4.5.2.15 Beweislast4.5.3 Erhöhung des Einkommens (§ 8 Abs. 3 Satz 2 KStG)4.5.3.1 Hinzurechnung der verdeckten Gewinnausschüttung nur bei Einkommensminderung4.5.3.2 Hinzurechnung nur der verdeckten Gewinnausschüttung4.5.3.3 Hinzurechnung außerhalb der Bilanz4.5.3.4 Zur Korrektur einer vGA außerhalb der Steuerbilanz4.5.4 Auswirkungen verdeckter Gewinnausschüttungen beim Anteilseigner4.5.4.1 Einnahmen gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG4.5.4.2 Umqualifizierung von Einkünften durch verdeckte Gewinnausschüttungen4.5.4.3 Beurteilung als Fremdgeschäft (Fiktionstheorie)4.5.4.4 Risikogeschäfte durch den Gesellschafter-Geschäftsführer4.5.4.5 Verdeckte Gewinnausschüttung im Falle der Vermietung an den Gesellschafter-Geschäftsführer4.5.4.6 Verdeckte Gewinnausschüttungen und Kapitalertragsteuer4.5.4.7 Zufluss der verdeckten Gewinnausschüttung4.5.5 Grundformen der verdeckten Gewinnausschüttung4.5.6 Bewertung der verdeckten Gewinnausschüttung4.5.6.1 Vorteilszuwendung4.5.6.1.1 Grundsätze4.5.6.1.2 Einzelfälle4.5.6.2 Wertansatz bei Körperschaft und Anteilseigner4.5.6.3 Korrespondierende Besteuerung verdeckter Gewinnausschüttungen4.5.6.3.1 Allgemeines4.5.6.3.2 Formale Korrespondenz bei verdeckten Gewinnausschüttungen4.5.6.3.3 Materielle Korrespondenz bei verdeckten Gewinnausschüttungen4.5.7 Auswirkungen auf andere Steuern/Sonstige Gewinnauswirkungen4.5.7.1 Gewerbesteuer4.5.7.2 Umsatzsteuer4.5.7.2.1 Verbilligte Leistungen an den Gesellschafter (oder ihm nahestehende Personen)4.5.7.2.2 Unentgeltliche Leistungen der Gesellschaft an ihre Gesellschafter4.5.7.2.3 Überhöhtes Entgelt4.5.7.3 Grunderwerbsteuer4.5.7.4 Schenkungsteuer4.5.7.5 Strafrechtliche und gesellschaftsrechtliche Gefahren der verdeckten Gewinnausschüttung4.5.7.5.1 Untreue (§ 266 StGB) bei verdeckter Gewinnausschüttung4.5.7.5.2 Steuerhinterziehung bei verdeckter Gewinnausschüttung4.5.8 Verdeckte Gewinnausschüttungen bei Dienstverträgen4.5.8.1 Steuerliche Anerkennung eines Dienstverhältnisses dem Grunde nach4.5.8.1.1 Erfordernis eines Dienstverhältnisses4.5.8.1.2 Erfordernis von Dienstleistungen4.5.8.1.3 Erfordernis eines Dienstvertrags4.5.8.2 Übersteigen der Angemessenheitsgrenze4.5.8.3 Aktuelle Verwaltungsmeinung zur Angemessenheit der Geschäftsführer-Bezüge4.5.8.4 Verzicht auf Tätigkeitsvergütung als verdeckte Einlage?4.5.8.4.1 Umsatztantiemen4.5.8.4.2 Gewinntantiemen4.5.8.4.3 Klare und eindeutige Berechnungsgrundlagen4.5.8.4.4 Angemessenheit4.5.8.4.5 Zur Vereinbarung einer Nur-Tantieme4.5.8.4.6 Vorschüsse auf die Tantieme4.5.8.4.7 Berücksichtigung von Verlustvorträgen bei der Tantiemeberechnung4.5.8.5 Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer – Überblick4.5.8.5.1 Überblick: Steuerliche Prüfung bei Pensionszusagen4.5.8.5.2 Überblick: Steuerliche Voraussetzungen bei Pensionszusagen4.5.8.5.3 Probezeit4.5.8.5.4 Ernsthaftigkeit4.5.8.5.5 Erdienbarkeit4.5.8.5.6 Einräumung einer Hinterbliebenenversorgung4.5.8.5.7 Steuerliche Folgen für die Rückdeckungsversicherung in vGA-Fällen4.5.8.5.8 Finanzierbarkeit4.5.8.5.9 Angemessenheit der Höhe nach4.5.8.5.10 Pension neben Aktivgehalt4.5.8.5.11 Abfindung von Pensionsansprüchen4.5.8.6 Pensionsverzicht des Gesellschafter-Geschäftsführers und Übertragung von Pensionsansprüchen4.5.8.6.1 Pensionsverzicht in der Krise zur Abwendung der Insolvenz4.5.8.6.2 Verzicht auf den sog. »future-service«4.5.8.6.3 Verzicht auf den werthaltigen Pensionsanspruch (Verzicht auf den sog. »past-service«)4.5.8.6.4 Steuerfalle Pensionszusagen und Pensionsverzicht4.5.8.6.5 Möglichkeiten zur Bereinigung von Pensionsrückstellungen4.5.8.6.6 Weitere Möglichkeiten zur »Abfindung« des Pensionsanspruchs4.5.8.7 Nebenleistungen zum Gehalt4.5.8.8 Angemessenheit der Gesamtbezüge eines Gesellschafter-Geschäftsführers4.5.9 Verdeckte Gewinnausschüttungen bei Darlehensverträgen4.5.9.1 Darlehen der Kapitalgesellschaft an den Gesellschafter4.5.9.2 Darlehen des Gesellschafters an seine Kapitalgesellschaft4.5.10 Verdeckte Gewinnausschüttungen bei Miet- und Pachtverträgen; Leihe4.5.10.1 Allgemeines4.5.10.2 Angemessenheitsprüfung4.5.10.3 Vermietung an den Gesellschafter4.5.10.4 Vermietung an die Gesellschaft4.5.10.5 Besonderheiten bei Betriebsaufspaltung4.5.10.5.1 Umqualifizierung bei überhöhter Pacht4.5.10.5.2 Angemessene Pachthöhe4.5.11 Verdeckte Gewinnausschüttungen bei Kaufverträgen, Lieferungs- und Leistungsverhältnissen4.5.11.1 Rückwirkungsverbot4.5.11.2 Angemessenheit4.5.11.3 Einzelfälle4.5.11.4 Verdeckte Gewinnausschüttungen bei GmbH & Co. KG4.5.11.5 Verdeckte Gewinnausschüttungen bei GmbH & Still4.5.12 Satzungsklauseln, Steuerklauseln, Rückzahlung verdeckter Gewinnausschüttungen4.5.12.1 Allgemeines, Rückzahlung verdeckter Gewinnausschüttungen4.5.12.2 Vorrang der erfolgswirksamen Aktivierung zivilrechtlicher Ansprüche4.5.12.3 Satzungsklauseln (Steuerklauseln)4.5.12.4 Zusammenfassender Fall: Rückforderung einer verdeckten Gewinnausschüttung von beherrschendem Gesellschafter5 Zinsschranke (§ 8a KStG, § 4h EStG)5.1 Überblick5.2 Ausnahmen von der Zinsschranke (§ 4h Abs. 2 EStG)5.2.1 Freigrenze5.2.2 Konzernklauseln5.2.3 Besonderheiten für Körperschaften (§ 8a KStG)6 Verlust und Verlustabzug bei Körperschaften (§ 10d EStG, § 8 Abs. 1 und § 8c KStG)6.1 Persönliche Berechtigung zum Verlustausgleich und Verlustabzug6.1.1 Grundsatz6.1.2 Verlustabzug bei Umwandlung, Verschmelzung oder Auflösung der Körperschaft6.2 Ermittlung des steuerlichen Verlusts6.3 Verlustabzug6.4 Durchführung des Verlustabzugs, Verfahrensfragen6.5 Verlustabzugsbeschränkung § 8c KStG6.5.1 Gesetzliches Grundprinzip und Rechtsentwicklung6.5.2 Vollständige Aufhebung von § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG6.5.3 (Vorläufige) Reaktion der Finanzverwaltung und Folgefragen6.5.4 Reaktion des Gesetzgebers6.5.5 Praxisrelevante Rechtsfolgen6.5.6 Wiederbelebung der Sanierungsklausel (§ 8c Abs. 1a KStG)6.6 Grundprinzip der Verlustabzugsbeschränkung für Körperschaften nach § 8c Abs. 1 KStG6.6.1 Überblick und Rechtsfolgen6.6.2 Einzelheiten zur Anteilsübertragung nach § 8c Abs. 1 KStG6.6.2.1 Vorbemerkung6.6.2.2 Wesentliche Inhalte des BMF-Schreibens vom 28.11.20176.6.2.2.1 Anwendungsbereich (Rn. 2)6.6.2.2.2 Schädlicher Beteiligungserwerb (Rn. 4)6.6.2.2.3 Unmittelbarer und mittelbarer Erwerb (Rn. 11)6.6.2.2.4 Fünfjahreszeitraum (Rn. 23)6.6.2.2.5 Übertragung auf nahestehende Personen (Rn. 26)6.6.2.2.6 Übertragung auf Erwerber mit gleichgerichteten Interessen (Rn. 28)6.6.2.2.7 Zeitpunkt und Umfang des Verlustuntergangs (Rn. 32)6.6.2.2.8 Unterjähriger Beteiligungserwerb (Rn. 33, 34, 35 und 36)6.6.2.2.9 Konzernklausel im Sinne von § 8c Abs. 1 Satz 4 KStG6.6.2.2.10 Prüfung der Konzernklausel im Zusammenhang mit der Ermittlung der schädlichen Erwerbsquote von 50 %6.6.2.2.11 »Stille-Reserven-Klausel« nach § 8c Abs. 1 Sätze 5 bis 8 KStG6.6.2.2.12 »Stille-Reserven-Klausel« bei negativem Eigenkapital6.6.2.2.13 Verhältnis der Konzernklausel zur Stille-Reserven-Klausel (Rn. 49)6.6.2.2.14 Ermittlung der stillen Reserven (Rn. 50)6.7 Der unterjährige Beteiligungserwerb anhand von Fallbeispielen6.7.1 Grundproblem und Ausgangsfall6.7.2 Zuordnung der Ergebnisse auf die Zeit vor und nach dem schädlichen Beteiligungserwerb6.7.3 Verlustausgleich für die Zeit bis zum schädlichen Beteiligungserwerb6.7.4 Beteiligungserwerb in das Vorjahr6.7.5 Verlustrücktrag aus der Zeit nach dem schädlichen Beteiligungserwerb7 Fortführungsgebundener Verlustvortrag (§ 8d KStG)7.1 Tatbestandsvoraussetzungen und Prüfungsreihenfolge des § 8d KStG7.2 Die Neuregelung des § 8d KStG im Überblick7.2.1 Die Verlustabzugsbeschränkung nach § 8c KStG7.2.2 Gesetzliche Regelungen zu § 8d KStG7.2.3 Allgemeines zu § 8d KStG7.2.4 § 8d KStG im Einzelnen (unter Berücksichtigung des o. g. BMF-Schreibens vom 18.03.2021, a. a. O.)7.2.4.1 Antragserfordernis (BMF, Rn. 4 bis 12)7.2.4.2 Materielle Voraussetzungen (BMF, Rn. 13 bis 48)7.2.4.2.1 Begriff des Geschäftsbetriebs (BMF, Rn. 16 bis 24)7.2.4.2.2 Kein schädliches Ereignis im Beobachtungszeitraum B (BMF, Rn. 25 bis 45)7.2.4.2.3 Ausschluss des Anwendungsbereichs (BMF, Rn. 46 bis 48)7.2.4.3 Rechtsfolgen (BMF, Rn. 49 bis 61)7.2.4.3.1 Umfang der Verlusterhaltung (BMF, Rn. 49 bis 55)7.2.4.3.2 Verrechnung des fortführungsgebundenen Verlustvortrags (BMF, Rn. 56 bis 58)7.2.4.3.3 Organschaft (BMF, Rn. 59 bis 61)7.2.4.3.4 Schädliche Ereignisse und Untergang des fortführungsgebundenen Verlustvortrags nach § 8d Abs. 2 KStG (BMF, Rn. 25 bis 45 sowie Rn. 62 bis 67)8 Steuerfreie Mitgliederbeiträge (§ 8 Abs. 5 KStG)8.1 Allgemeines8.2 Voraussetzungen für die Steuerbefreiung8.2.1 Mitgliederbeiträge (R 8.11 Abs. 1 KStR)8.2.2 Erhebung aufgrund der Satzung (R 8.11 Abs. 2 KStR)8.2.3 Keine Beitragsbemessung nach einer bestimmten Leistung der Personenvereinigung oder nach dem wirtschaftlichen Vorteil für das einzelne Mitglied (R 8.11 Abs. 3 KStR)8.3 Rechtsfolgen9 Auflösung und Abwicklung (Liquidation)9.1 Allgemeines – Bedeutung der Vorschrift9.2 Anwendungsvoraussetzungen9.2.1 Subjektive Voraussetzungen9.2.2 Objektive Voraussetzungen9.2.2.1 Auflösung9.2.2.2 Abwicklung9.3 Liquidationsbesteuerung9.3.1 Besteuerungszeitraum9.3.2 Abwicklungsgewinn9.3.2.1 Abwicklungsanfangsvermögen9.3.2.2 Abwicklungsendvermögen9.3.2.3 Allgemeine Gewinnermittlungsvorschriften9.3.2.4 Zusammenfassung9.3.2.4.1 Hinweise zur Ermittlung des steuerlichen Abwicklungsgewinns9.3.2.4.2 Bekanntgabe von Verwaltungsakten9.3.3 Auflösung einer Organgesellschaft9.3.4 Auswirkungen der Liquidation auf das steuerliche Einlagekonto (§ 27 KStG) und den Sonderausweis (§ 28 Abs. 2 KStG)9.3.5 Einkünfte der Anteilseigner9.3.5.1 Nennkapitalrückzahlung9.3.5.2 Aufteilung des Liquidationserlöses9.3.5.2.1 Keine Beteiligung i. S. § 17 EStG9.3.5.2.2 Kein Abzug von Refinanzierungskosten als Werbungskosten nach dem Zeitpunkt der Auflösung9.3.6 Beispiel zur Liquidationsbesteuerung10 Steuerentstrickung und Steuerverstrickung bei Körperschaften (§ 12 KStG)10.1 Allgemeines10.2 Entstrickung bei Ausschluss des Besteuerungsrechts (§ 12 Abs. 1 KStG)10.2.1 Allgemeines10.2.2 Persönlicher Anwendungsbereich10.2.3 Sachlicher Anwendungsbereich10.2.4 Rechtsfolge10.2.5 Verstrickung bei Wegfall oder Beschränkung des Besteuerungsrechts10.2.6 Steuerliche Folgen auf Ebene der Anteilseigner10.3 Steuerverstrickung bei Körperschaften11 Beginn und Erlöschen einer Steuerbefreiung (§ 13 KStG)11.1 Allgemeines11.2 Beginn einer Steuerbefreiung11.2.1 Aufstellung einer Schlussbilanz (§ 13 Abs. 1 KStG)11.2.2 Ansatz der Teilwerte11.2.3 Besteuerung der stillen Reserven11.3 Erlöschen einer Steuerbefreiung (§ 13 Abs. 2 KStG)11.4 Sonderregelung des § 13 Abs. 4 KStG11.4.1 Allgemeines11.4.2 Beginn einer Steuerbefreiung (§ 13 Abs. 4 Satz 1 KStG)11.4.3 Erlöschen einer Steuerbefreiung (§ 13 Abs. 4 Satz 2 KStG)11.5 Partielle Steuerbefreiung (§ 13 Abs. 5 KStG)11.6 Entstrickung und Verstrickung von Anteilen i. S. d. § 17 EStG12 Besteuerung von Beteiligungen an anderen Körperschaften und Personenvereinigungen (§ 8b KStG)12.1 Konzeption des § 8b KStG12.2 Freistellung von Beteiligungserträgen (§ 8b Abs. 1 KStG)12.2.1 Verhältnis zu Doppelbesteuerungsabkommen12.2.2 § 8b Abs. 1 KStG und Kapitalertragsteuer12.2.3 Steuerpflicht nach anderen Vorschriften12.2.4 Nicht unter § 8b Abs. 1 KStG fallende Bezüge12.2.4.1 Einnahmen aus Wertpapierleihgeschäften12.2.4.2 Einnahmen aus Wertpapierpensionsgeschäften12.2.4.3 Leistungen aus dem steuerlichen Einlagekonto12.2.5 Nach § 8b Abs. 1 KStG begünstigte Empfänger12.2.6 Nachsteuer nach § 37 Abs. 3 KStG bis 31.12.200612.2.7 § 8b Abs. 1 Satz 1–5 KStG12.2.7.1 Keine Befreiung, wenn das Einkommen der leistenden Körperschaft gemindert worden ist (§ 8b Abs. 1 Satz 2 KStG)12.2.7.2 Verdeckte Einlagen nur in Ausnahmefällen steuerneutral (§ 8b Abs. 1 Satz 3 KStG)12.2.7.3 Keine Befreiung, wenn die verdeckte Gewinnausschüttung nach einem Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei ist (§ 8b Abs. 1 Satz 4 KStG)12.2.7.4 Rückausnahme in Dreiecksfällen (§ 8b Abs. 1 Satz 5 KStG)12.3 Veräußerungsgewinnbefreiung (§ 8b Abs. 2 KStG)12.3.1 Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an einer Körperschaft oder Personenvereinigung, deren Leistungen beim Empfänger zu Einnahmen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 und 10 Buchst. a EStG gehören12.3.2 Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an einer Organgesellschaft i. S. d. §§ 14 oder 17 KStG12.3.3 Gewinne aus der Auflösung des Nennkapitals (Liquidationsgewinne)12.3.4 Gewinne aus der Herabsetzung des Nennkapitals12.3.5 Gewinne aus dem Ansatz des in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 3 EStG bezeichneten Werts (Wertaufholungsgewinne aus Kapitalbeteiligungen)12.3.6 Anwendung des § 8b Abs. 2 KStG auf weitere Realisationsvorgänge12.3.6.1 Einkommenserhöhungen durch verdeckte Gewinnausschüttungen12.3.6.2 Begrenzung der Steuerbefreiung wegen Teilwertabschreibungen (§ 8b Abs. 2 Satz 4 KStG)12.3.6.2.1 Rechtsprechung des BFH zur Problematik der Teilwertabschreibung12.3.6.2.2 Änderung der Verwaltungsauffassung12.3.6.3 Sachdividenden12.3.7 Einschränkung der Steuerbefreiung i. H. d. Übertragung einer Rücklage nach § 6b EStG oder ähnlichen Abzügen (§ 8b Abs. 2 Satz 5 KStG)12.3.8 Gewinne aus verdeckten Einlagen (§ 8b Abs. 2 Satz 6 KStG)12.4 Pauschalierter Betriebsausgabenabzug, Nichtanwendung des § 3c EStG und nicht zu berücksichtigende Gewinnminderungen (§ 8b Abs. 3 KStG)12.4.1 Pauschalierter Betriebsausgabenabzug (§ 8b Abs. 3 Satz 1 KStG)12.4.2 Nichtanwendung des § 3c Abs. 1 EStG (§ 8b Abs. 3 Satz 2 KStG)12.4.3 Nicht zu berücksichtigende Gewinnminderungen i. V. m. einer Kapitalbeteiligung (§ 8b Abs. 3 Satz 3 KStG)12.4.3.1 Ansatz des niedrigeren Teilwerts12.4.3.2 Gewinnminderungen im Zusammenhang mit der verdeckten Ausschüttung eines Anteils12.4.3.3 Verluste wegen Auflösung der Gesellschaft12.4.3.4 Verluste infolge Kapitalherabsetzung12.4.4 Gewinnminderungen bei Gesellschafterdarlehen (§ 8b Abs. 3 Sätze 4–9 KStG)12.4.4.1 Darlehensgewährung sowie Sicherheitsgestellung Gesellschafter (§ 8b Abs. 3 Satz 4 KStG)12.4.4.1.1 Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Darlehen12.4.4.1.2 Beteiligung zu mehr als 25 %12.4.4.2 Darlehensgewährung sowie Sicherheitsgestellung durch nahestehende Person oder einen rückgriffberechtigten Dritten (§ 8b Abs. 3 Satz 5 KStG)12.4.4.3 Ausnahme für Währungsverluste (§ 8b Abs. 3 Satz 6 KStG)12.4.4.4 Gegenbeweis durch Fremdvergleich (§ 8b Abs. 3 Satz 7 KStG)12.4.4.5 Anwendung bei wirtschaftlich vergleichbaren Rechtshandlungen (§ 8b Abs. 3 Satz 8 KStG)12.4.4.6 Wertaufholungsgewinne später steuerfrei (§ 8b Abs. 3 Satz 9 KStG)12.5 Einbringungsklausel (§ 8b Abs. 4 KStG a. F.)12.5.1 Sachliche Sperre (§ 8b Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 KStG)12.5.1.1 Entstehung einbringungsgeborener Anteile12.5.1.2 Versteuerung auf Antrag und Wegfall des deutschen Besteuerungsrechts12.5.2 Persönliche Sperre (§ 8b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 KStG)12.5.2.1 Unmittelbarer Erwerb unter dem Teilwert12.5.2.2 Mittelbarer Erwerb (über eine Körperschaft) oder mittelbarer Erwerb über eine Mitunternehmerschaft unter dem Teilwert12.5.3 Rückausnahmen – Steuerfreiheit (§ 8b Abs. 4 Satz 2 KStG)12.5.3.1 Siebenjahresfrist (§ 8b Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 KStG)12.5.3.1.1 Beginn und Ende der Siebenjahresfrist12.5.3.1.2 Siebenjahresfrist bei der Ketteneinbringung12.5.3.1.3 Spaltung oder Verschmelzung innerhalb der Siebenjahresfrist12.5.3.2 Steuerlich nicht berücksichtigte Teilwertabschreibungen12.5.3.3 Rückausnahme nach § 8b Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 KStG12.5.3.4 Ausnahme von der Rückausnahme12.5.3.5 Nachträglich eintretende Steuerverstrickung12.6 Steuerpflicht für Ausschüttungen aus Streubesitzdividenden (§ 8b Abs. 4 KStG)12.6.1 Allgemeines12.6.2 Anwendung der Neuregelung12.6.3 Regelungsinhalt12.6.4 Unmittelbare Beteiligung zu Jahresbeginn/unterjährig12.6.5 Mittelbare Beteiligung über eine Personengesellschaft (§ 8b Abs. 4 Sätze 4 und 5 KStG)12.6.6 Bemessung der Beteiligungshöhe in Umwandlungsfällen (§ 8b Abs. 4 Satz 2 KStG)12.6.7 Bemessung der Beteiligungshöhe in Fällen der Wertpapierleihe (§ 8b Abs. 4 Satz 3 KStG)12.6.8 Bemessung der Beteiligungsquote für Mitglieder einer kreditwirtschaftlichen Verbundgruppe (§ 8b Abs. 4 Satz 8 KStG)12.7 Pauschaliertes Betriebsausgabenabzugsverbot bei steuerfreien Dividenden (§ 8b Abs. 5 KStG)12.8 Anwendung des § 8b Abs. 1–5 KStG bei Beteiligung über eine Personengesellschaft (§ 8b Abs. 6 KStG)12.8.1 Mitunternehmerschaft i. S. d. § 8b Abs. 6 Satz 1 KStG12.8.2 Zurechnung von Bezügen, Gewinnen bzw. Gewinnminderungen12.8.3 Bezüge, Gewinne und Gewinnminderungen, die einem Betrieb gewerblicher Art über eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts zufließen (§ 8b Abs. 6 Satz 2 KStG)12.9 Anwendung von § 8b Abs. 7 und Abs. 1–6 KStG12.9.1 Allgemeines12.9.2 Rechtslage bis VZ 201612.9.2.1 Anwendung auf Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute, bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind (§ 8b Abs. 7 Satz 1 KStG)12.9.2.2 Anteilserwerb zur kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs bei Finanzunternehmen (§ 8b Abs. 7 Satz 2 KStG)12.9.2.2.1 Finanzunternehmen12.9.2.2.2 Merkmal »Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs«12.9.3 Rechtslage ab VZ 201712.9.3.1 Anwendung auf Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute bei denen die Anteile dem Handelsbestand i. S. d. § 340e Abs. 3 HGB zuzurechnen sind (§ 8b Abs. 7 Satz 1 KStG)12.9.3.2 Anwendung auf Finanzunternehmen (§ 8b Abs. 7 Satz 2 KStG)12.9.3.3 Einbeziehung in das Handelsbuch12.10 Nichtanwendung des § 8b Abs. 1–7 KStG auf Anteile, die bei Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen den Kapitalanlagen zuzurechnen sind (§ 8b Abs. 8 KStG)12.10.1 Hintergrund12.10.2 Regelung des § 8b Abs. 8 Sätze 1–3 KStG12.10.3 Regelung des § 8b Abs. 8 Satz 4 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 KStG12.11 Nichtanwendung von § 8b Abs. 7 und 8 KStG für Bezüge i. S. d. § 8b Abs. 1 KStG, auf die die Mutter-Tochter-Richtlinie anzuwenden ist (§ 8b Abs. 9 KStG)12.12 Entgelte bei Wertpapierleihe und Wertpapierpensionsgeschäften (§ 8b Abs. 10 KStG)12.12.1 Wertpapierleihe (Grundfall; § 8b Abs. 10 Satz 1 KStG)12.12.2 Verleiher (überlassende Körperschaft)12.12.2.1 Entleiher (andere Körperschaft)12.12.2.2 Rechtsfolgen bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 8b Abs. 10 Satz 1 KStG12.12.3 Überlassung von Wirtschaftsgütern statt Entgelt (§ 8b Abs. 10 Satz 2 KStG)12.12.4 Keine Anwendung von Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 5, § 8b Abs. 1 Satz 3 KStG12.12.5 Wertpapiergeschäfte nach § 340b Abs. 2 HGB (§ 8b Abs. 10 Satz 4 KStG)12.12.6 Ausnahme, wenn keine Einnahmen oder Bezüge erzielt werden (§ 8b Abs. 10 Sätze 5 und 6 KStG)12.12.7 Zwischenschaltung einer Personengesellschaft (§ 8b Abs. 10 Sätze 1, 7 und 8 KStG)12.12.8 Ausnahme (§ 8b Abs. 10 Satz 9 KStG)12.12.9 Ausnahme (§ 8b Abs. 10 Satz 10 KStG)12.12.10 Ausnahme (§ 8b Abs. 10 Satz 11 KStG)12.13 Nichtanwendung der Abs. 1–10 bei Anteilen an Unterstützungskassen (§ 8b Abs. 11 KStG)12.14 Auswirkungen der Anwendung des § 8b KStG auf die Gewerbesteuer12.15 § 8b KStG in Organschaftsfällen13 Organschaft13.1 Grundlagen13.1.1 Begriff und Bedeutung13.1.2 Grundsätze zur körperschaftsteuerlichen Einkommensermittlung13.2 Voraussetzungen der Organschaft13.2.1 Organträger13.2.1.1 Steuerpflicht des Organträgers13.2.1.2 Gewerbliches Unternehmen13.2.2 Organgesellschaft13.2.3 Sachliche Voraussetzungen der Organschaft13.2.3.1 Finanzielle Eingliederung13.2.3.2 Organschaftskette13.2.4 Die zeitlichen Voraussetzungen der Organschaft13.3 Gewinnabführungsvertrag13.3.1 Der aktienrechtliche Gewinnabführungsvertrag13.3.2 Gewinnabführungsvertrag anderer Kapitalgesellschaften13.3.3 Steuerrechtliche Erfordernisse des Gewinnabführungsvertrages13.3.3.1 Allgemeines13.3.3.2 »Kleine« Organschaftsreform in 201313.3.3.2.1 Heilung fehlerhafter Bilanzansätze im handelsrechtlichen Jahresabschluss bei »verunglückter Organschaft«13.3.3.2.2 Erforderlicher Inhalt der Verlustübernahmeverpflichtung für Gesellschaften, die nicht unter das AktG fallen13.3.3.2.3 Geminderte Verlustübernahmeverpflichtung, weil Kapitalrücklagen zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages verwendet wurden13.3.3.2.4 Steuerliche Folgen bei Nichtanerkennung der Organschaft (z. B. wegen fehlenden dynamischen Verweises auf § 302 AktG)13.3.3.2.5 Wichtiger Grund für die vorzeitige Kündigung eines Gewinnabführungsvertrags13.3.4 Durchführung des Gewinnabführungsvertrages13.3.5 Die Beendigung des Gewinnabführungsvertrages13.3.6 Gewinnabführungsvertrag bei Auflösung der Organgesellschaft13.4 Rechtsfolgen der körperschaftsteuerlichen Organschaft13.4.1 Grundsätze13.4.2 Ermittlung des Einkommens der Organgesellschaft13.4.2.1 Allgemeiner Überblick13.4.2.2 Die Beschränkung des Verlustabzugs (§ 15 Satz 1 Nr. 1 KStG)13.4.2.3 Bruttomethode gemäß § 15 Satz 1 Nr. 2 KStG13.4.2.4 § 7a GewStG für Organschaftsfälle: Bruttomethode auch bei der Gewerbesteuer13.4.2.5 Zinsschranke (§ 4h EStG) und Organschaft (§ 15 Satz 1 Nr. 3 KStG)13.4.3 Steuerliche Erfassung des Einkommens der Organgesellschaft beim Organträger13.4.3.1 Grundsatz der Einkommenseinheit13.4.3.2 Einzelfragen13.4.3.2.1 Rückstellung für zu übernehmende Verluste der Organgesellschaft13.4.3.2.2 Teilwertabschreibung auf Organbeteiligung13.4.3.2.3 Spendenabzug13.4.3.2.4 Verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte Einlagen13.4.4 Ausnahmen vom Grundsatz der Einkommenseinheit13.4.4.1 Ausgleichszahlungen (§ 16 KStG)13.4.4.2 Verdeckte Gewinnausschüttungen13.4.5 Die Einlagelösung bei Mehr- bzw. Minderabführungen13.4.5.1 Mehr- und Minderabführungen13.4.5.2 Sog. Einlagelösung nach § 14 Abs. 4 KStG i. d. F. des KöMoG13.4.5.2.1 Änderungen durch das KöMoG13.4.5.2.2 Bisherige Rechtslage: Aktive und passive Ausgleichsposten für Mehr- bzw. Minderabführungen – Überblick13.4.5.2.2.1 Aktive Ausgleichsposten für Minderabführungen13.4.5.2.2.2 Passive Ausgleichsposten für Mehrabführungen13.4.5.2.2.3 Hintergrund für die Einführung der Einlagelösung durch das KöMoG13.4.5.2.3 BMF-Schreiben zur Einlagelösung nach § 14 Abs. 4 KStG i. d. F. des KöMoG vom 29.09.2022, BStBl I 2022, 141213.4.5.2.3.1 Zeitliche Anwendung der Neuregelung (Rz. 1 BMF)13.4.5.2.3.2 Behandlung von Minder- und Mehrabführungen nach neuem Recht beim OT (Rz. 2 ff. BMF)13.4.5.2.3.3 Rücklage für bisherige Ausgleichsposten – Übergangsregelung nach § 34 Abs. 6e KStG (Rz. 11 f. BMF)13.4.5.2.3.4 Minder- und Mehrabführungen – Folgen für steuerliches Einlagekonto bei der OG (Rz. 25 f. BMF)13.4.5.2.3.5 Sonderfälle: Mittelbare Organschaft und Kettenorganschaft (Rz. 27 ff. BMF)13.4.6 Die Anwendung besonderer Tarifvorschriften13.5 Rechtsfolgen bei verunglückter Organschaft13.6 Gesonderte Feststellung des Organeinkommens13.7 Grundbeispiel zur Organschaft mit Gewinnabführung13.8 Rückwirkende Organschaftsbegründung bei Umstrukturierungen13.8.1 Eine durch übertragende Umwandlung aus einer Personengesellschaft entstandene Kapitalgesellschaft kann rückwirkend Organgesellschaft sein13.8.2 Rückwirkende Begründung einer Organschaft auch bei Ausgliederung eines Teilbetriebs nach § 20 UmwStG13.8.3 Keine rückwirkende Begründung einer Organschaft bei Anteilstausch i. S. d. § 21 UmwStGTeil D Tarif1 Steuersatz1.1 Überblick über die verschiedenen Körperschaftsteuersätze im Teileinkünfteverfahren1.2 Weitere Anwendung des Einheitssteuersatzes2 Berechnungsschema zur Körperschaftsteuer (R 7.2 KStR)Teil E Steuerermäßigung bei ausländischen Einkünften1 Besteuerung ausländischer Einkünfte (§ 26 KStG, §§ 34c und 34d EStG, Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, Außensteuergesetz)1.1 Überblick1.2 Steuerermäßigung nach § 26 KStG1.3 Keine Anwendung von § 26 KStG bei Freistellung durch ein DBA oder sonstige Freistellungen2 Methoden der Vermeidung bzw. Milderung der Doppelbesteuerung2.1 Freistellungsmethode2.2 Direkte Steueranrechnung (§ 26 Abs. 1 KStG)2.3 Abzug ausländischer Steuern von der Bemessungsgrundlage für die deutsche Körperschaftsteuer (§ 26 Abs. 2 Satz 2 KStG, § 34c Abs. 2 und 3 EStG)2.4 Eingeschränkte Berücksichtigung negativer Einkünfte mit Bezug zu Drittstaaten i. S. d. § 2a Abs. 1 EStG2.5 Berichtigung von Einkünften bei internationalen Verflechtungen (§ 1 AStG)2.5.1 Geschäftsbeziehung zum Ausland2.5.2 Nahestehende Person2.5.2.1 Nachrangige Anwendung des § 1 AStG2.5.2.2 Bemessungsgrundlage für die Korrektur2.5.2.3 § 1 Abs. 1 AStG und EU-Recht3 Weiterführende LiteraturTeil F Das steuerliche Einlagekonto (§ 27 KStG), Kapitalerhöhung und -herabsetzung (§ 28 KStG), Kapitalveränderungen bei Umwandlungen (§ 29 KStG)1 Das steuerliche Einlagekonto (§ 27 KStG)1.1 Sinn und Zweck1.2 Wer muss ein steuerliches Einlagekonto führen und weshalb?1.3 Erstmalige Ermittlung des steuerlichen Einlagekontos1.4 Fortschreibung des steuerlichen Einlagekontos1.5 Anfangsbestand des steuerlichen Einlagekontos in sonstigen Fällen1.5.1 Fälle des § 156 Abs. 2 AO1.5.2 Bei Wechsel von der beschränkten zur unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht1.6 Feststellung des steuerlichen Einlagekontos1.6.1 Feststellung des steuerlichen Einlagekontos in Liquidationsfällen1.6.2 Bindungswirkung der Feststellung1.7 Steuererklärungspflicht betreffend das steuerliche Einlagekonto1.8 Anwendung des § 129 AO bei unterlassener Feststellung1.9 Veränderungen des steuerlichen Einlagekontos1.9.1 Einlagen1.9.2 Fälle der Bar- bzw. Sachgründung und Einbringungsfälle gemäß § 20 UmwStG1.9.3 Erhöhungsbetrag i. S. d. § 23 Abs. 2 und 3 UmwStG1.9.4 Leistungen, für die das steuerliche Einlagekonto als verwendet gilt1.9.4.1 Ausschüttbarer Gewinn1.9.4.1.1 Eigenkapital der Steuerbilanz1.9.4.1.2 Gezeichnetes Kapital1.9.4.1.3 Bestand des steuerlichen Einlagekontos1.9.4.2 Leistungen, die zur Verwendung des steuerlichen Einlagekontos führen können1.9.4.3 Zeitpunkt der Verrechnung von Leistungen mit dem steuerlichen Einlagekonto1.9.4.4 Die Verrechnung von Leistungen1.9.4.5 Verrechnung mehrerer Leistungen in einem Wirtschaftsjahr1.9.4.5.1 Darstellung dreier Möglichkeiten zur Verrechnung mehrerer Gewinnausschüttungen in einem Wirtschaftsjahr1.9.4.5.2 Verwendung des steuerlichen Einlagekontos in Abhängigkeit verschiedener Berechnungsvarianten1.9.4.5.3 Bewertung der verschiedenen Verrechnungsmethoden1.9.4.6 Verrechnung von Leistungen bei einem negativen ausschüttbaren Gewinn1.9.4.7 Verrechnung von Leistungen bei negativem Bestand des steuerlichen Einlagekontos1.9.4.8 Verrechnung von Leistungen bei bestehender Einlageforderung1.9.4.9 Steuerbescheinigung1.9.4.10 Festschreibung der bescheinigten Verwendung des steuerlichen Einlagekontos, Haftung bei unzutreffend ausgestellter Bescheinigung, Berichtigung von Steuerbescheinigungen1.9.4.10.1 Festschreibung bei zu niedriger Bescheinigung der Minderung des Einlagekontos1.9.4.10.2 Fiktion einer bescheinigten Einlagerückgewähr i. H. v. 0 €1.9.4.10.3 Keine Berichtigung oder erstmalige Erteilung einer Steuerbescheinigung bei zu geringer Bescheinigung der Minderung des Einlagekontos1.9.4.10.4 Haftung für die Kapitalertragsteuer bei zu hohem Ausweis der Minderung des Einlagekontos1.9.4.10.5 Berichtigung einer Steuerbescheinigung bei zu hoher Bescheinigung der Minderung des Einlagekontos1.9.4.10.6 Anpassung der Feststellung des steuerlichen Einlagekontos an die der Haftungsinanspruchnahme zugrunde liegende Einlagenrückgewähr1.9.4.11 Direktzugriff auf das steuerliche Einlagekonto – kein Abzug von Leistungen, die zu einem negativen Einlagekonto führen1.9.4.11.1 Forderungsverzicht gegen Besserungsversprechen1.9.4.11.2 Rückzahlung von Nachschüssen1.9.4.12 Minder- und Mehrabführungen bei Organschaft1.9.4.12.1 Definition der Minder- und Mehrabführung1.9.4.12.2 Steuerliche Behandlung organschaftlicher Minder- und Mehrabführungen1.9.4.12.3 Weitere Ursachen einer Minder- bzw. Mehrabführung1.9.4.12.4 Minder- und Mehrabführung in organschaftlicher Zeit1.9.4.12.5 Erhöhung des steuerlichen Einlagekontos bei Minderabführungen auf Grund vorvertraglicher Geschäftsvorfälle1.9.4.12.6 Ermittlung der Minder- und Mehrabführungen1.9.4.13 Kein Direktzugriff auf das steuerliche Einlagekonto bei Auflösung von Kapitalrücklagen; keine verfassungsrechtlichen Bedenken1.9.4.14 Ausnahmsweise Direktzugriff auf das steuerliche Einlagekonto nach Rückzahlung des Nennkapitals i. S. d. § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG1.9.4.15 Materiell-rechtliche Bindungswirkung der Feststellung des Einlagekontos1.9.5 Veränderungen des steuerlichen Einlagekontos bei der Kapitalerhöhung bzw. -herabsetzung1.9.6 Veränderungen des steuerlichen Einlagekontos in Umwandlungsfällen1.10 Anwendung des § 27 KStG bei anderen Körperschaften als Kapitalgesellschaften (§ 27 Abs. 7 KStG)1.10.1 Körperschaften, die Leistungen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG erbringen können1.10.2 Körperschaften, die Leistungen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 10 EStG erbringen können1.10.2.1 Betriebe gewerblicher Art mit eigener Rechtspersönlichkeit1.10.2.2 Betriebe gewerblicher Art ohne eigene Rechtspersönlichkeit1.10.3 Ermittlung des Anfangsbestandes beim steuerlichen Einlagekonto1.10.4 Veränderungen des steuerlichen Einlagekontos1.10.4.1 Einlagen bei sonstigen Körperschaften und Personenvereinigungen1.10.4.2 Leistungen von sonstigen Körperschaften und Personenvereinigungen1.10.4.2.1 Verwendung des steuerlichen Einlagekontos für Leistungen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 9 und 10 Buchst. a EStG1.10.4.2.2 Verwendung des steuerlichen Einlagekontos für Leistungen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b EStG1.11 Einlagenrückgewähr bei nicht unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaften (§ 27 Abs. 8 KStG)1.11.1 Allgemeines1.11.2 Vordruck1.11.3 Einlagerückgewähr durch Kapitalgesellschaften in Drittstaaten2 Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sonderausweis (§ 28 KStG)2.1 Kapitalerhöhung im Handelsrecht2.1.1 Kapitalerhöhung aus Einlagen2.1.2 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln2.2 Kapitalerhöhung im Steuerrecht2.2.1 Kapitalerhöhung gegen Einlagen2.2.2 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln – Sonderausweis2.2.2.1 Feststellung, Bindungswirkung, Steuererklärung2.2.2.2 Körperschaften, bei denen ein Sonderausweis auftreten kann2.2.3 Nennkapitalerhöhung und Sonderausweis2.2.4 Vorrangige Verwendung des steuerlichen Einlagekontos2.2.4.1 Keine Konkurrenz der Nennkapitalerhöhung zur Verwendung des steuerlichen Einlagekontos für andere Leistungen2.2.4.2 Es besteht kein steuerliches Einlagekonto2.2.4.3 Ein steuerliches Einlagekonto ist vorhanden2.2.5 Auswirkungen der Kapitalerhöhung auf die Einkommensbesteuerung der Kapitalgesellschaft und ihrer Anteilseigner2.3 Nennkapitalherabsetzung und Sonderausweis2.3.1 Ordentliche Kapitalherabsetzung2.3.2 Vereinfachte Kapitalherabsetzung2.3.3 Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Anteilen2.4 Vorrangige Minderung des Sonderausweises2.5 Nachrangige Erhöhung des steuerlichen Einlagekontos2.5.1 Keine Erhöhung des steuerlichen Einlagekontos2.5.2 Keine Minderung des Sonderausweises2.6 Nennkapitalrückzahlung nach Kapitalherabsetzung2.6.1 Nennkapitalherabsetzung führt zu einer Minderung des Sonderausweises2.6.2 Nennkapitalrückzahlung bei fehlendem Sonderausweis bzw. Nennkapitalrückzahlung übersteigt den Sonderausweis2.7 Keine Differenzrechnung für Verwendung des steuerlichen Einlagekontos bei Nennkapitalrückzahlung2.8 Keine Steuerbescheinigung für Verwendung des steuerlichen Einlagekontos bei Nennkapitalrückzahlung2.9 Auswirkungen der Kapitalherabsetzung auf die Einkommensbesteuerung der Kapitalgesellschaft und ihrer Anteilseigner2.10 Anwendung des § 28 KStG bei Umwandlung2.11 Anwendung des § 28 KStG bei Auflösung2.11.1 Anwendung des § 28 KStG im Rahmen der Liquidationsbesteuerung2.11.2 Abschlagszahlungen auf den Liquidationserlös2.11.3 Schlussauskehrung bei Liquidation2.12 Anwendung des § 28 Abs. 3 KStG3 Kapitalveränderungen bei Umwandlungen (§ 29 KStG)3.1 Allgemeines3.1.1 Sinn und Zweck der Vorschrift3.1.2 Aufbau der Vorschrift3.2 Nennkapitalherabsetzung bei der übertragenden Kapitalgesellschaft gemäß § 29 Abs. 1 KStG3.2.1 Sinn und Zweck der fiktiven Nennkapitalherabsetzung3.2.2 Nennkapitalherabsetzung bei der übernehmenden Kapitalgesellschaft im Falle der Abwärtsverschmelzung3.3 Übergang des steuerlichen Einlagekontos bei Verschmelzung (§ 29 Abs. 2 KStG)3.3.1 Hinzurechnungsbeschränkung bei der Aufwärtsverschmelzung3.3.2 Kürzung bei der Abwärtsverschmelzung3.3.3 Keine Beschränkung bei Verschmelzungen ohne bestehendes Beteiligungsverhältnis3.3.4 Keine Aussage im Gesetz zum steuerlichen Einlagekonto der übertragenden Körperschaft in Verschmelzungsfällen3.3.5 Nennkapitalanpassung nach Umwandlungsvorgang (§ 29 Abs. 4 KStG)3.4 Anwendung des § 29 KStG bei Körperschaften, die keine Kapitalgesellschaften sind3.5 Beispiele3.5.1 Beispiel zur Verschmelzung der Tochter- auf die Muttergesellschaft3.5.2 Beispiel zur Verschmelzung der Mutter- auf die Tochtergesellschaft3.5.3 Beispiel zur Verschmelzung von Schwester-Kapitalgesellschaften3.6 Das steuerliche Einlagekonto bei Auf- oder AbspaltungTeil G Entstehung, Veranlagung und Erhebung von Körperschaftsteuer1 Entstehung von Körperschaftsteuer2 Veranlagung und Erhebung von Körperschaftsteuer3 Besteuerung kleiner Körperschaften (R 31.1 KStR)4 Unmittelbare Steuerberechtigung und ZerlegungTeil H Solidaritätszuschlag ab 19951 Allgemeines2 Abgabepflichtige Personen3 Bemessungsgrundlage3.1 Solidaritätszuschlag auf die veranlagte Steuer3.2 Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftsteuervorauszahlungen3.3 Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer4 Zuschlagssatz5 Anrechnung des auf die einbehaltene Kapitalertragsteuer entfallenden Solidaritätszuschlags beim Anteilseigner6 Doppelbesteuerungsabkommen7 Vergütungs- und Erstattungsverfahren durch das Bundeszentralamt für Steuern8 VerfahrensvorschriftenTeil I Das Halb-/Teileinkünfteverfahren auf der Ebene des Anteilseigners1 Konzeption des Halb-/Teileinkünfteverfahrens1.1 Bis VZ 2008 vom Halbeinkünfteverfahren betroffene Einkünfte1.2 Teileinkünfteverfahren statt Halbeinkünfteverfahren ab VZ 20091.2.1 Anwendung des Teileinkünfteverfahrens nur bei betrieblichen Einkunftsarten (§ 3 Nr. 40 Satz 2 EStG)1.2.2 Keine Anwendung des Teileinkünfteverfahrens bei laufenden Einnahmen im Privatvermögen1.2.3 Allgemeines1.2.3.1 Rechtslage bis VZ 20161.2.3.1.1 Anwendung auf Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute, bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind (§ 3 Nr. 40 Satz 3 EStG)1.2.3.1.2 Anteilserwerb zur kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs bei Finanzunternehmen (§ § 3 Nr. 40 Satz 3 EStG)1.2.3.2 Rechtslage ab VZ 20171.2.3.3 Einbeziehung in das Handelsbuch1.2.4 Anwendung des Teileinkünfteverfahrens für Beteiligungserträge aus Beteiligungen an Unterstützungskassen (§ 3 Nr. 40 Satz 4 EStG n. F.)1.2.5 Anwendung des Teileinkünfteverfahrens bei Veräußerungsgewinnen i. S. d. § 17 EStG1.3 Auswirkungen auf andere Vorschriften1.3.1 Abzugsverbot nach § 3c Abs. 2 EStG1.3.2 Auffassung des BMF zur Anwendung der BFH-Rechtsprechung (BStBl I 2013, 1269), Rechtslage bis 31.12.20141.3.2.1 Aufwendungen für die Überlassung von Wirtschaftsgütern an eine Kapitalgesellschaft, an der der Überlassende beteiligt ist1.3.2.2 Substanzverluste und Substanzgewinne sowie sonstige Aufwendungen bezüglich im Betriebsvermögen gehaltener Darlehensforderungen1.3.2.3 Rückgriffsforderung aus einer Bürgschaftsinanspruchnahme1.3.2.4 Besonderheiten bei einnahmelosen Kapitalbeteiligungen1.3.3 Rechtslage ab 01.01.20151.3.4 Verhältnis zur Kapitalertragsteuer1.3.5 Folgen des Halb-/Teileinkünfteverfahrens für außerordentliche Einkünfte i. S. d. § 34 EStG1.3.6 Anrechnung ausländischer Steuer (§ 34c EStG)1.4 Verfahrensproblem bei Personengesellschaften2 Tatbestände des § 3 Nr. 40 EStG2.1 Tatbestände des § 3 Nr. 40 Buchst. a EStG2.1.1 Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die zum Betriebsvermögen gehören2.1.2 Entnahme von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die zum Betriebsvermögen gehören (§ 4 Nr. 40 Buchst. a Satz 1 EStG)2.1.3 Teilwertabschreibungen/Zuschreibungen2.1.3.1 Reihenfolgeproblem2.1.3.2 Rechtsprechung des BFH und Änderung der Verwaltungsauffassung2.1.4 Teileinkünfteverfahren bei vorangegangenen Abzügen nach § 6b EStG bzw. ähnlichen Abzügen (§ 3 Nr. 40 Buchst. a Satz 3 EStG)2.1.5 Liquidation und Kapitalherabsetzung2.1.6 Veräußerung von Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften2.1.7 Verdeckte Einlage von Anteilen2.2 Tatbestände des § 3 Nr. 40 Buchst. b EStG2.2.1 Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die zum Betriebsvermögen gehören, in Zusammenhang mit Betriebsveräußerungen (§ 3 Nr. 40 Buchst. b Satz 1 EStG)2.2.2 Veräußerung oder Entnahme von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die zum Betriebsvermögen gehören, bei Betriebsaufgabe (§ 3 Nr. 40 Buchst. b Satz 2 EStG)2.2.3 Teileinkünfteverfahren bei vorangegangenen Abzügen nach § 6b EStG bzw. ähnlichen Abzügen (§ 3 Nr. 40 Buchst. b Satz 3 EStG)2.3 Tatbestände des § 3 Nr. 40 Buchst. c EStG2.3.1 Veräußerungspreis i. S. d. § 17 EStG2.3.2 Auflösung und Kapitalherabsetzung i. S. d. § 17 Abs. 4 EStG2.4 Tatbestände des § 3 Nr. 40 Buchst. d EStG2.4.1 Beteiligungen im Privatvermögen2.4.2 Beteiligungen im Betriebsvermögen2.4.2.1 Gewerbesteuerliche Problematiken2.4.2.2 Gewerbesteuerliche Auswirkungen des § 3c Abs. 2 EStG2.4.3 Bezüge aus dem steuerlichen Einlagekonto2.4.4 Einnahmen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG2.4.5 Besonderheiten bei verdeckten Gewinnausschüttungen (§ 3 Nr. 40 Buchst. d Sätze 2 und 3 EStG), Allgemeines2.4.5.1 Keine Teileinkünftebesteuerung einer verdeckten Gewinnausschüttung, wenn das Einkommen der leistenden Körperschaft gemindert worden ist (§ 3 Nr. 40 Buchst. d Satz 2 EStG)2.4.5.2 Teileinkünftebesteuerung bei verdeckten Gewinnausschüttungen, wenn sich das Einkommen einer nahestehenden Person erhöht hat (§ 3 Nr. 40 Buchst. d Satz 3 EStG)2.5 Tatbestand des § 3 Nr. 40 Buchst. e EStG2.6 Tatbestand des § 3 Nr. 40 Buchst. f EStG2.7 Tatbestand des § 3 Nr. 40 Buchst. g EStG2.8 Tatbestand des § 3 Nr. 40 Buchst. h EStG2.9 Tatbestand des § 3 Nr. 40 Buchst. i EStG2.10 Tatbestand des § 3 Nr. 40 Buchst. j EStG2.11 Tatbestand des § 3 Nr. 40a EStG3 Kapitalertragsteuer bis VZ 20084 Kapitalertragsteuer ab VZ 20094.1 Pflicht zum Kapitalertragsteuerabzug4.2 Grundsätzliches4.3 Kapitalerträge mit Steuerabzug (§ 43 EStG) – Aufzählung der Kapitalerträge4.4 Bemessung der Kapitalertragsteuer (§ 43a EStG)4.5 Entrichtung der Kapitalertragsteuer (§ 44 EStG)4.6 Abstandnahme vom Steuerabzug (§ 44a EStG)4.7 Erstattung der Kapitalertragsteuer (§ 44b EStG)4.8 Ausschluss der Erstattung von Kapitalertragsteuer (§ 45 EStG)4.9 Anmeldung und Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (§ 45a EStG)4.10 Kapitalertragsteuer und Doppelbesteuerungsabkommen4.11 Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern (§ 45d EStG)Teil J Komplexer Übungsfall1 Sachverhalt1.1 Aufwendungen/Erträge lt. Gewinn- und Verlustrechnung1.2 Dividende von der Y-AG1.3 Erstattung der Geldbuße1.4 Beteiligung an der Nudel-KG1.5 Wertaufholung Beteiligung X-GmbH1.6 Pensionszusagen AW und WW1.6.1 Pensionsverzicht durch AW1.6.2 Eintritt Besserungsfall bei Pensionszusage von WW1.7 Maßnahmen zur Stärkung der W-GmbH1.7.1 Rangrücktritt von WW1.7.2 Rangrücktritt von AW1.8 Geschäftsführerbezüge von WW und AW1.9 Geldauszahlung an Sohn von WW2 AufgabeTeil K Lösung zum komplexen Übungsfall1 Ermittlung des zu versteuernden Einkommens für 20232 Prüfung der Einlagenrückgewähr in 2023 nach § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG (Differenzrechnung)3 Ermittlung der KSt-Schuld 2023 und der Steuerrückstellungen für 2023 (KSt/SolZ)4 Endgültiger Jahresüberschuss 2023 lt. Steuerbilanz5 Gesonderte Feststellung des steuerlichen Einlagekontos zum 31.12.2023 (§ 27 Abs. 2 Satz 1 KStG)StichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-5732-3
Bestell-Nr. 20239-0005
ePub:
ISBN 978-3-7910-5734-7
Bestell-Nr. 20239-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-5733-0
Bestell-Nr. 20239-0154
Matthias Alber/Michael Szczesny/Hartmut Sell
Körperschaftsteuer
20. überarbeitete und aktualisierte Auflage, Oktober 2024
© 2024 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Reinsburgstr. 27, 70178 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © Umschlag: Stoffers Grafik-Design, Leipzig
Produktmanagement: Rudolf Steinleitner
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Autoren
Prof. Matthias Alber
Professor für Steuerrecht an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
Hartmut Sell
Dipl.-Finanzwirt, Steuerberater, Regierungsdirektor a.D., Wildeck
Prof. Dr. Michael Szczesny
Professor für Steuerrecht an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
Bearbeiterübersicht:
Sell: Teil C 12, Teil E, Teil H, Teil IAlber/Szczesny: Teil A, Teil B, Teil C 1–11, Teil C 13, Teil D, Teil F, Teil G, Teil J, Teil K
Vorwort zur 20. Auflage
Das vorliegende Lehrbuch bietet eine vertiefende systematische Darstellung des Körperschaftsteuerrechts. Umfassend behandelt werden die Bereiche verdeckte Gewinnausschüttungen, verdeckte Einlagen, Zinsschranke, Organschaft, Liquidation, Kapitalerhöhung und -herabsetzung sowie die Besteuerung ausgewählter Rechtsformen. Darüber hinaus werden die folgenden Themen intensiv beleuchtet: Sachliche Steuerbefreiungen nach § 8b KStG und Ausnahmefälle; Verlustabzugsbeschränkungen nach § 8c, § 8d KStG; steuerliches Einlagekonto i. S. d. § 27 KStG; Anwendung des Teileinkünfteverfahrens auf der Ebene der Anteilseigner nach § 3 Nr. 40 Buchst. a–i EStG.
Die Ausführungen geben den Rechtsstand 31.08.2024 wieder; berücksichtigt sind unter anderem die Änderungen durch das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts vom 25.06.2021 (BGBl I 2021, 2050) mit der darin enthaltenen Option zur Körperschaftsbesteuerung, das Jahressteuergesetz (JStG) 2022 (BGBl I 2022, 2294) sowie das Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz) vom 27.03.2024 (BGBl I Nr. 108). Neben aktuellen Verwaltungsanweisungen sind darüber hinaus die wesentlichen Entwicklungen im Bereich der nationalen Rechtsprechung und der Rechtsprechung des EuGH eingearbeitet.
Dieses Lehrbuch ist bestens geeignet sowohl für die steuerliche Ausbildung im Bereich der Körperschaftsteuer, z. B. für das Steuerstudium an (Fach-)Hochschulen, als auch zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung. Das Buch ist aber auch für den »Steuerpraktiker« eine unerlässliche Hilfe, um mit Steuerfragen zu Kapitalgesellschaften und ihren Anteilseignern in der täglichen Beratungspraxis souverän umgehen zu können.
Ludwigsburg/Wildeck, im September 2024
Die Verfasser
Abkürzungsverzeichnis
a. A.
anderer Ansicht
a. a. O.
am angegebenen Ort
ABl. EG
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
Abs.
Absatz
Abschn.
Abschnitt
abw. Wj.
abweichendes Wirtschaftsjahr
abzb.
abziehbar
AE
Anteilseigner
AEAO
Anwendungserlass zur Abgabenordnung
ÄndG
Änderungsgesetz
ÄndR
Änderungsrichtlinien
ÄndVO
Änderungsverordnung
a. F.
alte Fassung
AfA
Absetzung für Abnutzung
AG
Aktiengesellschaft
AG
Die Aktiengesellschaft, Zeitschrift für das gesamte Aktienwesen
AG & Co. KG
Kommanditgesellschaft mit einer AG als persönlich haftendem Gesellschafter
AK
Anschaffungskosten
AktG
Aktiengesetz
Alt.
Alternative
amtl.
amtlich
Anh.
Anhang
Anl.
Anlage
Anm.
Anmerkung
AO
Abgabenordnung
a. o.
außerordentlich(er)
AP
Ausgleichsposten
ARD
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands
arg. ex
argumentum ex (Umkehrschluss)
Art.
Artikel
AStG
Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (Außensteuergesetz)
AV
Anlagevermögen
AWD
Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters (siehe auch RIW/AWD)
Az.
Aktenzeichen
BA
Betriebsausgabe(n)
BAG
Bundesarbeitsgericht
BAnz.
Bundesanzeiger
BaWü
Baden-Württemberg
Bay
Bayern
BB
Betriebsberater
BBK
Buchführung, Bilanz, Kostenrechnung, Zeitschrift für das gesamte Rechnungswesen
Bd.
Band
BdF
Bundesminister(ium) der Finanzen
BE
Betriebseinnahmen
Beschl.
Beschluss
beschr.
beschränkt
Betr. AvG
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung
BewG
Bewertungsgesetz
BFH
Bundesfinanzhof
BFHE
Sammlung der Entscheidungen und Gutachten des Bundesfinanzhofs
BFH/NV
Sammlung amtlich nicht veröffentlichter Entscheidungen des Bundesfinanzhofs
BFuP
Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
BgA
Betrieb gewerblicher Art
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGHZ
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BilMoG
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
BiRiLiG
Bilanzrichtliniengesetz
Bl.
Blatt
Bln
Berlin
BMF
Bundesministerium der Finanzen
BMG
Bemessungsgrenze
Bp
Betriebsprüfung
BR
Bundesrat
BR-Drucks.
Bundesratsdrucksache
Brem
Bremen
bspw.
beispielsweise
BStBl
Bundessteuerblatt
BT-Drucks.
Bundestagsdrucksache
Buchst.
Buchstabe
BV
Betriebsvermögen
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerwG
Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
BW
Buchwert
bzw.
beziehungsweise
DB
Der Betrieb
DB
Durchführungsbestimmungen
DBA
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
dgl.
dergleichen
d. h.
das heißt
DIHT
Deutscher Industrie- und Handelstag
Doppelbuchst.
Doppelbuchstabe
D/P/M
Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer (Kommentar)
DRK
Deutsches Rotes Kreuz
Drucks.
Drucksache
DStG
Die Steuer-Gewerkschaft
DStJG
Jahrbuch der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft
DStPr
Deutsche Steuerpraxis
DStR
Deutsches Steuerrecht
DStZ
Deutsche Steuer-Zeitung, Ausgabe A
DStZ/E
Deutsche Steuer-Zeitung/ Eildienst (ab 1990: StE)
DV
Durchführungsverordnung
EAV
Ergebnisabführungsvertrag
EBITDA
Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
EFG
Entscheidungen der Finanzgerichte
eG
eingetragene Genossenschaft
EG
Europäische Gemeinschaft
EGAktG
Einführungsgesetz zum Aktiengesetz
EGBGB
Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuch
EGHGB
Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
EGKStRG
Einführungsgesetz zum Körperschaftsteuer-Reformgesetz
EGStGB
Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch
EHZ
Erhebungszeitraum
Eink.
Einkünfte
einschl.
einschließlich
EK
Eigenkapital
ErbSt
Erbschaft- und Schenkungsteuer
ErbStG
Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz
Erl.
Erlass
ESt
Einkommensteuer
EStDV
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
EStG
Einkommensteuergesetz
EStH
Einkommensteuer-Handbuch
EStR
Einkommensteuer-Richtlinien
e. V.
eingetragener Verein
evtl.
eventuell
EW
Einheitswert
EWG
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EU
Europäische Union
EuGH
Europäischer Gerichtshof
F.
Fach
f.
folgende
ff.
fortfolgende
Ffm
Frankfurt am Main
FA
Finanzamt
FinBeh
Finanzbehörde
FinMin
Finanzministerium
FinVerw
Finanzverwaltung
FG
Finanzgericht
FGO
Finanzgerichtsordnung
FK
Fremdkapital
Fn
Fußnote
FR
Finanz-Rundschau
FRL
Fusions-Richtlinie
FSt
Institut Finanz und Steuern
GAV
Gewinnabführungsvertrag
GbR
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
gem.
gemäß
GenG
Genossenschaftsgesetz
Ges.
Gesellschafter
GewSt
Gewerbesteuer
GewStDV
Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
GewStG
Gewerbesteuergesetz
GewStR
Gewerbesteuer-Richtlinien
GG
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
ggf.
gegebenenfalls
gl. A.
gleicher Ansicht
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH & Co. KG
Kommanditgesellschaft mit einer GmbH als persönlich haftendem Gesellschafter
GmbHG
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GmbHR
GmbH-Rundschau
Gr.
Gruppe
grds.
grundsätzlich
GrS
Großer Senat des BFH
GStB
Gestaltende Steuerberatung
G+V-Rechnung
Gewinn- und Verlustrechnung
H
Hinweis
HB
Handelsbilanz
Hbg
Hamburg
HBil
Handelsbilanz
HdU
Handbuch der Unternehmensbesteuerung
Hess
Hessen
HFA
Hauptfachausschuss (des Instituts der Wirtschaftsprüfer)
HFR
Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung
HGB
Handelsgesetzbuch
h. L.
herrschende Lehre
h. M.
herrschende Meinung
Hrsg.
Herausgeber
HS
Halbsatz
i. d. F.
in der Fassung
i. d. R.
in der Regel
IDW
Institut der Wirtschaftsprüfer
i. E.
im Einzelnen
i. Gr.
in Gründung
i. H. d.
in Höhe der (des)
i. H. v.
in Höhe von
INF
Die Information über Steuer und Wirtschaft
insbes.
insbesondere
InvStRefG
Investmentsteuerreformgesetz
InvZul
Investitionszulage
InvZulG
Investitionszulagengesetz
i. R. d.
im Rahmen der (des)
i. S. d.
im Sinne des
IStR
Internationales Steuerrecht
i. S. v.
im Sinne von
i. V. m.
in Verbindung mit
IWB
Internationale Wirtschaftsbriefe
i. Z. m.
in Zusammenhang mit
JbFfStR/JbFStR
Jahrbuch der Fachanwälte für Steuerrecht
jPöR
juristische Person des öffentlichen Rechts
JStG
Jahressteuergesetz
JÜ
Jahresüberschuss
jur. Pers.
juristische Person
KAG
Kapitalanlagegesellschaft
KapErhG
Gesetz über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und über die Verschmelzung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Kapitalerhöhungsgesetz)
KapErhStG
Gesetz über steuerrechtliche Maßnahmen bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln (Kapitalerhöhungs-Steuergesetz)
KapGes
Kapitalgesellschaft
KapSt
Kapitalertragsteuer
Kfz
Kraftfahrzeug
KG
Kommanditgesellschaft
KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien
KiSt
Kirchensteuer
Kj.
Kalenderjahr
KO
Konkursordnung
Kö
Körperschaft
KÖSDI
Kölner Steuerdialog
KSt
Körperschaftsteuer
KStDV
Körperschaftsteuer-Durchführungsverordnung
KStG
Körperschaftsteuergesetz
KStR
Körperschaftsteuer-Richtlinien
KWG
Kreditwesengesetz
lfd.
laufend
Limited
Kapitalgesellschaft englischen Rechts/mit beschränkter Haftung
LSt
Lohnsteuer
LSW
Lexikon des Steuer- und Wirtschaftsrechts
lt.
laut
m. a. W.
mit anderen Worten
m. E.
meines Erachtens
Mio.
Million(en)
MoMiG
Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen
mtl.
monatlich
MU
Mitunternehmer
MV
Mecklenburg-Vorpommern
m. w. H.
mit weiteren Hinweisen
m. w. N.
mit weiteren Nachweisen
nabzb.
nichtabziehbar
Nds
Niedersachsen
n. F.
neue Fassung
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
NL
Niederlande
Nr.
Nummer
nrkr.
nichtrechtskräftig
Nrn.
Nummern
NSt
Neues Steuerrecht von A bis Z, Kommentar-Zeitschrift für das gesamte Steuerrecht
NRW
Nordrhein-Westfalen
n. v.
nicht amtlich veröffentlicht
NV
naamlose vennootschap (Aktiengesellschaft niederländischen Rechts)
NW
Nordrhein-Westfalen
NWB
Neue Wirtschafts-Briefe für Steuer- und Wirtschaftsrecht
o. a.
oben angegeben
o. ä.
oder ähnlichem
OECD
Organization for Economic Cooperation and Development
OECD-MA
OECD-Musterabkommen
öff.
öffentlich
OFD
Oberfinanzdirektion
OG
Organgesellschaft
oGA
offene Gewinnausschüttung
OHG
offene Handelsgesellschaft
OLG
Oberlandesgericht
OT
Organträger
o. V.
ohne Verfasser
PersGes
Personengesellschaft
PV
Privatvermögen
R
Richtlinie(nabschnitt)
RAP
Rechnungsabgrenzungsposten
RdNr.
Randnummer
Rdvfg
Rundverfügung
RFH
Reichsfinanzhof
RG
Reichsgericht
RGBl
Reichsgesetzblatt
RGZ
Reichsgerichtshof in Zivilsachen
RhPf
Rheinland-Pfalz
RIW/AWD
Recht der Internationalen Wirtschaft, Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters
rkr.
rechtskräftig
Rn.
Randnummer
Rs.
Rechtssache
RStBl
Reichssteuerblatt
Rumpf-Wj.
Rumpfwirtschaftsjahr
RWP
Rechts- und Wirtschaftspraxis
Rz.
Randziffer
s.
siehe
s. a.
siehe auch
SA
société anonyme (Aktiengesellschaft französischen Rechts)
Saarl
Saarland
Sachs
Sachsen
SachsAnh
Sachsen-Anhalt
s. b. Ertrag
sonstiger betrieblicher Ertrag
SBV
Sonderbetriebsvermögen
SchlHol
Schleswig-Holstein
Schr.
Schreiben
SE
Europäische (Aktien-)Gesellschaft (Societas Europaea)
SEStEG
Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften
s. o.
siehe oben
SolZ
Solidaritätszuschlag
SolZG
Solidaritätszuschlagsgesetz
sonst.
sonstige
Sp.
Spalte
StandOG
Standortsicherungsgesetz
StändG
Steueränderungsgesetz
StAnpG
Steueranpassungsgesetz
StB
Der Steuerberater
StBereinigungsG
Steuerbereinigungsgesetz
Stbg
Die Steuerberatung
StBil
Steuerbilanz
StbJb
Steuerberater-Jahrbuch
StbKongrRep
Steuerberater-Kongress-Report
StBp
Die steuerliche Betriebsprüfung
StEd
Steuer-Eildienst (bis 1989: DStZ/E)
StEK
Steuererlasse in Karteiform
StEntlG
Steuerentlastungsgesetz
StKongrRep
Steuerkongress-Report
Stpfl.
Steuerpflichtiger
stpfl.
steuerpflichtig
StPflicht
Steuerpflicht
str.
strittig (streitig)
StRefG
Steuerreformgesetz
StRK
Steuerrechtsprechung in Karteiform
StSenkG
Steuersenkungsgesetz
StStud
Steuer und Studium
StuB
Steuer und Buchhaltung
StuW
Steuer und Wirtschaft, Zeitschrift für die gesamte Steuerwissenschaft
StVergAbG
Steuervergünstigungsabbaugesetz
StVj.
Steuerliche Vierteljahreszeitschrift
StW
Steuerwarte
s. u.
siehe unten
TB
Teilbetrieb
TEV
Teileinkünfteverfahren
Thür
Thüringen
TW
Teilwert
tw.
teilweise
Tz.
Textziffer
u. a.
unter anderem
UBG
Unternehmensbeteiligungsgesellschaften
u. E.
unseres Erachtens
UG
Unternehmensgesellschaft (haftungsbeschränkt)
UmwG
Umwandlungsgesetz
UmwStG
Umwandlungssteuergesetz
UmwStG 1977
Gesetz über steuerliche Maßnahmen bei Änderung der Unternehmensform (Umwandlungssteuergesetz) vom 06.09.1976 BGBl I 1976, 2641, mit späteren Änderungen
UmwStG 1995
Umwandlungssteuergesetz vom 28.10.1994 BGBl I 1994, 3267, mit späteren Änderungen
unbeschr.
unbeschränkt
URefG
Unternehmensteuerreformgesetz 2008
Urt.
Urteil
USt
Umsatzsteuer
UStDV
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
UStG
Umsatzsteuergesetz
UStR
Umsatzsteuer-Richtlinien
u. U.
unter Umständen
VAG
Gesetz über die Beaufsichtigung der privaten Versicherungsunternehmungen (Versicherungsaufsichtsgesetz)
vEK
für Ausschüttungen verwendbares Eigenkapital (verwendbares Eigenkapital)
VermBG
Vermögensbildungsgesetz
VermG
Vermögensgesetz
Vfg.
Verfügung
VG
Vermögensgegenstand
vGA
verdeckte Gewinnausschüttung
vgl.
vergleiche
VO
Verordnung
V+V
Vermietung und Verpachtung
VVAG
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
VZ
Veranlagungszeitraum
WaBeschG
Wachstumsbeschleunigungsgesetz
WG
Wirtschaftsgut
WiB
Wirtschaftsrechtliche Beratung
wistra
Zeitschrift für Wirtschaft/Steuer/Strafrecht
Wj.
Wirtschaftsjahr
WM
Wertpapier-Mitteilungen
w. N.
weitere Nachweise
z. B.
zum Beispiel
ZfB
Zeitschrift für Betriebswirtschaft
ZfbF
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung
ZGR
Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
z. T.
zum Teil
zust.
zustimmend
zutr.
zutreffend
zvE
zu versteuerndes Einkommen
zzgl.
zuzüglich
Teil A Stellung und Entwicklung des Körperschaftsteuerrechts
Körperschaftsteuerrecht, Entwicklung desDie Körperschaftsteuer erfasst das Einkommen der im Körperschaftsteuergesetz genannten Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen. Rechtsgrundlagen sind das KStG vom 15.10.2002 und die KStDV vom 22.02.1996 jeweils in der aktuellen Fassung.
Durch das Körperschaftsteuerreformgesetz vom 31.08.1976 erfolgte eine grundlegende Neuordnung des Systems. Die selbständige Körperschaftsbesteuerung wurde zwar beibehalten, die Doppelbelastung ausgeschütteter Gewinne aber durch Anrechnung der Körperschaftsteuer auf die Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer der Anteilseigner beseitigt (System der Vollanrechnung). Damit wurden die ausgeschütteten Gewinne einer Körperschaft im wirtschaftlichen Ergebnis passgenau auf der Basis der individuellen Leistungsfähigkeit des jeweiligen Anteilseigners besteuert.
Das Anrechnungsverfahren, das von der Praxis schnell angenommen wurde, wurde dennoch kritisiert. Es sei zu kompliziert, nicht europatauglich und zu anfällig gegenüber Missbrauch. Auf der Grundlage der Brühler Empfehlungen zur Reform der Unternehmensbesteuerung wurde durch das Steuersenkungsgesetz vom 23.10.2000 BGBl I 2000, 1433 das Anrechnungsverfahren ab 2001/2002 durch das so genannte Halbeinkünfteverfahren abgelöst.
Damit kehrte man zum klassischen Besteuerungssystem der Körperschaftsteuer zurück. Auf der Gesellschaftsebene werden die erwirtschafteten Gewinne unabhängig vom Ausschüttungsverhalten einem festen Steuersatz unterworfen, bei Ausschüttung erfolgt eine weitere Besteuerung beim Anteilseigner. Das Problem der Doppelbelastung wurde durch einen niedrigeren Einheitssteuersatz auf der Gesellschaftsebene sowie eine Teilentlastung auf der Ebene der Anteilseigner – allerdings im Vergleich zum Anrechnungsverfahren – nur annähernd gelöst.
Die deutsche Wirtschaft begrüßte den Systemwechsel vor allem wegen der Absenkung des Körperschaftsteuersatzes von 40 % auf (jetzt) 15 %, ferner die damit stufenweise einhergehende Absenkung des Einkommensteuerspitzensatzes von ursprünglich 53 % bis auf 45 %; ferner die Steuerfreistellung von Gewinnen aus der Veräußerung von Beteiligungen an inländischen Kapitalgesellschaften durch eine Körperschaft, sowie die aneinander angeglichene steuerliche Behandlung von inländischen und ausländischen Dividenden.
Das Halbeinkünfteverfahren hat sich nach fast einem Jahrzehnt seit 2009 im Zusammenhang mit der Einführung der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge zu einem Teileinkünfteverfahren gewandelt. Mit dem Systemwechsel ist aber keinesfalls eine Beruhigung in der Entwicklung des Körperschaftsteuerrechts eingetreten. Diese war und ist Gegenstand weiterer Änderungen durch Gesetzgebung und Rechtsprechung.
Von den zahlreichen Änderungen seien an dieser Stelle vor allem genannt die
Entstrickung bei Kapitalgesellschaften (§ 12 KStG),
Optionsmodell für Personengesellschaften (§ 1a KStG),
grundlegende Umgestaltung der bisherigen Gesellschafterfremdfinanzierung (§ 8a KStG a. F.) unter Berücksichtigung einer Zinsschrankenregelung nach § 4h EStG und § 8a KStG sowie kapitalersetzender Gesellschafterkredite (§ 8b Abs. 3 KStG),
Neuregelung des Verlustabzugs (§ 8c KStG und § 8d KStG),
mehrfachen Änderungen bei der körperschaftsteuerlichen Organschaft (Mehrmütterorganschaft; organschaftlicher Ausgleichsposten, Einlagelösung) und schließlich
Absenkung des Körperschaftsteuersatzes von 25 % auf 15 % seit 2008.
Durch das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel von Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften (UStAVermG) vom 11.12.2018 (BGBl I 2018, 2338) wurde § 8c KStG Abs. 1 Satz 1 KStG aufgehoben und die Sanierungsklausel in § 8c Abs. 1a KStG wieder rückwirkend angewandt.
Die letzten größeren Veränderungen erfolgten mit dem Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) vom 25.06.2021. In diesem Gesetz wurde für bestimmte Personengesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften die Möglichkeit geschaffen, nach § 1a KStG zur Körperschaftsteuer zu optieren. Zudem wurde erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2022 der Wechsel der bisherigen Behandlung von Minderabführungen und Mehrabführungen im Rahmen einer ertragsteuerlichen Organschaft hin zur sog. Einlagelösung vollzogen.
Teil B Steuerpflicht
1 Anwendungsbereich des Körperschaftsteuergesetzes
1.1 Allgemeines
Anwendungsbereich des KStGSteuerpflicht, persönlicheUnter die unbeschränkte Steuerpflicht fallen nur die in § 1 Abs. 1 KStG aufgeführten sechs Gruppen von Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen. Die Aufzählung ist grundsätzlich abschließend (R 1.1 Abs. 1 Satz 1 KStR). Sie umfasst keineswegs alle privat- und öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Zum einen fallen Juristische Person, des öffentlichen Rechtsjuristische Personen des öffentlichen Rechts als solche nicht unter das KStG. Sie sind nur steuerpflichtig
im Bereich der unbeschränkten Steuerpflicht:
mit ihren Betrieben gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG);
im Bereich der beschränkten Steuerpflicht:
bei Bezug inländischer Einkünfte, die dem Steuerabzug (zum Beispiel Kapitalertragsteuer) unterliegen (§ 2 Nr. 2 KStG).
Der Begriff der Kapitalgesellschaft ist einer erweiternden Auslegung nicht zugänglich (R 1.1 Abs. 1 Satz 2 KStR). Aufgrund der abschließenden Aufzählung unbeschränkt steuerpflichtiger Gebilde in §§ 1 und 3 KStG ergibt sich durch Umkehrschluss weiterhin:
Nicht zu den körperschaftsteuerpflichtigen Gebilden i. S. v. §§ 1 und 3 KStG gehören die Personengesellschaften.
Dies sind insbesondere OHG, KG, Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) sowie ähnliche Gesellschaften und Gemeinschaften (zum Beispiel atypisch stille Gesellschaft). Häufig sind hierbei die Gesellschafter Mitunternehmer eines Gewerbebetriebs. Gleichgültig aber, ob es sich um gewerbliche Mitunternehmer (i. d. R. bei OHG und KG) oder nichtgewerbliche Gemeinschaften, z. B. GbR, die kein Gewerbe betreibt, handelt, unterliegen diese Personengesellschaften nicht selbständig der Körperschaftsteuer (und auch nicht der Einkommensteuer).
Vielmehr werden die Einkünfte anteilig den Gesellschaftern zugerechnet und bei diesen als Einkünfte der Einkommensteuer unterworfen (bzw. der Körperschaftsteuer, wenn der Gesellschafter ein körperschaftsteuerpflichtiges Unternehmen ist). Handelt es sich um gewerbliche Mitunternehmer, erzielen die Gesellschafter aufgrund der Klassifikationsnorm § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG gewerbliche Einkünfte.
Im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht gemäß § 2 KStG ist der Kreis der Steuersubjekte weiter als bei der unbeschränkten Steuerpflicht gespannt.
Er umfasst nach dem Wortlaut – vorbehaltlich der Einschränkung durch § 3 KStG – alle Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen des privaten und öffentlichen Rechts (mit bestimmten inländischen Einkünften i. S. d. § 49 EStG).
Denn anders als in § 1 Abs. 1 KStG sind nicht bestimmte Körperschaften usw. aufgezählt. Trotzdem fallen unter den Begriff der »Personenvereinigungen« auch im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht nicht die Personengesellschaften.
Ob eine ausländische Personenvereinigung unter das KStG fällt, hängt davon ab, mit welcher Rechtsform des deutschen Rechts sie im Wesentlichen vergleichbar ist (vgl. H 1.1 und H 2 [Ausländische Gesellschaften, Typenvergleich] KStH). Maßgebend ist hier für die Frage der Rechtsfähigkeit das internationale Privatrecht, für die Frage der Körperschaftsteuerpflicht die Organisationsstruktur. Vgl. auch BFH vom 03.02.1988 BStBl II 1988, 588, BFH vom 23.06.1992 BStBl II 1992, 972 sowie vom 20.08.2008 BStBl II 2009, 263 zu einer nach dem Recht des Staates Florida gegründeten US-amerikanischen LLC.
BEISPIEL
Die »société anonyme« (SA) (Frankreich) entspricht in wesentlichen Punkten der deutschen AG.
Bei Bezug inländischer Einkünfte sind sie beschränkt steuerpflichtig (§ 2 Nr. 1 KStG).
Praxishinweis: Auch britische LimitedSteuerpflicht, Limited bleiben KSt-Subjekte
Aus steuerlicher Sicht kommt es für die britischen Limited durch den Brexit allerdings nicht zu einem Wechsel des Besteuerungssystems. Dies wurde mit dem Brexit-StBG geregelt, mit dem ein neuer § 12 Abs. 4 KStG in das Gesetz klarstellend aufgenommen wurde:
»(4) Einer unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland ist nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union das Betriebsvermögen ununterbrochen zuzurechnen, das ihr bereits vor dem Austritt zuzurechnen war.«
Sie wurde durch die allgemeinere Bestimmung des § 8 Abs. 1 Satz 4 KStG ersetzt, die in allen offenen Fällen anzuwenden ist (§ 36 Abs. 3c i. d. F. des StAbwG). Eine Aufdeckung der stillen Reserven in dem deutschen Betrieb der Limited droht also nicht. Eine solche Gesellschaft wird damit auch nach dem Brexit als Körperschaft i. S. v. § 1 Abs. 1 KStG behandelt. Voraussetzung für die Eigenschaft als Körperschaftsteuersubjekt war nämlich bereits bisher auch bei Drittstaatengesellschaften nur, dass das ausländische Gebilde eine körperschaftliche Struktur aufweist. Das ist der Fall, wenn der ausländische Rechtsträger einer inländischen Körperschaft in den wesentlichen Aspekten vergleichbar ist. Ob das der Fall ist, ist durch einen »TypenvergleichTypenvergleich« der rechtlichen Strukturtypen festzustellen (vgl. H 1.1 »Ausländische Gesellschaften, Typenvergleich« KStH m. w. N.). Dabei ist zu prüfen, ob die inländische Gesellschaft nach ihrem durch das ausländische Recht geregelten Aufbau und ihrer wirtschaftlichen Stellung einer deutschen Körperschaft entspricht.
Auch wenn eine Limited nach dem Brexit aus deutscher Sicht zivilrechtlich eine Personengesellschaft darstellt, folgt das Steuerrecht anderen Prinzipien. Eine Körperschaft mit statuarischem Sitz (»Satzungssitz«) in einem Drittstaat, die ihre Geschäftsleitung (»Verwaltungssitz«) aber in Deutschland hat, ist danach steuerlich eine (nicht rechtsfähige) Körperschaft, weil eine Verlegung der Geschäftsleitung nach Deutschland schon nach bisheriger deutscher Auffassung zwar die Auflösung der Gesellschaft, nicht aber ihre Vollbeendigung zur Folge hat. Dies gilt nun auch für britische Kapitalgesellschaften nach dem Brexit, die bereits bisher ihre Geschäftsleitung in Deutschland haben. Eine Limited ist körperschaftlich strukturiert, sodass sie unter § 1 Abs. 1 KStG fällt. Sie wird steuerlich also nicht als Personengesellschaft behandelt. Da die (nicht rechtsfähige) Gesellschaft ihre Geschäftsleitung im Inland hat, ist sie (weiterhin) unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig.
Fraglich war, welche steuerlichen Folgen die Löschung der Ltd. aus dem britischen Handelsregister nach dem 31.12.2020 nach sich zieht. Die Finanzverwaltung hat hierzu mit Schreiben vom 19.07.2023 BStBl I 2023, 1567 Stellung genommen. Körperschaftsteuerlich besteht zwar mit der Löschung kein Steuersubjekt mehr. Allerdings kommt es nicht zu der sonst üblichen Liquidationsbesteuerung (vgl. § 11 KStG; § 16 GewStDV). Vielmehr führt die Löschung der Limited im Companies House zu einer Schlussbesteuerung unter Aufdeckung der stillen Reserven und zu einer Auskehrung des Eigenkapitals der Limited unter Einbehalt von Kapitalertragsteuer, soweit für diese Auskehrung nicht das steuerliche Einlagekonto verwendet wird.
Auf Ebene des/der Gesellschafter führt die Löschung der Limited zu den Steuerfolgen einer Auflösung nach § 17 Abs. 4 EStG sowie § 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG − Vollausschüttung mit Teileinkünfteverfahren bzw. Abgeltungsteuer, sofern es sich um eine Beteiligung im Privatvermögen handelte. Im zweiten Schritt erfolgt eine Einlage aus dem Privatvermögen in die GbR, OHG bzw. das Einzelunternehmen mit dem Teilwert. Wurde die Beteiligung an der Limited im Betriebsvermögen gehalten, folgt die Besteuerung auf Ebene der Gesellschafter den allgemeinen Regeln für Gewinne aus der Auflösung von Körperschaften.
1.2 Maßgeblichkeit der Rechtsform
Entscheidend für die Körperschaftsteuerpflicht ist nach ständiger Rechtsprechung des BFH die RechtsformRechtsform, Maßgeblichkeit der – eines Gebildes. Dies dient der Rechtssicherheit und Berechenbarkeit der steuerlichen Folgen.
Somit ist für die Entscheidung über die Steuerpflicht, persönlichepersönliche Steuerpflicht im Rahmen der §§ 1 bis 3 KStG für die Einordnung rechtsfähiger und nichtrechtsfähiger Gebilde bürgerliches Recht, insbes. Handels- und Gesellschaftsrecht maßgebend.
Für die Anwendung wirtschaftlicher Betrachtungsweise ist kein Raum. Die Einschaltung einer weiteren Rechtspersönlichkeit zwischen natürliche Personen und den Rechtsverkehr ist steuerlich zu beachten (vgl. BFH vom 05.03.1969 BStBl II 1969, 350).
Auch in Grenzfällen ist steuerlich allein auf die formale Rechtsgestaltung abzustellen (vgl. BFH vom 04.11.1958 BStBl III 1959, 50).
BEISPIEL
Bei einer ins Handelsregister eingetragenen KG soll vieles wirtschaftlich auf einen Verein hindeuten (Annahme).
LÖSUNG Das Gebilde ist trotzdem nicht als nichtrechtsfähiger Verein i. S. v. § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG, sondern als nicht körperschaftsteuerpflichtige Personenvereinigung (Handelsgesellschaft) zu behandeln.
1.2.1 Einpersonen-GmbH
1.2.1.1 Selbständige Körperschaftsteuerpflicht
Es ist gesellschaftsrechtlich zulässig, dass ein einziger Gesellschafter sämtliche Anteile einer GmbH hält.
Nach § 1 GmbHG kann bereits die Gründung durch einen Gesellschafter erfolgen.
Die GmbH ist körperschaftsteuerlich ohne Rücksicht auf ihre wirtschaftliche Selbständigkeit ein eigenständiges Steuersubjekt. Dies gilt auch für die Einmann-GmbH.
Eine wirtschaftliche Betrachtungsweise derart, dass die Gesellschaft mit ihrem einzigen Gesellschafter identifiziert wird, ist unmöglich.
Das ganze Körperschaftsteuerrecht beruht auf der Anerkennung der besonderen Rechtsnatur dieser Gesellschaftsform. Die Gesellschaft steht rechtlich völlig unabhängig neben dem Gesellschafter.
BEISPIEL
A hält zu 100 % die Anteile an der A-GmbH.
LÖSUNG Auch wenn eine natürliche Person sämtliche Anteile an einer GmbH hält, bleibt die GmbH als juristische Person selbständig körperschaftsteuerpflichtig gemäß § 1 Abs. 1 KStG. Der Alleingesellschafter ist nicht per se Gewerbetreibender, sondern kann als Geschäftsführer Einkünfte aus § 19 EStG, als Bezieher von Ausschüttungen der GmbH Einkünfte aus § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG erzielen.
Diese Grundsätze gelten auch bei Familien-GmbHEhegatten-GmbHEhegatten- und Familien-GmbH uneingeschränkt (vgl. z. B. BFH vom 25.10.1960 BStBl III 1961, 69).
1.2.1.2 Durchgriff durch die Rechtsform?
Durchgriff, durch die RechtsformDie Kapitalgesellschaft ist nach der BFH-Rechtsprechung ein selbständig körperschaftsteuerpflichtiges Subjekt (vgl. BFH vom 05.05.1959 BStBl III 1959, 369), weil an die gewählte Rechtsform anzuknüpfen ist (vgl. BFH vom 17.07.1968 BStBl II 1968, 695).
Diese konsequente Rechtsprechung des BFH führt dazu, dass schuldrechtliche Beziehungen zwischen der Kapitalgesellschaft und ihren Gesellschaftern grundsätzlich auch steuerlich anzuerkennen sind.
Trotz der grundsätzlichen Anerkennung der Vorschaltung einer GmbH wird steuerlich – je nach dem Grad der Einflussnahme der Gesellschafter (des Gesellschafters) – sehr wohl bei der steuerlichen Anerkennung der Beziehungen Gesellschaft – Gesellschafter differenziert (vgl. z. B. BFH vom 05.05.1959 und 04.08.1959 BStBl III 1959, 369 und 374). Insbesondere bei beherrschenden und Alleingesellschaftern können vertragliche Beziehungen nicht oder nur eingeschränkt anzuerkennen sein, weil »verdeckte Gewinnausschüttungen« angenommen werden. Vgl. C 4. 5. 1.
Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus § 35 Abs. 3 GmbHG. Diese Vorschrift erklärt § 181 BGB für anwendbar. Das hat zur Folge, dass Verträge des Alleingesellschafters mit der GmbH nur dann rechtswirksam sind, wenn er vom SelbstkontrahierungsverbotSelbstkontrahierungsverbot befreit worden ist (§ 181 BGB). Ohne diese Befreiung ist der Vertrag schwebend unwirksam (§§ 177, 184 BGB), so dass das steuerliche Nachzahlungsverbot mit der Folge einer verdeckten Gewinnausschüttung eingreift.
1.2.2 GmbH & Co. KG
GmbH & Co. KG, als PersonengesellschaftBei einer KG darf handelsrechtlich die alleinige persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) eine juristische Person sein (insbesondere GmbH und AG).
Es entstehen die
GmbH & Co. KG bzw.
AG & Co. KGAG & Co. KG.
Typischerweise sind die Kommanditisten auch gleichzeitig Gesellschafter der GmbH.
Eine solche Rechtsform ist auch steuerlich anerkannt (z. B. BFH vom 17.01.1973 BStBl II 1973, 269).
Eine GmbH & Co. KG ist keine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG und nicht als eine solche körperschaftsteuerpflichtig (vgl. BFH vom 25.06.1984 BStBl II 1984, 751).
Die in § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG erfolgte gesetzliche Fundierung bzw. Festschreibung der Gepräge-RechtsprechungFestschreibung der sog. Gepräge-Rechtsprechung, die durch den o. a. Beschluss des Großen Senats aufgegeben worden war, lässt die Verneinung der Körperschaftsteuerpflicht einer GmbH & Co. KG durch den BFH unberührt. So auch H 1.1 (GmbH & Co. KG) KStH.
BEISPIEL
GmbH & Co. KG
An der X-KG sind beteiligt
die Y-GmbH als Komplementärin zu 10 %,
die natürlichen Personen A und B als Kommanditisten zu je 45 %.
A und B sind gleichzeitig Gesellschafter der Y-GmbH zu je 50 %.
LÖSUNG Die KG bleibt trotz der hier vorliegenden Mischform eine Personengesellschaft, ist daher nicht körperschaftsteuerpflichtig.
Der Gewinn der KG wird einheitlich und gesondert festgestellt. Die Kommanditisten unterliegen mit ihren Gewinnanteilen der ESt. Nur die GmbH selbst ist mit ihrem Gewinnanteil an der KG körperschaftsteuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG).
Die Motive für die Wahl dieser Rechtsform sind steuerlich unerheblich. Dies gilt auch bei Gründung zum Zweck einer angestrebten Steuerersparnis (vgl. BFH vom 17.10.1951 BStBl III 1951, 223). Über die Frage des Bestehens einer GmbH & Co. KG wird i. R. d. einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung für die KG (§§ 179 ff. AO) entschieden; vgl. auch BFH vom 25.06.1984 BStBl II 1984, 751. Die dortige Entscheidung ist für die KSt der GmbH bindend (§ 182 Abs. 1 AO; BFH vom 03.07.1956 BStBl III 1956, 308).
Infolge des prägenden Charakters der Beteiligung der GmbH an der KG sind allerdings die Einkünfte der KG unter den Voraussetzungen des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG stets und insgesamt als gewerbliche Einkünfte zu behandeln. Eine solche gewerblich geprägte Personengesellschaft ist gegeben, wenn
sie keine Tätigkeit i. S. d. § 15 Abs. 1 Nr. 1 EStG ausübt und
ausschließlich eine oder mehrere Kapitalgesellschaften persönlich haftende Gesellschafter sind und
nur diese oder Personen, die nicht Gesellschafter sind (gemäß Gesellschaftsvertrag), zur Geschäftsführung befugt sind.
Auch bei der GmbH & Co. KG ist eine Angemessenheitsprüfung hinsichtlich der Gewinnbeteiligung der GmbH vorzunehmen. Wenn der GmbH ein zu niedriger Gewinnanteil zugewiesen wurde, liegen bei ihr insoweit verdeckte Gewinnausschüttungen vor. In solchen Fällen ist der Gewinnanteil der GmbH und damit auch der Gesamtgewinn der KG um die verdeckte Gewinnausschüttung zu erhöhen (vgl. BFH vom 15.11.1967 BStBl III 1968, 159 sowie vom 06.08.1985 BStBl II 1986, 17).
1.3 Abgrenzungsregel des § 3 Abs. 1 KStG
EinkommensträgerDie Vorschrift dient der Abgrenzung der Körperschaftsteuerpflicht nichtrechtsfähiger Gebilde von der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerpflicht ihrer Beteiligten. Dabei ist die Körperschaftsbesteuerung des Gebildes selbst subsidiär.
Für die Abgrenzung der KSt-Pflicht sind drei Gruppen von Gebilden zu unterscheiden:
Juristische Personen
Juristische Personen i. S. v. § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 KStG sind ohne weiteres selbständig körperschaftsteuerpflichtig. Dies ergibt sich allein aus ihrer Rechtsform. Denn sie sind rechtlich und wirtschaftlich Eigentümer ihres Vermögens.
Als berechtigte Bezieher der Einkünfte schließen sie ihre Gesellschafter vom unmittelbaren Bezug von Einkünften rechtlich aus. Ihr Einkommen haben sie daher selbst zu versteuern und nicht ihre Gesellschafter. Vgl. auch 1.2. Nicht erforderlich ist, dass sie tatsächlich Einkommen- oder Körperschaftsteuer zahlen.
Hiervon zu unterscheiden ist die Ausschüttung von Gewinnanteilen an die Mitglieder juristischer Personen. Dies ist lediglich eine »mittelbare« Versteuerung – nicht die im § 3 Abs. 1 KStG genannte unmittelbare Versteuerung bei anderen Personen –, und zwar aufgrund einer Gewinnverwendung der juristischen Person (z. B. aufgrund eines gesellschaftsrechtlichen Ausschüttungsbeschlusses).
Personengesellschaften des Handelsrechts
Die Personengesellschaften des Handelsrechts (OHG, KG) sind ebenso unproblematisch niemals selbst körperschaftsteuerpflichtig. Daran hat sich auch durch das am 01.01.2024 in Kraft getretenen MoPeG vom 10.08.2021 (BGBl I 2021, 3436) und den ebenfalls durch das KrZwMFördG neu eingefügten § 14a AO, der den Begriff der Personenvereinigung steuergesetzlich legal definiert, nichts geändert. Es liegt vielmehr mit der Neufassung in § 3 Abs. 1 KStG lediglich eine redaktionelle Änderung vor, die keine materielle Bedeutung besitzt.
Bei diesen Gesellschaften tritt auch steuerlich das gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 AO nach dem MoPeG weiterhin fingierte Gesamthandsverhältnis hinter dem Einzelrecht der Mitunternehmer auf unmittelbaren Bezug des Gewinnanteils zurück.
Die Mitunternehmer der OHG und KG sind somit unmittelbar Einkommensträger i. S. v. § 3 Abs. 1 KStG. Die Gewinnanteile können bei ihnen nach dem EStG (Einzelperson als Gesellschafter) oder KStG (Körperschaft i. S. v. §§ 1 bis 3 KStG als Gesellschafter) zu versteuern sein.
Auch (und gerade) die Zurechnung des Gewinns nach Bruchteilen gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO ist »unmittelbare Einkommenszurechnung« i. S. v. § 3 Abs. 1 KStG.
Auch hier ist mithin die Rechtsform maßgebend. Auch bei – wirtschaftlich betrachtet – körperschaftsähnlicher Gesamtverfassung muss eine OHG oder KG stets als – nicht der Körperschaftsteuer unterliegende – Personengesellschaft behandelt werden.
Ihr Gewinn ist unmittelbar von den Gesellschaftern anteilig zu versteuern (§ 3 Abs. 1 KStG, § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO, § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG). Vgl. BFH vom 04.11.1958 BStBl III 1959, 50.
Unmittelbar steuerpflichtig sind auch regelmäßig die Beteiligten bei ähnlichen Gesellschaften, z. B.
Rechtsfähige wie nichtrechtsfähige GbR (§ 705 Abs. 2, § 740 BGB),
stiller Gesellschaft (§§ 230 ff. HGB),
ehelicher bzw. fortgesetzter Gütergemeinschaft,
Erbengemeinschaft.
Sonstige Personenvereinigungen und Vermögensmassen
Abgrenzungsfragen tauchen nur bei den übrigen nichtrechtsfähigen Personenvereinigungen auf, die also
weder juristische Personen i. S. v. § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 KStG
noch OHG, KG oder ähnliche Gesellschaft
sind; vgl. hierzu BFH vom 25.06.1984 BStBl II 1984, 751.
Aus dem Bereich der sonstigen nichtrechtsfähigen Gebilde sind zunächst einmal alle nichtrechtsfähigen Vermögensmassen stets körperschaftsteuerpflichtig (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG). Problematisch ist lediglich die Einordnung nichtrechtsfähiger Personenvereinigungen.
Wie fließend die Grenzen zwischen dem nichtrechtsfähigen Verein und der GbR sind, kommt bereits in § 54 BGB zum Ausdruck. Danach gelten für den nichtrechtsfähigen Verein die Vorschriften über die GbR (§§ 705 ff. BGB).
Je nach Gesamtverfassung kann es sich also handeln um
einen nichtrechtsfähigen Verein, der der Körperschaftsteuer gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG unterliegt oder
um eine GbR, die nicht der Körperschaftsteuer unterliegt. Abgrenzungsregel ist auch hier der § 3 Abs. 1 KStG.
Danach tritt bei nichtrechtsfähigen Personenvereinigungen eine Besteuerung nach dem KStG nur ein, wenn die Einkünfte nicht bereits unmittelbar bei den Gesellschaftern der Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) zu unterwerfen sind.
§ 3 Abs. 1 KStG ist somit eine weitere Voraussetzung für die Körperschaftsteuerpflicht nichtrechtsfähiger Personenvereinigungen. Hierdurch soll bei Personenvereinigungen eine Doppelbelastung mit Einkommensteuer und Körperschaftsteuer vermieden werden.
Abgrenzungsmerkmale sind:
Der nichtrechtsfähige Verein unterscheidet sich von einer Personengesellschaft dadurch, dass er vereinsrechtlich und nicht gesellschaftsrechtlich organisiert ist (vgl. § 54 BGB). Das kommt nach Auffassung der Finanzverwaltung im BMF-Schreiben vom 19.05.2022 BStBl I 2022, 742, Tz. 280–283, in folgenden Indizien zum Ausdruck:
Der nichtrechtsfähige Verein tritt nach außen wie nach innen hin unter einem Gesamtnamen als einheitliches Ganzes auf.
Im Innenverhältnis hat ein nichtrechtsfähiger Verein genau wie ein eingetragener Verein Organe, deren Entscheidungen sich das einzelne Mitglied nicht entziehen kann (Vorstand, Mitgliederversammlung).
Der Bestand eines nichtrechtsfähigen Vereins ist vom Wechsel der Mitglieder unabhängig. (Bei Personengesellschaften entsteht auf jeden Fall bei vollständigem Austausch der Gesellschafter ein anderes Steuersubjekt.)
BEISPIEL
Bei einem nach seiner Gesamtverfassung als nichtrechtsfähiger Verein zu beurteilenden Personenzusammenschluss haben die »Mitglieder« keinen Anspruch an den Einkünften des Vereins und können daher insoweit nichts bei der Einkommensteuer zu versteuern haben.
LÖSUNG Daher unterliegt der Verein selbständig mit seinen Einkünften der Körperschaftsteuer. Würde es sich um eine GbR handeln, wären die anteiligen Einkünfte unmittelbar von den Gesellschaftern zu versteuern (§ 3 Abs. 1 KStG, § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG).
ÜBERSICHT Zusammenfassender Überblick