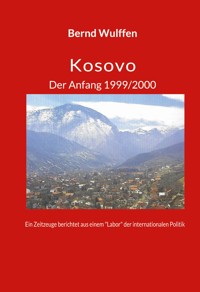
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Jahr 1999 war spannungsgeladen. Das Eingreifen der NATO gegen Restjugoslawien im Frühjahr war nur das Vorspiel. Würden sich die Serben aus dem verwüsteten Kosovo zurückziehen? Wer würde fortan die Herrschaft ausüben? Würde Russland mitspielen? Ich kam als "ziviler Koordinator" im September 1999 nach Pristina. Die UNO (UNMIK) und die von der NATO geleiteten internationalen Truppen (KFOR) hatten noch im Juni 1999 das Kommando übernommen. Die Russen hatten Milosevic überzeugt, sich zurückzuziehen. Es galt jetzt, das Land wieder aufzubauen, Arbeitsplätze zu schaffen, die große Zahl von Flüchtlingen, die während des Pogroms der Serben Kosovo verlassen hatten, wieder zurückzuführen und demokratische Strukturen aufzubauen. Deutschland und das von mir geleitete Büro beteiligten sich trotz gewaltiger Schwierigkeiten engagiert in diesem "Labor" der internationalen Politik. Zum ersten Mal in meiner Karriere arbeitete ich eng mit den Militärs zusammen. Gemeinsam galt es, die Klippen, die sich immer wieder auftürmten, zu umschiffen. Aber ein Problem, das sich auch heute noch stellt, konnten wir nicht lösen: Die Überwindung des Konflikts zwischen Serben und Kosovaren. Vielleicht gelingt es, mit der Eröffnung einer konkreten Beitrittsperspektive in die EU von der Konfrontation zur allmählichen Kooperation zu gelangen. Hierfür gibt es Beispiele in Europa, die uns ermutigen könnten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UNTER MITARBEIT VON JÜRGEN BAUER
Weihnachtszeit 1999. Tom Koenigs und ich verteilen Geschenke, die der „Train for Future“ aus Deutschland mitgebracht hatte
Inhalt
Vorwort
Erstes Kapitel ‒ Die Rahmenbedingungen
Das Rennen der Schildkröten
Krieg um das Kosovo
UNMIK und KFOR-zwei Säulen in einem erschütterten Land
Zweites Kapitel ‒ Der Beginn meiner Arbeit im Kosovo
Der Anfang ‒ ein Berg voller Aufgaben
Ein Konzert im Kosovo
Tag der deutschen Einheit-Mein erstes öffentlichen Auftreten
Drittes Kapitel ‒ Das A und O, die Wirtschaft
Wie können wir ihr auf die Beine helfen?
Die Weinberge des Kosovo
Eines unserer Hauptprobleme: Das Kraftwerk Prishtina
Ausbildung-Eine zwingende Notwendigkeit
Ein Gemeinschaftsprojekt
Viertes Kapitel ‒ Vom Chaos zum Rechtsstaat?
Mitrovica
Freiheit und Demokratie ‒ Grundlagen für den Rechtsstaat
Eine erste „Regierung“
Unterstützung aus der Heimat: Besucher
Fünftes Kapitel: Zu Land und Leuten
Viel Schnee, aber Skilaufen unmöglich
Das Preševo-Tal
Ein Picknick in der Rugova-Schlucht
Die Rückkehr der Flüchtlinge
Sechstes Kapitel ‒ Ein Blick zurück
Ein Blick in die Geschichte des Kosovo
Die orthodoxen Klöster und andere „Exklaven“ des Kosovo
„Sprung“ ins Land der „Skipetaren“
Siebentes Kapitel ‒ Kurioses, Trauriges, Erbauliches
Begegnung mit einem russischen Oberleutnant
Die Eisenbahn ‒ Befreiung aus einem Engpass
Krusha i Vogel
...
und abends ins „Hani“
Meine letzten Tage im Kosovo
Nachbetrachtung
Anhang
Literatur
Vorwort
Wenn der britische Schlagerkomponist und Sänger James Blunt von sich behauptete, er habe als Captain im Kosovo1 durch Befehlsverweigerung ‒ mit Rückendeckung seines Generals ‒ den dritten Weltkrieg verhindert, dann ist dies vielleicht journalistisch überhöht oder einem starken Ego geschuldet. Tatsache aber ist, dass der damalige NATO-Oberbefehlshaber für Europa, SACEUR2, General Wesley Clark, im Juni 1999 den Befehl erteilt hatte, russische Truppen, die den Flughafen von Prishtina3 eigenmächtig besetzt hatten, notfalls mit Gewalt von dort zu vertreiben. Diesen Befehl führte General Michael Jackson, Kommandierender General der neu gebildeten KFOR (Kosovo Force) und Chef von Blunt, nicht aus, weil er einem Konflikt mit Russland mit unabsehbaren Folgen aus dem Wege gehen wollte. Damit setzte er seine militärische Karriere aufs Spiel. Stattdessen setzte sich Jackson mit seinem Vorschlag durch, die Russen in Prishtina zu isolieren, aber ansonsten in die zu erwartenden internationalen Strukturen einzubinden.4 Der britische General und KFOR-Kommandeur war überzeugt, dass es letztlich Moskau war, das Milošević Anfang Juni 1999 zum Einlenken bewegt hatte.5 Es war von Bedeutung, dass Jackson ständige Verbindung zu den Russen hielt und ein Klima schuf, dass für die Verständigung in Detailfragen günstig war.6
Die USA konnten Ungarn, das gerade NATO-Mitglied geworden war, dazu bewegen, eine Flugverbotszone in Südosteuropa einzurichten, so dass es der russischen Militärführung nicht möglich wäre, ihre Truppen im Kosovo mit Nachschub zu versorgen. Dies führte bald zum Rückzug der Russen aus Prishtina.7 Im Gegensatz zu anderen Quellen hat Jackson nie von der Einrichtung einer "Flugverbotszone“ gesprochen. Er sprach nur von einem „more subtle approach“, um den Abzug der Russen herbeizuführen.
Als ich im September 1999 als „ziviler Koordinator für Kosovo-Soforthilfe“ (der längste Titel in meiner Diplomatenkarriere) nach Prishtina kam, sprach niemand mehr von diesem Zwischenfall, wohl aber war die Blockade einer Zufahrtstrasse in das Städtchen Orahovac durch „albanische“ Kosovaren vom August 1999 noch in aller Munde. Dadurch sollten die dort stationierten russischen Truppen (erneut) zum Rückzug gezwungen werden.
Diese beiden Vorgänge waren nur das Nachspiel von Auseinandersetzungen im Sicherheitsrat der UNO. Russland hatte zwar den Truppeneinsatz (der NATO) gegen das „Restjugoslawien“ von Slobodan Milošević im Frühjahr 1999 abgelehnt und sein Veto dagegen eingelegt, hatte jedoch der Resolution 1244 des Sicherheitsrats vom Juni 1999 zugestimmt, wonach die UNO nach der Beendigung des erfolgreichen Einsatzes der NATO die Verwaltung des mittlerweile von serbischen Verbänden geräumten Kosovo übernehmen und eine 50.000 Mann starke Friedenstruppe KFOR unter Führung der NATO eingesetzt werden sollte.
General Sir Michael (Mike) Jackson
Bei der Diskussion um die Dislozierung der internationalen Truppen im Kosovo war Russland insofern zu kurz gekommen, als ihm zwar eingeräumt wurde, im Rahmen der internationalen Friedenstruppe ein Truppenbataillon zu entsenden; sein Wunsch, eine eigene „Besatzungszone“ (MNB) im Kosovo zu erhalten, wurde jedoch nicht berücksichtigt. Über diese Frage war es am 11. Juni 1999 zu einer Kontroverse zwischen dem Chef-Unterhändler der USA, dem Unterstaatssekretär Strobe Talbott und seinen russischen Counterparts im Außenministerium in Moskau gekommen. Russland hatte nicht nur auf der Zuteilung eines eigenen Sektors (MNB) bestanden, sondern auch verlangt, seine Truppen müssten der UNO und nicht der NATO unterstellt werden. Dass es dazu nicht kam, ist auch dem Angebot Talbotts an den russischen Außenminister Iwanow zu verdanken, eine gesichtswahrende Erklärung über CNN an die Weltöffentlichkeit abzugeben. Im Hintergrund hatten jedoch russische Hardliner bereits die Besetzung des Flughafens von Prishtina geplant und sogleich ins Werk gesetzt.8
Der Westen hatte sich mit seiner Position durchgesetzt, dass lediglich die fünf NATO-Staaten USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland und Italien jeweils eine Multinationale Brigade (MNB) mit militärischer Verantwortlichkeit auf einem bestimmten Gebiet des Kosovo entsenden sollten. Die Westmächte fürchteten bei einer Zuteilung einer weiteren MNB an Russland eine Teilung des Kosovo, ähnlich der Teilung Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg. Russland, das traditionell eng mit Serbien verbunden ist, hätte die größtenteils im Norden des Kosovo siedelnden serbischen Kosovaren sicherlich militärisch unter seinen Schutz genommen.9 Dies sollte verhindert werden.
Die eingangs geschilderte Besetzung des Flughafens von Prishtina durch russische Fallschirmjäger war eine Protestaktion, mit deren Hilfe Russland, gleichsam durch die Hintertür, seine Forderung nach Zuteilung einer Zone durchsetzen wollte.
Ich bin überzeugt davon, dass die Zurückweisung der russischen Forderungen in Moskau, das noch unter der Führung von Präsident Jelzin stand, von den Hardlinern, welche gleichberechtigtes russisches Mitsprache- und Mitwirkungsrecht im Kosovo verlangten, mit Wut und großer Enttäuschung registriert worden sein dürfte. Sie hatten das Gefühl, Russland werde wieder einmal in die zweite Reihe geschoben. Eine Serie weiterer für Moskau negativer Ereignisse dürfte dazu beigetragen haben, dass sich die Großmacht immer mehr isoliert betrachtete und unter Putin darauf sann, u.a. die Scharte im Kosovo irgendwann wieder auszuwetzen und aller Welt mit grausamen Mitteln klar zu machen, dass es in der ersten Reihe am Tisch der Großen Platz nehmen würde.
2022 war es so weit. Mit einem Schlag wurde das Kosovo wieder zu einem Thema der internationalen Politik. Russland rechtfertigte seinen Krieg gegen die Ukraine auch mit dem Hinweis auf den von der Völkergemeinschaft verantworteten oder zumindest hingenommenen „Krieg der NATO“ 1999 wegen der im Kosovo begangenen Gräueltaten gegen das Jugoslawien von Milošević. Was dem Westen damals zugestanden wurde, könne man Russland heute nicht verbieten.10
Putin hatte im Vorfeld seiner Kriegshandlungen gegen die Ukraine und im Zusammenhang mit dem Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine von Verbrechen in den mit der Okkupation der Halbinsel Krim besetzten Gebieten von Donezk und Luhansk gesprochen und die Ukraine des „Völkermords“ bezichtigt. Er zog eine Parallele zu den Vorgängen 1999 in Jugoslawien. Auch damals hätte der Westen mit Hinweis auf die von bewaffneten jugoslawischen Kräften verübten Verbrechen an der kosovarischen Bevölkerung von „Völkermord“ gesprochen.
Putin und seine Regierung haben jedoch nie Beweise für die Behauptung des angeblichen Völkermords in den Gebieten der Ost-Ukraine vorgelegt, während die Gräueltaten der Jugoslawen im Kosovo detailliert belegt sind und auch mehrfach Gegenstand von Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag waren.
Bundeskanzler Scholz hatte bei seinem kurz vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine mit Putin geführten Gespräch im Kreml die seit Jahrzehnten in Europa bestehende Friedensordnung beschworen. Putin hatte dem entgegengehalten, es habe bereits mit den Angriffen der NATO 1999 auf Jugoslawien „Krieg“ in Europa gegeben. Ähnlich hatte sich bereits 1999 Alexander Solschenyzin geäußert: „Die NATO hat für uns eine neue Epoche eröffnet, wie Hitler, der aus dem Völkerbund austrat, und als Ergebnis begann der Zweite Weltkrieg“.11
Wer sich mit dem Balkan und dem Kosovo beschäftigt hat, weiß, dass der Vergleich Kosovo 1999 und Ukraine 2022 absurd ist. Der Hauptunterschied liegt darin, dass wir es bei Milošević mit einem Kriegsverbrecher zu tun hatten, gegen den 2002 in Den Haag vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien ein Prozess u.a. wegen Völkermords eröffnet wurde. Milošević verstarb 2006 nach Abschluss der Beweisaufnahme, aber vor der Urteilsverkündung. Die ehemalige Chefanklägerin am Internationalen Strafgerichtshof, die Schweizerin Carla Del Ponte, sagte noch 2006 dem SPIEGEL, Milošević wäre verurteilt worden, da genug Beweise vorgelegt worden seien.12 Was die Ukraine anbetrifft, liegen keinerlei Anhaltspunkte für von dort aus befohlene Verbrechen vor. Russland hat keine Beweise vorgelegt und auch kein Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof beantragt.
Die Bundesregierung bemüht sich seit Jahren, zwischen Serbien und dem Kosovo zu vermitteln. Serbien weigert sich bisher, das Kosovo staatsrechtlich anzuerkennen. Aus unserer Sicht ist dies nicht nur ein Hindernis für die Aufnahme der beiden Staaten in die EU, sondern auch für die dauerhafte Befriedung des westlichen Balkans. Im Mai 2022 hat Bundeskanzler Scholz sowohl den serbischen Ministerpräsidenten Vučić als auch den kosovarischen Ministerpräsidenten Kurti zu Gesprächen in Berlin empfangen. Er hat beide Politiker zur Kompromissbereitschaft aufgerufen, um zu einer Einigung zu gelangen. Dabei dürfte der Status des nördlichen, fast ausschließlich von Serben bewohnten Kosovo eine Rolle gespielt haben.
Serben bedrohen auch die Einheit von Bosnien-Herzegowina. Unter Missachtung des Abkommens von Dayton (1995 einigten sich Kroatien, Serbien und Bosnien-Herzegowina auf Drängen der USA auf die Schaffung eines aus den drei ethnischen Bestandteilen bestehenden Staates mit der Hauptstadt Sarajewo) drohen serbische Kräfte immer wieder damit, die „Republika Srpska“ aus dem staatlichen Verband Bosnien-Herzegowinas zu lösen und Serbien anzuschließen. Der Erfolg der Separatisten würde alle Bemühungen um Stabilität und Frieden in der Region zunichtemachen.
Zu allem Überfluss scheint sich auch Kroatien in den Aufnahmeprozess seiner Nachbarn auf dem Westbalkan einzuschalten. Die kroatische Akademie der Wissenschaften und Künste hat unter dem Titel „Beiträge zum Schutz kroatischer Interessen“ einen Katalog von Forderungen zusammengestellt, der geeignet sein könnte, den Beitrittsprozess von Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro zu stoppen. Bevor dies Wellen schlägt, sollte die Bundesregierung der Regierung in Zagreb klarmachen, dass Stabilität auf dem Westbalkan unter dem Dach der EU auch im kroatischen Interesse liegt. Es muss ein Schlussstrich unter die finsteren Kapitel der Vergangenheit gezogen werden, sonst werden immer neue Konflikte ausbrechen, welche die beteiligten Staaten nicht vorwärtsbringen, sondern zurückwerfen.
Es ist trotz allem ein hoffnungsvolles Signal, wenn im Oktober 2022 in Berlin die sechs Staaten des Westbalkans durch Abschluss von drei Teilabkommen einen wesentlichen Schritt in Richtung der bereits vor drei Jahren beabsichtigten Einrichtung einer Freihandelszone gegangen sind und sich geeinigt haben. Erstaunlich ist die Teilnahme des Kosovo an den Vereinbarungen. Dies könnte auch einen Schritt in Richtung einer de-facto-Anerkennung durch Serbien bedeuten, das sich bisher strikt geweigert hatte, das von ihm abgetrennte Gebiet, das 2008 seine Unabhängigkeit erklärt hatte, anzuerkennen. Jedenfalls ermahnte die deutsche Außenministerin als Gastgeberin in Berlin Serbien und Kosovo „ihre andauernden Spannungen“ zu überwinden und sich endlich zum Abschluss eines umfassenden Abkommens bereitzufinden, das das Verhältnis der beiden Länder zueinander regelt.13
Von September 1999 bis Oktober 2000 war ich mehr als ein Jahr diplomatischer Vertreter der Bundesrepublik Deutschland im Kosovo. Ich nannte mich „Ziviler Koordinator für Kosovo-Soforthilfe“. Dies war „politically correct“, gab es doch noch keinen Staat Kosovo bei dem ich hätte akkreditiert werden können. Trotzdem fühlte ich mich als „Botschafter“ und wurde auch von den internationalen Vertretern im Kosovo, ob Beamte oder Militärs, als solcher wahrgenommen.
Jahre später, nachdem das Kosovo immer wieder in die Schlagzeilen der Medien geraten war, wurde mir klar, dass ich die schwierige Geburt eines Staates miterlebt hatte. Ich war Zeitzeuge dieses Vorgangs geworden, der vor allem auch unser Land zu einem für uns neuen Engagement geführt hatte. Wir waren ein wichtiger Faktor für die Sicherung des Friedens in einem besonders unruhigen, immer von wieder von Konflikten geschüttelten Teil Europas geworden.
Eine wichtige Station auf dem Weg der Staatswerdung und der Unabhängigkeit des Kosovos war der im Februar 2007 vom ehemaligen finnischen Staatspräsidenten Martti Ahtisaari ausgearbeitete Plan. Er erwähnte zwar nicht den Begriff „Unabhängigkeit“, stattete jedoch das Kosovo mit wichtigen Attributen eines selbständigen Staates aus: Eigene Verfassung, Flagge und Hymne, eigene „multiethnische und professionelle“ Armee, Grenzkontrolleinheiten, Polizei. Fähigkeit, internationale Abkommen abzuschließen, „nach Mitgliedschaft in internationalen Organisationen zu streben“. Dabei sollten die Rechte der serbischen Minderheit gewährleistet sein. Albanisch und Serbisch würden gleichberechtigte, offizielle Amtssprachen.
Für die albanischen Kosovaren bot der Plan die Plattform und den Rahmen für die 2008 erklärte Unabhängigkeit. Während sie damit begannen, ihn Stück für Stück umzusetzen, lehnten ihn die kosovarischen Serben und Serbien selbst den Athtisaari-Plan ab. An dieser Haltung hat sich bis heute wenig geändert.
Im Jahre 2008, nach der diplomatischen Anerkennung des Kosovo als selbständigem Staat, eröffnete Deutschland eine Botschaft, in einem Haus, das einige Straßen höher lag als das „Deutsche Haus“, in dem ich Dienst tat. Damit kam auch symbolisch zum Ausdruck, dass wir den völkerrechtlichen Status unserer Vertretung in Prishtina auf eine höhere Stufe angehoben hatten.
Martti Ahtisaari
Ich war gespannt darauf, einige Jahre danach bei einem Besuch in Prishtina einige alte Bekannte aus meiner Zeit wiederzusehen. Vor allem freute es mich, Frau Pula wieder zu treffen, die sich besonders im Deutschen Haus verdient gemacht hatte. Sie war nicht nur eine umsichtige Reinigungskraft, sondern auch eine gute Schneiderin, die so einigen von uns Sachen nähte, die wir damals dringend brauchten. Ich habe die Frau umarmt. Wir waren beide, angesichts der vielen Erinnerungen nach unserem Anfang im Deutschen Haus, sehr gerührt.
Andrang vor der deutschen Botschaft in Prishtina (rechts). Mit der Erteilung von Visa durch die Botschaft hat der Besucherstrom erheblich zugenommen.
1 Albaner sprechen auch gern von „Kosova"
2 Supreme Allied Commander Europe
3 Hauptstadt des Kosovo, mit unterschiedlicher Schreibweise: Prishtina, Pristina oder auch Prisšina
4 Jackson, Soldier 334 ff.
5 The Guardian vom 3.8.1999
6 Jackson aaO, 333
7 The Guardian aa0
8 Joetze, Der letzte Krieg in Europa?, 166 f.
9 Vgl. auch Jackson, aa0 308
10 Vgl. FAZ vom 16.3.2022 „Kosovo 1999 und Ukraine 2022
11 FAZ aa0
12 DER SPIEGEL, 11. März 2006
13 FAZ vom 22.10.12022
Erstes Kapitel ‒ Die Rahmenbedingungen
Das Rennen der Schildkröten
Der Westbalkan ‒hierzu rechne ich vor allem die Länder des früheren Jugoslawiens, also Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Mazedonien, das Kosovo und Albanien ‒ wurde bald nach dem Tode von Josip Broz, genannt „Tito“, erneut zu einem Unruheherd. 1991 kam es zum Krieg. Serbien wollte sich mit dem „Abfall“ seiner Bruderländer, mit denen es seit 1918 in „Jugoslawien“ vereint war, nicht abfinden. Wir haben die Bilder der Zerstörungen von Sarajevo, Mostar und anderen Städten der Region noch vor Augen.
Nur mit großen diplomatischen Anstrengungen gelang es, schließlich den Frieden herzustellen. Die USA hatten sich in erster Linie engagiert. Im Dayton-Agreement von 1995, an dem auch die EUAnteil hatte, einigten sich die Hauptkontrahenten Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina über die Teilung des ehemaligen Jugoslawien, aber vor allem über den Vielvölkerstaat Bosnien-Herzegowina, der künftig eine Staatsspitze aus Serben, Muslimen und Kroaten erhalten sollte. Ein mehr als wackliges Gebilde, wie wir heute wissen.
Milošević (Serbien), Kroatien (Tudjman) und Bosnien (Izetbegović) zeichnen im November 1995 das „Dayton-Agreement“. In der zweiten Reihe v.l.n.r. Felipe González (E), Bill Clinton (USA), Jacques Chirac (F), Helmut Kohl (D), John Major (Vereinigtes Königreich) und Viktor Tschernomyrdin (Russland) (Quelle: „Der Kurier“, Wien)
Leider hielt der Frieden nicht lange. Der Chauvinismus von Milošević, der 1989 auf dem Amselfeld (Kosovo) in einer nationalistischen Rede faktisch die dem Kosovo unter Tito gewährte Autonomie aufhob, führte erneut zum Krieg, zunächst eher im Verborgenen, aber im Frühjahr 1999 zu offenen Kämpfen, wobei die NATO gegen den Widerstand Russlands militärisch gegen Serbien eingriff und dadurch die Abtrennung des Kosovo von Restjugoslawien erzwang. Kosovo war gemäß der Bundesverfassung von Jugoslawien von 1974 neben der Vojvodina „autonome Provinz“ und den sechs Teilrepubliken Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Mazedonien und Montenegro de facto gleichgestellt.
Nach der militärischen Intervention der NATO, jetzt unter Einbeziehung Russlands, das im Sicherheitsrat der UNO kein Veto hiergegen einlegte, wurde das Kosovo unter die Verwaltung der Vereinten Nationen gestellt. Diese Verwaltung erhielt den Namen UNMIK (United Nations Mission Kosovo). Kosovo wurde somit zu einer Art Protektorat der UNO.14
Damit jedoch waren keineswegs Ruhe und Stabilität auf dem Westbalkan garantiert. Wir mussten damit rechnen, dass jederzeit in dieser Region Konflikte ausbrechen konnten, um Grenzen zu verschieben und hier und dort eine neue Flagge zu hissen. Die EU reagierte. Sie wollte dadurch, dass sie der gesamten Region einen Stabilitätspakt und eine Beitrittsperspektive anbot, das latente Konfliktpotential entschärfen und allmählich einen dauerhaften Frieden in der Region sichern.15
Ich erinnere mich noch gut und habe dies in meinem Tagebuch von 1999/2000 mehrfach festgehalten. Die Region sollte dauerhaft in die von Westeuropa durch die Römischen Verträge begründete Europäische Union integriert werden. Sollte dies gelingen, würden die Grenzen auf dem Westbalkan in den Hintergrund geraten. Sie wären nicht mehr wichtig. Handel und Wandel unter den Westbalkanstaaten würden auf eine neue Grundlage gestellt. Die Konfrontation sollte durch Kooperation auf allen Gebieten ersetzt werden.
Fast gebetsmühlenhaft haben wir dies in unseren Ansprachen, Interviews und Zeitungsartikeln aus den Jahren 1999 und 2000 wiederholt. Heute werden wir daran erinnert. Denn leider sind unsere Versprechen auch nach mehr als 22 Jahren nicht Wirklichkeit geworden. Zwar sind Slowenien und Kroatien mittlerweile Vollmitglieder der EU geworden haben mit einigen der übrigen Westbalkanstaaten Vertragsverhandlungen begonnen, aber wirklicher Fortschritt hat sich hier kaum eingestellt. So kritisiert die Europäische Stabilitätsinitiative ESI, die (beabsichtigte) Aufnahme einiger neuer Mitglieder des Westbalkans sei zur Farce geworden.16 In der Studie wird der ernsthafte Wille der EU-Kommission und der Mitgliedstaaten, die Staaten Südosteuropas zu Vollmitgliedern der EU zu machen, bezweifelt. Eine bedingte Beitrittszusage, wie sie die EU 2001 Litauen, Lettland und der Slowakei gemacht habe und die mit dem Jahr 2004 eine datierte Zielvorgabe enthalten habe, sei heute auch für den Westbalkan möglich. Man könne wenigstens wichtige Etappenziele, wie den Beitritt zum gemeinsamen europäischen Markt, festlegen.17
Immerhin haben Nord-Mazedonien und Albanien, nach achtzehn bzw. achtjähriger Wartezeit im Juli 2022 durch die förmliche Aufnahme von Beitrittsverhandlungen eine Perspektive erhalten. Wie lange sich die Verhandlungen hinziehen, kann heute niemand voraussagen. Auch jetzt sind Geduld und Durchhaltevermögen der beiden Beitrittskandidaten gefragt.
Durch den Krieg in der Ukraine hat die Frage des Beitritts der Länder des westlichen Balkans weiter an Brisanz gewonnen. Der Schatten Russlands breitet sich über Europa aus. Putin sucht mit allen Mitteln, die EU zu schwächen und spielt die serbische Karte. Er versucht - dies zeigt auch die geplante Reise von Lawrow im Juni 2022 nach Belgrad, die durch die Verweigerung der Überfluggenehmigung durch einige Staaten verhindert wurde - Serbien zu sich herüberzuziehen und es aus der Reihe der Beitrittskandidaten zur EU herauszubrechen. Einladungen des serbischen Ministerpräsidenten Aleksandar Vučić und seines kosovarischen Kollegen Albin Kurti nach Berlin und Gespräche mit Bundeskanzler Olaf Scholz können hilfreich sein, wenn sie konkrete Ergebnisse hervorbringen. Bisher zeigt sich dies jedoch nicht. Auch die Förderung von Investitionen der EU (EU-Investitionsinitiative mit 3,2 Mrd. EU) ist ein positives Signal, das aber nicht die Aufnahme bzw. die Beschleunigung von Beitrittsverhandlungen ersetzen kann.
Die Zeit drängt, und daher werden die Kommission und die Mitgliedstaaten der EU weitere Initiativen entfalten müssen, die über „Lockvogelangebote“ hinausgehen müssen.
14 Clewing und Reuter, Der Kosovo-Konflikt 12
15 Vgl. Auch Clewing und Reuter, in „Der Kosovo-Konflikt", 11
16 The Balkan Turtle Race ‒ a warning for Ukraine, Internet, Aufruf am 17.7.2022
17 FAZ vom 16.7. 2022
Krieg um das Kosovo
Der NATO-Einsatz im Kosovo gegen das frühere Jugoslawien, im Frühjahr 1999 (24.3.bis 10.6.1999) gründete sich auf das „humanitäre Völkerrecht“. Ein bedrohtes Volk sollte durch eine „humanitäre Intervention“ vor seiner Vernichtung bewahrt werden.
Die Rechtsfigur der „humanitären Intervention“ ist umstritten. Die wohl herrschende Auffassung unter Völkerrechtlern lehnt sie ab. Der Vorwand einer „humanitären Intervention“ könne willkürlichen militärischen Operationen Tür und Tor öffnen.18 Allerdings wird auch die Auffassung vertreten, dass bei der Gefahr einer akuten Bedrohung, bei der die Auslöschung von Teilen der Bevölkerung eines Landes auf dem Spiel stehe, als letztes Mittel, wenn diplomatische Verhandlungen versagen, ein militärisches Tätigwerden Dritter infrage kommen könne. Dies müsse jedoch verhältnismäßig sein (vgl. Abhandlung im Anhang). Die bereits im Mittelalter entwickelte Lehre vom „gerechten Krieg“ bildete hierfür den Hintergrund.
Im Fall des ehemaligen Jugoslawiens waren Teile der albanisch-sprechenden Bevölkerung des Kosovo konkret bedroht. Von Belgrad gesteuerte paramilitärische Gruppen verübten schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die an Grausamkeit nicht mehr zu überbieten waren. In dem kleinen Ort Krusha i Vogel zum Beispiel, im Süden des Kosovo, trieb ein serbisches Kommando die Männer in einem Haus zusammen und sprengte es in die Luft. Dies geschah auch an anderen Orten. Bekannt ist auch das Massaker von Račak, bei dem im Januar 1999 etwa 45 kosovarische Zivilisten von serbischen „Sicherheitskräften“ ermordet wurden. Massengräber, fast überall im Kosovo, zeugten von den schweren Verbrechen.
Der Balkan, wovon Kosovo ein Teil ist, gilt seit langer Zeit als Zone der Instabilität. Wie ich bereits ausführte, konnte Josip Broz „Tito“ die Völker Jugoslawiens zusammenhalten. Die Lage auf dem Balkan hatte sich stabilisiert. Man lebte im Frieden miteinander. Aber mir dem Tode Titos 1980 brachen die Gegensätze in den verschiedenen Teilen Jugoslawiens wieder auf. Ein Auseinanderbrechen des Staates war nicht mehr aufzuhalten.
Massenhafte Flucht von Albanern aus dem Kosovo nach Mazedonien (April 1999)
Kosovo, das unter Tito einen Autonomiestatus innehatte, war Teil Serbiens. Aber auch hier nahmen die Kräfte zu, die nach Unabhängigkeit strebten. Der serbische Präsident Slobodan Milošević hatte 1989 mit einer Rede auf dem Amselfeld (Kosovo) die Autonomie dieses Landstrichs beendet, ihn politisch und administrativ in Serbien integriert und damit das Fanal für den Aufstand der Kosovaren gegen die serbische Herrschaft gegeben. Es kam zu einer Art Guerrilla-Krieg, bei dem Belgrad immer härtere Maßnahmen ergriff.
Vor allem ab 1997 begann Milošević durch die Entsendung von Polizei-Einheiten, darunter auch Spezialgruppen, an der Eskalationsschraube zu drehen. Immer häufiger kam es zu bewaffneten Polizeiaktionen gegen albanische Kosovaren. Besonders intensiv führten die Serben Einsätze im Raum Drenica, im Westen, aus, die sich immer mehr auf die Liquidierung des Jashari-Clans konzentrierten, dem Mit-Urheberschaft für den bewaffneten Aufstand der albanischen Kosovaren gegen Serbien unterstellt wurde. Das Ergebnis waren 58 Tote auf der albanischen Seite, darunter auch des Clan-Chefs Adem Jashari, der fortan als Märtyrer für die albanisch-kosovarische Sache galt.19
Während die jugoslawisch-serbische Führung ihre Polizeiaktionen im Kosovo als eine innere Angelegenheit betrachtete, waren die damit verbundenen Massaker aus der Sicht internationaler Beobachter ein Wendepunkt im Geschehen. In einem Bericht stufte Human Rights Watch die Aktion als „willkürlich und exzessiv“ (arbitrary and excessive) ein und wertete sie zusammen mit anderen Polizeiaktionen, die serbische Polizeikräfte im Kosovo etwa gleichzeitig durchgeführt hatten, als Verletzung der Menschenrechte. In den USA begann die Regierung auf die Vorgänge aufmerksam zu werden. Im März 1998 kam es zur Resolution 1160 des Sicherheitsrats der UNO, worin u.a. ein Waffenembargo gegen Jugoslawien verhängt wurde und Autonomie und eine bedeutsame Selbstverwaltung (meaningful self-administration) für das Kosovo verlangt wurden. Die Resolution kam fast einstimmig zustande. Nur die VR China enthielt sich.20
Wendepunkt wurde Drenica auch für die Aktivitäten des bewaffneten kosovarischen Widerstands unter Führung der UÇK (Ustria Çlirimtare e Kosovës, Befreiungsarmee des Kosovo). Sie hatte ihre Wurzeln in mehreren Untergrundorganisationen, die gegen Ende der siebziger Jahre entstanden und sich 1982 zur LPRK, Volksbewegung für eine Republik Kosovo, zusammenschlossen. 1991 nannte sie sich nur noch LPK, Lëvizja popullore e kosovës, Volksbewegung Kosovas.21 Ihre Mitglieder verfochten die These, nur durch Gewalt und nur durch einen bewaffneten Aufstand sei ein unabhängiges Kosovo zu erreichen. Bis 1995 war die LPK eine kleine radikale Partei am rechten Rand. Die meisten Kosovo-Albaner waren durch den grausamen Krieg in Bosnien schockiert und hofften auf eine friedliche Lösung des Kosovo-Problems. Etwa in dieser Zeit vereinigte sich die radikale LPK mit anderen Splittergruppen zur UÇK.22
Nach Dayton, in dem das Kosovo-Problem nicht angesprochen worden war („Kosovo-Das Stiefkind von Dayton“)23, bekamen diejenigen, die für die Unabhängigkeit zu den Waffen greifen wollten, immer mehr Zulauf. Es setzte sich allmählich die Auffassung durch, dass mit friedlichen Mitteln nichts zu erreichen sei. Auch vermerkten die Kosovo-Albaner mit Bitterkeit, dass Milošević, den sie für die brutalen und grausamen ethnischen Säuberungen in Bosnien verantwortlich machten, in Dayton mit der Errichtung einer „Republika Srpska“ in Bosnien auch noch belohnt worden sei. Gewalt schaffe allseits anerkannte Realitäten, während sich Gewaltlosigkeit nicht auszahle.24
Die UÇK begann sich immer mehr zu bewaffnen. Bis 1997 führte sie einzelne Terroraktionen, vor allem gegen die serbische Polizei, durch. Rugova, dessen Bemühungen um friedliche Veränderungen dadurch gestört wurden, bezeichnete sie als „serbische Provokateure“. Waffen beschaffte sich die UÇK anfangs vor allem aus Albanien. Als die nach einem gigantischen Anlagebetrug aufgebrachten albanischen Massen 1997 ein vom Diktator Enver Hodscha angelegtes Waffenlager stürmten, bedienten sich auch die UÇK-Leute aus dem Kosovo. Geld beschaffte sich die allmählich entstehende Untergrundarmee durch Beiträge unter albanischen Gastarbeitern in der Schweiz und in Deutschland. Noch weit bis 1998 hinein funktionierte die UÇK meist nur auf lokaler Ebene, wobei sich die einzelnen Führer untereinander abstimmten. Anfang 1998 gelang ihr es erstmals, im Raum Drenica, ein größeres Territorium unter ihre Kontrolle zu bringen.25
Das Wappen der UÇK
Im Laufe des Jahres 1998 eilten hunderte Albaner aus verschiedenen Staaten Europas herbei, um sich am Kampf gegen Serbien zu beteiligen. Danach kam es zu einer Welle von Überfällen auf Polizei-Einrichtungen und zu neuen Kämpfen zwischen den verfeindeten Lagern. Der Konflikt verschärfte sich während des Sommers 1998 immer mehr. Serbische Kräfte verstärkten ihre Angriffe auf Dörfer und Städte, vor allem im Westen des Kosovo, in der Region Djakova. Daraus resultierte eine stetig anwachsende Welle interner Flüchtlinge. Sie werden auf bis zu 300.000 geschätzt.26
Deutsche Diplomaten, wie der damalige Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Wolfang Ischinger, wie auch sein Kollege, der damals bei der OSZE in Wien akkreditierte Botschafter Hansjörg Eiff, waren während ihrer Reisen 1998 ins Kosovo Zeugen der durch serbische Kräfte hervorgerufenen Zerstörung geworden. Ischinger hatte Milošević darauf angesprochen: „Sie ziehen da eine Furche der Gewalt durch das Land“. Der antwortete, es handele sich um Einzelfälle. Ischinger habe insistiert: „Wie können Sie mit solchen Methoden eine Provinz halten, die zu 80 % mit Albanern besiedelt ist?“
Eiff, der ganz ähnliche Beobachtungen gemacht hatte, sprach sich für die Stationierung robust bewaffneter internationaler Streitkräfte aus. Dabei schwebte ihm nach den in Bosnien gemachten Erfahrungen eine an ISFOR/SFOR orientierte Schutztruppe vor. Leider konnte er sich mit dieser Idee, die wahrscheinlich viel Blutvergießen vermieden hätte, nicht durchsetzen. Weder die USA noch Russland waren 1998 bereit, einer solchen Idee näher zu treten.27
Immerhin drängten die USA und andere Staaten auf eine Waffenruhe. Die NATO drohte mit Luftschlägen gegen Jugoslawien, sollte die Welle der Gewalt im Kosovo nicht beendet werden. Es gelang schließlich dem Sondergesandten und Vertreter der Kontakt-Gruppe, Richard Holbrooke, mit Milošević im Oktober 1998 ein Waffenstillstandsabkommen zu vereinbaren, das den Rückzug der jugoslawischen Militärs und Sondereinsatzgruppen der Polizei vorsah und humanitären Hilfsorganisationen Zutritt zum Kosovo ermöglichte. Auch wurde eine Beobachter-Mission der OSZE (Kosovo Diplomatic Observer Mission, KDOM) zugelassen. Obwohl dies weitgehend umgesetzt wurde, kam es zu einer Reihe anderer schwerer Verstöße der serbisch-jugoslawischen Seite gegen die Menschenrechte. So fanden politische Prozesse ohne die Beachtung der Rechte der Angeklagten wie auch systematische Angriffe auf die Pressefreiheit statt.28
Der Westen wollte eigentlich einen neuen bewaffneten Konflikt auf dem Balkan verhindern. So wie 1994 in Dayton29 erfolgreich durchgesetzt, bemühte sich die sog. „Kontakt-Gruppe“ bestehend aus Vertretern der USA, Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands und Russlands um eine Verhandlungslösung. Auf der Grundlage eines Plans, der vom US-Botschafter in Mazedonien, Christopher Hill, vorgelegt worden war, und der eine weitgehende Autonomie für das Kosovo und die Dislozierung von NATO-Truppen dorthin vorsah (insgesamt enthielt der Plan 10 Punkte), kam es am 6.2.1999 im Schloss Rambouillet zu Verhandlungen, die auf kosovarischer Seite von Hashim Thaçi und Ibrahim Rugova, auf serbischer Seite vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Ratko Marković und als Vertreter der Kontakt-Gruppe von Beauftragten der USA, der EU und Russland geführt wurden. Ziel der Verhandlungen, unter dem Vorsitz des britischen Außenministers Robin Cook und des französischen Außenministers Hubert Védrine, war der Abschluss einer Vereinbarung zwischen Serbien und dem Kosovo, nach dem Muster von Dayton.
Nachdem die Gespräche in Rambouillet am 23.2.1999 unterbrochen worden waren, wurden sie am 15. März in Paris fortgesetzt. Während sich die kosovarische Seite nach massivem Druck der USA (Außenministerin Madeleine Albright) zur Annahme eines Vereinbarungstexts bereiterklärte, sperrte sich Jugoslawien dagegen. Schließlich stellte die NATO der BR Jugoslawien ein Ultimatum zur Annahme des Abkommens. Für den Fall der Nichtannahme drohte die NATO mit Bombardierungen in Jugoslawien.
Es folgten noch eine Reihe fruchtloser Initiativen und Gespräche, darunter das von Holbrook mit Milošević am 22.und 23. März 1999. Wird der Serbe noch in letzter Minute einlenken, nachdem Moskau versucht hatte, ihm eine diplomatische Brücke zu bauen? Der US-Diplomat nennt seine Gespräche als die „trübsinnigsten und uninteressantesten, die wir je hatten“. Der Serbe scheint nicht mehr bereit und fähig, auf irgendwelche Argumente und Vorschläge einzugehen. Brütend und resignativ reagiert er auf die Beschwörung seines Gesprächspartners, der ihm den Ernst der Lage verdeutlicht.30 So verstreicht die letzte Gelegenheit, noch zu einer Verständigung zu gelangen.
Als Belgrad unter allerlei Ausflüchten nicht reagierte und die im Ultimatum gesetzte Frist verstrichen war, wies der NATO-Generalsekretär Javier Solana den SACEUR (Supreme Commander Europe), General Wesley Clark an, mit der militärischen Operation gegen Serbien zu beginnen. Ich habe Solana in Prishtina kennengelernt. Das war kein „kriegslüsterner“ Mann, sondern jemand, bei dem ich mir von seinem Auftreten und seiner Persönlichkeit vorstellen könnte, dass ihm der Befehl zum Eingreifen schwer gefallen ist. Der Spanier Solana war freundlich und bereit zur Kommunikation. Während der Begegnung mit ihm, im Jahre 2000 hörte er seinen Gesprächspartnern aufmerksam zu, bevor er sich selbst äußerte.
So begann die NATO am 24. März mit der Operation „Allied Force“ und der Bombardierung Jugoslawiens, vor allem von Infrastruktur in und um Belgrad. Mehrere Jahre hatte der Westen zugesehen, ohne einzugreifen. Als jedoch die jugoslawische Intervention im Kosovo immer mehr Züge eines Völkermords annahm und die Regierung in Belgrad keine Bereitschaft zu Konzessionen mehr zeigte, entschloss er sich zu handeln.
Nachdem Russland sein Veto gegen einen Resolutionsentwurf des Sicherheitsrats der UNO, der eine bewaffnete Intervention zum Schutz der Bevölkerung im Kosovo vorsah, eingelegt hatte, entschloss sich der Westen, auch ohne Mandat der UNO, zum Handeln. Der NATO-Einsatz war nach dem Scheitern aller Bemühungen um Erhaltung des Friedens ein „last resort“. Er war der erste Kriegseinsatz der NATO seit ihrem Bestehen und führte allerdings zu einer neuen Welle von Gewalt, zu pogromartigen Exzessen, die vor allem von serbischen militärischen, paramilitärischen und Polizeikräften verübt wurden. Ähnlich hatten sich serbische Kräfte bereits 1995 beim Massaker in Srebrenica verhalten. Etwa 10.000 Kosovaren verloren im Frühjahr 1999 ihr Leben, 863.000 flohen ins Ausland und 590.000 verließen ihre Wohnungen, um in einem anderen Teil des Kosovo eine sichere Bleibe zu finden31 . Die NATO erzwang im Juni 1999 nach Luftangriffen auf Ziele in Serbien den Abzug aller serbischen Kräfte aus dem Kosovo und seine administrative Abtrennung von Serbien. Das Land wurde unter die Verwaltung der UNO (UNMIK) gestellt, die nur langsam ihre Arbeit von Prishtina aus aufnahm32. 2008 erlangte es nach langem Ringen schließlich seine Unabhängigkeit.





























