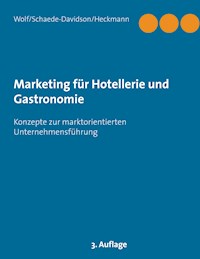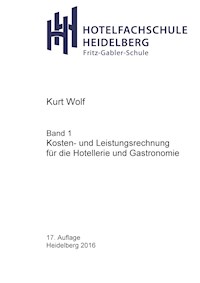
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Hotelfachschule Heidelberg - Rechnungswesen
- Sprache: Deutsch
Seit 1990 werden an der Hotelfachschule Heidelberg Arbeitsunterlagen für das Rechnungswesen angeboten. Die Fachschulausbildung im Rechnungswesen vermittelt dem künftigen Hotelbetriebswirt zunächst Kenntnisse auf dem Gebiet der Buchführung und der Kosten- und Leistungsrechnung. Darüber hinaus soll dem Fachschüler die Bedeutung der Kosten- und Leistungsrechnung für den Erfolg gastgewerblicher Betriebe bewusst werden. Schließlich muss er in der Lage sein, die Daten auszuwerten, die das Rechnungswesen zur Verfügung stellt, und für unternehmerische Planungen zu nutzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 68
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gliederung
1 Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung
2 Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung
2.1 Der Kostenbegriff
2.2 Spezielle Kostenbegriffe
3 Kostenartenrechnung
3.1 Aufgaben der Kostenartenrechnung
3.2 Kostenarten
3.2.1Gliederung der Kostenarten
3.2.2 Gliederung nach verbrauchten Kosten
3.2.3 Gliederung nach Zurechenbarkeit
3.3 Kosteneinflussfaktoren
3.3.1 Änderung der Produktionsbedingungen
3.3.2 Änderung des Produktionsprogrammes
3.3.3 Änderung der Faktorpreise
3.3.4 Änderung der Beschäftigung
3.4 Kosteneinteilung und Kostenverhalten unter dem Einfluss der Beschäftigung
3.4.1 Fixe und variable Kosten
3.4.2 Die Gesamtkostenkurve und ihre kritischen Punkte
3.4.3 Kritik an der bisherigen Darstellung
3.4.4 Lineare Kosten- und Erlösfunktionen
3.5 Elastizität der Kosten in Bezug auf Änderungen des Beschäftigungsgrades
3.6 Das Phänomen der Kostenremanenz
4 Kostenstellenrechnung
4.1 Begriffe und Aufgaben der Kostenstellenrechnung
4.2 Kostenstellenrechnung im gastgewerblichen Betrieb
5 Kostenträgerrechnung
5.1 Begriffe der Kostenträgerrechnung
5.2 Verfahren der Kostenträgerrechnung
5.3 Die Kostenträgerzeitrechnung
5.4 Die Kostenträgerstückrechnung
6 Teilkostenrechnung
6.1 Die Deckungsbeitragsrechnung
6.2 Entscheidungssituationen für die Teilkostenrechnung
6.3 Grenzen der Deckungsbeitragsrechnung
7 Budgetierung
7.1 Begriff der Budgetierung
7.2 Gründe für die Budgetierung
7.3 Planung der Kosten und Erlöse
7.4 Kostenauflösung
7.5 Erstellung und Kontrolle des Budgets
7.6 Abweichungsanalyse
8 The Uniform System of Accounts for the Lodging Industry
8.1 Grundlagen
8.2 Formular für die Gesamtbereichsrechnung
8.3 Formular für die technische Abteilung
8.4 Umsatzbereich Beherbergung
8.5 Umsatzbereich Speisen und Getränke
8.6 Zahlenbeispiel Umsatzbereich Speisen und Getränke
1 Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung
Der Gesamterfolg eines Hotel- und Gaststättenbetriebes kann mit Hilfe der Finanzbuchführung (Geschäftsbuchführung) durch regelmäßige Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge einer Rechnungsperiode ermittelt werden. Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ermöglicht über den Betriebsvergleich eine Beurteilung der Aufwands- und Ertragsentwicklung des Gesamtunternehmens.
In den Aufwendungen und Erträgen können Beträge enthalten sein, die mit dem eigentlichen Zweck des Hotel- und Gaststättenbetriebes nicht direkt in Zusammenhang stehen. Deshalb lassen sich aus der GuV keine Aussagen zur Wirtschaftlichkeit und Produktivität einzelner Leistungsbereiche (Küche, Restaurant, Beherbergung) machen. Diese Informationen sind aber für die Kontrolle und Steuerung des gastgewerblichen Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Neben der Finanzbuchführung ist daher die Kosten- und Leistungsrechnung (Betriebsbuchführung) erforderlich.
Die Finanzbuchführung unterliegt vor allem wegen des Gläubigerschutzes und der gleichmäßigen Steuererhebung gesetzlichen Vorschriften (z. B. HGB, EStG). In der Kosten- und Leistungsrechnung besteht Gestaltungsfreiheit. Gesetzliche Vorschriften sind grundsätzlich nicht zu beachten.
Die Hauptaufgaben des Hotels- und Gaststättenbetriebes sind
Erzeugnisse zu fertigen (z.B. Speisen) Fertigungsfunktion
Getränken bereitzustellen Handels- und Sortimentsfunktion
Dienstleistungen zu produzieren (z.B. Gästezimmer bereitstellen) Dienstleistungsfunktion
Dazu müssen Güter und Leistungen
beschafft (Beschaffungsfunktion)
be- und verarbeitet (Fertigungsfunktion) und
abgesetzt (Absatzfunktion)
werden. Sie verlassen den Betrieb wertvoller, auch wenn das Äquivalent für diesen Wert manchmal nicht gezahlt wird, weil der Bedarf zurückgegangen ist oder die Konkurrenz preiswerter anbietet kann.
In der Regel wird ein Betrieb nur dann produzieren, wenn
Bedarf vorhanden ist und
die Ausbringung (Output) nach Vorausschätzungen höherwertiger sein wird als der Einsatz (Input).
Bei Veräußerung fließt das Entgelt in den Betrieb zurück und kann zur erneuten Beschaffung von Produktionsfaktoren verwendet werden. Denn erst die Einnahmen sichern den Arbeitsplatz, festigen die Stellung des Unternehmens im Absatzmarkt, aber auch im Beschaffungsmarkt. Die Einnahmen ermöglichen die Einstellung neuer Arbeitskräfte, die Beschaffung von Rohstoffen und die Verzinsung des Kapitals.
So durchlaufen den Betrieb entgegen gesetzte Ströme, nämlich
der Güterstrom - von der Beschaffung zum Absatz - und
der Geldstrom - vom Absatz zur Beschaffung -
Der Güterstrom beginnt mit der Beschaffung der Produktionsfaktoren, der Geldstrom mit den Einnahmen.
Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung
Erfassung der Kosten nach Kostenarten
Verteilung der Kosten auf die Kostenstellen
Zurechnung der Kosten auf die Kostenträger
Ermittlung der Wirtschaftlichkeit
Kontrolle der Wirtschaftlichkeit
Ermittlung und Kontrolle der Preise
Kontrolle des leistungsbezogenen Erfolges
Planung der Beschaffung, der Produktion und des Absatzes
Erfolgsplanung
2 Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung
2.1 Der Kostenbegriff
Der Kostenbegriff ist ein zentraler Begriff der Betriebswirtschaftslehre. Ihm werden zur Definition vier Merkmale zugrunde gelegt:
(1)Güterverzehr
(2)Leistungsbezogenheit
(3)Bewertung des Güterverzehrs
(4)Normalcharakter (Regelmäßigkeit)
zu (1) Güterverzehr
Unter Güterverzehr verstehen wir den mengenmäßigen Ge-/Verbrauch von Sachgütern (Verbrauch z.B. von Werkstoffen und Gebrauch z.B. von Betriebsmitteln) und Dienstleistungen (z.B. von Transportleistungen).
Der Mengenverzehr betrifft die gesamten Produktionsfaktoren wie Werk-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Betriebsmittel, Rechte, verzehrfähigen Boden, Arbeits- und Dienstleistungen, Unternehmerleistungen und Arbeitsleistungen.
Der Güterverzehr wird bei abnutzbaren Gebrauchsgütern über die Abschreibung anteilmäßig erfasst, während er bei Verbrauchsgütern aufgrund von Materialentnahmen und/oder Inventuren ermittelt wird. Dienstleistungen werden in der Regel nach der Zeit oder der Art des Gutes festgestellt. Der erzwungene Güterverzehr (z.B. Diebstahl, Katastrophen) wird in den Wagniskosten erfasst.
zu (2) Leistungsbezogenheit
Kosten entstehen nur dann, wenn der Güterverzehr im Zusammenhang mit dem Sachziel des gastgewerblichen Unternehmens steht, d.h. wenn durch die Leistung des Unternehmens ein Beitrag zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse durch die Kombination von Produktionsfaktoren erbracht wird.
Zu den Leistungen zählen:
unmittelbar am Markt verwertete Dienst- und Warenleistungen, z.B. Getränke-, Speisen- und Zimmerverkauf
Bestände an unfertigen und fertigen Erzeugnissen, z.B. Fertiggerichte
innerbetriebliche Leistungen, z.B. Dekorationen der Floristenabteilung
zu (3) Bewertung
Es gibt keine einheitliche Bewertungsregel. Generell werden in der Kostenrechnung alle Arten von Werten bzw. Preise aller Arten angesetzt, wobei diese Werte (un-)mittelbar von den bestehenden Marktpreisen abgeleitet sein können, z.B.
Anschaffungspreise (z.B. für Küchenmaschinen)
Tagespreise (z.B. für Frischgemüse)
Wiederbeschaffungspreise (z.B. für Hotelcomputer)
usw.
Kostenwerte erfüllen zweierlei Funktion
Verrechnungsfunktion: Verschiedene Güterarten (z.B. Waren und Arbeitsleistungen) werden durch die Bewertung in gleichartig gemacht.
Lenkungsfunktion: Wirtschaftsgüter sollen ihrer günstigen Verwendungsmöglichkeit zugeführt werden.
zu (4) Normalcharakter
Normalcharakter hat der Regelverbrauch, der bei der betrieblichen Leistungserstellung im Durchschnitt einer längeren Periode und unter den üblichen Produktionsbedingungen entsteht.
Das Kriterium ist "betriebsnotwendig". Abzugrenzen ist
Güterverzehr, der nicht der betrieblichen Leistungserstellung dient, sowie
alles Einmalige und nur Zufällige, selbst wenn es betriebsbedingt ist.
2.2 Spezielle Kostenbegriffe
Die Kosten stehen im engen Zusammenhang mit den Rechnungsgrößen, Auszahlungen, Ausgaben und Aufwand und auf der anderen Seite mit den Begriffen Einzahlung, Einnahme, Ertrag und Leistung.
Die beiden Schaubilder zeigen die Zusammenhänge!
3 Kostenartenrechnung
3.1 Aufgaben der Kostenartenrechnung
Die Aufgaben der Kostenartenrechnung bestehen in
Erfassung
Gliederung
Bewertung
der verbrauchten Kostengüter während der Leistungserstellung und -verwertung
Sie sucht Antworten auf folgende Fragen:
1. Welche Kosten sind entstanden?
2. In welcher Höhe sind die einzelnen Kostenarten in der Periode angefallen?
Die Kostenartenrechnung dient als Entscheidungsgrundlage zur Kostenbeeinflussung. Die Kostenarten einer Periode werden mit denen vorangegangener Perioden oder mit den geplanten Kostenarten (Budgetierung) verglichen. Es kann auch ein Vergleich mit den Kostenarten der Mitbewerber erfolgen (z.B. Wareneinsatz im Küchenbereich).
3.2 Kostenarten
3.2.1 Gliederung der Kostenarten
3.2.2 Gliederung nach verbrauchten Kosten
a. Verbrauch bzw. Gebrauch von Sachgütern
Materialkosten: Fertigungsmaterial (= Werk- od. Rohstoffe, z.B. Fleisch oder Fisch), Hilfsstoffe (z.B. Gewürze, Fleischbrühe) und Betriebsstoffe (z.B. Fett, Energie).
Abschreibung auf Gebäude, Maschinen (z.B. Küchenmaschinen, Zapfanlage), Werkzeuge (z.B. Küchenmesser) und Geschäftsausstattung (z.B. Bestuhlung, Büroeinrichtung).
Methoden der Verbrauchsermittlung