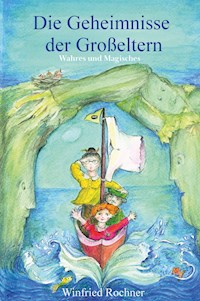6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herzsprung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Es ist ein winterlicher Tag da draußen. Meinen Blick hebe ich zur Kuppel und sehe, wie die Schneeflocken die gläserne Hülle bombardieren. Da kommt mir die Sinnlosigkeit all der hier geführten Debatten fast körperlich nahe ... Winfried Rochner greift in seinen Erzählungen Schicksale und Erlebnisse eines verloren gegangenen Landes, eines aufgelösten Systems und die politische Gegenwart auf. In den Rückblenden ist zu erkennen, dass die menschlichen Strukturen keine Veränderungen bereithalten, die aber heute auf einem anderen Niveau stehen. Es werden Eigenschaften im Arbeiten und Zusammenleben in Ost und West ausgelotet. Zwischen den Erzählungen wird ein zeitlich großer Bogen geschlagen, der nicht nur Befindlichkeiten offenlegt, sondern auch zum Schmunzeln einlädt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
o
Kostenfaktor Mensch
Erzählungen
Winfried Rochner
o
Impressum
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet - www.herzsprung-verlag.de
© 2022 – Herzsprung-Verlag GbR
Mühlstr. 10, 88085 Langenargen
Alle Rechte vorbehalten. Taschenbuchauflage erschienen 2022.
Cover gestaltet von © Jane Gebert
Lektorat + Herstellung: CAT creativ - www.cat-creativ.at
ISBN: 978-3-98627-026-1 - Taschenbuch
ISBN: 978-3-98627-027-8- E-Book
*
Inhalt
Vorbereitung des Feldzugs
Die Brücke
Eine unfreiwillige Wanderung
Kampfgruppen und Panzerspiele
Die Wegsäule
Der Unfall
Marktwirtschaft auf Sozialistisch
Der Krake
Hilfslieferungen nach dem Osten
Nachwendeorientierung
Baustellenleben
Impressionen dörflichen Lebens
Der Bittsteller
Der Kostenfaktor Mensch(Eine Bundestagsdebatte)
Der Autor
*
Vorbereitung des Feldzugs
Der noch nicht vorauszusehende Untergang des Dritten Reiches war mit der Mobilmachung des Polenfeldzuges eingeleitet worden. Die in aller Stille für den Krieg auf Hochtouren laufende Rüstung sollte an den Polen erprobt werden. Aktives, ausgebildetes Militär reichte nicht aus, um den polnischen Korridor und darüber hinaus ganz Polen breitzumachen. Überall im Lande zog man kriegsunwillige Männer zusammen. So auch alte Reserveoffiziere im Rundgebiet einer kleinen schlesischen Stadt, um sie zur Ausbildung des schnell gemusterten Reichsarbeitsdienstes zu bestimmen. In Gasthäusern, Turnhallen und Vereinshäusern verteilten Frauen der Deutschen Frauenschaft Stroh zur Aufnahme vieler Arbeitsmänner. Schnellküchen verabreichten militärische Verpflegung.
Alfred Ritter gehörte auch zu denjenigen, die gemustert, in eine braune Tuchuniform gesteckt und mit einem Spaten ausgerüstet und mit gemischten Gefühlen der Dinge entgegensahen, die da kommen sollten. Mit ihm lagen im Gasthof Zur Linde noch fünfzig andere Arbeitsmänner genauso unvorbereitet und versehen mit dem Missbehagen, die jedes unsichere Unternehmen bot. Vorsichtige Diskussionen ergaben gleiche Gedankengänge der anwesenden Mitstreiter. Es waren Männer zwischen fünfunddreißig und vierzig Jahren im erfolgreichen Berufsleben. Alfred entdeckte wenige bekannte Gesichter, die ihm als selbstständiger Handwerker durch seine Arbeit in der Stadt aufgefallen wären. Der Tagesablauf war voll militärisch gestaltet. Sechs Uhr wecken, waschen, frühstücken, Ausbildung am Spaten anstelle eines Gewehres, Mittagessen und wieder Ausbildung am Spaten, Abendessen und um zwanzig Uhr Bettruhe. Ausgang und Urlaub waren nicht vorgesehen. Die Zeit für Gespräche war auf die Zeit nach dem Abendessen beschränkt.
„Eine Sauerei, dass wir hier rumhocken und so einfach Krieg spielen, während zu Hause viel Arbeit zu tun ist“, schimpfte ein großer, vierschrötiger Kerl mit Händen wie Schmiedehämmer. Seine kleinen Augen unter einer niedrigen Stirn und einem vollen, runden Gesicht blickten böse in die Runde, die um einen alten Wirtshaustisch saß.
„Mensch, Fritz, was willst du denn?“, sprach ihn ein kleiner, untersetzter Kerl an. „Es geht uns doch ganz gut hier! Die Arbeit zu Hause und der Streit mit deiner Alten laufen dir nicht davon, du hörst doch im Radio, dass wir bald in Warschau einmarschieren werden und der Sieg nicht mehr weit entfernt ist. Wir müssen uns nur beeilen, dass wir nicht zu spät kommen und von der Siegeswurscht ein Stück abbekommen.“
Der mit Fritz Angesprochene hob seinen Kopf, den er mit einer Hand gestützt hatte, und mit der anderen nahm er ein Stück Kommissbrot vom Teller. „Nach meiner Arbeitslosenzeit“, so der Untersetzte, „habe ich hier eine für mich vernünftige Arbeit bekommen und an der Autobahn mitgearbeitet. Jetzt arbeite ich in der Bleiweißfabrik als Heizer und verdiene mein Geld.“
Alfred warf leise ein: „Dann hast du also an der Nachschubfrage für den Krieg gearbeitet.“
„Ach was, Geld ist Geld“, knurrte der andere. „Was weißt du schon vom Hunger.“
Alfred, ein kleiner, drahtiger Mann mit einem durchtrainierten Körper, wurde lauter: „Verstehst du überhaupt, was es heißt, sich in dieser Stadt gegen Konkurrenten durchzusetzen? Ich war genauso arbeitslos wie du und habe mit Fahrrad und Anhänger und mit fünfzig Mark Kapital einen Handwerksbetrieb gegründet, Grips gehört natürlich auch dazu.“
Einige nickten beifällig, die anderen schauten neugierig auf Fritz, den Vierschrötigen. Der hatte mit dem Brot zu tun und entgegnete, sehr zum Bedauern der anderen, nur mit einem unverständlichen Knurren. Die Neugierigen und Beifälligen widmeten sich in schöner Eintracht dem harten Kommissbrot. Nur Alfred und der kleine Untersetzte unterhielten sich weiter. „Ja“ sagte Alfred, „wenn man den Humor nicht behalten hätte, dann könnte man gleich der nächsten Kugel entgegenrennen oder dem Oberleutnant der Reserve den Spaten zwischen die Beine hauen. ... Wie heißt du eigentlich?“
Der so Angesprochene sagte: „Max, und du?“
„Alfred“, antwortete der Drahtige und sie gaben sich dabei die Hand wie zwei alte Kollegen.
Max sagte: „Partei?“
Alfred schüttelte den Kopf. „Aber ich rate dir, mit deinen Reden etwas vorsichtiger umzugehen. Man weiß nie, wer hier so rumschnüffelt.“
Sie hatten sich beide etwas abseits auf eine Bank gesetzt. Dieser Rummel in den Zeitungen, wo es um Vergeltung und Schuldzuweisungen ging, zerrte langsam an den Nerven.
„Soll er seinen Krieg doch machen, damit alles bald vorbei ist und wir wieder nach Hause können“, sagte Alfred.
„So leicht ist das sicher nicht. Nach den Reden Hitlers geht der Spaß noch weiter, das Ende kann keiner voraussehen“, entgegnete Max.
„Ach was“, erwiderte Alfred. „Was soll’s, wer kann schon am Wahnsinn interessiert sein. Mein Bruder ist bei den Sozis, aber was Anständiges haben die auch nicht zusammengebracht. Hör dir doch das Geschrei an, sie streiten sich mit den Kommunisten rum und sind dann noch stolz, wenn sie untereinander Heimkriege fabrizieren können. Wie war es denn 1930 in unserer Stadt? Sie zogen die Oderstraße runter und die Kommunisten über den Schlossplatz! Erst schlugen sie sich gegenseitig tüchtig auf die Köpfe und sind dann, als die SA eingriff, getürmt. Von den Kommunisten sind dann einige prügelnd bis zur Ohle gezogen und da wurde aus Versehen der gute Konietzke, ein Nazi, von den Nazis erschossen. Die würdige Tat schob man dann den Kommunisten in die Schuhe und heute heißt die Brücke über die Ohle die Konietzkebrücke. So schnell wird also ein Denkmal gesetzt, siehst du!“
„Wenn du in die erste Kugel rennst, Alfred, dann kräht kein Hahn mehr danach. Siehst du, Alfred, du hast schön aus deiner eigenen Geschichte gehört. Überleben ist alles.“
Alfred lächelt bereits versonnen, für ihn war dieser Fall abgeschlossen, bevor er durch die Rede von Max wieder hervorgebrochen war. Er hatte damals die Dinge am Rande mitverfolgt, den gezielten Schuss vernommen, der einen Nazimärtyrer machte, und den Schützen ausgemacht. Ihn ging die Sache nichts an. Aber er verstand seinen Bruder nicht, der als Sozi den Rummel mitmachte. Weiter dachte er: „Was mögen meine Kinder jetzt zu Hause machen?“
„Weißt du, ich gehe jetzt schlafen.“ Alfred dehnte sich und stand auf. Er ging in den mit Stroh aufgeschütteten Tanzsaal, fummelte noch ein bisschen im Stroh rum, zog die Stiefel und einige Sachen aus und warf sich auf die aufgelösten Strohbündel. Er fiel bald in einen unruhigen Schlaf und Träume aus seiner Kindheit umgaukelten das Strohlager.
„Du, Alfred, geh einkaufen und nimm deine kleine Schwester mit. Lass den Kinderwagen nicht wieder vor dem Laden stehen“, hörte er seine Mutter mit leiser Stimme rufen. Die kleine Schwester wurde mit Schwung in den Kinderwagen gesetzt, die Tasche hinterhergeworfen und ab ging es.
Die Briegerstraße wurde im sausenden Galopp genommen, dass die Räder nur so über die Katzenköpfe flogen. Jauchzend machte die Kleine diese Partie noch mit. So, nun um die Kurve rum, dass die Funken stoben, die Schwester hielt sich krampfhaft am Wagenrand fest und wäre um ein Haar auf die Straße gerollt. Mit einem ängstlichen Pfeifton verringerte Alfred die Geschwindigkeit und schlenderte die Wilhelmstraße hinunter. Beim Bäcker wollte sich Alfred nicht aufhalten, obwohl der Duft mächtig in seine Nase stach – aber das Geld in seiner Tasche war genau auf die zu tätigenden Einkäufe abgestimmt. Am Denkmal des heiligen Rochus riskierte er eine spöttische Verbeugung, um dann mit kühnem Schwung eine extra dafür mitgebrachte alte Mütze auf den Kopf des Heiligen zu praktizieren. Schnell schaute er sich noch mal um, aber niemand hatte die Verschönerung des Heiligen bemerkt.
„Wenigstens hätte einer meiner Feinde davon Notiz nehmen können“, dachte Alfred. Jetzt zog er seine Schuhe aus und verstaute sie im Kinderwagen, um das Tempo wieder ordentlich zu beschleunigen. Denn er befürchtete die Begegnung mit Menschen, die auch in einer Kleinstadt wie dieser nicht zu vermeiden war. An den ersten segelte er mit vollem Speed vorbei. Dann aber ging es los, die ersten Feinde, Jungen aus der Nachbarstraße in seinem Alter und etwas darüber, riefen: „Alfredflasche! Alfredflasche mit der großen Einkaufstasche kommt mit seiner Heulsuse.“
Da passierte es dann doch wieder. Die Schwester fing an zu brüllen, was sie immer tat, wenn sie fremde Menschen sah. Alfred geriet in Wut auf die Schwester, auf die Feinde – und blieb dann erst einmal stehen. „Na wartet, ich werde euch ... Und du hörst erst einmal auf zu brüllen!“, wandte er sich an die kleine Schwester.
Liesel hörte nicht darauf, nein, sie blähte ihre Nasenflügel um einiges mehr auf und ließ ihre Stimme in einer anderen Tonart anschwellen. Alfred gab sein nutzloses Unterfangen bald auf, denn er kannte seine Schwester und deren Ausdauer. Kurzerhand schob er den Wagen in die Kreuselgasse, an deren Ecke er gerade angelangt war. Alfred rannte hinter den Jungen her, die immer noch ihren Spottvers abließen. Er jagte sie durch winklige Gassen, über Hinterhöfe und Gärten, bis er einen erwischt hatte. Er sprang ihn von hinten an und beide wälzten sich auf dem Bürgersteig. Im Nu standen die anderen Jungen um die beiden Kämpfenden herum. Alfred war kleiner als sein Gegner, dafür wendiger und sehniger. Er hatte den Größeren bald unter sich und verpasste ihm eine gehörige Abreibung. Jetzt war es an der Zeit, sich aus dem Staube zu machen, denn der Kreis der anderen wurde dichter und dichter. Mit einem Satz sprang Alfred von seinem Gegner, rammte seinen Kopf in den Bauch eines anderen und ehe sich die Meute gefasst hatte, war ein Vorsprung erzielt, den er nicht mehr abgab. Er versteckte sich in der Durchfahrt des Kramladens der Kabus-Else, schlich auf Umwegen zum Wagen mit der Liesel und setzte ungerührt seinen Einkaufsbummel fort.
Liesel brüllte, wann immer sich ein Fremder dem Wagen näherte. Alfred musste wieder zurück zur Kreuselgasse und stellte den Wagen mit der Schwester noch einmal ab. Dann lief er zum Fleischer, holt für zwee Biehm Plempelwurscht, erhielt von der freundlichen Fleischersfrau Viertel einen Wurstzipfel geschenkt und trollte zu Grünberg, um noch Mehl, Zucker, Butterschmalz und Malzkaffee zu holen.
Die dicke Grünberger stand satt und strahlend hinter ihrem Bonbonglasbehälter und hatte für Alfreds verlangenden Blick keine Augen. „Nun, mein Sohn, darf es noch etwas sein?“, flötete sie.
Der hatte keinen Sinn für so viel Freundlichkeit, sondern warf scheppernd die Ladentür zu. In seinem Zorn hatte er die Ladenstufen übersehen und flog auf den Bürgersteig. Die Tasche mit den Kostbarkeiten hielt er dabei instinktiv hoch, lieber aufgeschlagene Knie als aufgeplatzte Tüten. Zähneknirschend stand er auf und eilte zur lieben Schwester. Diese hatte sich beruhigt und kaute an den Schuhbändeln von Alfreds Schuhen herum, schaute erst verdutzt, als sie ihren Bruder kommen sah, ließ sich aber, ohne weitere Geräusche zu verursachen, im Wagen davonschieben.
Alfred hatte den Heimweg vor sich. Er dachte: „Wenn ich einen Umweg durch die Gasse vom Schnapshermann in die August-Feige- Straße mache, dann entwische ich sicher den anderen, die ja meinen Heimweg kennen.“ Fröhlich pfeifend klatschten seine nackten Füße den Takt auf dem Pflaster der Gasse und der Kinderwagen ratterte dazu wie ein Trommelwirbel. So ging es um die Ecke der Gasse in die August-Feige-Straße, kein Feind war in Sicht.
Er merkte plötzlich, dass ihn das aufgeschlagene Knie schmerzte. Aber was sollte es, bis jetzt hatte er sich siegreich aus der Affäre gezogen und ein Held musste Schmerzen ertragen. Bald hatte er die Post erreicht, jetzt war es nicht mehr allzu weit bis nach Hause. Da stürmen sie auch schon heran, hinter den Säulen des Postamtes hatten sie auf ihn gelauert. Da er, nichts Böses ahnend, gerade überlegte, ob er seinen Wurstzipfel, bevor er zu Hause war, auffuttern oder ihn mit dem Bruder teilen sollte, wurde diese Denkarbeit jäh unterbrochen. Er musste blitzschnell nach einem Ausweg suchen, um dieser Situation zu entfliehen. Ihm entgegen stürmten vier Jungen, den Kinderwagen konnte er nicht so schnell wenden. Seine Schwester im Stich lassen, ging nicht. Kurz entschlossen stürmte er mit gesenktem Kopf in voller Kinderwagenfahrt auf die verdutzten Jungen zu. Diese sprangen auseinander – einer fiel sogar hin und fing hinter Alfred an, zu heulen. Ehe die anderen die Sachlage erfasst hatten, war Alfred schon ein Stück davongezogen. Mit Gebrüll stürmten die Jungen hinterher. Alfred wusste, dass mit dem Kinderwagen der Vorsprung nicht lange zu halten sein würde und er schrie seinerseits aus vollem Halse, um seinen Bruder, der zu Hause sicher wieder hinter den Büchern saß, aufmerksam zu machen. Weit war es ja nicht mehr bis zur Haustür, aber da hatte der Erste ihn schon erreicht und sprang ihm von hinten an den Kragen. Alfred schlug wie ein Pferd nach hinten aus und traf auf etwas Hartes, sicher das Schienbein des Angreifers. Da er aber keine Schuhe anhatte, war der Schlag relativ harmlos und da waren die anderen schon heran. Sie rissen ihn zu Boden und rollten sich auf dem Bürgersteig. Alle, so auch Alfred, hatten nicht die kleine Schwester einkalkuliert, die ihrerseits die Sirene anstellte – und das hörte der Bruder Paul. Er raste die Treppen hinunter und warf sich in den Kampf.
Nach einiger Zeit endete dieses Gefecht, abgesehen von einigen blauen Flecken und zerrissenen Hosen, unentschieden. Die Kampfhähne liefen mit gegenseitigen Drohungen in verschiedene Richtungen auseinander.
Alfred wurde munter, als das erste Klopfen der Spaten auf der Diele des Vorraumes zu hören war. Seine Knochen taten ihm weh wie nach einer halb gewonnenen Schlacht. Er wälzte sich aus dem Strohlager. „Blödsinniger Krieg“, murmelte er. „Wieder Griffe klopfen, stramm stehen und die kostbare Arbeitszeit verplempern.“
„Träume nicht, Alfred“, sagte Max, der schon angezogen war und ihm gutmütig auf die Schulter schlug. „Die Gulaschkanone wartet mit einem wunderbaren Blümchen auf uns.“
„Ja, ja, ich komme“, brummte der, hing aber weiter seinen Gedanken nach. Man müsste diesen Krieg, der mit Sicherheit kommen würde, möglichst schnell beenden, mit welchem Ergebnis? ... Möglichst mit einem Sieg. Er schlug die Hosenträger über die Schultern. Bisher waren Siege der Deutschen in ihrer Anzahl immer gering gewesen, über Jahrhunderte hinweg. Man zehrte praktisch noch von der Schlacht im Teutoburger Wald und vom Sieg gegen die Franzosen 1870/71. Ansonsten Reinfälle auf der ganzen Linie. Bei dem jetzigen Schreihals war auch nicht viel Hoffnung, das Ganze siegreich zu beenden. Je mehr Reden und forsches Gewese, umso schwächer die Ergebnisse. Nun waren die Knöpfe richtig, alles durch die Knopflöcher gezogen. Die Knobelbecher, dazu noch Jacke, Koppel und das forsche Käppi auf die schon leicht ergrauten Haare gesetzt. „Na ja“, dachte er, „ein Soldat werde ich sowieso nicht, aber mit dem Spaten wird es schon weitergehen.“
Max schlürfte bereits seinen Kaffee, stand vor der Gulaschkanone und schaute kurz auf, als Alfred kam. Der vierschrötige Fritz stapfte unrasiert und den Spaten nachziehend davon, um noch rasch eine Zigarette abzubrennen.
„Was meinst du, Max, werden wir den Krieg gewinnen?“ Fritz hatte im Vorbeigehen diese Frage hingeworfen.
Max war verdutzt ob dieser Frage. „Hoffentlich nicht“, sagte er.
„Wie?“ Alfred glaubte, sich verhört zu haben.
„Was soll die Fragerei?“, knurrte Max. „Trink, ergreife deinen Spaten und salutiere.“ Damit goss er den Rest des Kaffees auf den Boden und ging zum Appell.
Alfred war durch dieses zwischen den Zähnen Hervorgekaute hoffentlich nicht hellhörig geworden. Da ihm die Uhrzeit im Nacken saß, schulterte er den Spaten und trabte hinterher, das Denken hatte er jetzt aufgegeben.
Das Wetter hatte sich eingetrübt. Sie marschierten mit aufgepflanzten Spaten durch das Dorf. Freundliche Leute riefen den schmucken Arbeitsmännern Scherzworte zu. Ein Lied brüllte der Kommandierende: „Schwarzbraun ist die Haselnuss.“ Frisch und fröhlich klangen die Stimmen. Alfred kam diese ganze Spielerei lächerlich vor. Etwas Positives hatte die Sache schon, man blieb bei diesem leichten Training wenigstens körperlich fit. Inzwischen schwenkten sie in die Seitenstraße ein – zwischen eine Gänseherde, die auseinanderstob und mit langen Hälsen noch eine Weile hinter ihnen herzischte. Eine lustige Begebenheit fiel Alfred in diesem Zusammenhang ein:
Ich mochte ungefähr acht Jahre alt gewesen sein, als ich mit meiner Mutter deren Bruder, der im Dorfe Stannowitz wohnte, besuchte. Einige Bauernwäldchen rahmten das Dorf ein und bildeten die abschirmende Grundlage des in der Ebene liegenden Dorfes. Wir fuhren mit den Fahrrädern, deren es nur die beiden in der Familie gab. Das von Mutter und vom Vater. Der Sattel von Vaters Fahrrad war mir zu hoch, sodass ich auf der Querstange hockte, die ich mit einem Lappen in der Größe meiner Sitzfläche gepolstert hatte. Die Straße war staubig, das Wetter heiß und Mutter kam mit ihrem langen Rock ganz schön ins Schwitzen. Wir beabsichtigten, selbst gebackenes Brot und andere Erzeugnisse der Landwirtschaft meines Onkels zu holen. Unsere hungrige Familie, die aus acht Personen bestand, hatte einen beträchtlichen Naturalieneinsatz, den zu befriedigen den ganzen Einsatz meiner Eltern erforderte. Die goldenen Zwanzigerjahre hatten keinen so positiven Einfluss auf unsere Familie gehabt, sodass wir die Fahrten zu meinem Onkel hätten einschränken oder gar unterlassen können. Wir strampelten also munter drauflos, wobei ich zwischendurch einige Radkunststückchen auf der Mühle meines Vaters versuchte. Diese Kunststückchen hätten mir, von meiner vor mir radelnder Mutter, bald ein paar Ohrfeigen eingebracht, aber ich konnte geduckt den Wischern ausweichen. Das hatte fast einen Sturz meiner Mutter zur Folge, die den Schwung nur schlecht abbremsen konnte.
„Verflixter Bengel!“, schimpfte sie. „Warte, wenn wir erst beim Onkel sind.“ Ich wusste aus Erfahrung, dass bis dahin alles vergessen sein würde.
Am Bach vor dem Dorf machten wir Halt und wuschen uns ein wenig. Mutter tauchte meinen Kopf noch mal ins Wasser und glättete meine widerborstigen Haare. Tatsächlich erinnerte sich Mutter an die verhinderte Ohrfeige und holte sie nun doppelt nach. Ich plärrte zum Schein ein wenig, schwang mich beleidigt aufs Fahrrad und trat an. Diesmal hatte ich mich nicht verrechnet. Meine Mutter rief hinter mir her: „Bleib stehen, es war doch nicht so gemeint! Aber musst du mich auch immer so ärgern?“ Und noch einiges mehr. Langsam verzögerte ich das Tempo und ließ die Mutter heranrauschen. Inzwischen hatte ich schon das Versprechen einer Zuckerstange, eine von denen, die mich beim Kaufmann Grünberg immer so verlockend anschielten. Zufrieden zogen wir beide nach dieser einseitigen Unterhaltung weiter, nur musste ich jetzt vor meiner Mutter fahren, denn sie traute dem Frieden nicht, da Vaters Fahrrad einen schwer zu ersetzenden Familienbesitz darstellte, der noch über Jahre hinaus seinen Dienst tun musste.
Inzwischen waren wir auf dem Gutshof, Mutters Geburtsstätte, angekommen. Mein Onkel bewirtschaftete fünfzig Morgen, hatte zehn Kühe, unzähliges Federvieh, sechs Schweine, einen Hund, eine Frau und drei Kinder, zwei davon waren Mädchen.
Meine Tante lief uns entgegen. „Ha, do seit dar jo.“
Ich nahm Doppeldeckung. Meine Mutter machte auch kein begeistertes Gesicht, denn die Umarmung und vor allen Dingen ihre nassen Küsse waren bei unserer Familie bekannt und gefürchtet. Mutter bekam dann auch die volle Breitseite ab, während ich mit einer halben, seitlichen Drehung nur einen Streifschuss erhielt. Zu Hause hieß es immer: „Die Kissla kumma olle aus’em Waschschaffla.“
Das Schlimmste war nun überstanden, ich war in Gnaden entlassen und konnte meinen Interessen nachgehen. Mein Vetter war noch zu klein, als dass man mit ihm was anstellen konnte, aber die beiden Basen waren schon ganz brauchbar. Es waren zwei dralle herzige Bauerntrienen mit langen Zöpfen, die straff geflochten bis über die verlängerten Rücken fielen. „Na los, kommt ihr mit?“
Beide waren gleich bei der Sache. Der erst Weg führte in die Scheune. Die bekannten Hühnergelege wurden einer Inspektion für würdig befunden. Unter dem Protest der beiden leerte ich geschickt einige Eier. Es war ganz einfach. Mit einem spitzen Stein pikste ich vorsichtig zwei Löcher in die jeweiligen Enden des Eies. Wichtig war die anschließende Geruchsprobe, dann schlürfte ich die Eier aus. Angebrütete Eier waren nicht nach meinem Geschmack. Der Rest der gefundenen Eier wurde dann gemeinsam der Tante als stolze Beute überreicht.
„Ihr seit ock brove Kinderla. Sull ich euch a Eierla kocha?“
„Nein, nein!“, wehren wir ab und verschwanden, ehe die Tante andere Wünsche äußerte.
Was nun? Die richtige Lust für eine Heldentat war heute nicht vorhanden. Der Trick mit der Katze war bekannt und langweilig. Die beiden Basen guckten nicht gerade sehr intelligent in die Gegend. Barfuß, die Hände bis an die Ellenbogen in den Hosentaschen vergraben, wackelte ich über den Hof und die beiden Basen hinterher. Ein leichter Trab führte uns an die Grenze des Anwesens meines Onkels. Weiter ging es zum Bach.
„Weißt du was, Erika, ich wette, dass ich hier über den Bach springen kann.“
„Ha, du nicht“, äußert sie spöttisch, „der Ernst vom Nachbarhof schafft das nicht mal, und der ist viel größer.“
Ich kannte Ernst, er war ein großer, schwerer Bauernjunge, der nicht über diesen Bach kam. „Was gilt die Wette, Erika?“, rief ich noch mal.
Sie zögerte etwas und auch Liesbeth sah skeptisch drein.
„Ich wette um eine Brause“, rief ich.
Sie zögerte. Eine Brause war das Höchste, was es für uns in der warmen Jahreszeit gab. Der Preis erschien Erika doch zu hoch. Beruhigend wollte ich meinen Trab am Bach entlang fortsetzen, aber Erika stimmte nun doch zu. „Gut, die Wette gilt, dafür darf ich aber die Stelle aussuchen, wo du rüberspringen musst“, heuchelte Erika.
Mit einer großartigen Handbewegung gab ich zur Kenntnis, dass mir diese Kleinigkeit egal sei.
Wir schlenderten am Bach hin und her, bis sie auf eine Stelle wies, die eine Bachbreite von ungefähr fünf Metern hatte. Die Sonne strahlte vom wolkenlosen Himmel. Eine Lerche stieg jubilierend aus der Wiese auf. Eine Stille herrschte über dem Land. Der nahe Wald wurde von keinem Lüftchen bewegt. Ich fühlte mich unsäglich frei in dieser Landschaft. Am liebsten hätte ich mich ins Gras geworfen und geträumt.
Die Stimmen von Erika und Liesbeth rissen mich in die Wirklichkeit zurück: „Los, hier kannst du springen.“
Vorsichtig griff ich an meine Hose und löste die Knöpfe von den Hosenträgern, als mir der Schrei von Erika Einhalt signalisierte. „Du Schwein, lass die Hosen an! Wenn ich das der Mama sage.“
„Pff, ist mir egal. Wenn ich in den Bach falle, dann ist die Hose futsch und es setzt von Mutter Hiebe. Du kannst ja wegsehen“, hielt ich ihr entgegen und ließ die Hose fallen.
Beide schauten erst in Richtung des Waldes, besannen sich dann aber und meinten: „Du schmulst, wenn wir nicht hinsehen, und dann haben wir verloren.“ So sahen sie doch zu mir hin.
Ich schritt eine gehörige Anlaufbahn auf der sumpfigen Wiese ab und warf mich in Positur. Dann trat ich mit einem Blitzstart an, hob kurz vor dem Bach ab und plumpste kurz vor dem anderen Bachufer ins Wasser.
„Ätsch, nun hast du es!“, brüllten beide los. „Und ich sag es doch meiner Mama wegen der Hose.“
„Du hast ja hingesehen“, konterte ich. „Das werde ich auch deiner Mama sagen.“ Beschämt zog ich meine Hose über meinen Allerwertesten. „Wir titschen Steine, wie wär’s“, schlug ich vor.
Gemeinsam suchten wir flache, stahlmesserdünne Steine, die ich in meine Taschen steckte. Erika benutzte dazu ihren hochgehobenen Rock, den sie wie einen Beutel hielt. Liesbeth beteiligte sich, indem sie ihre Beute der Erika in den Rock steckte. Als wir genügend zusammen hatten, stiegen wir in den Bach, um die Länge des Baches zum Steinetitschern auszunutzen zu können. Man musste sich seitlich neigen, um möglichst flach mit einem geschickten Wurf die Wasseroberfläche zu berühren. Erika hatte dabei einige Übung und ich hatte Mühe, ihre Geschicklichkeit mit meiner Kraft auszugleichen. Drei Mal auf dem Wasser auftitschen, das war der Durchschnittswert, der von uns und auch von Liesbeth immer geschafft wurde. Vier, fünf oder sogar sechs Mal gelang nur selten und Erika hatte dabei die Nase immer etwas vorn. Ich holte nun zu einem gewaltigen Wurf aus, um die beiden Basen zu beeindrucken. Dieser Wurf war so schwungvoll, dass ich nach vorn gerissen wurde, das Gleichgewicht verlor und diesmal mit Hose den Grund des Baches ausmaß.
„Ha, ha, ha!“ Erika überschlug sich fast vor Lachen. „Da hast du es, du schlauer Stadtschwengel.“
Prustend kam ich hoch.
„Alles willst du können und fällst jedes Mal herein.“ Sie konnte sich nicht beruhigen.
Langsam kam es in mir hoch – ihre langen Zöpfe baumelten so verlockend vor mir, dass ich einfach nicht widerstehen konnte. Ein kräftiger Ruck an dem prachtvollen Gehänge und Erika lag ebenfalls im Bach.
Nach dieser beidseitigen Abkühlung hatten sich die erhitzten Gemüter beruhigt. Erst weinte sie, dann musste sie bei meinem traurigen Anblick doch lachen. Ich lachte auch mit, sodass ein Hase, der im nahen Wald Männchen gemacht hatte, erschreckt auffuhr und uns seine Blume zeigte.
Was nun? Durchnässt, wie wir nun einmal waren, legten wir einen Teil unserer Sachen ab und ließen sie in der Sonne trocknen.
„Die Mama darf nichts merken“, wiederholte Erika immer wieder. Und zu Liesbeth gewandt sagte sie: „Du verpetzt uns gefälligst nicht.“ Sie bibberte dabei ein wenig.
Mir war das im Grunde egal, meine Mutter war Kummer gewöhnt und vor ihrer Handschrift fürchtete ich mich nicht. „Morgen müssen wir wieder in die blöde Schule gehen und stundenlang Gedichte und Sprüche vorleiern“, setzte ich die Unterhaltung fort. In meiner Klasse waren nur Jungen, die alle die Weisheit nicht gepachtet und ein Verhältnis zum Lehrer wie Verteidiger zum Angreifer hatten, was eine Verständigung nicht zuließ.
Erika stöhnte sorgenschwer über ihre Einklassenschule von der vierten bis zur achten Klasse, alle Jahre das Gleiche. Je nach Intelligenzgrad blieb davon, egal in welcher Klasse, etwas haften.
„Das Schönste sind die Pausen“, unterbrach ich ihre Rede.
„Nicht bei uns. Man kann zwischen Aufgaben, die regelmäßig an die Klasse ausgegeben werden und die einige Zeit in Anspruch nehmen, so schön dösen“, schwärmte Erika.
„Nun ja, bei euch ist das besser. Unser Fuchs passt auf, und wehe, einer dreht die Augen nach innen, dann hat er gleich ein fliegendes Schlüsselbund am Kopf.“
Ich erläuterte die Erziehungsmethode meines Lehrers etwas genauer. „Wisst ihr, er hat dabei eine Zielgenauigkeit, die einfach grandios ist. Einmal hat er meinem Nachbarn ein Auge so angeschlagen, dass der ins Krankenhaus musste. Aber dem Pauker haben wir es später besorgt, darauf könnt ihr euch verlassen.
„Mensch Alfred, döse nicht“, zischte ihm sein Vordermann zu. Sie waren inzwischen auf dem Exerzierplatz angekommen. Er hatte das Kommando „Halt!“ überhört und den Vordermann fast umgerannt.
*
Die Brücke
Eine Ansammlung von Menschen stand an der Brücke, überwiegend Frauen und Kinder. Eine prächtige Stahlkonstruktion, diese Brücke, die den breiten Strom überspannte. Die Natur im Januar 1945 grub sich in die Knochen, durchdrang die dicke Kleidung, verhinderte Gedanken und verhalf zu springenden, schüttelnden Bewegungen. Die Unkenntlichkeit in dieser Vermummung ließ nur die Nebenstehenden erkennen, die sich kannten aus den in dieser Straße stehenden Häusern.
Die kleinen, schwer beladenen Panjewagen, bespannt mit Pferden, deren pflasterschlagenden Hufe die Brücke in stoßweise Schwingungen versetzte. Die Kutscher der Gespanne trieben mit Peitschenschlägen die erschöpften Tiere an. Mit Gesichtern, denen Eiszapfen an den Nasen und Bärten hingen, ausgemergelt und mit letzten Kraftreserven. Die Köpfe bedeckt mit Kopfschützern, in Kriegszeiten zu Hause gestrickt für die Männer an der Front, die jetzt auf sie zukam. Sie flohen vor einem Feind, dessen Gräueltaten als Antwort auf diejenigen der eigenen Soldaten folgten.
Aus den Bewegungen der an der Brücke Stehenden ließ sich die Angst ablesen, die diese Fuhrwerke bei ihnen auslösten. Der Fluss war zugefroren, die Lastkähne im Hafen, die Fischer und Transportschiffer in verdienter Ruhestellung. Sie blieben in ihren kleinwinkeligen Häusern, sonst nur Reparaturen sommerlicher Schäden an ihren Kähnen ausführend.
Der zugefrorene Fluss erahnte nur das fröhliche sommerliche Badetreiben am herrlichen Sandstrand. Kinderkreischen, die Rufe der besorgten Mütter, das Begrüßen der vorbeifahrenden Kähne. Bewunderung den todesmutigen Springern gegenüber, die vom obersten Stahlgerüst der Brücke in den Fluss sprangen und mit lautem Klatschen die Wasseroberfläche berührten. Die eintauchten und in seltenen Fällen bei Niedrigwasser mit dem Kopf den Flussboden erreichten.
Ein Trupp Soldaten rannte, mit Kabeltrommeln und Kisten beladen, entgegen der Fluchtrichtung der über die Brücke kommenden Gespanne. Sie verhedderten sich ineinander, fluchten und drängten zum Brückenrand, den Trupp vorbeilassend. Der fluchende Sprachenausdruck deutete an, diese Leute kamen von weit her. Die Soldaten in Winteruniform, ausgestattet mit dicken Mützen und Handschuhen, schleppten ihre Lasten zum Brückenende. Mit Gesichtern, die ängstliche Eile ausdrückten. Der dampfende Atem aus aufgeblähten Nasen gefror in kleinen Tropfen vor ihren Mündern, blieb in den Bärten hängen.
Hinterherhastend blieb ich dann keuchend stehen, hielt mich am Geländer der Brücke fest und starrte durch die Absperrung der Brückenstäbe auf den Fluss. Die Eisschollen trieben nach der vorherigen Sprengung um die Brückenpfeiler, sie konnten jetzt in diesen Stückgrößen die Pfeiler nicht wegreißen. Meine Augen wurden müde, sie schauten ins Nichts.
Mein Vater schwamm zusammen mit einigen Männern auf einer Eisscholle. Die Erkennungsmarken hingen vor ihrer Brust, als einziges Zeichen ihrer Existenz, teilbar, dessen eine Hälfte die Heimat erreicht, um ihren Tod zu dokumentieren. Ihre Gesichter zeigten sich fröhlich, lächelnd, ohne Todesahnung. Auf der Brust trugen sie diesen letzten Daseinsnachweis, doch dieser gab keine Aussage ihrer Ängste, Sorgen und Kämpfe, der Leiden ihres Unterganges. Ein Stück Blech nur, das irgendwann von irgendwem entzweigebrochen, als letztes Lebenszeichen galt.
Nun, es würde schon nichts passieren,
verpflichtet zum Lächeln,
mein Ende wird in keiner Ermordung,
anonym verscharrt,
irgendwo, sein.
Einige der Männer hatten einen bunten Streifen in den Knopflöchern, der auf der Eisscholle abgelegten Uniformen, als Zeichen dessen, anderen dasjenige angetan zu haben, was ihnen nun bevorstand.
Unter meinen Füßen dröhnten Kommandos, meine Augen streiften die Eisschollen. Ich beugte mich weit vornüber, hielt mich an den Gitterstäben der Brücke fest. Nahm Hände wahr, die surrend aus der Trommel Kabel herauszogen. Unter mir der Brückenpfeiler, der teilnahmslos die Kletterei, das Verzurren der Kabel an den Übergängen zum Stahlgerüst erduldete, ohne zu erahnen, dass das Dynamit den Pfeiler missbrauchte, an das nun die blanken Enden der Zündkabel gelegt werden.
Strabunzebeutel, unter diesem Namen ihn jeder in der Stadt kannte, wohnte im Ochsenkopp, dem ehemaligen Gefängnis, welches später zu einem Wohnhaus umgebaut wurde. Der Mann, für Späße immer aufgelegt, ließ in der Stadt verlauten: „Morgen um 8.00 Uhr wird die Brücke gesprengt.“
Obwohl niemand daran zweifelte, dass dies nicht passieren würde, ergab sich ein gewaltiger Menschenauflauf mit entsprechender Polizeipräsenz um die Brücke. Eine Viertelstunde nach 8.00 Uhr tauchte dann Strabunzebeutel auf, barfuß in alten Hosen und mit einer Gießkanne in der Hand. Er ging über die Brücke und sprengte die Straße. Die Polizei verstand diesen Spaß nicht und führte ihn wegen groben Unfugs ab.
Langsam ging ich zur unruhig am Brückenanfang stehenden Gruppe. Die Wagenkolonne riss nicht ab, sie ergoss sich weiter die Straße entlang. Vorbei an den Häuserzeilen, ohne ein jegliches Ziel vor Augen.
Der Todeskampf spielte sich ganz weit hinter der flussüberspannenden Stahlkonstruktion ab. Weitab der Luft- und Nebelschichten, die aufgerichtet waren in Kolonnen, mit unbestimmtem Ziel. Dazwischen Dörfer, Städte, Häuser, Straßen. Auch Menschen, die gequält, geschunden, vergewaltigt wurden. Wer hat das Recht dazu und nimmt sich dies heraus? Etwa der Mensch mit seinen Obrigkeitszwängen und Machtängsten?
Es ist Sommer, ich laufe die lange Straße, mit nackten klatschenden Füssen. Renne schnell, die Sohlen brennen auf dem aufgeheizten Asphalt, dann die Brücke entlang. Heiße Luft flimmert an meinem Kopf vorbei, die Füße erzwingen das Brückenende.
Ich stürze mich auf den sonnenheißen Badestrand, der neben dem Brückenpfeiler kühl und weich ist. Einige Minute bleiben zum Verweilen, um den Atem zu beruhigen. Die Buhnen, weit in den Fluss ragend zum Schutz der Flussränder. Sie empfinden das Gurgeln des Wassers, das ihre Kanten streift und an den Köpfen vorbeischießt.
Eine Zeit lang stehe ich mit erhobenem Kopf, sehe dem Spiel des Wassers zu. Sauge den Geruch nach altem Öl und fortgetragenem Schlamm, der an meinem Gesicht vorbeizieht, ein. Ich fühle mich wohl an diesem Generationenort.
Die Hitze treibt mich in das dunkle Wasser, das hier nicht so tief ist. Schwimmen ist noch keine Schulpflicht, lässt mich auf den alten Strom vertrauen, mich bis zum Hals die Tiefe ausmessen. Bei diesem Pegel erlaube ich mir einige Schritte längs des Flusses, um dann den Rückzug anzutreten. Die Nähe der Buhne, die ich erreicht habe, bringt mich in ein Loch, das dort üblicherweise durch Strudel an den Stellen herausgedreht worden war, von mir jedoch keine Beachtung fand. Mit aller Kraft schon unter Wasser gezogen, erreiche ich den Rand des Strudelloches und strebe voller Angst dem Ufer zu
Der Wagenzug schwoll weiter, bewegte sich schneller in Kenntnis der Dynamitladung an den Brückenpfeilern. Unter den Menschen am Anfang der Brücke entdeckte ich meinen Freund Karl, dick vermummt mit roter Nase, ohne Gesicht. Nicht zu erkennen, was er dachte. Wir trampelten und schlugen, Erwärmung erwartend, die Arme um unsere Körper. Die Schulen öffneten nur noch für die Flüchtlinge in ihren Panjewagen. Unsere damit errungene Freiheit stimmte uns diesmal nicht auf Ausflüge, Spiele oder Dummheiten ein.
Der aufkommende Abend erstarrte die Sterne, der Mond sah wie immer ungerührt dem Menschenchaos zu. Er war es gewohnt, alles in gleicher Weise zu betrachten. Bei Liebespaaren sein Licht fröhlicher zu senden, bedeutete das nur, ihren Gefühlen Romantik zu suggerieren. Er schickte uns nach Hause. Die anderen zerstreuten sich und gingen durchgefroren, mit hängenden Schultern, unruhig in ihre Häuser und Wohnungen.
*
Eine unfreiwillige Wanderung
Die Kälte fraß sich in die Fenster. Von einem Vogelfutterhaus durchbrochen eine Scheibe, bizarre Eisblumen bildend am Doppelfenster. Zwischen diesen ein Kaninchenbraten, der einfror, Ersatz für einen Kühlschrank. Der Kanarienvogel saß aufgeplustert im ofenwarmen Zimmer. Ein gehauchtes Guckloch, Ziel eines Auges in die Welt da draußen, nahm das Spiel zweier Hunde wahr, denen das Wirbeln der Schneeflocken die Kälte vergessen ließ. Die Mutter schaufelte Steinkohlen, an denen ich als Kleinkind knabberte, in das hungrige Loch der Kochmaschine.