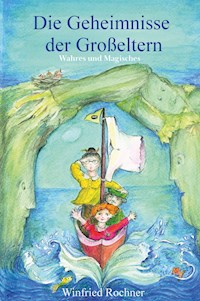8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herzsprung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die Sammelleidenschaft mancher Landsleute trieb schon die wunderlichsten Blüten. Einen ganz besonderen Sammler erkannte ich in einem meiner Studienfreunde. Der Mann sammelte Erlebnisse mit Frauen. Er, ein gut aussehender Bursche mit kurzem Haarschopf, kräftiger trainierter Figur, konnte die erotischen Gefühle der ... Winfried Rochner beschreibt in seinen skurrilen Geschichten den Alltag all der Menschen um uns herum. Keine noch so brisante Situation wird verschleiert, sondern genüsslich ausgebreitet. Der bekannte Politiker oder Künstler wird ebenso wenig verschont wie der normale Bürger in seinem täglichen Leben. Ein besonderer Lesespaß, der keinen unberührt lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
o
Das Knie trifft nicht die Magengrube
Skurrile Geschichten aus dem Würfelbecher
Winfried Rochner
o
Impressum
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet - www.herzsprung-verlag.de
© 2022 – Herzsprung-Verlag GbR
Mühlstr. 10, 88085 Langenargen
Alle Rechte vorbehalten. Taschenbuchauflage erschienen 2022.
Cover gestaltet von © Jane Gebert
Lektorat + Herstellung: CAT creativ - www.cat-creativ.at
ISBN: 978-3-98627-032-2 - Taschenbuch
ISBN: 978-3-98627-033-9- E-Book
*
Inhalt
Fernsehgrößen
Arztbesuche im ländlichen Raum
Orchesterspiele
Wohnungssuche in der Großstadt
Sprücheklopfer
Nachhaltiges aber teuer
Ein hervorragender Großstadtsenat
Nachbarschaftshilfe in Russland
Das Jüngste Gericht
Ein starkes Stück Theater
Im Kaufrausch
Der Fußballschiedsrichter
Die Arbeitsfreunde kommen
Die Preußen sind noch da
Meine Nachbarin
Der fröhliche Autocrash
Die große Tierliebe
Die Wahl
Der Staatsstreich
Wichtiges Länderspiel
Eulenspiegel tritt im Bundestag auf
Schulische Lernmethoden
Die Entführung
Kniefälligkeiten
Die Modedame
Körperliche Dienstleistungen
Sammelleidenschaft
Der Klimagipfel
Es rechnet sich nicht
Das Messie-Syndrom
*
Fernsehgrößen
Das Fernsehen – eine Quelle schmeichelhafter Äußerungen. Die vielen Programme – von dessen Inhalt gar nicht erst zu reden. Jeder darauf Angesprochene gab eine andere Antwort über die Anzahl der Programme, deren Inhalte und die Farbe des Bildes. Danach gab es keine klaren Ergebnisse von den Befragten meines Freundes- und Bekanntenkreises sowie zufälliger Gesprächspartner. Hierzu ergab sich nichts Konkretes.
Mein Freund Wadim Buchner meinte, dass die Unterhaltung per Bildschirm Vorrang hätte, denn dieser Schirm sei kein Rettungsschirm für haltlos Fallende und kein Schirmpilz für Verstecke kleiner Leute. Selbst als Regenschirm wäre er nur bedingt nutzbar, denn im Regen stehen nur jene, die auf den Schirm glotzen und sich maximal die Augen dabei verderben. Wadims Leichtsinn ging so weit, zu unterschiedlichen Tageszeiten den elektrischen Strom zu bitten, den Schirm zu erleuchten. Sein Finger an der Fernbedienungshand drückte in eine Richtung alle aufleuchtenden Zahlen, die – mit den entsprechenden Programmen liiert – diese prompt hergaben.
Einzelschicksale, Liebesnöte, Familiendramen, Gerichtsbeschlüsse, Sportsendungen, die sich überwiegend auf den Fußball orientierten, desgleichen wüste Mordorgien mit für ihn völlig unbekannten Personen nötigten ihm jedes Mal einen Viertelliter Tränen ab, die er durch einen möglichen Flüssigkeitsnachschub ersetzen musste. Zwischendurch verwechselte er die Flaschen und lag dann besinnungslos neben dem Fernsehapparat.
Sein Erinnerungsvermögen gab später nichts mehr heraus, und er bekam das Gefühl, einige Gehirnverkettungen verloren zu haben. Zwei Tage später verweigerte der Finger seiner rechten Hand den Gehorsam, den Einschaltknopf am Fernsehschalter zu bewegen und den Fernsehbedienungsknopf für die Programme systematisch zu drücken. Sein Jubel darüber stellte sich verhalten ein. Eine Woche später begann er mit dem alten Spielchen – Fernseher an. Bei den Krimiserien, die nunmehr jeden Abend weit bis in die Mitternachtsstunden folgten, legten der Schusswechsel, die blutigen Messerstiche und andere scheußliche kriminelle Handlungen meinen Freund Wadim ins Koma und bescherten ihm einige Tage Freizeit.
Eines Tages sprach er mich an: „Weißt du, Uwe, ich kann keinen Blick mehr auf den Bildschirm richten. Ich habe Angst, dass meine Gesundheit und meine Verbindungen im Gehirn darunter leiden.“
„Ach was, Wadim Buchner, mein Freund, das richtige Leben findet in den Comedy-Serien statt. Alles andere sind Kulissen, rote Farbe und eine gewissenhafte Arbeit von Realisatoren, um aus Schauspielern Verletzte und Leichen zu präparieren. Heute aber ist ein wundervolles Programm zu erleben, Prominente im Container, das musst du einfach sehen, nein, erleben. Das Spektakel spielt in einem herrlich ausgestatteten Haus (alles Kulisse) mit Prominenten, die sich pausenlos vollblödeln. Ein dicker Mann namens Holtz auf der Heide und ein kleiner vertrockneter, Rudi der Schlichte, sind die Moderatoren, die vor diesem Hause sitzen. Endlich fand das Fernsehen einen richtig hässlichen Vogel auf dem Bildschirm und nicht wieder die üblichen männlichen Männer, denen die Künstlichkeit aus allen Poren tropft, von dem Kleinen mal ganz abgesehen. Die Serie kommt jede Woche regelmäßig, und wir können uns dann darüber unterhalten. Ja, wir setzen uns beide vor den Fernsehapparat bei mir zu Hause und können den Spaß so echt genießen.“
Am nächsten Tag kam Wadim zu mir, und wir starren gespannt auf den Bildschirm. Ein fetter Kerl in rosa Kleidern mit einer hohen Mütze auf dem Kopf, der sich in einem Sessel vor dem Haus rekelte, begrüßte all die Weiblein und Männlein, die vor dem Containerhaus eintrafen, und vielleicht auch die Bildschirmgucker.
„Hallo Leute, scheiße, dass ihr schon hier seid, ich musste noch den letzten Promi in die Kiste bringen“, gab er von sich, und das alles in einem verballhornten Berliner Dialekt, der schnell auf die Herkunft dieses Monsters schließen ließ. Der kleine dünne Mitmoderator artikulierte ein erkenntliches Hochdeutsch, dafür jedoch pausenlos, ohne zwischen den Sätzen Luft zu holen. Ein erstaunliches Phänomen für mich. Der Inhalt dieser Reden passte hervorragend zu den Prominenten im Big-Brother-Container. Die Spannung wuchs bei den Reden dieser Moderatoren.
Der Dicke zu einem Neuankömmling: „Endlich bist du da, trotz der vielen Termine konntest du dich für uns freimachen, und nun ist deine Großmutter krank. Selbstverständlich musst du dich um sie kümmern und zurückgehen. Wir werden dich vermissen, liebe Marlene.“
Eine Stimme aus dem All, die über den Prominenten schwebte, gab Anweisungen für ein Spiel, welches über das Verbleiben oder Entlassen aus dem Haus entschied. Beim Ausscheiden nach dem Verlust der Aufgabe kam ein neuer Promi hinzu. Die Stimme ordnete ein Fingerspiel an (für Kinder von 3 Jahren leicht zu bewältigen), und Graben Heinrich weinte, da er es nicht schaffen könnte.
„Fuck you“, heulte eine andere Promili los, „habe keinen Bock auf die Aufgabe.“
„Big Brother ist so ein Schwein und fiese Sau“, ertönte es von Promi Peter, denn sie mussten eklige Fleischstücke und eine krümelig stinkige Substanz runterwürgen.
„Es ist nur zum Abkotzen“, so Promi Greta.
Nach einer angeordneten Schlammdusche folgte: „Scheiße, ich will deinen Rücken nicht einreiben, was habe ich davon!“
„Wichser, Megahammer, dass du endlich von den Drogen runter bist! Sortierst du mit mir das Konfetti bei der nächsten Aufgabe?“
So tönten die Unterhaltungen während der Aufgaben oder in der verbleibenden freien Zeit.
Der dicke Moderator wechselte oft die Kleidung und hatte bald alle Farbschattierungen und Hüte aufgetragen. Manchmal denke ich, dass die Promis, die mir völlig unbekannt sind, sich der Promiskuität widmen und vielleicht dabei die Klappe halten.
Diese hervorragende Unterhaltung am Bildschirm – es ist eine Freude, den unartikulierten Streitereien der Promis zuzuhören. Ich beglückwünsche die Erfinder dieser schon fast authentischen Bilddokumentation über das Verhalten der Prominenten in unserem Lande. All jener Berühmtheiten, die uns mit sprachlichen Ausdrucksformen verwöhnen und damit die Deutsche Kultur auf ein besonderes Niveau heben. Es sind Gott sei Dank 800 Sendungen geplant, wobei ich kaum befürchte, dass nicht genug Promis dafür gefunden werden.
Wirklich Prominente, die jeder auf dem Bildschirm sieht, sind die immer wieder öffentlichkeitsgeilen Politiker. Es dauerte nur einen Wimpernschlag, vielleicht auch noch weniger, da entdeckten die Politiker dieses Promi-Big-Brother-Haus. Eine weitere Möglichkeit, ohne eine persönliche Berührung mit dem Volke, sich diesem zu präsentieren. So auch der Landtagspräsident. Der Bundestagspräsident schaltete sich mit ein und meinte, er könnte so einige, bisher nicht bekannte Bundestagsabgeordnete hier präsentieren. Vielleicht den einen oder anderen abgehalfterte Bundesminister, die noch im Bundestag herumsaßen, still hielten und währenddessen ein weiteres Sprungbrett ansteuerten für eine neue Karriere. Ja, oder einen neuen MDB, der als Hinterbänkler sein tristes Dasein fristete, sinnierte er vor sich hin.
Zuerst entsandte der Senat den Finanzsenator. Ein lustiges Kerlchen voller eigenbrötlerischer Kraft, dem die hohen Schulden des Stadtstaates Berlin hinten vorbeigingen. Der rosa Dicke begrüßte ihn gleich, ohne seine Fettpolster aus dem Sessel zu heben.
„Na, du Flachmann, wie siehst du denn aus in Schlips und Kragen! Hosen runter, haha, und Schlabberlook an, du Flachzange, du wirst det schon machen.“
Der Promi zog ein, und er platzte in eine Diskussion mit Promi Käthe, die eine blaue Nase auswies, da sie eben von Promi Greta eine übergezogen bekam. Nur wegen Promi Peter, den beide haben wollten.
„He, Alter wann druckst du denn endlich große Scheine oder kannst du das nicht, eh? Ich bin pleite nach meinen letzten Gesängen!“, ließ Promi Peter aus dem Hintergrund seine Stimme erschallen.
Inzwischen ertönte die salbungsvolle dunkle Stimme von irgendwoher aus dem All. Eine nächste Aufgabe, die über den Verbleib im Promihaus entscheiden sollte: „Hebt das rechte Bein bis an das linke Ohr, die Arme vorstrecken, nach hinten fallen und lauthals Kuckkuck rufen und das Ganze zehnmal ohne Zeitangabe.“
Nach zwei Tagen schafften Promi Ursel und Käthe die Leibesübung sogar sechsmal, während Promi Peter nur zweimal dieses Kunststück fertigbrachte. Beim letzten Fall konnte er nicht mehr aufstehen, und sein Gesicht nahm eine blau-grüne Farbe an. Der Finanzsenator, an derartige Verrenkungen gewöhnt, erledigte das locker in drei Stunden.
„Hervorragend, ihr vier, das Publikum entscheidet, wer ausziehen muss“, tönte aufs Neue die Stimme von irgendwoher.
Nach zwei Tagen zog der Finanzsenator aus, das Publikum wollte einen Vertreter des Schuldengrabes nicht mehr länger ertragen. Man nahm an, die Stimmen gegen ihn waren getürkt, um als nächsten Vertreter den Oberpartylöwen aus dem Rathaus auszustellen. Ein herziges Kerlchen, dem Berlin förmlich auf den Leib geschrieben stand. Über die versenkten Milliarden und Fehlentscheidungen in seinem Verantwortungsbereich sahen die beiden Empfangskomiteeler großzügig hinweg, die Party konnte beginnen.
Ehe die zwei etwas sagen konnten, krähte er: „Das ist gut so, wo sind die Schlampen, die ich ausführen soll?“
Dem kleinen Empfänger verschlug es glatt die pausenlos quatschende Klappe. Großartig zog der Oberlöwe ein, trank die erste Flasche Sekt leer, um dann die reich gedeckte Tafel zielgerichtet abzuräumen. Nach mehreren kräftigen Rülpsern hielt er eine seiner inhaltsleeren Reden, um anschließend ein neues blendendes Projekt über den Ablauf im Container zu organisieren. Geld spielte für ihn keine Rolle, die Gebührenzahler finanzierten ohnehin alles. Die geheimnisvolle Stimme ließ er ins Leere laufen und saß nach Jahren immer noch im Container, der später, nach zwei Jahren, Konkurs anmelden musste. Der Oberlöwe beantragte flugs einen neuen Kredit, und die Party konnte weitergehen. Da ertönte wieder die mysteriöse Stimme, die er nun nicht mehr ignorieren konnte, mit folgender Aufgabe: „Was ergibt die Wurzel aus Vier?“, deren Antwort er nicht wusste. So flog er in seinen Posten zurück.
Nun endlich konnte der Bundestag den ersten Hinterbänkler entsenden, der bisher still und bescheiden über 37 Jahre im Bundestag saß, niemals auffiel und aus früheren Erfolgen zehrte. Ihn segneten ein wirkungsvolles Greisenalter und eine Zeit, wo er viele ganz unterschiedliche Bundesministerien bekleidete. Er litt an leichter Senilität, konnte jedoch noch seine Gattin und Kinder erkennen. Nur bei einer seiner letzten öffentlichen Reden bemerkten es die Mitglieder des Bundestages. Sie fanden das in Ordnung, denn zu seiner Rente passte bloß das zusätzliche Salair als MDB. Den Container erreichte er mit seinem persönlichen Fahrer. Heinold Reisenzwicker, mit einem ruhigen, sehr langsamen Redefluss ausgestattet, konnte nichts und niemand erschüttern. In Designerkleidung zog er in den Container ein. Der rosarote Dicke konnte ihm nur noch nachrufen: „Eh, Alter, nimm die Fliege ab!“, um nicht als Bestgekleideter zu gelten.
Für ihn gab es eine Sondereinzugsaufgabe. Er sollte alle seine Vorstandsposten aufzählen, aus denen er reichlich Geld bezog, was trotz allen Mühens nicht klappte. Sein Leibarzt, der ständig neben ihm stand, konnte da leider nicht helfen. In Unterhaltungen mit den anderen Promis sollte er über seine Arbeit im Bundestag berichten.
Er schwafelte langsam, mit großer Ausdruckskraft, und irgendwann folgte die Erkenntnis: „Ich weiß nicht mehr so genau, was ich da tue“, und auch bei jedweden weiteren Fragen wiederholte er, „ich weiß nicht mehr so genau, was ich da tue.“
Ein umwerfender Gewinn für die Fernsehzuschauer, die von diesem Greis keine knisternde Erotik erwarten konnten. Die geheimnisvolle Stimme stellte ihn permanent den Zuschauern zur (Ab)wahl. Aber wo sollte der Mann noch hin, er passte perfekt zu den knödelnden Promis, die einer nach dem anderen ab- und neugewählt wurden. Nach der 250. Sendung starb schließlich sein Leibarzt, während Heinold Reisenzwicker den Altersdurchschnitt im Big-Brother-Container weiter hochhielt. Seine Wahlperioden für den Bundestag liefen nach vier Jahren ab, und er wurde in seinem Wahlkreis für weitere vier Jahre gewählt. Danach konnte er sich noch mal ins europäische Parlament mogeln. Nach dem vorzeitigen Ende der Serie von insgesamt 658 weiteren Folgen gab es für Heinold entweder den Posten des Vorsitzenden der Jungen Union oder auch den des Direktors eines Krematoriums. Heinold Reisenzwicker musste sich entscheiden.
*
Arztbesuche im ländlichen Raum
Auf den Dörfern in Deutschland, vor allem dort, wo die jungen Leute auswandern, weil sie Besseres vorhaben, ist der Arztberuf eine Mangelausbildung. Keiner will mehr studieren und wenn, dann geht es nach der Ausbildung ab in die Stadt. Je größer die Stadt und je mehr Ärzte dort vereint sind, desto höher ist der Verdienst. Keiner will jemals wieder ins Dorf zurückkehren, obwohl kostenlose Praxiseinrichtungen angeboten werden. Viele Jugendliche aus den Dörfern schielen dorthin, wo es bessere Bedingungen für sie gibt. Wie zum Beispiel ein höheres Hartz-Salär für Anfänger, weil die Mieten in der Stadt höher liegen und häufigere Partnerwechsel so schön anonym bleiben. Schließlich sieht in einem Dorf jeder, der vorbeikommt, ob die Gardinen an den Fenstern des Nachbars hängen oder bereits neue dort Einzug gehalten haben, ob Opa nun doch die Schuhe des Enkels aufträgt oder ob schon wieder eine neue Mieze beim Nachbarn eingezogen ist. Da die Bewohner in einem Dorf oder zwischen den Nachbardörfern mehr oder weniger untereinander verwandt sind, gehört vor jedem Partnerwechsel ein ordentliches Stammbaumstudium dazu. So will man Erkenntnisse gewinnen, dass dann eine neue Partnerin oder Partner nicht das illegale Kind eines eigenen Vaters ist. Deshalb besser die Landflucht, um zu vermeiden, dass hier nicht – wie bei den Pharaonen üblich – die eigene Schwester geschwängert wird. Folglich werden die Dörfer jugendleer, und die Alten mit ihren Gebrechen sitzen nun alleine in ihren viel zu großen Häusern herum. Die Kinder, die dann noch in den Dörfern leben, stammen von Zuwanderern, die entweder reich genug sind, um vom Durchgebrachten zu leben, oder eben Naturverrückte. Sie alle lieben die wunderbare Landschaft und die Freiheit in der Natur und nehmen gerne längere Wege in Kauf, um gelegentlich einer entfernteren Beschäftigung nachzugehen.
Für die verbliebenen Bewohner all dieser Dörfer gibt es zwei Höhepunkte im laufenden Jahr: Einerseits das Dorffest und die umliegenden Dorffeste (die sämtlich auf die Monate Juli bis Oktober fallen), sodass ein Riesenstress auftritt, sie allesamt zu besuchen. Andererseits die Arztbesuche in der nahe gelegenen kleinen Stadt. Dorthin gelangt man mit dem einmal täglich fahrenden Bus, mit dem Fahrrad oder mit dem Pkw, wenn es denn noch möglich ist. Die Haare schneidet man sich gegenseitig, oder eine schönheitsdurstige Frau bestellt sich ab und zu eine Bekannte oder Freundin, die das Handwerk nach einer jahrelangen Kleinarbeit perfekt beherrscht. In Ausnahmefällen bei Hochzeiten oder hundertjährigem Geburtstag lässt man sich in die Stadt kutschieren.
Für die Alten ist der Arzt in der Stadt ein Muss. Allgemeine praktizierende Ärzte erfahren, zumal es mehrere gibt, hohe Frequenzen. Die drei Fachärzte unterschiedlicher Disziplinen signalisieren in der Regel riesige Wartezeiten.
Mich erwischte einmal das seltene Glück, dass ich meinen rechten Arm nur unter sehr starken Schmerzen bewegen konnte. Ein Bus fuhr um die Zeit eines Arztbesuches nicht in die Stadt, auf das Fahrrad musste ich verzichten, da ich die Handbremse nicht bedienen konnte. Also setzte ich mich ins Auto und bearbeitete alle Fahrhebel mit einem Übergriff der linken Hand. Während dieser Bedienung klemmte ich das Lenkrad zwischen die Knie. Die Stadt erreichte ich mit Schmerzen und schlenkerte zur Arztpraxis. Drei Namen standen in Aluminium schwarz geprägt am Hauseingang, und ich erkannte eine Gemeinschaftspraxis dreier Allgemeinärztinnen. Den Hauseingang durchschritt ich noch ganz hoffnungsvoll und stellte mich an das Ende einer Schlange, die zusätzlich die Treppe bevölkerte und am Tresen der Anmeldung endete. Nach einer Stunde Wartezeit stand ich dann vor einer umwerfend reizenden Schwester, die keinen geschlossenen weißen Kittel trug, sondern ihrer Reize offen zur Schau stellte. Sie sah mich durchdringend und freundlich lächelnd an, sodass mir alle Engel in den Kopf schossen und dann gleich zurück etwas tiefer.
Nach einem anfänglichen Stehplatz setzte ich mich nach einer weiteren halben Stunde auf einen frei werdenden Stuhl im Wartezimmer. Dreißig Patienten bevölkerten den Raum und verursachten einen immerhin erheblichen Geräuschpegel. Ich lauschte der Unterhaltung der mir am nächsten sitzenden zwei Frauen, die nach meiner Schätzung kurz vor ihrem achtzigsten Lebensjahr standen. Sie werteten ihre Rundreise aus, die sie mit ihrem Fahrrad über die skandinavischen Länder geführt hatte. Nun saßen die beiden hier und lachten über eine Begegnung in Finnland, als sie fast mit einem Elch zusammengestoßen wären, der sie beim Radeln überholen wollte, es jedoch nicht schaffte. Dafür streifte aber ein entgegenkommender Elch mit seinem Geweih die Lenkstange von Bertas Rad, um jenem Elch, der sie überholen wollte, auszuweichen. Ihr Lachen unterbrach dann die reizende Schwester vom Empfangstresen, die daraufhin Berta Stadler zur Ärztin Frau Dr. Griesecke rief. Sie blieb eine halbe Stunde im Behandlungszimmer, während ich mich vor Schmerzen hin und her wand. Durch die Tür der behandelnden Ärztin waren laute Unterhaltungsgeräusche und immer wieder lautes Gelächter zu hören. Frau Berta Stadler kam nach dieser schier endlosen Zeit heraus und hielt triumphierend ein Aspirin-Rezept in der Hand. Zu ihrer Reisebegleiterin sprach sie dann: „Frau Schmutzler, jetzt kann ich endlich meine Kopfschmerzen bekämpfen, die mich immer vor dem Einschlafen plagen.“
Beide Frauen saßen danach noch eine längere Zeit beisammen und besprachen ihren nächsten Ausflug, der sie mit dem Fahrrad in die Hauptstadt führen sollte, um ein Rockkonzert der Gruppe „Tim Spaltenscheißer“ zu besuchen.
Staunend sah ich, wie sich in einer Ecke des Warteraumes verschiedene Patienten formierten und ihre Bekleidung auf vorher gezogenen Schnüren aufhingen, die wie Kulissen in einem Theaterstück wirkten. Zwei Großelternpaare mit zusammen vier Enkeln postierten sich und begannen ein Theaterstück einzuüben. Nach längerer Konzentration erkannte ich, dass es sich um ein Krippenspiel handelte. Bis Weihnachten gab die Zeit noch keinen Anlass, solches zu proben. Ein Kind legte sich auf den Boden, wurde mit einer alten Jacke zugedeckt, und ein Großelternpaar mimte Maria und Josef. Die restlichen Kinder liefen als die drei Könige herum. Eine der beiden Großmütter stand mit erhobenen Armen als Engel neben der Maria. Sie schaute sich noch eine Weile suchend im Wartezimmer um und meinte, mit meinem herunterhängenden Arm sei ich zweifellos der richtige Esel für das nun fast vollständige Krippenbild. Gleich ob ich nun wollte oder nicht, wurde ich am Arm hochgezerrt und hinter den Josef gestellt, wobei der übrige Großvater als Hirte neben mir Aufstellung nahm. Weitere Aktionen zur Personalerhöhung gaben die Räumlichkeiten und die wenigen Kulissen nicht her.
Der Engel wies mit großer Geste auf die Krippe und rief theatralisch: „Ein Kind ist uns geboren“, wobei ich nicht verstehen konnte, dass solch alte Leute noch Kinder zeugen konnten.
Die Türen der Ärztinnen öffneten sich dank dieses Lärms, und sie wollten schon den Notdienst alarmieren, um die werdende Mutter in die Klinik überweisen zu lassen. Beim Anblick des Engels jedoch verzogen sie sich wieder in ihre Behandlungsräume.
Von Josef bekam ich von hinten einen Tritt verpasst und musste lauthals: „Iah, iah …“ schreien.
Die drei Könige umrundeten das liegende Enkelkind, und der Hirte brüllte: „Seht, es rührt sich, welch ein Wunder!“
Kurz darauf erschien die reizende Schwester, und der Engel mit dem Krippenkind durfte zu Frau Dr. Schubach, der anderen Ärztin der Gemeinschaftspraxis. Eine Pause trat nun ein, und die übrigen Krippenaktionäre sangen sämtliche Weihnachtslieder, beginnend von Stille Nacht bis Ihr Kinderlein kommet ab. Mein Arm schmerzte schrecklich, und ich setzte mich als Esel vor die Maria, die das gar nicht schicklich fand. Jetzt schrie ich weiterhin „iah, iah“ und immer weiter und weiter, da ich es vor Schmerzen nicht mehr aushielt.
Endlich erbarmte sich eine der drei Ärztinnen und Frau Dr. Straube befahl mit strenger Stimme: „Ausziehen!“
Ich fragte ungläubig: „Alles?“, worauf sie antwortete: „Ja, machen Sie schon.“ Mit höllischen Schmerzen riss ich mir die Sachen vom Leibe. Ich musste mich setzen, und nach der Rachen- und Zungenprobe befand sie, dass alles bestens sei. Nachdem ich sie ungläubig anblickte, meinte sie: „Na, dann drehen Sie sich mal um“, und ging mit ihrer behandschuhten Hand in meine unteren Eingeweide.
Sie verschrieb mir eine kleine Packung Aspirin, da dieser Lärm in ihrem Wartezimmer mir sicher Kopfschmerzen verursacht hätte. Abschließend schlug sie mir noch die Faust in den Rücken wegen der Wirbelsäulenprobe und versuchte meinen Arm zu bewegen. Ich schrie laut auf.
„Ach, das wird sich schon geben, bewegen Sie ihn nur fleißig“, kommentierte sie, verpasste mir eine Beruhigungsspritze und entließ mich aus ihren Fängen.
Die ganze Zeit über begutachtete die hübsche Schwester vom Tresen, die jetzt der Ärztin assistierte, wohlgefällig meine Extremitäten, was aufgrund dieser Schmerzen bei mir nichts mehr auslöste.
Als ich durch die Tür wieder in den Warteraum trat, sah ich einen Mundharmonikaspieler, der seine Mütze mit dem Schild schräg aufgesetzt hatte und eine lockere Weise zum Besten gab. Ich erkannte gleich diesen Sozialhilfeempfänger, der bei einem Musikwettbewerb erster geworden war. Die Schwester schob diesen berühmten Star gleich ins Arztzimmer von Frau Dr. Straube, obwohl er sich heftig dagegen wehrte. Nach einer Viertelstunde kam er als gebrochener Mann zurück und stöhnte, dass er doch nur Reklame für seine nächsten Auftritte mache und nun schon in der fünften Arztpraxis jedes Mal eine Spritze bekäme und deshalb bald nicht mehr laufen könnte. Bevor ich den Warteraum verließ, bemerkte ich noch, wie zwei Alte lauthals Die Glocke von Schiller aufsagten und von den anderen Patienten immer wieder korrigiert wurden. Mit Freuden stellte ich fest, dass diese Praxis einen kulturellen Treffpunkt für Alte und Kinder darstellte und deren Freizeit und Alltag verschönte.
Beim nächsten Mal nehme ich meine Frau mit, und wir werden dann das Theaterstück Eine offene Zweierbeziehung von Dario Fo und Franca Rame aufführen.
*
Orchesterspiele
Ein neuer Tag brach an, die Sonne gab das Letzte her und prasselte unnachgiebig auf den Straßenbeton und natürlich auf die Fußwege. Die Menschen, die dort entlangmarschierten, trugen alle eine Sonnenschutzkopfbedeckung, und manchmal sah die Sonne einen Schirm, der ihre Strahlen abhalten sollte.
Markus Fingerhut, der Erste Geiger in einem Orchester, verließ sein Bett, um Einkäufe zu tätigen. Seine Frau gab ihm einen Einkaufszettel, wo überwiegend Getränke verschiedener Sorten die Mehrheit bildeten. Bei dieser Gluthitze konnte an Getränken niemals genug im Hause sein. Er lief schnell und schnippte nervös mit seinen Geigenfingern. Einige Passanten drehten sich nach ihm um, wobei er meinte, als Erster Orchestergeiger erkannt zu werden. Dieser Irrtum klärte sich frühestens zu Hause rasch auf, als er bemerkte, dass eine Socke über seinen Schuhrand hing. Erkannt zu werden als Orchestergeiger schien fast schon unmöglich, denn er war Mitglied in einem Orchester, das quasi im Keller saß – einem Opernorchester. Ein Teil der Musiker saß mit freiem Blick nach oben in ihren Stühlen, während der andere Teil die Bühnendecke über sich hatte und somit das Stampfen der Balletttänzer dumpf vernahm. Der Dirigent hingegen konnte den Blick schweifen lassen zu seinen Musikern, auf die Opernakteure und zum Schluss beim Verneigen auf das Publikum. Sein Kopf ragte nur so weit aus dem Keller, dass manche annahmen, er habe keinen Unterleib. Das änderte sich erst dann, wenn er nach dem Ende der Vorstellung auf die Bühne zum Verneigen durfte. Die Arbeitszeit aller Opernakteure richtete sich sowohl nach der Länge der Oper, nach dem Applausbedarf des Publikums und der Eitelkeit einzelner Sänger bei Bravorufen und anschließend erfolgten Wiederholungen. Diese Sänger schritten dann mit hoch erhobener Nase aus dem Operngebäude. Die Orchestermitglieder galten als fleißige Arbeiter ohne besondere Allürenbezeugung. Es sähe wohl auch komisch aus, wenn Markus Fingerhut aus dem Keller auf die Bühne geklettert oder gar wie Phönix durch eine Plattform auf der Bühne langsam aufgetaucht wäre und seine Geige hochgehalten hätte. Manchmal überlegte er, ob er nicht doch einmal die Plattform benutzte und die göttlichen Stimmen auffordern würde, die Töne richtig zu treffen.
Es boten sich doch die vielfältigsten Abwechslungen im Keller während einer Opernaufführung. Am schlimmsten erging es den Orchestermusikern bei den langen Wagneropern. Der schier unerträgliche Lärm trug schon während der Vorstellung manchen Musiker mit geplatztem Trommelfell aus dem Keller. Alle litten unter starken Hörschäden, und sie erahnten öfter nur an den Armbewegungen des Dirigenten, an welcher Stelle der Oper sie sich gerade befanden. Ansonsten gab es nichts Schöneres als Musiker im Orchesterkeller zu leben. Für einige von ihnen war während der Opernaufführung keine Vollbeschäftigung gegeben. So hatte der Schlagzeuger nur ein kurzes Arbeitsdebüt. Der Triangelspieler schlug während des ganzen Abends nur drei Schläge an sein Instrument. In seiner freien Zeit spazierte er durch die Reihen der Musiker und nahm Bestellungen für einen Einkauf entgegen. Das Ganze ging über Lebensmittelkäufe für das Abendbrot der Familien bis zum Schlips für die Beerdigung des Onkels. Fabian Gutknecht, der Triangelspieler, erhielt sogar einmal vom Posaunisten den fragwürdigen Auftrag, einen Satz Kondome zu kaufen, da dieser gleich nach der Vorstellung seine Freundin besuchen musste, weil deren Mann an besagtem Abend in der Kneipe saß. Bei dieser Hitze rannte einer der Zweiten Geigen ständig in die Spätverkaufsstelle, um Getränke zu besorgen. Schwierig stellte sich die unmittelbare Getränkeversorgung des Dirigenten dar. Ihm wurde eine flache Flasche unter das Oberhemd praktiziert. Sobald er dann mit äußerster Hingabe und tief gebeugtem Kopfe seine Arme kreisen ließ, nahm er immer einen Schluck aus dem verdeckten Strohhalm seiner Flasche. Schwierig gestaltete sich bei längeren Opern der Getränkenachschub. Hier wurde durch den Flaschenboden zu einem Rückschlagventil ein Schlauch gezogen, welcher schließlich beim Zweiten Hornbläser endete, der wiederum mit einer Pumpe für Getränkenachschub sorgte. Einmal unterlief ihm jedoch ein folgenreiches Missgeschick, indem er die Flaschen vertauscht hatte, sodass eine Ladung Kognak beim Dirigenten landete. Nach dem letzen Applaus auf der Bühne umarmte und küsste der angeheiterte Maestro dauernd die Blumenfee, trug sie dann auf seinen Armen davon und wollte sie mit nach Hause nehmen.
Die Damen des Orchesters verbreiteten ein ständig sehr beunruhigendes Gefühl. Besonders Vanessa Trickler, eine reizende Brünette, erfreute sich während der Vorstellung zunehmendem Interesse mehrerer Orchesterherren. Sie blies brillant die Querflöte und verschwand während ihrer Flötenpausen mit dem Ersten Trompeter durch die Kellertür des Orchesters und kam zu ihrem Einsatz völlig aufgelöst zurück. Ihre Querflöte brachte sie wieder mit. Der Erste Trompeter hatte sich von dem Zweiten Trompeter vertreten lassen. Der Fagottist, Herr Alexander Hasentreter, wollte in einer gemeinsamen Bläserpause das Zusammenspiel von Querflöte und Fagott probieren, was ihm jedoch nur einmal gelang, da sie beim zweiten Mal die Querflöte mit sich hatte, er aber sein Fagott vergaß. Mangelnde Pausen beklagten die Streicher wie Geiger, Bratscher und Cellisten. In ihren knappen Notenpausen malten sie sich lustige Männeken auf die Noten. Der Erste Klarinettist bestellte sogar einen seiner Schüler hinter die Bühne, um ihm Unterricht zu erteilen, sodass er quasi als Doppelverdiener auftrat. Unter dem nennenswerten Vorsatz, diesem Schüler den richtigen Anreiz zu geben, ließ er ihn an seiner Stelle einige Passagen im Orchester mitspielen. Der Erste Trompeter versuchte es ebenfalls, nur drang der Übungslärm dann bis zum Publikum im Zuschauerraum. Was dazu führte, dass er vom Dirigenten eine Abmahnung bekam.
Der Dirigent des Orchesters, Generalmusikdirektor Herr Adam Flammers, ein sehr sportlicher Mann, verbesserte seine Fitness mit dem Expander, den er jeden Morgen und Abend kräftig zog, und mit ausgiebigen Waldläufen im nahe gelegenen Forst. Seine Armbewegungen, das Einknicken der Knie und die Seitwärtsbewegungen beim Dirigieren mussten stets flüssig und locker daherkommen. Eine Oper von sechs Stunden Dauer verlangte ausreichende Kondition. Seine familiären Aufgaben hielten sich in Grenzen. Um nicht ganz aus dieser Übung zu kommen und damit sein Training etwas zu verbinden, schwang er seine neugeborene Tochter öfter auf seinen Dirigentenarmen. Mit dem Ergebnis, dass die Kleine dann in einen doppelten Überschlag geriet. Nur die geistesgegenwärtige Oma konnte das Baby noch auffangen. Seitdem konzentriert sich Adam Flammers ausschließlich auf seine Arbeit im Orchester. Durch sein regelmäßiges Konditionstraining erlitt er an der linken Schulter einen Bänderriss, der ihm den linken Arm fast lahm legte. Die Auswirkungen auf den Klang des Orchesters durch sein behindertes Dirigat waren enorm. Mit dem Schwingen seiner rechten Hand (Stabhand) erhöhte das Orchester – die Kontrabässe, Cellis und Bläser – den Klang überdimensional, während er mit der fast unbewegten linken Hand bei den Geigern und Holzbläsern kaum einen Ton hervorbrachte. Die Gesangssolisten und der Chor, äußerst irritiert, klangen noch schräger als sonst. Wagner wurde noch unverständlicher, und die Mozartopern gerieten zu panischen Aufführungen. Völlig überraschend danach für alle die Kritiken. Sie überschlugen sich in Lobeshymnen in Presse, Fernsehen und Radio über die völlig neue Interpretation der Werke. Es hagelte Preise und Ehrungen. So erhielt das Orchester die Goldene Eiche für seine bodenständige Ausdruckskraft. Für das Gesamtwerk der Interpretationen folgten das Bundesverdienstkreuz am bunten Wimpel und die Gelbe Rübe für die gelungenste Fernsehaufnahme. Der Dirigent erhielt obendrein noch den Goldenen Schuh für seine furchtlosen Auftritte. Generalmusikdirektor Adam Flammers achtete nun sehr pedantisch darauf, dass sein Bänderriss auch weiterhin einer blieb.
Die Erfolge des Orchesters sprachen sich im Ausland herum, und es hagelte Gastspielangebote in vielen Ländern. Ungeahnte Möglichkeiten taten sich für alle auf. Um einen Überblick und eine regelrechte Organisation für die Notenpausen zu schaffen, beschlossen die Orchestermitglieder nun einen Verein zu gründen – und zwar „Orchesterfreiheit e. V.“. Den Vorsitz übernahm der Triangelspieler Fabian Gutknecht. Sämtliche Musiker des Orchesters wurden Mitglieder, allein der Dirigent sperrte sich. Das Statut sah lediglich vor, die Freizeit während der Opernaufführungen und Orchesterproben zu organisieren und zu nutzen. Vanessa Trickler, inzwischen zur Zweiten Vorsitzenden gewählt, erhoffte sich im Ausland größere Erfolge mit ihrer Querflöte. Die restlichen Vorstandsposten erhielten die Streicher und eine Kontrabassistin. Der Fagottist Alexander Hasentreter wollte unbedingt mit in den Vorstand, er wurde jedoch als zu unzuverlässig – von der Querflötistin begründet – abgelehnt. Sie dachte dabei an sein vergessenes Fagott.
Die ersten Einsätze im Ausland konnte das Orchester als Riesenerfolg verbuchen, nur der Verein kam mit Schwierigkeiten über die erste Hürde. Der Einkauf verlief nicht optimal, da die Sprache des Landes sich als hinderlich darstellte. Sie saßen bei ihren Sonderkonzerten nicht mehr im Keller, sondern auf der Bühne, also ein weiteres Handicap, den Verein wirksam werden zu lassen. Ein Dolmetscher musste her, desgleichen ein verdeckter Einkäufer. Der Vorsitzende, Herr Gutknecht, hatte wichtigere Aufgaben zu lösen, auch seine Körpergröße überragte die anderen Musiker – vor allem beim Sitzen. Die Freizeitpläne aus den Noten für jede Stimme stellte erst er zusammen und danach jedes Mal ein neuer Ermittler und Einkäufer. Nach langem Hin und Her kam nur einer infrage, der die Einkäufe aufnahm, durchführte und wieder ausgab. Die Entscheidung traf den Notenwart, Herrn Uwe Wittlich, der nur 1,42 Meter Körpergröße maß und ohne Sicht auf Knien die Reihen während des Konzertes durchstreifen konnte. Währenddessen lernte er noch die wichtigsten Vokabeln der jeweiligen Landessprache und avancierte zum unentbehrlichsten Mann im Orchester. Alles klappte hervorragend, nur die Instrumentenschüler der einzelnen Orchestermitglieder konnten im Ausland nicht unterrichtet werden und auch während des Konzertes ihre Lehrer nicht unterstützen. Das zusätzliche Unterrichtsgeld fiel weg, und einige Musiker konnten ihr zweites Leben nicht bestreiten und ausleben. Vanessa Trickler hatte die kurzen Abstecher während der Notenpausen hinter der Bühne satt, und sie hielt ernsthaft Ausschau nach etwas Festem. Seit zwei Jahren reiste dem Konzertbetrieb ein alter Japaner hinterher. Er starrte Vanessa immer ungebührlich an und machte ständig so komische Hüftbewegungen, die ihr wohlbekannt vorkamen. Einmal stellte sie den alten Herrn in einer größeren Pause zur Rede. Er machte ihr sofort einen Heiratsantrag, und da sie sich vorher schon über seine finanziellen Mittel erkundigt hatte, stimmte sie sofort zu und heiratete ihn nach dem Konzert.
Ein Zwischenfall ist doch noch während eines Konzertes passiert, bei der Kontrabassistin Milena Jurkowitsch setzten während eines Konzertes – allerdings wieder im Keller – die Wehen ein. Bei ihrer strammen Figur bemerkte keiner der Musiker etwas von ihrer Schwangerschaft, nur der Dirigent wusste Bescheid. Das kurz danach Neugeborene passte mit seinem Geschrei vortrefflich zur Aufführung einer Wagneroper aus dem Nibelungenzyklus.
*
Wohnungssuche in der Großstadt
Nachdem alle noch bewohnbaren Plattenbauten abgerissen waren und viele Menschen in den Speckgürtel von Berlin zogen, stellte sich bald wieder eine Rückwärtsbewegung aus dem Speckgürtel und dem weiteren Umfeld ein. Die noch verfügbaren Wohnungen wurden knapp, und die Mietpreise schossen dank der Marktwirtschaft (Wechselspiel von Angebot und Nachfrage) in die Höhe. Der Senat reagierte wie üblich hilflos und brach dann in eine hektische Betriebsamkeit aus im Glauben, irgendetwas versäumt zu haben und dieses nachholen zu müssen. Vor Jahren schon waren alle kommunalen Sozialwohnungen „vorausschauend“ an private Anbieter verkauft worden, die jetzt ihr Schnäppchen sahen und die Mietpreise von Tag zu Tag rapide in die Höhe trieben. Die zuständigen Amtsträger arbeiteten dabei an diesem Problem, entweder die Mieten zu deckeln oder den Wohnungsbau voranzutreiben, weiter mit sehr ruhiger Hand. Halsstarrig widerstanden sie der Politik, die immer wieder mit dem wählenden Postenerhalt in Hahnenkämpfe verstrickt, den Beamten ihren ruhigen Lauf ließen.
Mein Freund Karli, der nach wie vor bei seinen Eltern wohnte, fand es nicht mehr schick, den längeren Reden, Wünschen und gelegentlichen Verboten seiner Erzeuger zu lauschen und das alles zu befolgen. Kurzerhand verkündete er eines Tages, ausziehen zu wollen und der elterlichen Fürsorge zu entwischen. Er versuchte bei einer passenden Wohngemeinschaft seine Füße unter deren Tisch zu stecken. Bei mir konnte er nicht landen, denn ich wohnte noch bei den Alten, die mich rundherum bedienten und mir keinerlei Anlass boten, daran etwas zu ändern.
Also schaltete er das Internet in die Suche nach einer passenden Wohngemeinschaft ein und klapperte diese systematisch ab. Nach einem Jahr intensiver Suche und diversen Vorstellungen bei den einzelnen Gemeinschaften passte ihm alles nicht so richtig. In der einen Wohngemeinschaft schauten zu wenig hübsche Miezen aus den Zimmern, bei den nächsten gefielen ihm die zu leistenden finanziellen Beiträge nicht, und die restlichen verfügten über schlecht geputzte Schuhe oder eine verkeimte Dusche und ein stark riechendes Klo. Karli fiel es daraufhin ein, sich selbst um eine eigene Wohnung zu bemühen. Er studierte die Zeitungsanzeigen und rannte zu jedem Treff, den verschiedene Makler als Besichtigung anboten.
Beim ersten Besichtigungstermin fand sich Karli am unteren Ende einer Menschenschlange von dreißig Personen auf einer Treppe wieder. Nach drei Stunden endlosen Wartens stand er vor der Wohnungstür und einem unfreundlichen Makler. Er sah sich die Wohnung unter Vorbehalt an und ließ sich in die Liste eintragen, auf der schon zwanzig Namen von Leuten standen, die sämtlich diese Wohnung haben wollten. Ein Name stand da, dessen Träger es sich noch überlegen wollte. Karli ging betreten nach Hause und meinte, dass die Wohnung seiner Eltern soo schlecht gar nicht sei. Er ließ jedoch nicht locker und vereinbarte mit Herrn Kronenfeld noch weitere zehn Besichtigungstermine. Es lief immer das gleiche Prozedere bei den Besichtigungen ab. Ausgenommen Wohnungen wie Suiten mit Dachgarten und totaler Stadtansicht, die nur sehr wenig Bewerber nachwiesen. Dort gab es eine detailgetreue Besichtigung mit allen möglichen und unmöglichen Angaben. Diese Wohnungen lagen außerhalb der Bezahlbarkeit normaler Verdiener. Bei denen wäre nach vierundzwanzig Monaten Miete auch eine Eigentumswohnung bezahlt.
Der Zeitverlust, den Karli bei diesen ständigen Besichtigungen erlitt, ließ ihn sein Studium der Rechtswissenschaften hinwerfen. Er hinkte in allen Prüfungen weit hinterher. Nun, da er Zeit nach dem Studiumende gewann und die Eltern ihn weiter versorgten, ging er den Ursachen dieser Wohnungsmisere nach. Schnell erkannte er, dass hier der Senat schuldig zu machen sei. Die bereits ausgebrochene Hektik bei den Beamten (wenn man weiß, wie Beamte ticken) erklärte ihm dieses. Er ging zum Bauverantwortlichen des Senats, Herrn Dr. Knoblich, der momentan von einem Herrn Weißmüller vertreten wurde. Herr Dr. Knoblich befand sich auf einer längeren Dienstreise in Afrika, um dort die Bauvorhaben und deren Technik beim Wohnungsaufbau im Urwald zu studieren. Karli kam mit dem Vertreter nicht gut voran, und er erfuhr, dass bald eine Bauberatung mit allen teilnehmenden Senatsverantwortlichen sowie dem Beamtenapparat stattfinden sollte, wo man über das Wohnungsbauproblem in der Hauptstadt beraten würde. Karli ging zu dieser Beratung einfach hin, es fiel auch gar nicht auf, dass er nicht dazugehörte. Ein unerhörter, nicht enden wollender Streit entbrannte über das Für und Wider des Bauens oder Nicht-Bauens – und wenn ja, wer bezahlte den ganzen Ramsch?
Karli stellte ein gut durchdachtes, zwingendes Konzept über einen schnellen und ausreichend finanzierten sozialen Wohnungsbau in der Hauptstadt vor. Ein jeder spendete Beifall, und ohne weitere Debatte nahmen alle Teilnehmer dieses Konzept an. Ja, selbst die Beamten, da sie weniger Arbeit für sich befürchteten. Dr. Knoblich, der in Afrika weilte, musste dieses Konzept unterschreiben, weil es sonst nicht wirksam wurde. Eine Kommunikation mit Dr. Knoblich (da noch kein Internet im Busch) gestaltete sich sehr schwierig. Nach langem Suchen fand man in einem Asylbewerberheim endlich einen Afrikaner, der die Trommelkommunikation beherrschte und bis zur nächstgelegenen Großstadt seine Signale über ein Telefon nach Afrika senden konnte. Von dort aus ergriffen dann verwandte Buschmänner diese Botschaft und trommelten sie bis zu Dr. Knoblich. Handys funktionierten im Busch nicht, da es keine Anbieter für ein Funknetz gab. Nach einigen Nachfragen zwischen Herrn Dr. Knoblich und dem Senat gab es schließlich die verbindliche Zusage von Dr. Knoblich zum sozialen Wohnungsbauprojekt.
Karli arbeitete unbemerkt als Abteilungsleiter in der Baubehörde und trieb den Wohnungsbau zielstrebig voran. Eigentlich wollte er nur eine bezahlbare Wohnung, aber er wohnte noch immer bei den Eltern und erhielt inzwischen unbemerkt ein stattliches Gehalt vom Senat. Inzwischen legte der Bauherr den Grundstein für die ersten vierhundert Wohnungen auf einem Freigelände außerhalb der Stadt (früher als Weide für Kühe genutzt). Zu dieser Grundsteinlegung erschienen alle am Baugeschehen Nichtbeteiligten. Etwa zwanzig Damen und Herren des Senats bekamen je einen eigenen Hammer in die Hand gedrückt, mit dem sie auf die eigens für diesen Zweck errichtete Mauer schlagen konnten.
Gemeinsam riefen sie: „Gott segne dieses Haus“, wobei die Stimme des Oberbürgermeisters einen krähenden Unterton abgab und das Ganze etwas misstönend klang.
Einer rief weiter: „Ich ziehe da nicht raus!“, wobei er ganz schnell und verschämt den Hammer zur Seite legte.
Karli überlegte indessen ernsthaft, aufs Dorf zu ziehen, da nach dieser Hammerattacke auf die errichtete Mauer nichts weiter passierte. Er fand es schön kuschelig im Senatsbüro, und so verzichtete er schweren Herzens auf eine eigene Mietwohnung.
Herr Dr. Knoblich kehrte nach seiner zweijährigen Erkundungsreise aus Afrika voller Tatendrang zurück. Er konnte jetzt genau berichten, wie strohgedeckte Rundhütten aufgebaut werden. Ebenso, aus welchem einheimischen Material und in welcher Zeit für wieviel Bewohner. Völlig überraschte ihn, dass alles kostenlos errichtet wurde und die Bewohner dieser Eigentumshütten bloß mitarbeiten mussten. Einfach fantastisch. Nun suchte er einheimisches und obendrein kostenloses Material im Lande. Nach mehreren Jahren der Suche in allen Bundesländern fand er tatsächlich noch eine alte Frau, die auf dem Feld Ähren las, was er aus der Zeit nach 1945 öfter erfahren konnte. Das Stroh – als absolut kostenloses Material gewonnen – diente der Frau nur als Trinkhalme für ihre Enkel.
Inzwischen wurde Dr. Knoblich wegen seiner außerordentlichen Erfahrungen, die er jahrelang in Afrika im Baugeschehen gewonnen hatte, Staatssekretär beim Finanzsenator.
*
Sprücheklopfer
Eines Abends saß ich relativ zufrieden in meinem bequemen Sessel und wollte mir ein Buch zumuten. Ich überlegte noch, in welches Regal ich greifen sollte und ob gezielt oder unvermittelt, als meine Ehefrau hereinstürzte und rief: „Wir sollten endlich mal was machen!“
„Was willst du mir damit sagen?“, stellte ich die unvermeidliche Frage.
„Wir sollten endlich mal was machen“, wiederholte sie.
Im Radio hörte ich vor langer Zeit eine Rede im Bundestag, die mir sofort einfiel. Sie stammte von einem berühmten Politiker, der ständig hervorragende Sprüche ablassen konnte, so zum Beispiel: „Ich sagge es und das mit allem Nachdruck und bin davon fest überzeugt.“
Hier jedoch folgte nichts weiter. Was wollte der gut bezahlte Dicke damit sagen?
Vielleicht wollte er mit seinem nächsten Spruch ergänzen: „Entscheidend ist, was hinten rauskommt“, aber das kam dann nicht mehr. Kein Mensch, soweit ich weiß, äußerte sich dazu, weder zu diesem Zeitpunkt noch später. Ein gelinder Schreck durchzuckte mich. Diese Worte staken fest verankert im hintersten Kästchen meiner Gedanken, ausgelöst durch meine Ehefrau mit ihrem Spruch: „Wir sollten endlich mal was machen.“
Das musste geklärt werden. Nach langem Überlegen berief ich den Familienrat und den erweiterten Freundeskreis ein, sodass wir – 65 Personen insgesamt – über diesen rätselhaften Ausspruch reden konnten. Wir trafen uns im „Goldenen Anker“. Alle Eingeladenen trafen pünktlich ein, nur Tante Mielchen fehlte, sie kurierte ihre Halsentzündung aus und konnte deshalb keinen Ton herausbringen.
Den Satz: „Ich sagge es mit allem Nachdruck und bin davon fest überzeugt“, warf ich in den Raum. Mein Nachbar, der Herr Grasinski und obendrein ein Kommunalpolitiker, meinte, dass der Redner bestimmt was nachdrucken wollte. Vielleicht suchte der Mann eine Druckerei, von der er fest überzeugt wäre, und der Satz könnte noch weitergehen. Doch was wollte er nachdrucken – ein Gesetz oder einfach nur die Speisekarte aus der Bundestagskantine?
Meine Mutter, die schon die Achtzig überschritten hatte, bemerkte, er wollte etwas Überzeugendes sagen und wusste zum Schluss nicht mehr, was es war. Tante Mielchen, der ich den Text zugeschickt hatte, antwortete mit einem Fahrradkurier, dass „sagge“ wohl ein Fremdwort sei und sie nichts damit anfangen konnte.
Sicher, man könnte den Satz ebenfalls umdrehen: „Ich bin fest davon überzeugt und sagge es mit allem Nachdruck.“ Dieser Wortlaut käme der Druckerei oder den Druckerzeugnissen schon näher – nur was soll alles nachgedruckt werden?
Die Debatten gingen bis spät in die Nacht hinein, bis der Wirt uns hinausfegte, und nur er kam zur Erkenntnis, einen guten Umsatz gemacht zu haben.
Unzufrieden trabte ich nach Hause und konnte keinen Schlaf finden. Vielleicht gab es einen Zusammenhang zu einem von ihm später rausposaunten Satz: „Entscheidend ist, was hinten rauskommt.“ Ja, dann bekäme das Ganze auch einen Sinn. „Ich sagge es mit allem Nachdruck und bin fest davon überzeugt, entscheidend ist, was hinten rauskommt.“
Eigentlich wäre das wortsinnig eklig. So ein großer fetter Mensch, ein entscheidender Politiker wird nicht über seine geheimsten Gänge zu Hause oder in den Sitzungspausen solch eine Aussage tätigen, es sei denn, er meint etwas völlig anderes. Im Nebenhaus wohnt ein Bundestagsabgeordneter, mit dem ich, falls er nicht irgendwo Reden hält, in der Eckkneipe ein Bierchen trinke. Er würde im Bundestag eine Anfrage darüber einbringen, was mit den bedeutenden Aussagen jenes Spitzenpolitikers gemeint sei. Schließlich bestehe ein Recht des Volkes, solche Aussagen zu verstehen.
Vier Wochen fand darüber eine hitzige Debatte im Bundestag statt. Er, der schon lange das Spitzenplätzchen im Parlament mit dem Ruhepolster in Oggersheim getauscht hatte, verwirrte mit seinen Sprüchen immer noch die Politik. Was sollte der Spruch: „Ich sagge es mit allem Nachdruck und bin fest davon überzeugt“, heute noch aussagen? Der Fraktionsvorsitzende der CDU meinte daraufhin, dass der Chef die Energiewende schon damals ins Visier nahm.
„Euer Chef war schon damals bar jeder Vision, und seine Überlegungen reichten gerade mal vom Heimweg bis zum Bundestag“, konterte der Grünen-Chef und ging mit Fäusten auf den CDU-ler los.
Bald wäre es zu einer allgemeinen Keilerei im Bundestag gekommen, allein das angesagte Wasserwerferkommando konnte diesen Streit ersticken. Es konnte nicht geklärt werden, wann und wo dieser Ausspruch stattgefunden hatte, da ständig und bei jeder Gelegenheit noch schlimmere Sprechblasen in seinen Reden platzten.
Der Bundestagsabgeordnete Herr Fladenrock besuchte mich direkt zu Hause und erklärte mir traurig das Ergebnis. Sein Kommentar lautete allerdings, wenn er das selbstzufriedene und überhebliche Gesicht des Übermenschen bei solchen Sprüchen einschätzte, dann konnte dies nur die Folge seiner Überzeugung über blühende Landschaften sein.
Nach Jahren gab es tatsächlich in Deutschland nur noch blühende Landschaften. Ganze Landstriche blühten in strahlendem Gelb, und grüne Stauden streckten sich hoffnungsvoll gen Himmel. Deren Produkte verschwanden dann als Sprit in den Autotanks und in den Biogasanlagen, sie erzeugten viele neue Arbeitsplätze sowie vergiftete Böden.
Meine liebe Ehefrau, die das unsinnige Treiben mit verfolgte, meinte im Hinblick auch auf ihren Spruch: „Du siehst, was Visionen vermögen.“
*
Nachhaltiges aber teuer
Bei einem meiner Spaziergänge durch die Stadt fielen mir herrliche Bauten in wunderschönen Anlagen auf. An Einfamilienhäusern mit protzigen Säulen, die den Eingang stabiler aussehen ließen, an Villen mit viel Stuck an den Fassaden und an prächtigen hohen Plattenbauten vorbei, denen man die Platten nicht ansah, da eine dicke Isolierung alles verdeckte. Meine Gedanken verirrten sich dabei zu Jahrhundertbauwerken. Jeder kleine und große Politiker, der über Steuergelder verfügte, bediente sich, um bei der Nachwelt Bewunderung zu ernten. Manchmal gerieten diese Bauwerke unter den Abriss der Nachwelt, sie verursachten so weitere Steuermittel des nächsten Selbstdarstellers. Große oder kleine Könige und Fürsten schufen Schlösser, die später an reiche Privatbesitzer übergingen oder Museum wurden. Wobei „schufen“ immer das falsche Wort ist – sie ließen ihre Untertanen schuften.
Die letzten beiden deutschen Politikkonkurrenten, der kleine Erich und der große dicke Helmut, meinten gar, die nächste Nachwelt mit etwas Monumentalem zu erschüttern. Der kleine Erich baute für sein Volk einen kleinen Palast an historischer Stelle, und der Dicke schwor auf seine platten Reden, die jeden Komiker begeisterten. Der Palast des kleinen Erich hinterließ nach seinem Tode eine grüne Wiese. Die Sprüche des Dicken überstanden noch einige Runden, solange bis die alten Komiker starben, die Memoarien überließ man alsbald dem Reißwolf. Ich warf meine Mütze in die Höhe und vergoss für beide reichlich Tränen.
Die Gegenwart verlor weiterhin nichts von den Geisteshaltungen der an Geld kommenden Regierenden. Dem Volk wird zuerst etwas eingeredet, dann blindlings drauflos gebaut. Opernhäuser, Bahnhöfe und sogar einen überdimensionierten Flughafen. Einen besonderen Hafen ohne Wasseranschluss, der auf einer riesigen Fläche ein fröhliches und ruhendes Dasein verbrachte, mit leer stehenden Hallen und Türmen einfach nur monumental und mächtig beeindruckend.
Einen Flugplatz, der nach vielen Jahren wilder Arbeit Hunderter Firmen mit einer wahrhaft unnachahmlichen Eröffnungsfeier seine Krönung fand. Die Nichtbeteiligten hielten große Reden und Lobeshymnen auf die Schöpfer dieses einmaligen Wunderwerkes der modernen Technik.
Der Oberbürgermeister stand neben dem Minister und krähte alles, was er gerade zu sagen meinte, frei heraus: „In alle Welt geht es von hier aus, kein noch so weites und kleines Land wird ausgelassen, und ja, die Abfertigung der Passagiere eine Minutensache und die Zufahrt mit raketenschnellen Verkehrsmitteln direkt bis zum Flugzeug.“
Eine riesige Sektflasche hing an einem extra dafür aufgestellten Mast, nur um die Einweihung würdig zu begehen. Vertreter aus vieler Herren Länder – sogar aus Afrika, Indien und China – klatschten brav in die Hände.
In unmittelbarer Nähe zum Redner stand mein Freund Hanshardi Schlesog mit seinem fünfjährigen Sohn, der ebenfalls in seine Händchen klatschte und freudig rief: „Wo sind denn die Flieger?“
Der Großredner, der schon zur Sektflasche gegriffen hatte, bemerkte nach diesem Ausruf vom kleinen Georg, dass er selber nicht wusste, worauf er die Flasche werfen sollte. Hunderte Menschen, die eifrig ausharrten, schauten sich suchend um, sahen aber nur Fläche und Gebäude und folgten lauthals dem Ruf des Kleinen. Die vielen ausländischen Gäste verstanden hingegen nicht, was da gerufen wurde, sie ließen ihre Übersetzer reden und stimmten in ihrer Sprache in den Ruf „Wo sind denn die Flieger?“ ein. Der Flaschenwerfer setzte diese kurzerhand an den Mund und nuckelte sie langsam aus, wobei er überlegte, was nun zu tun sei.
Als fixer Politikredner rief er: „Wir werden eine Untersuchung einleiten!“, dann erinnerte er an die Schildbürger, die allerdings nur die Fenster im Rathaus vergaßen und das Licht schließlich mit Säcken ins Rathaus trugen.
„Ihr seht, alles geht, unsere Gebäude und Türme sind mit großen Fenstern bestückt, und die paar Flieger werden schon noch kommen“, fügte er euphorisch hinzu.
Er konnte jedoch nicht verhindern, dass der Skandal das ganze Land erfasste. Eine Kommission mit einigen hundert Experten untersuchte und fand nicht nur die fehlenden Flugzeuge. Sie fanden nach Monaten heraus, dass die Flugzeuge wegen bürokratisch erfundener Mängel nicht vor den Hallen parken durften. Die Passagiere fanden keine Duschköpfe, die eventuell auftretende Feuer löschten. Wegen dieser paar zusätzlicher Milliarden für die wenigen Mängel solle sich der Steuerzahler nicht so haben, wiegelte er als Oberbürgermeister und Vorsitzender des Aufsichtsrates ab.
Ein besonderer Experte, der Versager Edmund Gangelhofer, konnte gewonnen werden, die Kiste aus dem Feuer zu reißen und die Flugzeuge zum Abflug zu zwingen. Der Gute krempelte seine faltenreichen Arme frei, klopfte seine üblichen großen Sprüche los und entließ die Fachleute. Wortreich erklärte er, dass sein Bruder während seines Hausbaus die Toilette und den Küchenherd vergaß. Neben dem Haus besorgte er sich eine Pachttoilette und bestellte Essen auf Rädern, so konnte er sogar auf die Reinigung der Toilette, den Einkauf und das Kochen verzichten. Also sei der Flughafenbau gar kein Problem für ihn.
Er stellte einen Mängelplan auf und ging damit zum Vorstandsvorsitzenden. Der kam geradewegs von einer Partie, und seine knappe Zeit ließ keinen Spielraum für diese blöde Liste, die obendrein noch unendlich lang und damit langweilig war. Das kurze Beispiel mit dem Hausbau des Bruders von Gangelhofer kam dem Herrn schon mehr entgegen. Inzwischen wechselte der Vorstand mehrfach, und am Ende war der alte auch der neue Vorsitzende. So löst man schnell Probleme, denn doof bleibt doof, da geht nichts dazwischen.
Der Vorsitzende sah nun doch die Mängelliste durch, packte Edmund am Kragen, schüttelte ihn durch und schrie nach den verschwendeten Millionen. Mehr konnte er nicht erkennen, wenn er die Rechnungen und damit die verschwundenen Millionen sah. Damit ging Gangelhofer zum Bundesminister, der ihm einen echten irischen Whisky anbot.
„Ich habe Ihre Mängelliste gewissenhaft gelesen und ein erschütterndes Ausmaß von Verantwortungslosigkeit festgestellt. Wie können Sie es wagen, einen solch dummen Plan aufzustellen! Denken Sie, wir sind alles Laien, die in jahrelanger Planung und Arbeit nur Mist gebaut haben? Kein einziges Wörtchen des Lobes verloren Sie an die fleißigen Arbeitenden. Ja, wie soll ich das der Bevölkerung im Lande erklären!“ Schluchzend fiel der Minister dem Edmund Gangelhofer um den Hals und konnte sich trotz dessen tröstender Streicheleinheiten nicht beruhigen.
„Ich werde alles tun, um die Flugzeuge auf Kurs zu bringen“, versprach Gangelhofer und hob dabei drei Finger der rechten Hand.
Der Minister strebte ein Abwahlverfahren des Oberbürgermeisters an, mit dem Ziel, dass dieser gewissenhafter als Vorsitzender des Aufsichtsrates arbeiten konnte. Dem einst hochgelobten Experten Gangelhofer kürzte man das Gehalt und verpflichtete ihn zum Flughafenerfolg. Er musste nun das Fünfsternehotel verlassen und konnte nur noch zu seinem Bruder in das vermurkste Haus ziehen. Er absolvierte einen Jahreslehrgang für verfehltes Management und weiterer überheblicher Sprüche. Gangelhofer gab trotz allem nicht auf, er brachte sogar ein Flugzeug auf eine Nebenpiste, das aber nicht abhob. Dann schloss er sich in die kleinste Bude ein und überlegte, was er noch anstellen konnte.
Nach Wochen kam ihm die Erleuchtung: „Ich werde den anderen, bereits geschlossenen Flughafen wiederbeleben und einen noch bestehenden alten Flughafen um eine Piste erweitern!“
Damit fand er nur noch Gegner, die ihn am Ende jagten und in der Außentoilette seines Bruders verhafteten. Er erhielt mit einer Fußfessel Freigang, den er erfolgreich zur Flucht nutzte. In seinem Privatflugzeug konnte er sich unerkannt auf die Malediven retten. Als der geborene Manager wird er sich selbstverständlich als Geschäftsführer beim neuen Stuttgarter Bahnhof bewerben. Inzwischen konnte der noch nicht fertiggestellte große Flughafen der Natur wieder zurückgegeben werden.
*
Ein hervorragender Großstadtsenat
Die deutsche Hauptstadt, das einwohnerreiche Berlin, gesegnet mit einem wunderbaren Senat und einem fantastischen Oberbürgermeister. Jede Stadt in Deutschland, ja sogar die EU, beneidete uns um diesen Edelstein. Ganz bürgernah, auf jeder größeren Partie zu finden, um den Bürger zu erleben und der Bürger seinen Oberbürgermeister. Gerne würden wir die Neider zufriedenstellen. Er regiert die Stadt schon sehr, sehr lange – gar zu lange – so beliebt ist er. Geschickt fand er ständig sehr unterschiedliche Parteien, um mit denen gemeinsam zu regieren, vielleicht meistens oder immer öfter zu reagieren. So zum Beispiel auf die maroden Brücken. Völlig überrascht stellte er fest, dass die Hälfte der Brücken verkehrsuntüchtig sei, also dass diese keine Autos mehr trugen.
„Was brauchen wir mehr Brücken als Venedig – einfach schließen, meine Bürger können darüber laufen und auf der anderen Seite weiterfahren. Ich habe als Pfadfinder beim Kanuwanderfahren das Kanu zum anderen Ende der Schleuse getragen, um dann weiterzupaddeln. Es geht alles“, tönte er laut bei einer Senatssitzung, „für mehr ist kein Geld da. Berlin sitzt auf einem hohen Schuldenberg, über den ich nicht sehen kann. Diesen Berg schichtete mein Vorgänger, der Ebbi, mit seiner Pleitebank auf. (Mein Gott, solange bin ich schon Ober!) Der grub Berlin sogar das Wasser ab, das ich jetzt mit vielen Millionen (die ich nicht habe) für meine lieben Bürger zurückkaufte.“
Die grüne Lunge um und in Berlin bekam in der Stadt dunkle Flecken. Allerorts schwarze Punkte, die schwebend sich überall niedersetzen und eingesogen werden. Die Berliner joggen zu viel und sind gierig nach Luft. Die Autos sind an der Verschmutzung Berlins nicht schuld, dafür zeigen sie eine schöne grüne Plakette an den Autoscheiben, was recht anregend und hübsch aussieht. Es gibt ihnen etwas Bodenständiges, Einmaliges. Falls das Auto verloren geht, steht immer noch das Autokennzeichen auf dem grünen Aufkleber. Andersfarbige Autoaufkleber dürfen in der Innenstadt keine Spazierfahrt unternehmen, sie verpesten die Luft. Nein, nicht der Scheibenaufkleber, sondern der Auspuff. Wichtig ist, was hinten rauskommt, weist ein toller Spruch, den der alte Kohl einst formulierte, darauf hin. Bei mir, am Außenfensterbrett meiner Wohnung, setzt sich immer eine Dreckschicht ab, verursacht vom nahe gelegenen sauberen Kraftwerk. Völlig überrascht von diesem Zustand, wie auch nicht anders zu erwarten, ist der Senat. Na ja, wenigsten das Geld für den Autoaufkleber haben wir kassiert, denkt er beruhigt.
„Jetzt lassen wir uns von solchen Nichtigkeiten nicht mehr überraschen“, schworen sich bei der nächsten Sitzung die Senatsmitglieder.
Zur Eröffnung der Badesaison der Berliner Bäderbetriebe gingen alle Damen und Herren des Senates baden.