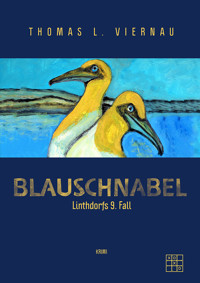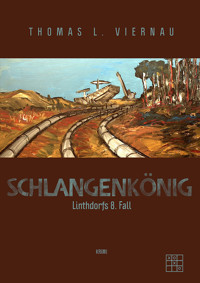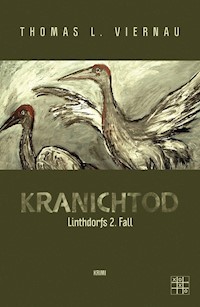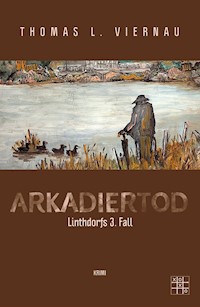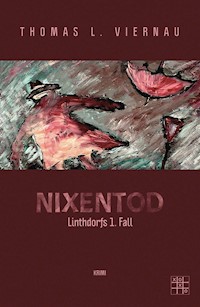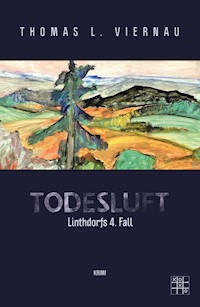Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Linthdorfs Fälle
- Sprache: Deutsch
In einem vergessenen Winkel Brandenburgs passieren zahlreiche Unfälle, die auch die Aufmerksamkeit des Kriminalisten Linthdorf für die Ereignisse im Vorwerk Krähwinkel wecken. Angefangen hatte es mit einem toten Bürschchen, das von niemandem vermisst wurde. Eine Abrechnung im Kleinkriminellenmilieu … vermuteten die Ermittler. Doch die folgenden Ereignisse ließen Zweifel an der einfachen Lösung aufkommen. Ein schrecklicher Haushaltsunfall einer alleinstehenden Witwe, der Unfalltod eines landstreichernden Rentners und die Pilzvergiftung eines unbescholtenen Ehepaars – alles passierte innerhalb von vierundzwanzig Stunden und am selben Ort – eben jenem stillen und beschaulichen Dörfchen namens Krähwinkel. Auch der Tote aus dem nahegelegenen Forellenzuchtteich und der Brand eines Einfamilienhauses im Ort ließen vermuten, dass etwas Böses im Dorf Einzug gehalten hatte. Linthdorf stocherte wieder mal im Nebel. Überall stieß er bei seinen Recherchen auf eine Mauer des Schweigens. Erst seine Suche in den Archiven brachte einen Anhaltspunkt. Krähwinkel war trotz seiner abgeschiedenen Lage im Brennpunkt diverser Interessengruppen. Was er in mühsamer Kleinarbeit ans Licht der Öffentlichkeit brachte, war ganz ungeheuerlich. Die Geister der Vergangenheit hatten die Siedlung fest im Griff. Eine Sisyphusarbeit für den Kommissar und seine Helfer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas L. Viernau
Krähwinkeltod
Linthdorfs 5. Fall
Kriminalroman
XOXO Verlag
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-015-6
E-Book-ISBN: 978-3-96752-515-1
© 2020 XOXO Verlag
Umschlaggestaltung: Grit Richter
Coverbild: Thomas L. Viernau
Buchsatz:
Alfons Th. Seeboth
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag ein IMPRINT
der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149
28237 Bremen
Alle im Roman vorkommenden Personen sind rein fiktiv. Sollte es zufällige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen geben, so ist das nicht beabsichtigt.
Personenregister
Ermittler:
KHK Theo Linthdorf, Ermittler beim Landeskriminalamt Potsdam
Kriminalrat Dr. Nägelein, Vorgesetzter Linthdorfs
KOK Petra Ladinski, Ermittlerin beim Landeskriminalamt Potsdam
Kriminalrat Bogumil von Katz, Chef der Wittstocker Polizeidienststelle
KOK Schwertfeger, Ermittler in Wittstock
KOK Kehl, Ermittler in Neuruppin
Dorfbewohner:
Herbert Golm, pensionierter Lehrer und Hobbyastronom
Erhard und Gisela Kappenbach, Rentnerehepaar
Marius und Silke Kappenbach, Sohn und Schwiegertochter, beide Angestellte in der Verwaltung
Irene Flumming, ehemals Verkäuferin, Witwe
Karl und Elli Lehmbeck, Bauern, schon gestorben
Dorchen Lehmbeck, deren Tochter, lebte in Neuruppin, bereits vor sieben Jahren mit dem Auto verunglückt
Enrico Lehmbeck, Sohn von Dorchen Lehmbeck, Herumtreiber und Kleinkrimineller
Günther und Almtrud Weidenbaum, Frührentner
Simone Weidenbaum, deren Tochter und Versicherungssachbearbeiterin
Giovanni, deren etwas zu klein geratener Liebhaber
Heidemarie Gontschorek, alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen, Pflegedienstmitarbeiterin
Familie Jesko und Wanda Kleinschmidt, leben auf dem Bauernhof, Maurer und Hausfrau, haben drei Söhne
Boris und Nancy Kleinschmidt, Geschäftsleute, Naturliebhaber, haben eine Tochter
Karlheinz und Gundula Kruse, Architekt und Bankfilialleiterin
Ernst und Elvira Flachbein, Rentner und Hobbylandstreicher
Paul und Wally Wüllersbarth, Rentner, Alkoholiker
Reinhard Bachhorn, verwitweter Pensionär, Kettenraucher, ehemals Funktionär in der Kreisleitung
Trude Leimdank, verwitwete Konditorin
Siegbert und Irmtraud Schallert, beide noch berufstätig
Frieda Humprecht, verwitwete Fleischermeistergattin
Klaus und Minni Spengelrath, Fleischereibesitzer
Tina Vasquez-Heumann, Nagelstudio-Besitzerin
Militärangehörige der GSSD, Gentzrode:
Oberst Saweli Pankratow, stationiert in Gentzrode
Leutnant Juri Tichomirow, Panzerkommandant
Sergeant Waleri Stashenko, Richtschütze
Sergeant Ruweli Mkrschjan, Panzerfahrer
Weitere Personen aus dem Umfeld:
Peggy, Fahrerin des mobilen Bäckershops
Guido Linhardt, Forellenzuchtmeister in Rägelin
Willi Schaperow, pensionierter Polizist aus Wittstock
Familie Baierstedt, Rentner im Klosterstift Lindow
Alle im Roman vorkommenden Personen sind rein fiktiv. Sollte es zufällige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen geben, so ist das nicht beabsichtigt.
Prolog
Krähwinkel
… ist ein fiktiver Ort, der zum ersten Mal in einer Satire von Jean Paul im Jahr 1801 auftauchte. Heinrich Heine verwendete ihn und auch August von Kotzebue, ein inzwischen fast vergessener Dramatiker, verwendete diesen Ort 1803 und 1809 in zweien seiner Stücke. Krähwinkel gilt als eine zutiefst spießbürgerliche Kleinstadt und wird manchmal als Vergleich herangezogen, um zu verdeutlichen, dass man einen Ort für ein langweiliges, spießiges und rückständiges Provinzstädtchen hält.
Begriffserklärung aus der Wikipedia 2017
Krähen im Winter
Krah, krah! Unüberhörbar melden sie sich zu Wort.
Krah, krah! Hallt es über die Felder fort.
Krah, krah! Voller Freude über ihre Gegenwart,
kritzel‘ schwungvoll Krähen auf mein Skizzenblatt.
Krah, krah! Krähen gehören im Winkel dazu,
bringen Leben in die öde Ruh.
Krah, krah! Gehören mit ins Bild, ob halb zahm oder wild,
ob zahlreich oder als einsame Kräh‘ im Schnee,
begleiten sie mich quer durchs Land.
Krah, krah! Hüpfen vor mir im Sand, blinzeln wissend herüber.
Krah, krah! Mit schiefgelegtem Schnabel:
Na, mein Lieber? Kommste wieder?
Krah, krah! Na klar … übers Jahr.
Ruppiner Heide
Mittwochnacht, 26. September 2007
Die Person lief nun schon fast zwei Stunden durch die Finsternis. Nur das leise Keuchen ihres Atems war zu vernehmen. Ab und zu knackte ein kleiner Ast, auf den sie trat, aber das war auch alles. Viel war nicht zu erkennen, die Person hatte ein dunkles Kapuzenshirt angezogen und die Kapuze über den Kopf gezogen. Sie vermied es, auf dem kleinen Pfad zu laufen. Die klare Sternennacht beleuchtete halbwegs ausreichend die Lichtungen und Wege. Nur im Schutz der Bäume war man wirklich unsichtbar. Die Person wusste das.
Vielleicht fünfhundert Meter entfernt lief eine andere Person ebenfalls im Schutz der Bäume, mit schnellen Schritten der Spur der ersten Person folgend. Auch diese Person war dunkel gekleidet. Woher sie kam, war schwer festzustellen. Möglicherweise gehörte sie zu dem verlassenen Auto, das vorn auf der Fernverkehrsstraße stand. Die Straße verlief hier schnurgerade durch ein ehemaliges Militärsperrgebiet.
Vor zwanzig Jahren rollten die russischen Panzer durchs Gelände, übten für den Ernstfall, um dann jedoch glücklicherweise beim wirklich eingetretenen Ernstfall im November des Jahres 1989 friedlich in ihren Unterständen zu bleiben.
Noch weiter in dem nur spärlich mit niedrigen Bäumchen bewachsenen Gelände solle es bis heute noch Minen und Blindgänger geben. Der Räumdienst käme so schnell nicht voran und das Gebiet erwies sich für die Spezialisten als zu groß und schlecht zugänglich. Das Betreten des Geländes war daher strikt verboten.
Die beiden Personen, die sich im Schatten der Bäume bewegten, wussten. Mit einer gewissen Unbekümmertheit folgten sie jedoch den ausgetretenen Pfaden, die von den Soldaten bei ihren Manövern angelegt worden waren.
Plötzlich lichtete sich der Kiefernwald. Vor den beiden Personen lag eine endlose, offene Hügellandschaft, nur bedeckt von Feldern und ein paar vereinzelt stehenden Büschen. Eine denkbar ungeeignete Gegend um sich zu verstecken.
Dennoch lief die eine Person geduckt hinaus ins Offene, hoffend, dass der Verfolger dieses Manöver nicht mitbekam. Ein dunkler Schatten bewegte sich auf dem abgeernteten Feld vorwärts.
Am Waldesrand stand die andere Person und spähte ins Land. Nichts war zu erkennen, was eine flüchtende Person sein könnte. Ein leichter Wind hatte eingesetzt, blies die trockene Erde vom Feld in die Luft, so dass ein Staubnebel entstand, der sich über dem offenen Land ausbreitete. Der Verfolger musste seine Augen zusammenkneifen. Staub machte es unmöglich, die Augen offen zu halten. Irgendwo schräg voraus schien der Staub etwas dunkler zu sein. Als ob sich im Schutz des Staubs etwas bewegte. Da war sie wieder, die dunkle Gestalt, klar und deutlich war sie gegen den hellen Sternenhimmel zu sehen.
Leichtfüßig folgte die Person dem dunklen Schatten im Staub. Es war kurz vor drei Uhr nachts. Eine Straße querte die Felder. Die fliehende Person rannte jetzt auf der Straße entlang. Sie hatte Panik bekommen. Nichts hatte geholfen, den Verfolger abzuschütteln. Er blieb einfach an ihr haften. Möglicherweise schaffte sie es ja, wenn sie einfach nur schnell genug rannte. Der Atem ging stoßweise. Seitenstechen setzte ein. Die fliehende Person wurde langsamer, pausierte. Der Atem normalisierte sich.
Ein Blick nach hinten genügte, da war sie wieder, die dunkle Gestalt, die einfach nicht verschwinden wollte.
Vorn wurden ein paar Häuser sichtbar.
War hier etwa schon das Dorf?
Mitten in der größten Einöde gab es wirklich ein Dorf. Nicht groß, eher bescheiden, nur eine Handvoll Häuser, keine Kirche, nichts Bemerkenswertes. Wenn, ja, wenn man es bis dorthin schaffen würde, dann könnte man sich wirklich verstecken.
Mit der letzten Energie rannte die Person im dunklen Kapuzenshirt los. Doch es war zu spät. Hinter sich spürte sie schon den heftig keuchenden Atem des Verfolgers. Nur noch wenige Meter waren es jetzt. Eine Frage von Sekunden. Durch das Gehirn jagten alle möglichen Optionen. Keine war wirklich gut. Es blieb nur noch die allerletzte Option. Das Messer.
In der Tasche des Kapuzenshirts war es verborgen, zusammengeklappt. Ein Handgriff genügte um es herauszuholen und aufzuklappen. Oft schon hatte die dunkle Gestalt im Kapuzenshirt damit geübt.
Beim Herumdrehen bemerkte die Person, dass der Verfolger ebenfalls auf die Idee gekommen war, ein Messer zu zücken.
Dann ging alles sehr schnell. Ein durchdringender Schrei entrang sich der Kehle des Getroffenen. Das Messer lag auf der Straße, zu weit weg, um Widerstand leisten zu können. Blut spritzte im hohen Bogen aus der aufgeschlitzten Schlagader. Der Mund füllte sich mit Blut, heftig atmend blickte die Person in den klaren Sternenhimmel, spürte das immer schwächer werdende Pochen des Herzens und den nahen Tod.
Er kündigte sich an durch ein kälter werdendes Gefühl in den Füßen, dann in den Beinen und Armen, schließlich im ganzen Körper. Das Leben floss stoßweise aus dem Körper heraus. Das letzte, was die verblutende Person am Straßenrand sah, war der dunkle Schatten der anderen Person, die sich jetzt über sie beugte und sie stumm anstarrte.
Nur hundert Meter weiter war das erste Haus der kleinen Siedlung zu sehen. Der Schrei war laut und durchdringend, aber in den Häusern blieb es dunkel. Niemand hatte etwas gehört.
Aufgeschreckt von dem Schrei flatterten ein paar Krähen verstört davon. Sie hatten wohl ihr Nachtlager direkt in dem kleinen Apfelbaum am Straßenrand. Niemand kümmerte sich um ihr ärgerliches Gekrächze.
Das Dorf
Weit draußen in der Ostprignitz spärlich besiedeltes Land,
Dörfchen, verstreut wie Inseln im endlosen Feldermeer,
fast vergess‘ne Leuchtfeuer der Zivilisation,
einsame Höfe recken sich empor.
Sind sie noch bewohnt? Und wenn ja, von wem?
Wer hält es hier draußen aus?
Bei einem Pott Kaffee und einem Stück Streuselkuchen sitzend,
beobachte ich Hühner und Enten beim Suchen nach Futter,
mümmelnde Karnickel zupfen Kräuter im Garten,
ein Radio leise dudelt, Zeit vergeht wie im Fluge,
lässt keine Gedanken an Einsamkeit aufkommen.
I
Das Dorf, Haus Nr. 12
Mittwochnacht, 26. September 2007
Der Übergang zwischen dem Ruppiner Land und der Prignitz wird als Ostprignitz bezeichnet. Nicht ganz so dünn besiedelt wie der westliche Teil der Prignitz, aber immer noch an die Grafschaft Ruppin erinnernd. Die Dörfer sind gepflegt und die Entfernungen zwischen ihnen erträglich. Hier tobte im Dreißigjährigen Krieg eine der größten Schlachten. Danach war die Gegend entvölkert.
Ein Hauch von Prignitz zieht seitdem durchs Land. Alles ist flach und starker Wind pfeift ausreichend. Windräder ragen in jeder Richtung in den Himmel. Die Ostprignitz gibt sich unspektakulär und bescheiden.
Die Septembernacht war schon kalt. Der Herbst kündigte sich mit kühlen, klaren Nächten an. Ideale Nächte zum Sternegucken.
So nannte er seine heimliche Leidenschaft, die ihn, den Schlaflosen, nächtelang auf dem ausgebauten Dachboden in den Himmel starren ließ. Er hatte zwei Fernrohre aufgebaut, beides teure Präzisionsgeräte, die es ihm ermöglichten, weit in die Tiefe des Weltalls zu blicken, Planeten zu beobachten, Mondlandschaften zu studieren und den Lauf der Sterne zu bewundern.
Die ganze Woche war es schon so kalt und klar des Nachts. Vor sich hatte er diverse Astrokalender aufgeschlagen, in denen die Positionen der Planeten genau beschrieben waren.
Er suchte den Saturn, der sollte gerade jetzt im späten September gut zu beobachten sein. Ein paar Mal hatte er ihn schon ins Visier genommen. Das Fernrohr gestattete ihm eine Auflösung, die sogar das Ringsystem um den Planeten sichtbar machte.
Ein gelblich schimmerndes Scheibchen mit einem hellen Kreis, der sich schräg darumlegte. Schon seltsam, was sich die Natur für Objekte einfallen ließ.
Aus der Nähe könnte man sehen, dass es keine Ringe waren, sondern kleine Eispartikel, die von der Gravitation des Gasriesen auf diese sonderbare, ringförmige Bahn gezwungen wurden. Astronomen nahmen an, dass es wohl ein ehemaliger Mond gewesen war, der dem Planeten zu nahekam und von dessen Gravitation zerrissen wurde. Saturns Monde waren größtenteils Eiswelten. Gefrorenes Methan. Bizarre Welten mit Eisvulkanen und Nebelwolken aus Ammoniak. Überhaupt, da draußen in den Weiten des Weltalls schien alles nur noch aus gefrorenen Gasen zu bestehen. Ungemütliche Orte.
Fröstelnd zog er sich für einen Moment von seinem Beobachterposten zurück. Er schaute auf seine Uhr. Es war kurz nach drei Uhr nachts. Aus seiner Thermoskanne goss er sich einen Kaffee in seinen Becher. Die Müdigkeit kam um diese Uhrzeit mit aller Macht und setzte ihm zu. Ab um Vier ging es dann wieder. Aber genau diese Stunde zwischen Drei und Vier war immer sein Totpunkt. Nur viel starker und heißer Kaffee half darüber hinweg. Stille herrschte. Kein Geräusch drang durch die sternenklare Nacht. Der Sternengucker schlürfte seinen Kaffee und vertiefte sich wieder in die vor ihm ausgebreiteten Astrokalender.
Man könnte ja auch noch einmal auf die Suche nach dem mit dem bloßen Auge kaum sichtbaren Uranus gehen. Selbst durch sein starkes Präzisionsteleskop war dieser türkisfarbene Eisriese nur als schwacher Lichtpunkt zu sehen.
Gerade wollte er sein Fernrohr auf die Koordinaten des weit entfernten Planeten ausrichten als er zusammenzuckte. Ein Schrei durchbrach die nächtliche Stille. Markerschütternd und nicht enden wollend. Er bekam unwillkürlich eine Gänsehaut, konnte zudem nicht einmal orten, von wo der Schrei kam. Er war so unmittelbar und plötzlich gekommen, als ob er über ihm ausgestoßen worden wäre. Aber da war natürlich nichts außer dem sternenübersäten Himmel.
Von da oben konnte er nicht gekommen sein, ja, er konnte nicht einmal feststellen, ob der Schrei aus einer männlichen oder weiblichen Kehle gekommen war. Vielleicht war es ja auch kein menschlicher Schrei.
Einige Tiere im Todeskampf sollten auch solche Schreie von sich geben. Möglicherweise hatte ein Fuchs einen Hasen … oder ein Uhu eine Maus… Kopfschüttelnd verwarf er jedoch die Idee, nein, die Intensität und die Länge des Schreis wiesen eindeutig auf eine menschliche Quelle hin.
Doch wer sollte nachts um Drei so markerschütternd schreien? Hier im Dorf schlief um diese Uhrzeit jeder. Nirgends war ein Licht zu sehen. Ob noch jemand anders den Schrei gehört hatte? Er beobachtete die Häuser, möglicherweise waren durch den Schrei ja ein paar leichte Schläfer geweckt worden.
Doch nichts passierte. Das Dorf lag still und dunkel vor ihm. Aber er hatte sich den Schrei doch nicht eingebildet! Er hatte ihn gehört, klar und deutlich. Was war da los?
Er klappte seine Astrokalender zu, trank noch einen Schluck heißen Kaffee und stieg vorsichtig die Treppe hinab. Irgendwo musste doch die Ursache des Schreis zu finden sein.
Möglicherweise brauchte jemand Hilfe. Er lief mit seiner Taschenlampe die Straße entlang. Nichts war zu sehen. Auch die andere Straße des kleinen Dorfs war still und dunkel. Hatten ihm seine Sinne nicht doch etwa einen Streich gespielt?
Ein Schatten huschte über die Straße ins unbewohnte Haus Nummer Sieben. Eine Katze? Ein Marder? So richtig konnte er es nicht erkennen. Vielleicht narrte ihn auch nur seine Einbildung.
Schwarze Schatten flogen plötzlich durch die Nacht, begleitet von einem ärgerlichen Krächzen. Golm zuckte zusammen. Seit wann waren den Raben nachtaktiv?
Verunsichert ging er wieder zurück ins Haus. Sternegucken war für heute Nacht erst einmal passé.
II
Das Dorf, Haus Nr. 14
Freitag, 28. September 2007
Das Dorf lag verlassen und vergessen inmitten der eintönigen Felder. Es gab nur zwei Straßen. Insgesamt waren es vierzehn Häuser, die sich entlang der beiden Straßen versammelt hatten. Die meisten waren alte Feldsteinhäuser mit dazugehörigem Hof und Stallungen nebst Scheunen. Einige Häuser, vielleicht eine Handvoll, schienen neueren Ursprungs zu sein. Sie besaßen meist nur einen Vorgarten und ein Carport.
Kein Kirchturm kündete vom Vorhandensein des Ortes, kein Schloss oder Gutshaus machte es für Wanderer zu einem beliebten Reiseziel. Es gab nichts wirklich Besonderes. Nur die beiden Straßen und ihre vierzehn Häuser.
Der Freitagabend war die Zeit, in der die Pendler von ihren Arbeitsstellen in den benachbarten Städten heimkehrten. Vor den Häusern parkten Autos, meist praktische Kombis, in denen man auch seine Einkäufe transportieren konnte.
Im Dorf gab es keine Läden. Der nächstgelegene Lebensmittelmarkt war in der Stadt. Zweimal in der Woche kam ein mobiles Bäckereigeschäft ins Dorf. Es war ein umgebauter Kastenwagen, dessen Seitenwand aufklappbar war und eine Verkaufstheke mit Vitrinen und einem kleinen Regal verbarg.
Das Bäckerauto, so nannten die Dorfleute den mobilen Verkaufswagen, kam stets zur selben Tageszeit. Pünktlich um Elf, immer dienstags und freitags.
Außer dem Bäckerauto gab es noch den mobilen Fleischer, ebenfalls ein Kastenwagen mit Verkaufstheke und das Postauto. Die kamen allerdings unregelmäßig.
Manchmal verirrte sich auch ein Feinfrostwagen ins Dorf, der sein Kommen mit einer nervigen Musikfanfare ankündigte.
Die Besuche der Versorgungswagen waren die Höhepunkte im wöchentlichen Dorfleben. Es waren immer dieselben Leute, die sich bei der Ankunft der fahrbaren Geschäfte trafen. Meist ältere Bewohner, die bereits in Rente waren, manchmal auch Mütter mit ihren Babys, die noch nicht kitatauglich waren.
An der Kreuzung, die von den beiden Straßen gebildet wurde, die das Dorf schnitten, gab es einen kleinen, grasbewachsenen Platz, der als idealer Standort von den Fahrern der Mobilgeschäfte auserkoren worden war. Der Grasplatz war von den Häusern links und rechts der Straßen gut einsehbar.
An diesem Freitagabend war der Grasplatz jedoch verwaist. Ein dunkelgrüner Opel Astra bog sanft um die Ecke und hielt vor dem Grundstück mit der Nummer Vierzehn.
In dem Haus mit der Hausnummer Vierzehn, die beiden Straßen hatten keine Namen, es gab daher nur Hausnummern, war am Abend ebenfalls Leben eingekehrt. Ein mausgrauer Golf parkte bereits vor dem Haus. Unter dem Carport stand ein großer Octavia-Kombi. Das Haus Vierzehn gehörte zu den wenigen, neuerbauten Anwesen des Dorfes. Weißverputzt, dunkelrote Ziegel, große, schallisolierte Fenster und ein Balkon, der für das Einfamilienhaus eine Spur zu groß geraten war, stand es auf einem mit Ligusterhecken begrenztem Grundstück am Ende der Straße. Der Astra parkte gleich neben dem Golf. Eine junge Frau in Rüschenbluse und etwas zu engen Jeans um die fülligen Hüften stieg aus.
Gleich hinter dem Grundstück begannen die endlosen Felder. Ende September waren die bereits abgeerntet. Eine trostlose, braune Erdwüste breitete sich bis zum Horizont aus.
Auf dem Grundstück standen ein paar vereinzelte Obstbäume, die sorgsam gepflegt wurden. Zwei Apfelbäume, deren schwer mit knallroten Früchten behangene Äste sich fast bis zum Gras neigten und ein Birnenbaum, der mit leuchtendgrünen Früchten behangen war. Gemüsebeete und ein Miniacker mit Kartoffelstauden waren im vorderen Teil des Gartens angelegt, der hintere Teil war Grasland.
Neben dem Wohnhaus stand ein großer Geräteschuppen. Zwischen dem Schuppen und dem Wohnhaus verband ein gläserner Wintergarten die beiden Gebäude. Vor dem Wintergarten glitzerte es tiefblau. Ein Swimmingpool mit Leiter, vielleicht zwölf mal zehn Meter, war der ganze Stolz der Bewohner.
Fünf Bewohner hatte das Haus Nummer Vierzehn. Erhard und Gisela Kappenbach, beide Anfang Sechzig, Marius und Silke Kappenbach, beide Anfang Dreißig, und deren kleiner Sohn Nick, gerade einmal vier Jahre alt.
Das ältere Paar wohnte in der linken, das jüngere Paar in der rechten Hälfte des Hauses. Man ging sich aus dem Weg, obwohl es eigentlich nicht nötig war. Marius war der Sohn von Erhard und Gisela. Ihm gehörte das Haus, obwohl er selbst dafür keinen Euro beigesteuert hatte. Es sei wegen der Steuerklasse, wurde allen immer erzählt. Marius könne die Kosten besser absetzen.
Marius und seine Frau Silke arbeiteten beide in der Kreisstadt auf dem Amt. So nannten die Dorfbewohner die Kreisverwaltung. Was er da genau machte, wusste keiner so richtig. Irgendwas mit Finanzen …, aber es interessierte auch nicht wirklich jemanden. Marius war nicht sehr gesprächig. Seine Frau war auch auf dem Amt, Sekretärin.
Die beiden älteren Hausbewohner waren bereits in Rente. Erhard hatte die Möglichkeit der Frühberentung genutzt und sich schon mit achtundfünfzig Jahren ins Privatleben zurückgezogen und seine Frau Gisela war seit ihrem Arbeitsunfall sowieso schon lange Zeit Invalidenrentnerin.
Sie kümmerten sich um Haus und Hof. Erhard war ein geborener Hausmeister, konnte gärtnern, reparieren und renovieren. Unter seinen geschickten Händen waren der Wintergarten und der Swimmingpool entstanden.
Neidisch beobachteten die Nachbarn das Tun auf dem Grundstück. Ihre Häuser waren älter, gehörten noch der Zeit an, als die Landwirtschaft die Dorfbewohner ernährte. Bauern gab es im Dorf keine mehr.
Der letzte Bauer war vor zehn Jahren in den Ruhestand gegangen. Seine Felder wurden von der Agrargenossenschaft aus dem Nachbarort übernommen. Der Genossenschaft gehörten die großen Felder, die das Dorf umgaben. Von weitem sah es aus, als ob das Dorf eine Insel inmitten eines Feldermeeres sei.
Die Kappenbachs zuckten immer mit den Schultern, wenn andere sie fragten, warum sie in dem gottverlassenen Nest ein Grundstück gekauft hatten. Sie hatten sich eben für das Dorf entschieden. Vielleicht mochten sie ja genau die Ruhe und Abgeschiedenheit. Sie waren bodenständig, gingen selten aus und schienen auch sonst keine Hobbys zu haben, die sie von ihrem Grundstück wegzogen. Im Sommer sah man Silke Kappenbach in einem albernen Bikini mit Rüschen am Beckenrand des Swimmingpools liegen, während ihr Mann sich um den korrekten Heckenschnitt bemühte. Der Nachwuchs war mit Oma und Opa im Grasgarten zugange und entdeckte Schmetterlinge und andere Kerbtiere. Haus Nummer Vierzehn war eine moderne Idylle. Alles hatte seinen Platz und seinen Sinn.
Der Freitagabend war für Familie Kappenbach Junior schon entspannte Freizeit, Einstieg ins Wochenende. Marius half seiner Frau, die großen Einkaufstüten ins Haus zu schleppen. Am Sonntagnachmittag wollten sie grillen. Eine Tüte war gefüllt mit Steaks, Würstchen, Schaschlik-Spießen und Putenbrustschnitzelchen. Auch ein Fünfzehn-Liter-Fässchen mit Bier rollte Marius ins Haus. Gäste wurden erwartet.
Erhard Kappenbach sah dem ganzen Treiben skeptisch zu. Dass die jungen Leute grillen wollten, hatten sie ihm noch gar nicht gesagt. Gerade wollte er einen Kommentar abgeben, als Marius ihn anblaffte. Ob er seinen Golf da wegfahren könnte, denn am Sonntag kämen doch Gäste, da würde der Parkplatz benötigt.
Erhard wollte etwas erwidern, hatte schon Luft geholt, ließ es dann doch bleiben. Diskussionen dieser Art hatte es im Hause Kappenbach schon oft genug gegeben. Es war sinnlos. Er winkte ab und ging zurück in seine Haushälfte.
Seine Frau Gisela erwartete ihn schon. Sie wusste natürlich Bescheid. Aber sie schien darüber nicht sonderlich überrascht zu sein. Marius war der einzige Sohn der Kappenbachs. Sein Wohlergehen war das einzige Lebensziel von Gisela Kappenbach. Auf ihr Betreiben wurde schließlich auch das Haus samt Grund und Boden Marius übertragen. Wer sollte sich denn um sie kümmern, wenn sie alt und krank würden?
Daher sollte Marius so früh wie nur möglich an das Grundstück samt deren Bewohner gebunden werden. Das waren ihre Hintergedanken. Sie kannte die Tragödien in den vielen Nachbarshaushalten. Die Alten blieben zurück, die Jungen zogen weg.
Sie konnte es jeden Tag beobachten. Gleich neben ihrem Grundstück lag der Hof Nummer Sechs der Baierstedts. Alte Bauernfamilie, drei erwachsene Töchter, allesamt weggezogen. Sie lebten mit ihren Familien weit entfernt, kamen nur alle paar Monate vorbei, blieben ein, zwei Tage und verschwanden wieder, ihre Eltern in der abgeschiedenen Trostlosigkeit ihres Dorfes zurücklassend. Kein Mensch kümmerte sich ansonsten um sie.
Aus der nahen Kreisstadt kamen zweimal täglich die jungen Damen vom Pflegedienst und verrichteten die notwendigsten Handgriffe. Der Hof jedoch erstarrte in einer Zeitschleife. Man sah es den Gärten an, keine pflegende Hand sorgte für den Baumschnitt, anstelle der Beete wucherte überall Gras und die einst mit Tieren gefüllten Stallungen waren allesamt verwaist.
Ab und zu schlurfte der alte Mann oder dessen Frau über den Hof, spürte dem vergangenen Leben nach, um dann wieder kopfschüttelnd zurück ins Haus zu gehen.
Baierstedts waren inzwischen im Pflegeheim in Lindow. Der Hof blieb ohne Bewohner zurück.
Nein, so wollten Kappenbachs Senior nicht enden. Da nahm man eben auch die arrogante Attitüte des Sohnes und die schnippische Wesensart der Schwiegertochter in Kauf, zumal sie ja den kleinen Enkelsohn oft zu ihnen rüberbrachten, der für freudige Abwechslung bei Kappenbachs Senior sorgte.
Gisela Kappenbach hatte Probleme mit ihrer Hüfte. Ein künstliches Hüftgelenk hatte zwar die Schmerzen beim Laufen mildern können, aber sie war stark eingeschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit. Treppensteigen bereitete ihr Höllenqualen, längeres Stehen ebenfalls. Meistens saß sie in der Küche auf ihrem bequemen Stuhl und beschäftigte sich mit dem Verarbeiten der Schätze aus ihrem Garten. Erhards »grüner Daumen« ließ alles in großer Menge und bester Qualität wachsen und reifen.
Zu jeder Jahreszeit, abgesehen vom Winter, hatte sie zu tun, alles zu zerkleinern, einzukochen, einzufrieren und einzukellern.
Der Keller der Kappenbachs war wohlgefüllt mit Dutzenden Einweckgläsern voller Obst, Bohnen, Erbsen, Beeren und sauer eingelegtem Gemüse. Der Sommer war lang und warm, die Ernte entsprechend groß. Jetzt zum Ende des Septembers kamen noch zahlreiche Tomaten, Gurken und Paprika aus dem kleinen Gewächshaus hinzu, dass von den jungen Leuten etwas hochtrabend als »Wintergarten« bezeichnet wurde. Auch die Äpfel, Pflaumen und Birnen warteten noch auf ihre Ernte.
Gisela Kappenbach seufzte. Heute Abend wollte sie eigentlich noch einmal ihre Schwester besuchen, die am anderen Ende der Straße lebte.
Irene Flumming war drei Jahre älter als sie und seit zwei Jahren verwitwet. Sie lebte allein in dem großen Haus mit der Hausnummer Zehn. Irene hatte keine Kinder. Gisela bekam immer ein schlechtes Gewissen, wenn sie an Irene dachte. Aber Irene war ein eigenwilliger Mensch. Sie beharrte darauf, dass sie gut allein mit allem zurechtkam und dass Alles, genauso wie es war, Bestens sei. Die beiden Frauen fuhren drei- bis viermal wöchentlich mit dem Auto in die Stadt zum Kaffeetrinken.
Am Markt gab es ein Café, in dem man stundenlang sitzen konnte und das Gefühl hatte, mitten im Leben zu sein. Ab und zu kam auch eine Bekannte vorbei, setzte sich mit dazu und man tauschte die neuesten Klatsch- und Tratsch-Geschichten aus. Es gab immer etwas, worüber man spekulieren konnte oder wo es Gerüchte gab.
Währenddessen kümmerte sich Erhard um das Anwesen. Er hatte sich eine Liste gemacht, auf der penibel alle Aufgaben notiert waren, die in der Woche erledigt werden sollten. Erhard arbeitete früher als Ingenieur, war es gewohnt, systematisch vorzugehen. Manchmal begleitete er seine Frau und die Schwägerin ins Café, aber eigentlich langweilte ihn das Herumsitzen und Stöbern in den Privatangelegenheiten wildfremder Menschen.
Da war er doch lieber mit seinen Pflanzen im Garten zusammen. Ab und zu besuchten ein paar gesellige Rabenvögel seine Obstbäume. Sie saßen gutgelaunt in den Ästen, krakeelten ein bisschen herum und flatterten nach ein paar Minuten wieder davon. Seltsamerweise fühlte sich Erhard Kappenbach durch die Besuche der Schwarzgefiederten erheitert.
Er hatte sich auch diesen Freitag wieder in sein Rückzugsgebiet begeben. Weder hatte er Lust, mit seiner Frau über die Laster und Gebrechen der übrigen Dorfbewohner zu sprechen noch mochte er den jungen Leuten über den Weg laufen, die sowieso nur mit sich selbst beschäftigt waren.
Hier hinten im Garten war er mit sich und der Welt im Reinen. Mit Stolz begutachtete er die zu erwartende Apfelernte und prüfte die Pflückreife der großen Pflaumen. Noch ein paar Tage …
Gisela war mit ihrem Elektroroller zu ihrer Schwester gefahren. Gut so! Endlich war Ruhe. Manchmal ging ihm Gisela mächtig auf die Nerven mit ihrer Art.
Alles war schlecht, was er machte. Nichts konnte er ihr recht machen. Dabei hatte er doch den gesamten Haushalt bestens im Griff. Alle Dorfbewohner, die er kannte, hatten Respekt vor seinen Hausmeisterqualitäten und bewunderten seine sichere Hand beim Planen und Bauen. Nun ja, er war eben Ingenieur …
III
Das Dorf, Haus Nr. 10
Freitag, 28. September 2007
Das Haus auf dem Grundstück mit der Nummer Zehn war schon etwas älter, obwohl es kein Bauernhaus war. Der ockerfarbene Rauputz und die Doppelfenster wiesen auf eine Bauzeit in den späten Sechzigern, möglicherweise sogar in den Fünfzigern hin. Zum Haus gehörte ebenfalls ein großer Hof und ein Obstgarten. Darinnen standen ein paar ehrwürdige Apfelbäume, die allerdings dringend eines ordnenden Schnittes bedurft hätten. Wild wucherten Asttriebe nach oben, die zwar viel Blattwerk aber dafür wenig Äpfel trugen.
Irene Flumming war das egal. Die paar Äpfel, die sie aß, waren ausreichend genug am Baum. Früher, als ihr Mann noch lebte, hatte er sich um die Bäume gekümmert. Jetzt bevölkerten Elstern, Raben und andere Federtiere die Bäume und stritten sich um die wenigen Früchte. Um die Früchte war es Irene nicht schade, aber der dauernde Lärm der unliebsamen Besucher hatte schon etwas Nerviges. Sie war sich sicher, dass sie die aufdringlichen Vögel ihrem verstorbenen Mann zu verdanken hatte. Er hatte die Vögel immer gefüttert.
Hubi, eigentlich Hubert, war nun schon zwei Jahre tot, eigentlich waren es bald drei Jahre …
Hubert hatte sich um alles gekümmert, was draußen auf dem Hof und im Garten gemacht werden musste. Er war ein stiller Mensch, saß ansonsten meist in seinem Sessel und las Zeitung. Eines schönen Tages im Winter saß er auch in seinem Sessel, sagte kein Wort und schien zu schlafen. Irene war schon etwas ärgerlich, dass er nicht reagierte, als sie ihn rief. Sie tippte ihn an, spürte just in dem Moment, dass etwas nicht stimmte. Hubi kippte langsam zur Seite weg. Er war einfach gestorben ohne etwas zu sagen.
Etwas ratlos rief sie ihre Schwester an, die auch gleich mit ihrem Elektroroller kam. Sie schaute auf Hubert, der seltsam verrenkt in dem Sessel lag. Ob man die Eins-Eins-Zwei anrufen solle?
Oder gleich den Leichenwagen? Na, irgendein Arzt müsse wohl vorbeikommen, der sollte den Totenschein ausstellen. Das war alles, was Gisela einfiel.
Eine Woche später war Hubert auf dem nahegelegenen Waldfriedhof begraben. Gerade mal Neunundsechzig Jahre alt geworden. Hatte keine Laster, rauchte nicht, trank nicht, trieb sich nicht herum, hatte sein stilles, friedliches Leben gelebt.
Etwas ratlos blieb Irene allein zurück. Dabei war sie heimlich immer ganz stolz auf Hubi gewesen.
Wenn sie sich mit den Frauen der Nachbarshöfe unterhielt und deren Nöte mit ihren Männern erzählt bekam, beglückwünschte sie sich leise. Hubi war eine Seele von Mann. Und trotzdem war er einfach so gestorben.
Ernst Flachbein aus der Vier war schon vierundsiebzig und trieb sich überall herum, bloß nicht zu Hause bei seiner Frau. Und Paule Wüllersbarth, der sich mit den Flachbeins den großen Hof teilte und die zweite Doppelhaushälfte mit seiner Frau bewohnte, soff nun schon seit drei Jahrzehnten ohne dass es seiner robusten Gesundheit zu schaden schien. Vorn aus dem Hof Nummer Fünf, der Reini, also Reinhard Bachhorn, der qualmte täglich drei Schachteln Zigaretten, hustete und spuckte schon seit Jahren, lebte aber dennoch. Ach, die Welt war ungerecht.
Irene wartete auf das bekannte Geräusch, das Surren des kleinen Elektromotors vom Roller ihrer Schwester.
Endlich drang das vertraute Knattern an ihr Ohr. Sie schaute aus dem Fenster, sah Gisela zu, wie diese sich mühsam mit ihrer kaputten Hüfte vom Roller bemühte und öffnete die Tür.
Die beiden Schwestern waren sich äußerlich nicht sehr ähnlich. Gisela war eine etwas fülligere Dame mit sehr gepflegtem Äußeren, die Haare stets ordentlich frisiert, einmal wöchentlich ging sie ja auch zum Friseur nach Lindow, immer sorgfältig geschminkt und mit modisch bunten Blusen und Jacken angetan.
Irene war da praktischer. Sie war eher der sehnige Typ Frau. Meist trug sie eine Kittelschürze und legte auch nicht so viel Wert auf ihre Frisur. Trotzdem waren sich die Schwestern sehr zugetan.
Irene litt seit dem Tod ihres Mannes unter Schlaflosigkeit. Oftmals wanderte sie nach Mitternacht ruhelos durchs Haus, dass ihr immer größer und bedrohlicher erschien. Manchmal glaubte sie sogar, den Schatten von Hubi zu erkennen, der irgendwo im Hause auf sie lauerte. Doch stets verschwand er wieder wie von Geisterhand. Mit keiner Menschenseele hatte sie über ihre nächtlichen Alpträume gesprochen, nicht mal mit Gisela.
Seit zwei Tagen war Irene nun schon in einem seltsamen Zustand. Es hing wohl mit dem Erlebnis in der Nacht zum Donnerstag zusammen. Wieder konnte sie nicht schlafen. Sie saß in der Küche, starrte in die Dunkelheit, traute sich nicht, Licht anzumachen. Was sollten denn die Nachbarn denken, wenn bei ihr nachts um Drei noch Licht brannte?
Nur der Radio dudelte leise sein Nachtprogramm. Wenigstens ein vertrautes Geräusch. Irene hatte wieder den Schatten gesehen. Hubi besuchte sie, wollte nach dem Rechten schauen. Sie fühlte sich immer ertappt, dass er so wenig Zutrauen zu ihr hatte.
Mein Gott, ihre Ehe war kein Zuckerschlecken gewesen. Die gemeinsamen Jahre waren zum Schluss eine Zumutung für beide. Aber keiner wollte aus dem unerträglichen Zustand ausbrechen. Man schwieg, ging sich aus dem Weg. Es könnte ja noch schlimmer kommen. Und allein sein, nein, das ging schon gar nicht … Außerdem, was sollten die Leute im Dorf sagen?
Sie schluckte nun schon seit zwei Tagen die kleinen roten Kügelchen, Beruhigungspillen. Aber die halfen inzwischen auch nicht mehr. Sie musste etwas tun, wusste aber nicht was.
Als einziger Ausweg fiel ihr ein, bei Gisela anzurufen. Gisela war immer die praktischere von den beiden Schwestern gewesen, ihr fiel immer etwas ein.
Und jetzt saß Gisela am Küchentisch. Irene hatte Kaffee gekocht. Beide hatten eine große Kaffeetasse vor sich stehen.
»Gisi, ich glaub‘, ich muss zum Arzt.«
»Was ist los? Hast du wieder dein Nervenleiden?«
»Ach Gisi, ich glaub‘ ich werd‘ langsam meschugge. Seit drei Tagen schlafe ich nicht mehr, bin aber vollkomen hundemüde.«
»Du solltest nicht so lange mehr fernsehgucken. Und immer das wilde Zeug, was du siehst, da würde ich ja auch ganz meschugge werden.«
»Quatsch, ich hab‘ den Fernseher überhaupt nicht angehabt in der ganzen Woche. Nein, es ist …«
»Renchen, du bist einfach überspannt. Du solltest dich am besten öfters mal hinlegen und nichts machen. Geh doch mal zum Friseur! Das ist auch ganz entspannend.«
»Gisi, manchmal höre ich furchtbare Geräusche. Vorgestern Nacht, da gab es ein fürchterliches Geräusch. Ein Schrei, ganz laut und langgezogen. Es war furchtbar, ganz furchtbar …«
»Ach, du spinnst ja. Ich habe nichts gehört und ich habe einen leichten Schlaf. Wer weiß, vielleicht hat sich der Fuchs ein Kaninchen geholt. Die pfeifen dann vor Todesangst.«
»Meinst du?«
»Ja, wer soll denn sonst in der Nacht schreien? Überleg‘ doch mal! Die paar Leutchen, die hier wohnen, da ist keiner bei, der nachts rumrennt und schreit. Wir sind doch nicht in Berlin, wo so etwas üblich ist. Was haste denn wieder für einen Schundroman gelesen? Du mit deinen komischen Krimis immer …«
Irene antwortete nicht. Natürlich, Gisela hatte ja Recht. Wer sollte hier draußen auch mitten in der Nacht schreien? Sie hatte auf die Uhr gesehen. Nachts um Drei war es. Da schlief normalerweise ein jeder. Außerdem, es war ja auch mitten in der Woche. Da wurde nie so lange gefeiert oder Blödsinn gemacht.
Trotzdem war Irene ratlos. Gisela war nicht die wirkliche Hilfe, die sie erwartet hatte. Sie wurde noch vollkommen verrückt, so allein in dem großen Haus. Vielleicht sollte sie sich ein Haustier zulegen? Einen Hund? Oder wenigstens eine Katze, dann wäre sie nicht ganz allein. Irene winkte jedes Mal ab. Sie solle doch einfach mal einen Blick in den großen Apfelbaum vor der Tür werfen. Dort seien genug Haustiere versammelt. Eine ganze Schar aufdringlicher Raben habe sich im Baum eingenistet und gebärde sich wie ein Tollhaufen.
Sie goss Kaffee nach. Gisela rührte etwas Zucker in den schwarzen Sud und goss auch Sahne aus dem kleinen Kännchen zu. Der Kaffee sei so bekömmlicher. Sie hatte es ja etwas mit ihrem Magen. Aber das kam immer, weil sie sich so aufregte. Eigentlich grundlos. Stets war Erhard der Grund für ihre Aufregung.
Erhard hier, Erhard da, Erhard machte und schraubte und buddelte und fuhr herum … sie sollte eigentlich froh sein, noch einen Mann zu haben, der sich so kümmerte. Aber Erhard konnte es Gisela nie recht machen. Er war stets im Verzug, immer war etwas zu tun und er vergaß es einfach.
Ach, das war alles so ungerecht. Sie saß nun ganz allein in ihrem Haus. Irene hatte keinerlei Geldsorgen, nein, ihre eigene Rente und die Witwenrente reichten vollkommen aus, um ein sorgenfreies Leben zu führen.
Nein, das war es nicht, was ihr Kummer bereitete. Es war die Angst vor der Einsamkeit.
Dass sie einfach so umfallen könnte wie Hubi, aber dass dann niemand da wäre, der sie fände. Eine unerträgliche Vorstellung war das. Neidisch schaute sie daher immer zu ihrer Schwester.
Gisela hatte es gut und das pralle Leben um sich. Ihr Mann lebte noch und kümmerte sich um alles.
Nichts war wirklich wichtig. Und da gab es ja auch noch Marius und die Schwiegertochter und natürlich das Enkelchen …
Kein Wunder, dass sie ruhig schlafen konnte!
Irene hingegen grübelte ständig. Immer hatte sie Angst, etwas vergessen zu haben. Bestimmt dreimal pro Nacht kontrollierte sie die elektrischen Geräte, ob sie denn auch alle ausgeschaltet waren. Speziell die Kochfelder des neuen Ceranfeld-Herdes, die waren ihr sowieso unheimlich. Auch die Lichtschalter wurden inspiziert und die Wasserhähne, ob sie nicht tropften.
Manchmal lief sie auch einfach im Nachthemd auf den Hof und schaute nach, ob die Gartentür geschlossen war. Das hatte sie früher nicht gemacht. Da lebte ja auch Hubert noch, der kümmerte sich um so etwas.
Man hörte neuerdings immer von den Räuberbanden, die nachts herumzogen. Die Welt war unsicher geworden. Ach, nein, es machte wirklich keinen Spaß mehr; alt zu werden war kein Zuckerschlecken. Dabei war sie gerade erst vierundsechzig.
Früher hatte sie in der Kreisstadt gearbeitet im Handel, wie sie immer zu sagen pflegte. Sie stand im Lebensmittelgeschäft an der Käsetheke, schnitt Edamer und Gouda auf, portionierte Frischkäse in schöne Plastiknäpfchen und war auch für die Salattheke verantwortlich. Das hatte ihr Spaß gemacht. Zumal sie stets mit einer blendend weißen Schürze und einem weißen Häubchen wie aus dem Ei gepellt inmitten ihrer hunderterlei Käsespezialitäten hantierte. Stets konnte sie mit den Kunden auch ein paar Worte wechseln, so dass nie Langeweile aufkam.
Seit vier Jahren war sie nun schon in Rente. Sie hätte ja noch gern ein paar Jahre gearbeitet, aber Hubert wollte es nicht. Naja, viel hatte er ja nicht von ihr gehabt. Seit fast drei Jahren war er nun schon tot. Sie hatten sich sowieso nicht viel mehr zu sagen.
Hubert starrte immer nur in seine Zeitung. Irene war sich sicher, dass er sie gar nicht las. Er wollte hinter den großen Seiten einfach verschwinden, sich unsichtbar machen. Speziell, wenn sie mit Staubsauger und anderen Geräten in der Wohnung herumwirtschaftete. Dabei war es immer pieksauber.
Und jetzt geisterte Hubert als Wiedergänger durch das leere Haus und raubte ihr den Schlaf. Natürlich, sie hatte ihn öfters angefahren, wegen seiner stupiden Rumsitzerei und überhaupt, er könne sich doch mal ein Beispiel nehmen an Erhard, dem Mann von ihrer Schwester, was der so alles machte.
Hubert schwieg zu alledem. Manchmal sprachen die beiden tagelang kein Wort miteinander. Irene ging dann immer zu Gisela und fuhr mit ihr ins Café um den Frust bei einem Stück Sahnetorte loszuwerden. Was Hubert machte, um seinen Groll zu vergessen, sie wusste es nicht. Es war ihr eigentlich auch egal.
Aber das war ja nun auch schon alles wieder lange Zeit vorüber. Jetzt hatte sie andere Probleme. Schlaflosigkeit, Einsamkeit und eben die Geräusche, die vielleicht gar nicht wirklich vorhanden waren. Wurde sie verrückt?
So wie die alte Martha Dellerkamm aus der Fünf? Die hatten sie vor einem halben Jahr abgeholt. Ins Heim. War alterssenil geworden. Mehrfach hatte man sie aufgegriffen, als sie hilflos und orientierungslos irgendwo in der Landschaft herumirrte. So wollte sie nicht enden.
Ob Gisela ihre Ängste verstand? Schwer zu sagen. Jetzt saß sie ihr gegenüber, rührte ihren Kaffee um und sah immer nervös auf ihre kleine Armbanduhr. Als ob sie etwas verpassen würde.
Ob sie vielleicht morgen mit ihr rüber in die Stadt …?
Gisela zuckte mit den Schultern. Sie müsse erst Marius fragen, der habe am Sonntag ein Grillfest geplant. Möglicherweise brauche er ja Hilfe beim Vorbereiten. Die Schwiegertochter wäre da nicht so eine große Hilfe.
Ein Grillfest?
Naja, es kämen wohl ein paar Arbeitskollegen, auch sein Chef. Marius wollte sich doch um den Posten des Kämmerers bewerben. Das habe er ihr bereits im August erzählt.
Ach, Kämmerer? So eine Art Buchhalter wäre das wohl?
Naja, nicht direkt, mehr so ein Finanzverwalter, aber genau wüsste sie es wohl auch nicht.
Irene war suspekt, was ihr Neffe im Amt machte. Früher hatte sie zu Marius eine recht gute Leitung gehabt. Immer, wenn er klamm war, kam er zu ihr. Sie steckte ihm dann stets ein paar Scheine zu. Naja, das hatte sich seit seiner Heirat erledigt. Marius war seitdem nicht einmal wieder bei ihr zu Besuch gewesen.
Sie fand das schoflig. Als ob sie nicht mehr existieren würde. Und den kleinen Nicki hatte sie auch nur sehr selten zu Gesicht bekommen. Silke, die Schwiegertochter von Gisela, schirmte den Jungen wie eine Glucke vor allem ab. Alte Frauen würden einen schlechten Einfluss auf seine Entwicklung haben, sagte sie immer.
Eine komische Person war das schon.
Wie Marius an die geraten war, wusste bis heute noch keiner. Eines Tages kam er zurück vom Studium und stellte sie ihnen als seine Verlobte vor.
Silke war ein Stadtmensch. Trotz ihrer Jugend hatte sie eine altkluge Art über alle Dinge zu sprechen. Sie kleidete sich auch eigenwillig. Meist trug sie Rüschenblusen. Vielleicht wollte sie damit ihren etwas zu flach geratenen Busen kaschieren.
Silke blickte auf das Landleben immer etwas geringschätzig herab. Auch sie hatte zusammen mit Marius studiert, war wohl ein Studienjahr unter ihm gewesen.
Warum sie nun nur als Sekretärin …? Aber das ging sie ja nichts an, schließlich war es ja deren Sache.
Gisela hatte ihren Kaffee ausgetrunken. »Ich rufe dich morgen an. Mal seh’n, vielleicht können wir uns ja für den Nachmittag ein paar Minütchen Zeit gönnen.«
Irene nickte. Vor ihr lag wieder eine lange, schlaflose Nacht.
IV
Das Dorf, Haus Nr. 2
Freitag, 28. September 2007
Es war eines der ältesten Anwesen im Dorf. Ein großes Bauernhaus trug die Nummer Zwei. Aus Feldsteinen gebaut, mit einem Anbau aus roten Klinkersteinen, dazu ein großer Hof mit Taubenhaus, Hühnerstall, Ententeich und Ställen, die immer noch ein paar Schafe und Ziegen beherbergten.
Ein alter Traktor zierte die Einfahrt. Er stand als Monument aus den Zeiten der Industrialisierung herum, rostete still vor sich hin und diente den beiden Kindern, die auf dem Hof heranwuchsen als Abenteuerspielplatz.
Das große Bauernhaus beherbergte zwei Familien. Im rechten Trakt lebten Günter und Almtrud Weidenbaum. Zu den Weidenbaums gehörten die Tochter Simone und deren Lebenspartner Giovanni. Simone war schon längst über dreißig und weit davon entfernt, noch als junge Frau zu zählen. Dennoch führte sie sich als solche auf. Giovanni war gut und gerne zehn Jahre jünger als Simone. Sie kleidete sich wie ein Teenie, trug ihre Haare entweder in Pippi-Langstrumpf-Manier oder als zerzausten Wischmopp. Meist hatte sie kreischend bunte T-Shirts an, die mit englischen Wörtern dekoriert waren und keinerlei Sinn ergaben.
Dazu trug sie halblange Jeans, die mit extrabreiten Hosenträgern dem ganzen Outfit etwas Schwung geben sollten. Simone war nicht die Schlankste. Ihre üppige Oberweite ragte nur knapp über den ebenfalls üppigen Bauchansatz. Glücklicherweise fiel der nicht so auf, da ihr imponierendes Hinterteil die Jeans vollkommen ausfüllte und immer alle Blicke auf sich zog.
Giovanni, ein eher mickeriges Kerlchen, war das egal. Er mochte stramme Frauen. Almtrud war es eigentlich nicht recht, dass ihre Tochter sich mit so einem jungen Bengel eingelassen hatte. Aber das war immer noch besser als gar kein Freund.
Es gab im Dorf auch junge Frauen, die einsam vor sich hinwelkten. Die hatten die Schwelle zur Dreißig überschritten und konnten keinen Mann finden, der sie von hier wegholte.
Gleich nebenan, in der linken Haushälfte lebte eine solche Frau mit ihren zwei Kindern. Ihr Freund und Kindsvater war über alle sieben Berge verschwunden und hatte sie allein zurückgelassen.
Heidemarie Gontschorek war bereits fünfunddreißig, alleinstehend, und führte einen eigenen Haushalt. Die beiden Jungs waren acht und sechs Jahre alt. Ab und zu kam Heidis Mutter aus dem fernen Berlin zu Besuch.
Dann konnte sie endlich auch einmal abends weg. Aber sie wusste schon, für sie war es zu spät. Die Disco im benachbarten Dorf war mit jungen Mädchen überfüllt, die halb so alt waren wie sie. Sie bewegte sich wie ein Alien inmitten der Backfische.
Auch mit der lauten, dumpf hämmernden Musik konnte sie nichts mehr anfangen. Die jungen Leute bewegten sich zu den Technoklängen wie durchgeknallte Roboter, zuckten mit allen Gliedmaßen und verdrehten ekstatisch die mit Haar-Gel strapazierten Köpfe. Männliche Wesen waren ebenso seltsam gestylt und eigentlich noch Kinder. Sie konnte sich die ausgeflippten Jungs jedenfalls besser als Spielkameraden für ihre beiden Söhne vorstellen, denn als Partner im Bett.
Heidi hatte es auch schon mit Partnersuche übers Internet probiert. Aber außer ein paar flüchtigen Bettbekanntschaften war daraus nichts geworden. Sie hatte es inzwischen aufgegeben, den richtigen Mann zu suchen.
So etwas wie nebenan die dicke Simmi an Land gezogen hatte, also, auf so etwas konnte sie verzichten. Dem Mickerling quollen ja jedes Mal die Augen aus seinem Spitzmausgesicht, wenn sie Wäsche aufhing und nur eine leichte Schürze trug. Sollte er mal ruhig sehen, wie eine schöne Frau aussah.
Auch Günni, also Günter Weidenbaum schlich dann immer ganz zufällig über den großen Hof. Günni war ein Schlappschwanz, machte nur, was Almtrud sagte.
Der konnte ja noch nicht einmal allein Einkaufen fahren. Ein Wunder, wie er es bisher geschafft hatte, durchs Leben zu kommen. Mit Dackelblick wartete er stets bis Almtrud mit wichtiger Miene erschien und Anweisungen gab.
Almtrud sah genauso aus wie ihre Tochter, eben bloß zwanzig Jahre älter und nicht ganz so schräg gekleidet. Sie trug eine Dauerwellenfrisur, wie viele Landfrauen. Wetterfest, praktisch und pflegeleicht. Ihren gewaltigen Hintern verbarg sie geschickt unter weiten Röcken, darüber eine legere Schürze, die ihr das Aussehen einer russischen Matrjoschka gab. Günni war ein farbloses Nichts, meist in beige gekleidet, dass seine Unauffälligkeit noch betonte. An seinem Handgelenk baumelte stets ein Herrentäschchen, das schon bestimmt seit einem Jahrzehnt außer Mode war.
Sie grinste. Mit Almtrud hatte sie sich einmal über Günnis Herrentäschchen unterhalten. Almtrud hatte ihr anvertraut, dass das Täschchen nur zu seiner Sicherheit sei. Falls er ihr unterwegs einmal abhandenkomme, wäre da alles drin, was er bräuchte, um zu ihr zurück zu finden: ein Prepaid-Handy, seine Ausweiskärtchen, ein Fünfzig-Euro-Schein und ein Taschentuch.
Heute Abend waren die beiden vom Großeinkauf zurückgekehrt. Günni schleppte die Vorräte ins Haus. Heidi, die gerade Wäsche aufhing, beobachtete die beiden Weidenbaums. Wo sich Simone und ihr spitzmäusiger Galan herumtrieben, wusste sie nicht. Vielleicht waren die ja auf Disco …
Almtrud grüßte kurz, kam für ein paar Sekunden zu ihr. Ihr Günni würde spinnen, neuerdings. Naja, er war sowieso noch nie eine Leuchte gewesen, aber seit ein paar Tagen wäre er vollkommen durch den Wind …
Heidi schaute etwas betreten zu Almtrud. Soviel intime Geheimnisse aus dem Familienleben der Weidenbaums wollte sie gar nicht wissen. Schlimm genug, dass sie das laute Stöhnen von Simmi jede Nacht ertragen musste, wenn sich Giovanni an ihr zu schaffen machte. Aber Almtrud war da robust. Sie hatte ihr schon öfters im Vertrauen peinliche Dinge berichtet.
Außerdem schien sie bestens über die anderen Dorfbewohner Bescheid zu wissen. Zu jedem Hof fiel ihr immer eine anrüchige Geschichte ein.
Heidi wollte das eigentlich nicht wissen, aber sie konnte sich der plumpen Vertraulichkeit Almtruds auch nicht entziehen. Wer weiß, was Almtrud über sie im Dorf erzählte? Aber das war ihr auch egal. Sie wohnte nun mal eben hier, grüßte die Leute, wenn sie welche sah und ging ansonsten ihrer Arbeit nach.
Nun stand sie also direkt vor ihr, verdeckte mit ihrem massigen Hinterteil die Sicht zu ihren beiden Söhnen, die mal wieder auf dem alten Trecker herumkletterten und wartete darauf, dass sie etwas erwiderte.
»Ach, Günter ist doch noch ganz okay. Schau dir doch mal den ollen Wüllersbarth an, den Suffkopp, oder Flachbein, der mit seinen vierundsiebzig immer noch herumzigeunert und den Frauen an die Wäsche geht. Da ist doch Günni eher ein harmloses Wesen, auch wenn er manchmal etwas spinnt.«
Almtrud nickte. Ja, natürlich, da habe sie schon recht. Aber sie wolle ja ihren Günni auch nicht mit solchen Gestalten wie Wüllersbarth und Flachbein verglichen haben, nein, so schlimm sei es um ihn nicht bestellt.
Günni habe im Moment die fixe Idee, einen Todesschrei gehört zu haben. In der Nacht zum Donnerstag, seitdem brabbele er ohne Unterlass von dem Schrei. Sie traue sich mit ihm gar nicht ins Dorf unter die Leute.
Wer weiß, was er noch alles für seltsame Dinge von sich gebe. Naja, Günni sei sowieso nicht der fixeste im Kopf. Das wüssten ja alle. Simonchen; Almtrud nannte ihre Tochter, die bestimmt hundert Kilo auf die Waage brachte, immer noch wie zu Kindergartenzeiten Simonchen, also Simonchen habe auch nichts gehört und sie selber schlafe ja, also, da könnte nebenan die Welt untergehen, sie würde da nichts von mitbekommen.
Heidi stutzte, vor zwei Tagen war sie auch aufgeschreckt mitten in der Nacht. Zuerst glaubte sie einen Schrei gehört zu haben, dann klang es nach dem Gekrächze von herumflatternden Raben. Aber die schliefen normalerweise doch nachts. Ob es vielleicht ein Käuzchen war? Oder doch etwas ganz anderes?
Sie dachte, dass Giovanni mit Simmi wieder irgendwelche wilden Spielchen machte, es war ein seltsames Geräusch, aber sie war noch ziemlich benommen vom Schlaf, lauschte kurz ins Kinderzimmer, dort war aber alles friedlich, und schlief wieder ein. Sie erzählte Almtrud davon, die mit weitgeöffneten Augen Heidis Bericht verfolgte. Hatte ihr Günni also doch nicht gesponnen? Was war dann die Quelle des Geräuschs? Wieso flatterten Krähen nachts durchs Dorf?
Heidi zuckte mit den Schultern. Wer weiß, vielleicht sei ja ein wildes Tier verendet, die gäben ja im Todeskampf manchmal schauerliche Geräusche von sich. Und Krähen waren Aasfresser, möglicherweise hatten sie nur ihre gefiederten Kameraden verständigt, dass es etwas zu fressen gab.
Nachdenklich stapfte Almtrud hinüber zu ihrer Haushälfte. Vielleicht sollte sie Günni ja noch einmal fragen, was er wirklich gehört hatte.
V
Landstraße Nr. 16, kurz vor dem Dorf
Samstag, 29. September 2007
Mit einem schlechten Gewissen schlenderte Ernst Flachbein Richtung Dorf. Er war seit vier Tagen unterwegs. Auf Tour, nannte er seine monatlichen Ausbrüche aus dem Alltag des Dorflebens. Immer, wenn sein Geld alle war, kam er wieder nach Hause zurück. Manchmal reichte es nicht mal mehr für ein Busticket, dann musste er laufen.
Trotz seiner vierundsiebzig Jahre war Flachbein noch gut zu Fuß. Er war eine Frohnatur. Meistens jedenfalls. Im Dorf waren seine Eskapaden bekannt. Die anderen nannten ihn etwas neidisch auch den ewigen Zigeuner. Naja, das Herumzigeunern, das lag ihm im Blut. Schon vor vierzig Jahren zog es ihn hinaus. Damals war er mit dem alten Trecker losgefahren, tuckerte wochenlang durch die Gegend, machte dabei stets einen großen Bogen ums Dorf. Er wollte eben was erleben.
Seine Frau war Kummer gewöhnt. Oftmals wurde sie von der Polizei benachrichtigt, dass sie ihren Mann abholen könne. Er wäre mal wieder aufgegriffen worden. Mittellos, etwas ungepflegt, aber dennoch gesund wie ein Fisch im Wasser.
Meist lag eine Anzeige wegen öffentlicher Ruhestörung vor, manchmal auch eine wegen sexueller Belästigung. Die konnte jedoch immer abgewehrt werden. Flachbein war harmlos, auch wenn er den Frauen manchmal nachstellte. Angerührt hatte er noch keine.
Immer, wenn es ihm gelungen war, ein paar Euro zusammenzusparen, machte er sich auf den Weg. Je nachdem, wieviel Geld er hatte, fiel seine Tour etwas länger oder kürzer aus. Diesmal hatte es genau für vier Tage gereicht.
Übernachtet hatte er einmal in einem alten Heuschuppen, einmal in einer verfallenen Kaserne und einmal unter freiem Himmel. Seine Geldvorräte reichten immer gerade so, um etwas Essbares zu kaufen und sich mit dem Überlandbus oder dem Regio fortzubewegen.
Das Unterwegssein, das war es, was ihn reizte. Die Landschaft an sich vorbeiziehen zu sehen, alle fünf Minuten einen neuen Horizont zu entdecken, dafür lohnte es sich, die Strapazen auf sich zu nehmen und aus dem sicheren Dorfidyll aufzubrechen.
Seine Tour hatte ihn bis an den Rand Brandenburgs gebracht. Noch ein paar Kilometer weiter und er wäre in Mecklenburg-Vorpommern gelandet. Doch davor schreckte er zurück. Nein, so weit weg wollte er nun doch nicht.
Zufrieden mit sich und der Welt zockelte er an dem Samstagmorgen auf der Landstraße Richtung Dorf. Ein Milchtanklaster hatte ihn bis zur großen Kreuzung mitgenommen. Der Milchtanker fuhr weiter in die Prignitz, er musste jetzt nur noch die paar Kilometer bis zum Dorf laufen. Ein schöner Morgenspaziergang, vielleicht drei Stunden Wanderung …
Und dennoch hatte er ein schlechtes Gewissen. Er hatte vor ein paar Wochen, kurz vor seinem vierundsiebzigsten Geburtstag seiner Frau geschworen, nicht mehr auf Tour zu gehen. Nein, mit dem Herumzigeunern sei jetzt Schluss, versprach er ihr. Elvira war skeptisch, doch sie freute sich. Endlich kam der olle Zausel zur Vernunft.
Tja, und dann war es wieder passiert. Die Sehnsucht nach der Ferne kam über ihn wie bei Zigarettenrauchern die Sucht nach dem Nikotin. Aus Elviras Portemonnaie hatte er sich einen Hunderter stibitzt und war einfach so am Mittwochmorgen mit dem Überlandbus losgefahren. Erst im Bus hatte er sich beruhigt. Sie hatte nichts bemerkt, war wie immer rüber zu Wally Wüllersbarth gegangen, um mit ihr Kaffee zu trinken. Wally, eigentlich Waltraud, war ihre beste Freundin.
Er hatte keine wirklichen Freunde im Dorf. Die meisten Nachbarn waren mit sich selbst beschäftigt, grüßten nur kurz und widmeten sich dann ihrem Hof und Garten. Das war ihm zu langweilig. Dutzende Geschichten konnte er erzählen von seinen Touren. Aber sie schienen niemand wirklich zu interessieren. In den kalten Winternächten hatte er angefangen, seine Erlebnisse aufzuschreiben. Aus dem Lebensmittelmarkt hatte er sich ein paar linierte Schulhefte mitgebracht. Die kosteten nicht viel.
Da schrieb er alles hinein. Nicht chronologisch geordnet, nein, so, wie es ihm gerade wieder einfiel. Seine Erlebnisse waren vielfältig und aufregend. Er war in einem russischen Panzer mitgefahren und hatte bei Berufsfischern auf dem Kahn geholfen, hatte zwei Tage in einem Kühlhaus verbracht und war zum Helden avanciert, als er einem kleinen Mädchen das Leben rettete. Die Kleine war beim Baden zu weit hinaus ins Tiefe geraten. Sein beherzter Sprung ins Wasser brachte sie wieder zurück. Prustend und heulend lag sie dann im Gras. Die Mutter hatte sich ebenfalls heulend ihm an den Hals geworfen. Naja.
Als Erntehelfer war er auf einem »Gurkenflieger« gefahren und hatte in den Gewächshäusern Tomaten gepflückt, Spargelstechen war nicht so sein Ding, hatte er aber auch eine Woche ausprobiert. Ein Binnenschiffer nahm ihn einmal elbaufwärts von Mühlberg bis nach Wittenberge mit. Das war toll. Die Welt von einem Schiff aus vorüberziehen zu sehen, war noch einmal etwas ganz Anderes als sie durch das Fenster eines Zuges zu beobachten.
Ein aufregendes Leben war das, er war eigentlich zufrieden mit dem, was er erlebt hatte. Und jetzt war er wieder zurück.
Vielleicht noch zweihundert Meter bis zu den ersten Häusern des Dorfes. Die Landstraße war hier schnurgerade. Links und rechts war die große Einöde der abgeernteten Felder, nichts bot sich dem Auge als Ruhepunkt an außer den Dächern des Dorfes. Selten kam ein Fahrzeug vorbei. Die Landstraße verband nur kleine Flecken miteinander. Irgendwo im Norden mündete sie dann auch in eine größere Fernverkehrsstraße. Er kannte die Stelle. Ein gelbes Schild zeigte schon lange vorher den Abzweig an.
Jetzt kam erst einmal ein grünes Schild mit gelben Buchstaben. Das waren die neuen Ortsteilbezeichnungen. Seit acht Jahren war das Dorf kein eigenständiges Dorf mehr, sondern eingemeindet worden. Der offizielle Name war seitdem »Siedlung Krähwinkel – Gemeinde Ruppiner Heide«.
Flachbein war das egal. Er nannte die vierzehn Häuser inmitten der Felder einfach nur das Dorf.
So wie alle anderen Einwohner auch. Nur die neuhinzugezogenen Leute sprachen von der Siedlung. Das klang immer wie Sibirien, dort gab es Siedlungen. Aber man war nicht in Sibirien, sondern mitten in Deutschland!
Gleich würde er das grüne Schild passieren, dann war er wieder zurück. Eine schwarze Wolke erhob sich kurz vor ihm. Krähen hatten es sich im Straßengraben und auf dem Feld gemütlich gemacht. Wer weiß, was sie gefunden hatten.
Er war schon fast am Schild vorüber, als er die dunkle Gestalt im Straßengraben liegen sah. Zuerst dachte er, es sei ein Vagabund, so wie er auch, der einfach verschlafen hatte.
Doch dann sah er die vielen dunklen Flecken. Das war getrocknetes Blut. Fliegen schwirrten herum. Er traute sich nicht, nachzusehen, wer da im Straßengraben lag.
Schnellen Schrittes lief er ins Dorf. Er brauchte ein Telefon. Sofort. Nein, so was war ihm noch nie vorgekommen. Ein Toter am Straßenrand. Und direkt vor seinem Dorf!
Flachbeins Atem ging schneller. Elvira war ihm entgegengekommen. Sie schaute ihn verstört an. So hatte sie ihren zigeunernden Ehemann ja noch nie erlebt. Mit weit aufgerissenen Augen stammelte er etwas von einem Toten im Straßengraben, und dass die Polizei kommen müsse, es gäbe auch viel Blut.
Ob er fantasiere, fragte sie ihn. Es würde kein Mensch vermisst im Dorf. Da wäre niemand. Wer weiß, was er gesehen habe, vielleicht ein totes Tier.
Flachbein wurde ungehalten. Er wisse wohl, wie ein überfahrenes Reh aussehe, und Rehe trügen keinen Kapuzenpullover, das sei nun einmal Fakt.
Elvira schüttelte den Kopf. Sie war ja froh, dass er wieder gesund und munter zurück gekommen war von seiner Tour. Immer hatte sie Angst, dass ihm etwas passieren könnte.
Mit zitternden Fingern wählte Ernst Flachbein die Eins-Eins-Null. Eine hohe Frauenstimme fragte ihn, ob er Hilfe benötige. Flachbein schilderte kurz seinen Fund, dann legte er auf.
Elvira sah ihn immer noch etwas ungläubig an. Doch nach zwanzig Minuten rollte ein Polizeiauto auf den Hof. Zwei Uniformierte stiegen aus, grüßten höflich und ließen sich von Flachbein noch einmal schildern, was er da im Straßengraben entdeckt habe. Dann nahmen sie ihn mit im Polizeiwagen, er solle doch die Stelle zeigen. Eine Stunde später wimmelte es im Dorf vor Polizei. Ein Krankenauto und ein Leichenwagen waren ebenfalls vor Ort, dazu noch zahlreiche Zivilfahrzeuge. Die Landstraße am Ortseingang war mit rotweißem Flatterband abgesperrt worden.
Flachbein saß in einem weißen Kastenwagen und unterzeichnete das Zeugenprotokoll. Die Leiche aus dem Straßengraben war eines unnatürlichen Todes gestorben. Ein Schnitt mit einem scharfen Messer hatte die Kehle durchtrennt. Der Anblick war selbst für die durch zahlreiche Verkehrsunfälle abgehärteten Beamten gewöhnungsbedürftig.
Nach vier Stunden kam das Dorf wieder zur Ruhe.
Ende der Schonzeit
Das Morgen von gestern ist das Gestern von morgen,
man nennt es auch Heute.
Ein Spruch von Regina Pepperkorn, Profilerin
Ausländer, Fremde, sind es meist, die unter uns gesät den Geist der Rebellion. Dergleichen Sünder, Gottlob! sind selten Landeskinder.
Der Obrigkeit gehorchen, ist die erste Pflicht für Jud und Christ. Es schließe jeder seine Bude. Sobald es dunkelt, Christ und Jude.
Wo ihrer drei beisammen stehn, da soll man auseinander gehn. Des Nachts soll niemand auf den Gassen sich ohne Leuchte
sehen lassen.
Es liefre seine Waffen aus ein jeder in dem Gildenhaus; Auch Munition von jeder Sorte wird deponiert am selben Orte. Wer auf der Straße räsoniert, wird unverzüglich füsiliert; Das Räsonieren durch Gebärden soll gleichfalls hart bestrafet werden.
Vertrauet Eurem Magistrat, der fromm und liebend schützt den Staat. Durch huldreich hochwohlweises Walten; euch ziemt es, stets das Maul zu halten.
Heinrich Heine: »Erinnerung aus Krähwinkels Schreckenstagen« 1834/1835
I
Potsdam
Montag, 1. Oktober 2007
Die Woche begann für Linthdorf mit einem unerwarteten Rapport bei seinem Chef, Kriminalrat Dr. Nägelein.
Seit seiner Rückkehr ins Berufsleben war Hauptkommissar Linthdorf mit keinem neuen Fall betraut worden. Er fristete ein unbefriedigendes Schattendasein im Innendienst. Sortierte Akten, archivierte, registrierte, kopierte, fotografierte, telefonierte …
Linthdorf kam Mitte Juni zurück von einer sechswöchigen Kur. Er erschien den Kollegen gegenüber schmaler und weniger präsent als zuvor. Natürlich, Linthdorf war noch immer eine imposante Erscheinung. Seine lichte Höhe von zwei Metern und vier Zentimetern war einfach nicht zu übersehen.
Aber seine sonst von allen wahrgenommene, starke körperliche Präsenz war nicht mehr so intensiv. Auf Kur hatte er zwölf Kilogramm abgenommen. Das sei für sein angegriffenes Herz gesünder, hatten die Ärzte ihm gesagt. Er hielt sich daran, versagte sich öfters Dinge, die er sonst mit viel Genuss zelebriert hatte.
Keine Schokolade mehr und keine Kekse. Auch die Limonaden verschwanden aus seinem Kühlschrank. Dafür nagte er jetzt öfters Äpfel und Birnen ab. Seine Mittagsportionen waren auch nicht mehr dieselben wie früher. Vorsuppen verschwanden, Nachttisch ebenfalls.
Nägelein hatte bei seiner Rückkehr darauf bestanden, ihm eine sechsmonatige Schonzeit im Innendienst zu verordnen. Linthdorf protestierte zwar, war aber letztlich mit der Weisung Nägeleins ganz gut klargekommen.
Er war ausgeglichener, fühlte sich zufriedener und glücklicher. Die Melancholie, die sonst immer ein wenig seine offen zur Schau gestellte Freundlichkeit begleitete, war verschwunden. Linthdorf war angekommen im Hier und Jetzt. Nur selten noch gönnte er sich lethargische Auszeiten, in denen er grübelnd und seufzend den vergangenen Zeiten nachhing. Die dunklen Schatten der Vergangenheit schienen keine Macht mehr über ihn zu haben.
Der Innendienst brachte neben der etwas eintönigen Arbeit auch einen regelmäßigen Wochenrhythmus mit sich. Die Wochenenden waren frei, Linthdorf hatte plötzlich den Luxus, über zwei freie Tage an jedem Wochenende zu verfügen.
Freitagabend fuhr er mit seinem geliebten SuV Richtung Thüringen, nach Weimar. Dort blieb er bis Montag früh. Seit seinem Kuraufenthalt hatte er Thüringen als Kulturland für sich entdeckt. Aber der Hauptgrund für die Wochenendfahrten war ein ganz anderer: er war groß, blond und lächelte ihn an. Milena.
Milena war in Linthdorfs Leben gekommen wie ein Regenschauer, der auf trockene Erde fiel. Sie war intelligent, kultiviert, sinnlich, eben alles, was er brauchte, um mit sich ins Reine zu kommen und dabei gleichzeitig für andere wieder da zu sein. Sie war sein Ruhepol und Energiequell.
Im Sommer waren sie zusammen verreist. Mit dem Auto bis nach Mostar in Bosnien-Herzegowina, Milenas alte Heimat. Eine abenteuerliche Tour war es geworden. Über Dresden, Prag, Wien nach Ljubljana, dort in den Karawanken ein paar Tage geblieben, einen Abstecher nach Triest in Italien, dann weiter nach Istrien, Rijeka, entlang der dalmatinischen Küste bis Dubrovnik. Schließlich Mostar mit seiner zauberhaften Kulisse, der wiedererrichteten Brücke über der grünschimmernden Neretva und dem Besuch bei Milenas Mutter und ihren Verwandten. Zurück dann über Sarajevo, Budapest, Bratislava. Eine dreiwöchige Reise.