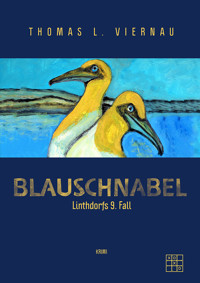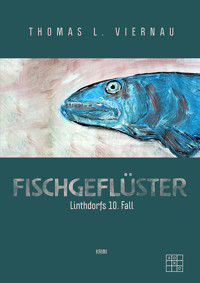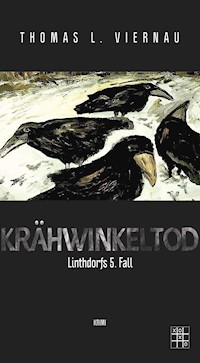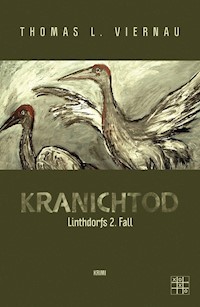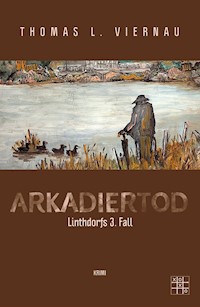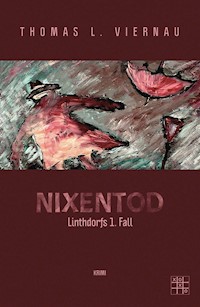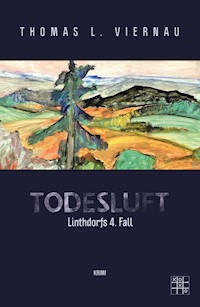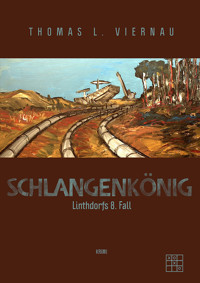
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Linthdorfs Fälle
- Sprache: Deutsch
Die Lausitz ist bekannt für ihre Kohletagebaue, riesige Kraftwerke und damit verbundenen wirtschaftlichen Umbrüchen. Aber sie steht auch für eine reiche Geschichtstradition, geprägt von den Sagen und Mythen der kleinen, sorbischen Minderheit, die es geschafft hat, ihre kulturelle Eigenständigkeit durch die Jahrhunderte hindurch zu bewahren. In der Lausitzmetropole Cottbus geht nachts der Schlangenkönig wieder um und verbreitet Furcht und Schrecken; eine Figur, die schon seit vielen Generationen populär ist. Ob der ominöse Schlangenkönig Schuld am Tod des Studenten hat, der als verkohlte Leiche aus dem Osterfeuer gezogen wird, ist unklar. Auf alle Fälle wurde er im Umfeld der schaurigen Fundstelle von mehreren Leuten gesehen. Kurze Zeit später finden die Cottbuser Kriminalisten ein paar brutal zugerichtete Leichen in einem Haus am Altmarkt. Wieder sind es Studentinnen… Kommissar Linthdorf wird mit herangezogen von seinen Cottbuser Kollegen, als es darum geht, die Reihe grausamer Morde im Studentenmilieu aufzuklären. Die Spur führt Linthdorf zu Kohlegegnern, Verschwörungstheoretikern, Kleingärtnern und Ökofreaks.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 735
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schlangenkönig
Tod in der Lausitz
Band VIII
Ein Brandenburg-Krimi
von Thomas L. Viernau
Zum Autor:
Thomas L. Viernau wurde 1963 in Suhl/Thüringen geboren. Nach einem Wirtschaftsstudium war er u.a. als Journalist, Maler und Graphiker tätig. Er lebte lange Zeit als selbständiger Kaufmann in Berlin.
Mit Brandenburg verbindet ihn eine langjährige Liebe. Zahlreiche Touren führten ihn in die verborgenen Winkel dieses Landstrichs. Nachdem er sieben Jahre in einem alten Feldsteinhaus mitten im Märkischen Oderland verbrachte, ist er inzwischen in der Lausitz angekommen. Heute lebt er in Cottbus.
Für Viola …
Inspirierende Muse und rationale Kritikerin zugleich. Gewidmet mit all meiner Leidenschaft, und natürlich unserer gemeinsamen Liebe zur Literatur.
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-099-6
eBook-ISBN: 978-3-96752-602-8
Copyright (2024) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung: Grit Richter, XOXO Verlag
Buchsatz, Bilder und Grafiken: Thomas Lünser
Hergestellt in Deutschland (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Alte Heerstraße 29 | 27330 Asendorf
Alle Personen und Namen innerhalb dieses Buches sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Zur Handlung:
Die Lausitz ist bekannt für ihre Kohletagebaue, riesigen Kraftwerke und den damit verbundenen wirtschaftlichen Umbrüchen. Aber die Lausitz steht auch für eine reiche Geschichtstradition, geprägt von den Sagen und Mythen der kleinen, sorbischen Minderheit, die es geschafft hat, ihre kulturelle Eigenständigkeit durch die Jahrhunderte hindurch zu bewahren. In Cottbus, der Lausitzmetropole, geht nachts der Schlangenkönig wieder um und verbreitet Furcht und Schrecken; eine Figur, die schon seit vielen Generationen gefürchtet wird.
Ob der ominöse Schlangenkönig Schuld am Tod des Studenten hat, der als verkohlte Leiche aus dem Osterfeuer gezogen wurde, ist unklar. Auf alle Fälle sahen ihn mehrere Leute im Umfeld der schaurigen Fundstelle. Kurze Zeit später finden die Cottbuser Kriminalisten ein paar brutal zugerichtete Leichen in einem Haus am Altmarkt. Wieder sind es Studentinnen…
Kommissar Linthdorf wird mit herangezogen von seinen Cottbuser Kollegen, als es darum geht, die Reihe grausamer Morde im Studentenmilieu aufzuklären. Die Spur führt Linthdorf zu Kohlegegnern, Verschwörungstheoretikern, Kleingärtnern und Ökofreaks.
Parallel zu Linthdorfs Ermittlungen spielt sich ein Drama in grauer Vorzeit ab. Tausend Jahre zuvor lebten die Elbslawen, allesamt westslawische Völker, deren Nachfahren die Wenden und Sorben sind, auf dem Gebiet des heutigen Brandenburgs. Ihr Leben im Fokus sich gerade formierenden Königreiche war nicht einfach. Nur wenig ist von ihnen übriggeblieben, ihre Spuren verlaufen sich… aber es gibt auch noch kleine Wunder: echte Schätze, eine reichhaltige Sagenwelt und das Wissen um die Verletzbarkeit unserer Natur und Umwelt, sind bewahrt worden. Ihr Erbe geistert noch heute durch die Köpfe vieler Menschen, speziell in der Lausitz.
Wer wirklich hinter den Morden steckt, ahnt keiner. Erst ein paar unscheinbare Hinweise aus der alten Slawenzeit bringen die Ermittler schließlich auf die richtige Spur.
Personenverzeichnis:
Ermittler in Potsdam:
Theo Linthdorf, KHK beim LKA Potsdam
Dr. Nägelein, Kriminaloberrat, Dienststellenleiter beim LKA
Regina Pepperkorn, Profilerin (operative Fallanalytikerin)
Ermittler in Cottbus:
Jan Terpin, KHK bei der Kripo in Cottbus
Margret Alpan, KHK bei der Kripo in Cottbus
Daniel Pepusch, KOK bei der Kripo in Cottbus
Leute in Cottbus:
Ströbitzer Kleingartenkolonie »Blütenglück«:
Karlheinz und Elvira Patzukowski, Rentnerehepaar
Eberhard Rödelheim, Parzellennachbar und Frührentner
Olli, Fränki, Rudi, Ralle, Lumpi, weitere Parzellennachbarn
Anni, Elsi, Tini, Geli, Bowi, Cori, Bini, Gabi, deren Frauen
»Heavy Wheelz«-Bande:
Joachim »Jo« Kulka, Kopf der Bande, auch der »Teufel von Ströbitz« genannt
Ingo Klauke, ehemaliger Freund von Mariana Huschke
»Eisenzahn« und »Rettich«, zwei schwere Jungs, Störenfriede
Cottbuser Fremdenverkehrsamt:
Achim Wintervogel, Leiter des Fremdenverkehrsamts
Hanka Puhl und Vera Knospe, Mitarbeiterinnen
Ferdi Cointz und Falko Gliencke, Studenten, aushilfsweise als Postkutscher beim Fremdenverkehrsamt angestellt
Cottbuser Universität:
Mandy Klatt, Studentin der Mediawissenschaften
Cindy Wöhler, Studentin der Mediawissenschaften
Mariana Huschke, Tochter von Gerwin und Gundula, Studentin für Maschinenbau
Leute aus dem Lausitzer Umland und den Cottbuser Vororten:
Olaf Groppendieck, Polizeidienststellenleiter in Peitz
Melissa Kohlhase, Polizistin in Peitz
Albertchen, Elvira, Edwin, Rentner aus Maust/Teichland
Ursula Witschenreuter, die Tänzerin im Park Branitz
Brigitte Hauschka, Verwaltungsbeamte in Welzow
Gerwin Huschke, Lebenskünstler / Protestler aus Proschim
Mirko Geyermeier, Treckerfahrer aus Sibirien bei Welzow
Elvira Flachsmicke, Lehrerin aus Peitz
Oberkommissar Gnaupel, Dienststellenleiter in Cottbus-Sandow
Dr. Gundram Fabricius Splettenhusen, Unternehmer, Visionär, Organisator
Gundula Huschke, geschiedene Ehefrau von Gerwin, Stationsschwester
Jurek Kaczorka, ein einsamer Mitbürger mit Schlafproblemen
Aus der Lausitzer Slawenzeit:
Dobislav und Bohimer, Hohepriester der Lusizen
Cescimir, Ältester des Ältestenrats der Lusizen
Snezana, Heilkundige und Wahrsagerin der Lusizen
Dragomir, Fürstensohn der Heveller
Vlad und Zdravko, Krieger vom Stamm der Heveller
Jacza, Fürst der Sprewanen
Milusa, Tochter des Sprewanenfürsten Jacza
Radoslava, Hohepriesterin der Milzener
Branislava, Schwester von Radoslava
Pribislav, Fürst der Heveller
Vratislav, sein erstgeborener Sohn, Bräutigam von Milusa
Dobislava, Tochter eines daleminzischen Knes
Slavomir, Fürst der Milzener
Strob, Hofbesitzer unweit Copsebuz
Jaro und Miran, lusizische Burschen im Dienste Snezanas
Helmold von Bosau, Chronist, Verfasser der Chronica Slavorum
Arnold von Lübeck, Bischof
Gerold von Aldenburg, Bischof
Prolog
Und dass dem Netze dieser Spreekanäle
Nichts von dem Zauber von Venedig fehle,
Durchfurcht das endlos wirre Flussrevier
In seinem Boot des Spreewalds Gondolier
Theodor Fontane, aus »Wanderungen durch die Mark Brandenburg«, Band IV, »Das Spreeland«
Die Sage vom Schlangenkönig
Tief im finstersten Sumpf des oberen Spreewaldes lebte er: der Schlangenkönig, Herrscher über alle Reptilien, die in dem Labyrinth der Wasserstraßen und auf den Sumpfwiesen des Spreewaldes lebten. Der Schlangenkönig konnte vielerlei Gestalt annehmen, meist jedoch war er als ein prächtig glitzerndes Reptil mit einem kunstvoll gearbeiteten Krönchen zu erblicken.
Oft nutzte er die warmen Sommertage, um sich zu sonnen. Da wurde er auch für die Bewohner des Spreewalds sichtbar. Ansonsten machte er sich rar, galt als ein ausgesprochen scheues Wesen.
Aber der Schlangenkönig wäre kein Zauberwesen, wenn er es nicht verstünde, sich den wechselnden Bedingungen in seinem Reich anzupassen. Im Winter kam er auch schon mal in Menschengestalt einher, der um Einlass in eine warme Stube bat. Im Frühling trat er als Tänzer beim wilden Ritt ums Osterfeuer auf und im Herbst war er mit dabei, wenn die »Wilde Jagd« durch die rauen Novembernächte ritt.
Für die Leute im Spreewald war er stets präsent, egal in welcher Gestalt er auftrat. Sie hatten sich mit ihm arrangiert, achteten ihn und brachten ihm auch kleine Geschenke vorbei.
Ein reicher Kaufmann aus dem Ausland erfuhr beim Durchqueren des Spreewaldes vom Schlangenkönig. Die Bauern und Fischer erzählten ihm ausführlich von ihren Begegnungen mit dem Zauberwesen, berichteten von der kleinen, goldenen Krone, die er stets trug und von den unermesslichen Schätzen die er tief im Spreewald bewachte. Der Kaufmann bekam spitze Ohren.
Natürlich, die Raffgier hatte ihn schon lange im Griff. Er wollte immer mehr… Also sann er darüber nach, wie er sich des Schlangenkönigs bemächtigen könnte. Beim Belauschen der abendlichen Erzählungen der einheimischen Frauen bekam er einen nützlichen Hinweis. Eine der Dorffrauen berichtete, dass sie bereits des Öfteren den Schlangenkönig beim Sonnen auf den Spreewiesen beobachtet hatte. Der Schlangenkönig würde dabei stets sein Krönchen ablegen und sich auf einem ausgebreiteten, weißen Leinentuch ausstrecken. Dabei wäre er verletzlich, denn er trug ja seine Krone nicht mehr, die ihn normalerweise vor jeglichen Angreifern beschützte.
Der Kaufmann war zufrieden über das, was er aufgeschnappt hatte. Am nächsten Tag folgte er der Dörflerin, die zum Heuwenden auf die Spreewiesen am Rande des Sumpfwaldes ging. Er hatte ein schönes, weißes Tuch aus feinstem Batist mit in
seiner Tasche, dass er heimlich ausbreitete. Der Schlangenkönig kam pünktlich zur Mittagszeit herbei, sah das weiße Tuch und ließ sich freudig darauf nieder. Flugs schnappte er sich das Krönchen und auch das weiße Tuch, auf dem sich der Schlangenkönig sonnte. Mit seinem Fang eilte er davon, darauf hoffend, die sagenhaften Reichtümer des Schlangenkönigs zu erbeuten.
Nur kurze Zeit später ward der Kaufmann wieder gesehen. Er hatte sich ein pompöses Schloss bauen lassen, fuhr in einer goldenen Kutsche vor und tafelte wie ein
Fürst. Der Kaufmann war unvorstellbar reich geworden…
Aber die Leute im Spreewald wurden von Stund‘ an plötzlich arm. Die Ernten fielen aus, da Unwetter das Getreide auf den Halmen verfaulen ließ, Seuchen rafften die Tiere der Bauern dahin und der Feuerteufel wütete in den Dörfern. Den Schlangenkönig hat seither niemals wieder ein Sterblicher zu Gesicht bekommen.
Lausitzer Sage – existiert in vielen Varianten, die allesamt jedoch denselben bitteren Ausgang
Peitzer Teichland – Gatojce, bei Cottbus
Sonnabend, 3.April, 2010
Das Osterwochenende war kalt und nass. Dennoch hatten sich viele Leute für das alljährliche Spektakel begeistern lassen und waren, dick einmummelt, in einem großen Kreis um das Osterfeuer versammelt.
Die Dorfjugend von Maust, eines der prosperierenden Dörfer im Teichland, hatte auch in diesem Jahr einen riesigen, fast fünf Meter hohen Stapel aufgeschichtet. Alte Bretter, ausrangierte Möbel, der Gartenbaumschnitt aus dem letzten Winter und klobige Holzpfosten eines abgerissenen Gartenzauns waren zu einem Großkunstwerk gestapelt worden. Ganz oben thronte auf einer langen Rute die Winterhexe, eine Strohfigur, der man alte Klamotten angezogen und ein böses Gesicht angemalt hatte.
Die Freiwillige Feuerwehr überwachte den Stapelbau und war auch mit Wasserschläuchen zur Stelle, falls das Feuer außer Kontrolle geraten sollte.
Fast eine Woche hatten die Enthusiasten an dem Stapel gebaut. In den letzten Tagen vor Ostern musste er sogar bewacht werden, da die Jugend aus den Nachbardörfern gern die Stapel ihrer Konkurrenten – es gab einen ungeschriebenen Wettbewerb der Lausitzer Dörfer, wer das größte Osterfeuer entfachen konnte – einfach stibitzte.
Auch in diesem nassen Frühling waren sie unterwegs. Mit Treckern wurden Stapel zum Einsturz gebracht und die besten Stücke auf den Hänger geworfen, um sie im eigenen Stapel zu verwenden.
Das Ganze wurde immer still und heimlich in den Nächten vor Ostern organisiert. Aber die Mauster Osterfeuermacher hatten Glück. Ihr Stapel blieb verschont. Nebenan in Neuendorf war der Stapel in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag zusammengefallen. Möglicherweise hatte dabei jemand nachgeholfen. Genaues wusste man nicht.
Im Teichland, auf Niedersorbisch Gatojce, waren die Dörfer Bärenbrück, Maust und Neuendorf vereinigt, dazu noch die Außenposten Maustmühle und Kleine Heide, direkt daneben die Dörfer Heinersbrück, Jänschwalde und das Städtchen Peitz, dessen zahlreiche Karpfenteiche die Gegend prägten und auch den Namen gaben.
Inmitten der Teichlandschaft thronte wie ein Relikt aus einem Science Fiction das Kraftwerk Jänschwalde. Gewaltige Kühltürme, die riesigen Blöcke der Turbinen und zahlreiche Schornsteine prägten die Silhouette des Kraftwerks, dessen weiße Wolkengebirge, die aus den Kühltürmen aufstiegen, aus allen Himmelsrichtungen überm Teichland zu sehen waren. Sie waren das unangefochtene Wahrzeichen des Teichlandes, Garanten für den Wohlstand der Gegend und Relikte einer einst ruhmreichen Zeit, als die Teichlandleute noch das schwarze Gold aus der Erde holten. Der letzte große Tagebau, Cottbus-Nord, war nur noch eine große Grube, die sich langsam mit Spreewasser füllte. Aber das war schon wieder eine andere Geschichte aus einer neuen Zeit.
Jetzt galt es, den Blick nach vorn zu richten und das Beste aus den Hinterlassenschaften der Kohlezeit zu machen. Die Teichländer setzten auf Tourismus, wollten ein Naherholungszentrum werden. Vielfältige Aktionen wurden ins Leben gerufen. Auch das Osterfeuer wurde von den Einwohnern stets mit viel Aufwand inszeniert.
Bereits am späten Nachmittag hatten die Feuerwehrleute den Stapel in Brand gesetzt, so dass er in den späten Abendstunden als helllodernde Fackel weit ins Land sichtbar war. Die Flammen züngelten bis zu zwanzig Meter in die Höhe. In der Mitte hatte sich ein gewaltiger Glutherd gebildet, dessen Wärme noch in dreißig Meter Abstand zum Feuer zu spüren war. Die Dorfbewohner prosteten sich zu, viele hatten die allseits beliebten »Taschenrutscher« mit dabei, gefüllt mit Hochprozentigem. Alte Männer und junge Burschen prosteten sich zu, kippten sich mit weit geöffneten Augen die Spirituosen in den Rachen und freuten sich dabei, wenn es in der Kehle ein wohliges Brennen gab. Die jungen Mädchen tranken lieber die kleinen Likörfläschchen, die es in großer Auswahl im Spreewald und der ganzen Niederlausitz zu kaufen gab.
Die Jugendlichen sangen Lieder, kicherten und lachten. Die Stimmung war ausgelassen. Jeder hatte etwas zu erzählen und freute sich über dankbare Zuhörer.
Um das Feuer liefen die Feuerwehrleute in ihren wärmeabweisenden Einsatzuniformen herum. Es konnte schon mal passieren, dass ein großes Holzscheit aus dem Stapel fiel, das dann mit viel Funkenregen und lautem Bersten einen letzten Flug absolvierte.
Einer der Feuerwehrleute hatte beim Beobachten des Feuers eine seltsame Vision. Sah das nicht wie ein Mensch aus, was da mitten im Feuer stand? Konnte eigentlich nicht sein. Zumal die Winterhexe bereits in Flammen aufgegangen war.
Er tippte seinen Kollegen an und zeigte ihm die Gestalt im Feuer. Der stutzte ebenfalls, holte einen langen Haken herbei mit dem das Holz auseinandergezogen werden konnte, wenn der Stapel zu instabil wurde. Gemeinsam hakten sie das seltsame Gebilde aus dem Feuernest, zogen mit viel Anstrengung das Ganze heraus und bekamen einen großen Schreck. Vor ihnen lag eine halbverkohlte Leiche, schwer erkennbar, ob Mann oder Frau.
Die Osterfeuerbesucher versammelten sich inzwischen um den grausigen Fund, der noch an Armen und Beinen glühte. So etwas hatte es bisher noch nie gegeben bei einem Osterfeuer!
Im Hintergrund bewegte sich eine dunkle Gestalt inmitten der Gaffer. Fast war die Gestalt mit der dunklen Nacht verschmolzen. Ein Gesicht war nicht erkennbar, das weite Regencape machte es zudem schwer, etwas zur Statur und Größe der Gestalt auszusagen, aber das interessierte im Moment sowieso niemanden. Alle waren nur damit beschäftigt, in die Nähe des Osterfeuers zu kommen, um wenigstens einen flüchtigen Blick auf die halbverkohlte Leiche zu werfen.
Einer der Feuerwehrleute hatte inzwischen die Polizei benachrichtigt. Alle Besucher waren paralysiert von dem grausigen Fund. Als in der Ferne das Blaulicht aufzuckte und das dazu gehörige auf- und abschwellende Sirenengeräusch ertönte, ging ein spürbares Geräusch der Erleichterung durch die Leute. Die ominöse Gestalt mit dem Regencape jedoch verschwand im Dunkel der Nacht.
Spurensuche im Feuer
Komm, schönes Jungfräulein, schlafe bei mir! Ich hab’ ein Goldringlein, das schenk’ ich dir, Ich hab’ ein Goldkämmerlein, das ist für dich, Ich hab’ ein Goldwiegelein, drin wieg’ ich dich.
Komm, schönes Jungfräulein, schlafe bei mir! Süßen und kühlen Wein trinkst du bei mir, Zucker heißt hier das Brot, Fleisch Marzipan, Äpfelchen rosenrot beißt dein Zahn.
Komm, schönes Jungfräulein, schlafe bei mir! Dienerinnen hübsch und fein warten an der Tür, Kammerfrau’n ohne Zahl stehen am Bett, Das in dem goldenen Saal hochzeitlich steht.
Komm, schönes Jungfräulein, schlafe bei mir! Zieh in mein Schloss mit ein, treu bin ich dir. Heißa! wie fliegt zum Tanz lustig der Strich! Du trägst den Hochzeitskranz, Bräut’gam bin ich.
Ernst Moritz Arndt »Lied des Schlangenkönigs«, 1818 erschienen im Erzählband
»Der Schlangenkönig«
I
Peitzer Teichland – Gatojce, bei Cottbus
Sonnabend, 3.April, 2010
Es war kurz vor Mitternacht. Das Gelände rings um das Osterfeuer glich einem generalstabsmäßig abgesteckten Operationsgebiet. Flatterband war überall gespannt worden. Polizeiwagen standen herum, dazu die Transporter der Kriminaltechnik und ein schwarzer Leichenwagen, der dezent etwas abseits parkte. Überall liefen Uniformierte zwischen den Absperrungen hin und her, die rotierenden Blaulichtrundumleuchten verbreiteten ein gespenstisches Licht.
Hinter einer Absperrung waren die beiden Ermittler Margret Alpan, eine resolute Endvierzigerin und Daniel Pepusch, ein blonder Hüne, der vielleicht Mitte Dreißig war, damit beschäftigt, die Aussagen der Beteiligten zu protokollieren. An der halbverkohlten Leiche hatten sich die Spurensucher und Gerichtsmediziner in ihren weißen Schutzanzügen zu schaffen gemacht. Jeder Quadratzentimeter wurde akribisch untersucht und dokumentiert.
Pepusch, dessen strahlend blaue Augen aus einem noch jugendlich frischem Gesicht schauten und ihm etwas Naives, Unschuldiges verliehen, war nicht begeistert von dem abendlichen Einsatz. Allerdings, ein so spektakuläres Ereignis wie eine Leiche im Osterfeuer war für den Kriminaloberkommissar schon etwas Außergewöhnliches.
Seine Partnerin, Kriminalhauptkommissarin Margret Alpan, war im Laufe ihres Berufslebens bei der Mordkommission schon einiges gewöhnt, vor allem der Anblick von gewaltsam aus dem Leben gerissenen Personen bereitete ihr nicht mehr allzu viel Nervenkitzel. Der Anblick der halbverkohlten Leiche war jedoch schon gewöhnungsbedürftig. Diese Bilder wieder aus dem Gedächtnis zu bekommen, würde viel Zeit benötigen. Sehr viel Zeit…
Bisher war der Erkenntnisgewinn noch nicht sehr groß. Keiner der Befragten wusste etwas über die Herkunft des Toten, niemand konnte etwas dazu sagen, wie der oder die Tote ins Osterfeuer geraten war. Trotz, dass der Holzstapel Tag und Nacht bewacht wurde, musste es jemandem gelungen sein, die Leiche dort zu platzieren. Möglicherweise war das Opfer sogar noch am Leben…
Aber das mussten die Gerichtsmediziner klären, falls das überhaupt noch feststellbar sein würde. Die menschlichen Überreste der zu siebzig Prozent verkohlten Leiche boten nur bedingt noch genügend Biomaterial zur eingehenderen Untersuchung.
Einer der Techniker schien etwas entdeckt zu haben. Etwas Blinkendes war in der mit Latex behandschuhten Hand des Mannes zu sehen. Es war silbern, klein und rund. Ein Schmuckstück? Ein Medaillon?
Pepusch hatte den Techniker herbei geholt. Der kleine Gegenstand war ein Ring, kunstvoll gearbeitet, eine Schlange darstellend, deren Kopf eine Krone trug. Es war der Schlangenkönig, ein sagenumwobenes Symbol, das für die geheimnisvollen Kräfte im Spreewald und der Lausitz stand. Wer so einen Ring trug, fühlte sich der heimischen Natur verbunden, glaubte an die Kraft der alten Mythen und war offen für Esoterik und andere marginale Wissensbereiche.
Pepusch kannte den Ring und wusste um die besonderen Eigenschaften der Ringträger. Es gab in Cottbus diverse esoterische Zirkel, in denen neben dem Symbol des Schlangenkönigs auch noch ganz andere Symbole populär waren. Da war der Schlangenkönig noch harmlos…
Bisher war die Szene jedoch noch nicht durch Gewaltdelikte aufgefallen. Pepuschs strohblonde Augenbrauen zoge4n sich in die Höhe. Auch Margret Alpan war mit der Symbolik vertraut.
Sollte die halbverkohlte Leiche aus dem Umfeld esoterischer Geheimbünde stammen? Hatte sich der oder die Tote etwas zuschulden kommen lassen, was seinen Feuertod erklärte? Oder war der oder die Tote vielleicht ein Opfer interner Konkurrenzkämpfe geworden?
Pepusch wollte eigentlich dem Ring nicht allzu viel Bedeutung zukommen lassen. Wer weiß, womöglich hatte der Ring auch gar nichts mit dem Leichenfund zu tun und war ganz zufällig gefunden worden. Er betrachtete die kunstvolle Ziselierarbeit noch einmal genauer, konnte auf der Innenseite des Rings neben dem Silberstempel zwei nachträglich gravierte Initialen entdecken. Kunstvoll waren ein G, ein F und ein S miteinander zu einem Monogramm verwoben. Ein erster Anhaltspunkt für die Klärung der Identität der oder des Toten.
Sorgsam zeichnete er die Initialen in seinen Notizblock. Die Gravur sah sehr professionell aus, er würde alle Goldschmiede und Juweliere der Stadt kontaktieren müssen. Womöglich erfuhr er ja auch noch etwas über die Herkunft des Schlangenrings.
Die Techniker waren inzwischen fertig mit ihrer Arbeit und die Gerichtsmediziner hatten sich der verkohlten Überreste angenommen und transportierten die Leiche ab. Margret Alpan gab ein Zeichen zum Aufbruch. Hier gab es nicht mehr viel zu tun für sie.
Alle Zeugenaussagen waren aufgenommen, alle Personalien der anwesenden erfasst, sie schaute kurz auf die Uhr, es war kurz nach Drei. Die Zeit für noch ein bisschen Schlaf war knapp bemessen.
Sie verabschiedete sich von Pepusch, verabredete sich dabei gleich für Sonntagmorgen um Neun zu einer Besprechung mit ihrem Chef, Kriminalhauptkommissar Jan Terpin, dem sie bereits eine ausführliche Nachricht auf elektronischem Wege zugesandt hatte.
Die Blaulichtfahrzeuge waren bereits verschwunden. Im Dunkel der Nacht waren noch ein paar Uniformierte mit Taschenlampen zu beobachten, die den Überresten des noch spärlich glimmenden Osterfeuers ihre Aufmerksamkeit widmeten.
Die beiden Kriminalisten fuhren in ihrem Volvo-Kombi davon.
Die dunkle Gestalt mit dem Regencape beobachtete den Rückzug der Beamten aus sicherer Entfernung, sorgsam darauf achtend, kein Geräusch zu machen oder gar durch etwaige reflektierende Teile die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie war eins mit der Dunkelheit der Nacht, fast ein Teil von ihr.
Nach nur wenigen Augenblicken war die Gestalt verschwunden, wieder eins geworden mit der Anonymität der Nacht.
II
Polizeidirektion Süd, Cottbus
Sonntag, 4.April, 2010
Für den Ostersonntagmorgen hatte sich Margret Alpan auch etwas anderes gewünscht als eine Dringlichkeitssitzung in den Diensträumen der hiesigen Polizeidirektion. Überall war gähnende Leere, nur in der Abteilung für Kapitalverbrechen, kurz auch »Mord & Totschlag« genannt, war reges Leben. Der gestrige Leichenfund im Osterfeuer hatte die gesamte Abteilung in Alarmbereitschaft versetzt. Dass es sich bei dem Fund um keinen banalen Unfall handelte, war den Beteiligten sofort klar.
Hier war etwas grundsätzlich Böses passiert. Einen Menschen in einem Osterfeuer zu platzieren war eine Blasphemie. Der Ort und der Zeitpunkt wiesen auf einen rituellen Akt hin, getrieben von einer dunklen, tief sitzenden Wut.
Margret Alpan kannte sich aus mit der alten Sagenwelt und Mythologie der sorbischen Lausitz, sie war in einer sorbischen Familie in einem kleinen Dorf unweit der Stadt Spremberg aufgewachsen.
Ihre Großmutter konnte noch fließend das Niedersorbische sprechen, sang ihr abends Lieder vor und las ihr auch alte Märchen und Sagen am Bett vor. Sie erinnerte sich an ihre Großmutter als eine Frau, die stets in dunkler Tracht gekleidet war und ein wenig an die Zauberwesen erinnerte, von denen sie ihr oft erzählt hatte. Irgendwann, die Großmutter war schon lange tot, verschmolz das Bild von ihr mit den Sagengestalten und Margret hatte Mühe, die Realität von der Sagenwelt zu unterscheiden. Sie musste jedes Mal den Kopf schütteln, wenn sich in die Erinnerungen an ihre Kindheit Gestalten wie der grünhäutige Wassermann, die zwergenhaften Lutki und die zwielichtigen Spreenymphen, die geheimnisvolle Mittagsfrau und der respektheischende Schlangenkönig einschlichen, die ganz selbstverständlich mit an dem großen Tisch ihres elterlichen Bauernhauses saßen und im großen Garten mit herumtollten.
Jan Terpin war bereits in seinem Büro, als die übrigen Beamten der Abteilung eintrudelten. Er hatte vorab bereits alle Protokolle und Berichte gelesen, die am Vorabend noch während der ersten Befragungen geschrieben worden waren. Terpin, ein Mann in den Fünfzigern, war ein ruhiger, mit den Worten eher sparsamer Chef der Abteilung »Kapitalverbrechen« in der Polizeidirektion-Süd. Offiziell wurde die Abteilung so bezeichnet, aber alle nannten sie umgangssprachlich nur »Mord & Totschlag«. Es klang genauer und versuchte nicht, wie so viele Verharmlosungen im Amtsdeutsch, den Kern des Ganzen zu verdecken. Kapitalverbrechen waren für viele Normalmenschen nicht unbedingt Gewaltdelikte. Aber es handelte sich genau darum. Akte brutaler Gewalt, die für die Betroffenen meist tödlich ausgingen.
Die Abteilung war daher stets bemüht, alle Fälle, die ihr zugetragen wurden, vollständig aufzuklären. Terpin war ein alter Fuchs, hatte ein sicheres Gespür für Ungereimtheiten und konnte seine Leute ohne viel Aufwand effektiv leiten. Seine Persönlichkeit galt unter den Kollegen als integer. Terpin hatte jahrelang als operativer Ermittler gearbeitet und sich so das Rüstzeug für seinen Job als Abteilungschef verschafft.
Ob der Leichenfund mit einem Tötungsdelikt in Verbindung stand, galt es zu klären. Der Bericht der Gerichtsmedizin ließ noch auf sich warten. Terpin seufzte. Die Konstellation Leichenfund im Osterfeuer barg Zündstoff.
In der Lausitz waren Osterfeuer weit verbreitet und galten als populäre Symbole für das Wiedererwachen der Natur nach einem langen, dunklen Winter, sie standen auch für Fruchtbarkeit und Wachstum, waren damit etwas Lebensbejahendes. Wenn nun inmitten eines solchen Feuers plötzlich der Tod präsent war, konnte es sich dabei nur um eine sehr ernst zu nehmende Botschaft handeln, gerichtet an alle, die dem freudigen Kult ums Osterfeuer huldigten.
Der Fund des Silberrings mit dem Schlangenkönig deutete zudem auf ein Umfeld, dass sich dieser Symbolik sehr bewusst war. Terpin kritzelte mit seinem Kugelschreiber auf seinem Notizblock herum, während er seine Gedanken schweifen ließ. Spiralen und Kreise bildeten ein kompliziertes Muster auf dem Blatt. Kopfschüttelnd riss er das Blatt aus dem Block und zerknüllte es. Keine Zeit für psychedelische Spielereien! Es gab einen Toten…
Seufzend erhob er sich und ging zum Konferenzsaal, der am anderen Ende des langen Ganges lag. Vor ihm stapfte der junge Pepusch und verdeckte mit seinem breiten Rücken die Sicht nach vorn.
Margret Alpan stand bereits vor der Tür und erwartete ihn. Unterm Arm hatte sie sich die Akte der Gerichtsmediziner geklemmt. Terpin nickte ihr zu. Sie sollte berichten.
Die Ermittlerin lieferte ein paar kurze Sätze zum gestrigen Leichenfund und den Begleitumständen. Dann zitierte sie aus der Akte der Gerichtsmedizin. Es handelte sich um eine männliche Person, nicht älter als Mitte Zwanzig. Nach der Überprüfung des Zahnstatus und einer ersten DNA-Analyse konnte ein junger Mann ermittelt werden, der als Student an der Landesuniversität Cottbus eingeschrieben war: Ferdinand Cointz, 23 Jahre alt, gebürtig in Senftenberg, seit zwei Jahren Student der Medienwissenschaften.
Terpin atmete tief durch. Immerhin, einen ersten Anhaltspunkt hatten sie nun. Sie kannten das Opfer. Was nun gerade ein Student aus Cottbus im Osterfeuer einer Umlandgemeinde zu suchen hatte, war weiterhin ein Geheimnis. Es wäre wohl besser gewesen, wenn der Tote aus dem direkten Umfeld des Peitzer Teichlands stammen würde. Dann hätte man viel schneller so etwas wie ein Motiv gefunden. Aber ein Student…
Normalerweise hatten die Cottbuser Studenten nur wenige Berührungspunkte mit dem Umland. Die typischen Studentenkneipen und Treffpunkte waren allesamt in Cottbus angesiedelt.
Terpin schnaufte. Er befand sich eigentlich im Sondereinsatz zu den Ostertagen im Stab der eigens dafür eingerichteten SoKo. Seine Mitarbeiter waren allesamt im erhöhten Bereitschaftsmodus. Er schaute auf die Uhr. Die Zeit drängte. Er musste wieder zurück in das Einsatzbüro des Stabs für Gewaltprävention. Seine Anwesenheit dort war von ganz oben angeordnet worden.
Margret Alpan und Daniel Pepusch kümmerten sich schon um alles Andere im Zusammenhang mit dem Leichenfund. Ob es sich um ein Gewaltdelikt handelte, musste noch geklärt werden. Falls ja, würde die gesamte Abteilung zur Höchstform auflaufen. Es war aber immer erst einmal ratsam, den Ball flach zu halten. Die meisten Fälle entpuppten sich nach kurzer Überprüfung als Unfälle oder tragische Verkettungen von schlechten Umständen. Wirkliche Kapitalverbrechen waren glücklicherweise recht selten.
Doch tief in seinem Unterbewusstsein spürte er, dass der gestrige Leichenfund etwas Ungewöhnliches war. Sorgenvoll blickte er aus dem Fenster. Draußen strahlte ein unschuldig blauer Frühlingshimmel, irgendwo läuteten die Kirchenglocken und ein vorwitziger Star trällerte und flötete im noch kahlen Lindenbaum.
Slawen in der Lausitz - Eine Spurensuche
Aus den Aufzeichnungen der Studentin Mariana H.
Echo aus dem Spreewald I
Das Tor zum Land der Sorben, das bin ich noch immer, noch recken meine Wipfel hoch sich in den Himmel, und altgewordene Bäume schwere, dunkle Fächer bauen immer noch den Flüssen dichte Dächer. Die Wasser wie im Sommer, so im Winter fließen, ihre Wirbel drehen still sich in den Tiefen, hier und da schon Sumpf und Gras die Flüssen engen, an manchem Ort sie in ein neues Bett sich drängen. Erlen, aus dem Sumpf hervorgewachsen, lauschen der jahrhundertalten Stimme: ihrem Rauschen; seit langer Zeit schläft in mir eine alte Weise, in der Nacht in Schilf und Weiden singt sie leise.
Mina Witkojc (1893-1975), sorbische Dichterin
Von den Sonnentropfen
In einigen fast vergessenen Sagen wird von den wundersamen Sonnentropfen berichtet. Es sollen die Tränen des Schlangenkönigs sein, die er weinte während seines Schlafes, träumend von seinem verloren gegangenen Reich. Die Tränen wurden im Sonnenlicht zu glitzernden Steinen, die sich warm anfühlten und die leicht wie trockenes Holz waren. Ihnen wurden Wunder nachgesagt. Sie sollten denjenigen, der sie bei sich trug, vor Ungemach beschützen, ihn unverwundbar machen und auch seine Wünsche erfüllen. Kurzum, die Sonnentropfen waren begehrt. Viele Menschen versuchten, den Schlangenkönig aufzuspüren um seine Tränen aufzusammeln. Wem es gelang, der wurde dank der glitzernden Steine zu einem glücklichen Menschen. Doch viele der Suchenden blieben glücklos. Sie verirrten sich im Dickicht des Spreewalds, ertranken oder verschwanden auf Nimmerwiedersehen in den tückischen Sümpfen. Die Jagd nach den Sonnentropfen war gefährlich und meist erfolglos. Nur wenige kamen in den Besitz der wundersamen Steine.
Aus dem sorbischen Sagenschatz
Slawische Ursprünge
Seit dem frühen 6. Jahrhundert wanderten zahlreiche slawische Stämme aus dem osteuropäischen Raum in das Gebiet zwischen Oder und Elbe, teilweise sogar noch weiter westwärts bis nach Holstein und ins heutige Niedersachsen, das Hannoversche Wendland ein.
In der Lausitz wurden die Lusici ansässig. Die Nachfahren der Lusici, auch Lusizen genannt – sie gaben dem Landstrich auch den Namen – leben noch heute als Wenden und Sorben vor allem im Spreewald, aber auch in den ländlichen Regionen rund um Cottbus bis hinunter an die sächsische Grenze und darüber hinaus.
Die Lusizen waren Fischer und Bauern, lebten in losen Familienverbänden und gründeten zahlreiche Dörfer. Größere, städtische Siedlungen waren nicht bekannt. Die westslawischen Völker, zu denen die Lusizen gehörten, waren in ihrer Hierarchie eher eine frühfeudale Welt. Es gab die klassische Schicht der freien Bauern, Fischer und Jäger, aus der auch der Kriegeradel hervorging. Ihnen unterstellt waren die zahlreichen Unfreien, die dem bäuerlichen Verbund als Untergebene dienten. Sie rekrutierten sich aus verarmten Freien und Kriegsgefangen. Die Adelsschicht, zu der neben der Priesterschaft die sogenannte Szlachta gehörte, ein loser Verbund aus altgedienten Kriegern und den als Starost bezeichneten Ältesten, die als Ratgeber fungierten, waren meist einem Knes, also einem Fürsten unterstellt. Einige elbslawische Völker hatten nach ihrem Sesshaftwerden auch Königreiche gebildet.
Der slawische Adel ließ mächtige Ringwallburgen aus Holz und Lehm errichten, die meisten dieser Bauwerke überlebten jedoch die Zeiten nicht.
Mit dem Vordringen germanischer Stämme Richtung Osten kam es seit dem späten 8. Jahrhundert zu immer mehr kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den slawischen Stämmen und den eindringenden germanischen Siedlern. Unter dem Frankenkaiser Karl dem Großen, begann bereits im späten 7. Jahrhundert die systematische Unterwerfung der Slawen, die bis in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts dauern sollte. Damit einher gingen die christliche Missionierung der Slawen und die vollkommene Vernichtung der slawischen, heidnischen Kultstätten und der damit verbundenen Götterwelt.
Die Götter der Slawen waren zahlreich und besaßen verwirrend viele Namen und ziemlich seltsame Eigenschaften. Kein Wunder, dass die gottesfürchtigen Christen damit Probleme hatten.
Slawische Gottheiten verkörperten wichtige Aspekte der Natur, waren eng mit dem Werden und Vergehen verbunden. In sogenannten Heiligen Hainen, die meist aus großgewachsenen Eichen und Buchen bestanden, wurden sie verehrt und ihnen wurden regelmäßig Opfer gebracht. Slawische Priester befragten im Schatten mächtiger Bäume Orakel und sprachen Zaubersprüche aus, die Glück oder Unglück über die Menschen brachten.
Im Laufe der Zeit ging das Wissen um die slawischen Götter verloren, die Erinnerungen an sie verblassten immer mehr. Übrig blieben die seltsamen Zauberwesen, die in den Sagenwelten der Lausitz weiterlebten und deren Herkunft ziemlich eindeutig auf die alten slawischen Gottheiten zurückzuführen ist.
Aus den Feld-, Wald- und Wiesengöttern wurden so die Mittagsfee Pŕezpołnica, die Totenhexe Smjertnica, der Wassermann Wódny muž, der Zauberdrache Plon und die Lutki, scheue Zwergengeister, die ein geheimnisvolles Leben im Unterirdischen führten. Eines der unheimlichsten Zauberwesen der alten Slawen war der Schlangenkönig, auf Sorbisch: Wužowy Kral. Sein Wirken war zwiespältig, vieles hing von seiner Laune ab. Die meisten Zauberwesen hatten eine solch ambivalente Ausprägung, konnten sowohl helfen als auch strafen.
Die vier slawischen Hauptgötter
Svarog – Schöpfer des Lebens, Beschützer des Lichts und des Himmlischen Feuers, galt auch als der »Himmelsschmied«, trat nur selten in Erscheinung, wachte über die Weltenläufe, griff aber nicht in sie ein.
Svarozic – Sohn Svarogs; als Vermittler des göttlichen Lebens spendete er Wärme und Licht, war ein Symbol des Guten, wurde daher auch als »Sonnengott« verehrt
Perun – oberster Kriegsgott, Herrscher über Blitz und Donner, wurde daher auch als »Gewittergott« verehrt
Veles – Beschützer der Toten, aber auch zuständig für Fruchtbarkeit und Reichtum, wachte dazu noch über das Vieh und galt als Rechtssprecher
Aus den vier Hauptgöttern mutierten im Laufe der Jahre bei den Elb- und Ostseeslawen eigenständige, regionale Gottheiten.
Der archaische Svarozic wurde zu dem populären Radegast. Als solcher war er einer der am meisten verehrten Gottheiten bei den Lusizen, aber auch bei den weiter nordwestlich siedelnden Obotriten und den an der Ostseeküste beheimateten Redariern.
Radegast wurde stets in Begleitung eines großen Adlers dargestellt, er trug einen riesigen Schild mit einem Büffelkopf. Dieses Symbol der Stärke hat bis heute im Wappen der Lausitz überlebt. Sein Haupttempel stand in der sagenumwobenen Stadt Rethra im heutigen Vorpommern. Ihm wurde vor und nach der Jagd geopfert, ebenfalls, wenn es in einen Kampf ging. Bis heute wird er auch als der wichtigste Kriegsgott der Westslawen bezeichnet.
Svantovit war ein vierköpfiger Gott, der als oberster Schutzgott in jede Himmelsrichtung schaute und so Unheil von den Menschen abhielt. Sein wichtigstes Attribut war ein nie versiegendes Füllhorn. Speziell zur Erntezeit huldigten die slawischen Bauern ihm, tranken aus selbstgefertigten Trinkhörnern ihm zu Ehren Bier und Wein. Svantovit stand für Reichtum und Überfluss.
Er ritt stets auf einem großen, weißen Pferd und zog unsichtbar vor den Kriegern in den Kampf hinaus, um die Gegner bereits müde zu machen. Sein größtes Heiligtum stand bei Kap Arkona an der Nordspitze der Insel Rügen.
Dem ranischen Svantovit ähnelte auch Triglav, ein ebenfalls mehrköpfiger Gott, der bei den Pomoranen, den Vorfahren der heutigen Pommern, sehr populär war. Sein Hauptheiligtum soll sich wohl in der untergegangenen Stadt Vineta befunden haben. In den Brandenburgischen Ländereien war sein Kult ebenfalls weit verbreitet.
Vor allem bei den Hevellern war der Kult des Gottes Jarovit, der auch als Gerovit bezeichnet wurde, beheimatet. Gerovit galt als Bringer des Frühlings, wurde oftmals mit Svantovit gleichgesetzt, da mit ihm das Wiedererwachen der Natur verbunden wurde. Gerovit trug stets einen großen goldenen Schild, den niemand berühren durfte. Ihm zu Ehren wurden die Frühlingsfeste gefeiert, Vorläufer des Oster- und des Pfingstfestes. Die Osterfeuer waren Symbol für die Wiederkehr seiner Herrschaft.
Regionale elbslawische Gottheiten
Crodo – der Gott auf dem Fisch
Crodo wurde stets als alter, bärtiger Mann dargestellt, der aufrecht auf einem riesigen Fisch stand. Sein Symbol war ein Rad, in den Händen hielt er einen Korb mit Früchten. Er war verantwortlich für das Wetter, beschützte zudem die Tier- und Pflanzenwelt. Das Rad symbolisierte den ewigen Kreislauf des Werdens und Vergehens, es galt darüber hinaus auch als Sonnensymbol.
Liuba – die Göttin der Liebe
Neben den meist recht gruselig aussehenden, männlichen Gottheiten gab es auch zahlreiche weibliche Götter. Liuba, die »Liebreizende«, wurde vor allem im Spreewald verehrt. Ihr waren zahlreiche Quellen gewidmet und sie war für das Liebesleben der Slawen zuständig. Ihr Hauptheiligtum soll sich in einem Heiligen Hain unweit von Lübben - Nomen est Omen - befunden haben.
Flyn – der Todesgott
Einen ausgesprochen furchterregenden Anblick bot der Gott des Todes Flyn. Meist wurde er als Skelett dargestellt, manchmal aber auch als gekrönter Löwe, der auf einem Thron saß. Flyn galt als mächtige Gottheit, deren Zerstörungswut unglaublich gewesen sein soll. Sein Symbol war ein großer Stab, dessen Spitze eine nie verlöschende Flamme trug. Damit konnte Flyn als Weltenzerstörer über Leben und Tod gebieten. Sein Hauptheiligtum befand sich in Madlow, einem heute zu Cottbus gehörenden Ort.
Sava – die Göttin des Lebens und des Glücks
Als eine schöne Frau mit langen, wallenden Haaren wurde Sava verehrt. Sie war zuständig für das zu erwartende Leben und für die Schönheit. Ihr blumenbekränztes Haupt und ihr liebliches Antlitz galten als Symbole der Vollkommenheit. In den Händen trug sie einen Apfel und Weintrauben, alte Fruchtbarkeitssymbole. Ihr Kult war vor allem im Oberhavelgebiet unweit der Havelquellwiesen von Ratzeburg beheimatet.
Sava erschien den Menschen oft als Kuckuck und gab so Auskunft über die noch zu erwartenden Lebensjahre. Ein Brauch, der sich bis in die Gegenwart erhalten hat.
Prono – der Gott der Gerichtsbarkeit
Als strenger und weiser Richter wurde die Gottheit Prono dargestellt. Charakteristisch für ihn waren seine überdimensionierten Ohren, denen nichts verborgen blieb. Seine Attribute waren ein langer Spieß und ein großer runder Schild. In seinem Heiligen Hain wurde Recht gesprochen. Es war dort strengstens untersagt, Blut zu vergießen. Verfolgte fanden daher auch in seinem Heiligtum Asyl.
Porevit –Schutzgott des ungeborenen Lebens
Als Beschützer der Schwangeren wurde der viergesichtige Porevit verehrt. Auf seiner Brust war zusätzlich ein fünftes Gesicht zu sehen. Die slawischen Frauen verehrten ihn, beteten zu ihm, wenn sie Nachwuchs erwarteten und erbaten sich Hilfe bei der Geburt. Porevit gewährte den Frauen Lebenskraft.
Die meisten Gottheiten wurden als grobgeschnitzte Holzskulpturen dargestellt. Nur wenige haben daher die Zeiten überdauert. Überlieferungen von alten Chronisten und Zeichnungen von Ethnologen waren oftmals die einzigen Quellen, die uns heute etwas über das Erscheinungsbild der alten Slawengötter berichten.
Geister und Fabelwesen
Überlebt haben viele der alten Gottheiten als Elementargeister und Gespenster in den zahlreichen Sagen und Märchen, die bis heute noch in der Lausitz erzählt werden.
Je nach Auftreten unterscheiden die Forscher Berg-oder Erdgeister, Luftgeister, Wassergeister und Feuergeister.
Typische Berggeister sind die Oreaden, auch Bergnymphen genannt, schöne unsterbliche Wesen, die an einen Felsen oder Berggipfel gebunden sind. Ihnen beigeordnet sind die Dryaden, auch Baumnymphen oder Baumgeister genannt. In der Lausitz erinnern die beiden Berggipfel Bilebog und Tschornebog an alte Berggeister. Bilebog, der »Weiße Gott« und Tschornebog, der »Schwarze Gott« waren dabei Antipoden, die das Schicksal der in ihrer Umgebung lebenden Menschen beeinflussten.
Aber auch der Riese Rübezahl ist ein solcher Berggeist. Alte Schreibweisen nennen ihn auch Riebenzahl oder Ribezal. Er wurde meist als Riese dargestellt, der allerdings seine Gestalt problemlos wandeln konnte. Oft trat er als Wandermönch dem ahnungslosen Reisenden entgegen oder auch als »Wilder Jäger«, manchmal als sprechender Rabe, auch als teuflischer Diabolus soll er schon seinen Schabernack mit den Leuten gespielt haben.
Vielen Leuten, die sich in sein Reich verirrten, trat Rübezahl als Widerspruchsgeist entgegen, der ambivalent in seinem Auftreten empfunden wurde. Für viele arme Bergbauern war er ein gütiger Geist. Für die meisten Reisenden jedoch galt er als ein heimtückischer und verschlagener Wegbegleiter.
Er galt zudem lange Zeit als Wächter längst verloren gegangener Schätze und war als solcher gefürchtet. Jedem Schatzsucher trat er entschieden aggressiv und bösartig entgegen. Viele von ihnen bezahlten eine Begegnung mit ihm mit ihrem Leben. Den Namen »Rübezahl« lehnte der Duchgor, zu Deutsch »Herr der Berge«, so war wohl sein korrekter Name, jedoch ab, empfand ihn sogar als Beleidigung.
Zu den Wassergeistern gehörten die Vilen und Rusalken, Zwitterwesen, halb Fisch, halb in menschlicher Gestalt, die als Bewacher von Quellen, Brunnen und Seen galten. Sie waren durchaus heimtückische und bösartige Geister. Der Wódny muž, auch Wassermann genannt, war ebenfalls ein solcher Wassergeist, der mit den Menschen oftmals ein böses Spiel spielte. Viele bezahlten eine Begegnung mit ihm mit ihrem Leben. Meist zeigte er sich als grünhäutiges Monster, manchmal auch als kleines, vor Nässe triefendes Männlein, seltener als junger Bursche, dem beständig Wasser aus dem Ärmel lief. Ab und an trat er den Fischern als kapitaler Wels oder störrischer Hecht entgegen. Es war jedoch immer derselbe Geist, dessen Inkarnationen erstaunlich vielgestaltig waren.
Die Gruppe der Luftgeister galt als besonders gefährlich. Es waren vor allem die Winddämonen, die hier für Unmut sorgten. Ihre zerstörerische Kraft wurde gefürchtet. Der heutzutage allseits beliebte Djed Moroz, auch als »Väterchen Frost« bekannt, war der Winddämon, der für Schneestürme und Frostnächte sorgte. Er galt früher als ein ausgesprochen unangenehmer Geist. Erst die jüngere Folklore machte aus ihm den Geschenkebringer, der als Weihnachtsmannersatz vor allem bei den osteuropäischen Slawen fungierte.
Die Windmutter Meluzina wurde von den Menschen ebenfalls gefürchtet. Brachten die Menschen ihr kleine Opfergaben, wurde sie gnädig gestimmt, sagte Naturkatastrophen voraus und warnte vor Stürmen. In der Romantik wechselte die Windmutter Meluzina, die in alten Überlieferungen auch bekannt war als das heimtückische »Schlangenweib«, das Fach und ward als Nixe Melusine eine eher tragische Figur der Literaturgeschichte.
Mit Abstand die bösartigste und brutalste Verkörperung der Luftgeister war Baba Jaga, auch Baba Roga, die »Kaltherzige«, die auf einer Feuerwalze durch die Luft flog und sich von Menschenfleisch ernährte. Aus ihr wurde die bekannte Hexe der slawischen Märchenwelt. Sie wurde auch als »Kostjanaja Noga«, das »Knochenbein«, verächtlich gemacht, eine Anspielung auf ihr Aussehen und ihren Appetit auf Menschenfleisch.
Seltener agierten die Feuergeister in den Erzählungen und Überlieferungen. Ihnen huldigten die slawischen Bauern vor allem mit großen Feuern zur Winter- und Sommersonnenwende. Auch die Osterfeuer waren ein solches Fanal, welches die Feuergeister bannen sollte. Die rituellen Feuer symbolisierten die Wiederkehr und Vertreibung von alten Dämonen, die es zu bändigen galt. Dabei handelte es sich meist um feuerspeiende Drachen und Basilisken, die in den stürmischen Nächten ihr Unwesen trieben und oftmals die Häuser und Stallungen der Menschen anzündeten und so für viel Leid sorgten. Plon, der Feuerdrache war ein solcher Feuerdämon.
Aber auch die nicht ganz so harmlos daherkommenden Irrlichter, Błudy genannt, gehörten zu den Feuergeistern, lockten mit ihren flackernden Lichtern die Menschen ins Verderben.
Neben den Elementargeistern wurde die Mythenwelt der slawischen Stämme noch von sogenannten Vegetationsgeistern und Schicksalsdämonen bevölkert.
Die populärste Erscheinung war die Mittagsfee, auch als Mittagsfrau bekannt. Ein wirklich furchterregender Naturgeist, der direkt dem Totenreich entsprungen war. Oftmals wird die »Pŕezpołnica« als schwarzhaarige, hohlwangige Frau in weißen Wallegewändern beschrieben, die in der Erntezeit über die Felder zog und die Bauern mit ihrer Sichel bedrohte. Dabei verwirrte sie die Sinne der Bauern, Jedem, den sie begegnete, hielt sie die Sichel an den Hals und stellte ihm meist unlösbare Rätsel. War die Antwort falsch, lachte sie höhnisch auf, kreischte dazu ihr »Serp a shyju« - Sichel an den Hals - und schnitt ihm kurzerhand den Kopf ab.
Typisch für die Mittagsfrau war auch ihr Auftreten im Zusammenhang mit sogenannten »Wechselbälgern«. Sie vertauschte dabei die gesunden, schönen Babys der Mütter mit dämonischen Wesen, die den Wöchnerinnen anstelle ihrer Babys in die Wiege gelegt wurden. Das Erscheinen der Mittagsfrau war daher besonders bei jungen Müttern gefürchtet.
Nachtdämonen galten als Gegenstück zu den Tagdämonen, standen diesen jedoch hinsichtlich Boshaftigkeit und Gefährlichkeit in nichts nach. Drachen, wie der berühmte Smok, gehörten dazu, aber auch Eiswürmer und Lindwürmer, beides furchterregende Reptilien, die es auf das Leben der Menschen, die in der Nacht herumirrten, abgesehen hatten. Das tödliche Gerippe »Tschudo-Judo« und die Totenhexe »Smjertnica«, die in ihrem unheimlichen Nebelschloss hauste, gehören zu den seltsamen Geschöpfen der Nacht. Ihr Kult kann auf die sehr alte, fast in Vergessenheit geratene Dunkle Göttin, Morana, zurückgeführt werden, deren Kult vor allem in schamanistischen Kreisen lebendig war.
Ein ganz eigenwilliger Dämon ist der Wužowy Kral, der Schlangenkönig. In der sorbischen Mythologie ist der Schlangenkönig ein mächtiger, geheimnisumwitterter und magischer Geist. Meist wurde er als großer, alter und weiser Mann dargestellt, der in einer Höhle lebt und in der Lage war, das Wetter und andere Naturkräfte zu beeinflussen. Die sorbischen Bewohner der Lausitz betrachten ihn als ihren Schutzpatron.
In der Legende vom Zauberer Krabat wird der Schlangenkönig als dessen Beschützer und Mentor genannt. So sorgt der Schlangenkönig dafür, dass Krabat im Kampf mit den finsteren Mächten der Schwarzen Mühle entsprechendes Wissen und Fähigkeiten erlangt.
Er galt ursprünglich als ein Hausgeist, der alte, verlassene Gemäuer bewohnte und als der Schutzgeist für alle kleineren Reptilien. Den Slawen war es strikt untersagt, eine Schlange zu töten, selbst, wenn sie sich ins Haus verirrt hatte. Wurde dennoch Gewalt gegen ein Reptil eingesetzt, trat der Schlangenkönig ins Licht und rächte den Frevel. Die Slawen hatten großen Respekt vor dem Dämon in Schlangengestalt, wussten sie doch Bescheid über dessen übernatürliche Fähigkeiten. Bis in die Gegenwart ist der Respekt vor dem »Wužowy Kral« groß. Den Schlangen im Spreewald kommt dieser Respekt zugute. Ungestört können sie ihren Geschäften nachgehen.
Die Legende vom Schlangenkönig lebt auch noch in den Bräuchen und Festen der sorbischen Dorfgemeinschaften in der Lausitz weiter. Es gab sogar früher ein Schlangenkönigsfest, bei dem ein als Schlangenkönig maskierter Tänzer auftrat und eine Prozession durchs Dorf stattfand, bei der der Schlangenkönig und dessen ebenfalls maskierten Begleiter im Mittelpunkt standen. Während der Prozession wurden alte sorbische Lieder gesungen und es wurden die alten Tänze gezeigt. Alle Dorfbewohner legten dafür ihre beste Festtracht an. Der Tänzer ahmte dabei die Bewegungen einer Schlange nach und warf Süßigkeiten, Obst und Gebäck in die Menge. Jeder, der so ein »Geschenk« des Schlangenkönigs auffing, sicherte sich so Glück und Wohlstand fürs ganze Jahr.
Das Opfer
Wir haben ein drittes Auge. Es ist nur uns gewachsen. Es sieht vieles anders. Es vermag die Welt zu sehen, wie sie nach der uns drohenden endlichen Abfahrt sein wird. Das Auge der anderen Sicht. Das Spuren sichernde Auge. Das auf Täter und Töter aus ist. Das Auge des grenzüberschreitenden Weitblicks, des regionalen Weltbürgers, des Mikrowesens, ohne dass das angestrebte Makrogemeinwesen eine lächerliche Utopie bleibt.
Jurij Koch, aus »Die Schmerzen der endenden Art«, erschienen im Sammelband »Jubel und Schmerz der Mandelkrähe«, sorbischer Schriftsteller
I
Liubusa, Heiliger Hain, Blota - Spreewald
Wintersonnenwende, anno Domini 1063
Der Winter war mit aller Macht vor ein paar Tagen über dem Land hereingebrochen. Ununterbrochen schneite es und verwandelte die Sumpflandschaft in ein weißes Wunderland. Die Leute in den Hütten, die sich, hufeisenförmig angeordnet, rund um das Hauptheiligtum duckten, hatten sich dick in Pelze gemummelt.
Es war der kürzeste Tag des Jahres, Wintersonnenwende. Trüb hatte der Tag begonnen. Grau war die vorherrschende Farbe am Himmel, der so niedrig schien, dass man ihn fast greifen konnte. Nur das Weiß des frisch gefallenen Schnees sorgte für Helligkeit.
Die beiden Hohepriester Dobislav und Bohimer hatten sich bereits im Heiligen Hain getroffen. Heute sollte das große Opferfest zu Ehren Crodos gefeiert werden. Der Heilige Hain war ein von mächtigen Eichen umgebener Platz, in dessen Mitte sich eine Feuerstelle befand. Um die Feuerstelle herum waren große Pfähle in die Erde gerammt, deren Spitzen mit dem Antlitz verschiedener Gottheiten verziert waren. Getrocknetes Blut klebte überall am Holz, gab ein grausames Zeugnis von bereits vorangegangenen Opferfesten.
Die beiden Priester entzündeten große Pechfackeln, die den Platz in ein gespenstisches Flackerlicht tauchten. Die Gesichter der alten Gottheiten auf den Holzpfählen begannen plötzlich lebendig zu werden. Schattenspiele ließen die starren Gesichter aufzucken und nährten die Illusion, dass sie zum Leben erweckt waren.
Die Pfähle trugen die Gesichter der wichtigsten Gottheiten der Lusizen, Svantovit mit seinen vier Köpfen war zentral im Mittelpunkt des Haines aufgestellt, ihm beigestellt waren Radegast mit dem Stierkopfschild und Flyn, der Totengott. Gegenüber waren Sava, Liuba und Crodo. Direkt am Feuerplatz stand der Pfahl Pronos, in dessen Dunstkreis das Hohe Gericht des Ältestenrates Platz nahm, um Recht zu sprechen.
Prono, der Gott der Gerechtigkeit, dessen Kult immer mehr den Charakter eines großen Schlachtfestes annahm, wurde auch hier bei den Lusizen verehrt. Üblicherweise wurde er als alter Mann mit strengen Gesichtszügen gezeigt, hier aber, in den sumpfigen Regionen des Binnendeltas der Spree, wurde der Kult zum Fest des »Schlangengottes« umgedeutet. Crodo übernahm von Prono dessen Zuständigkeit. Ihm wurden die zahlreich vorkommenden Schlangen zugeordnet. Crodo wurde ursprünglich nur bei den weiter nördlich siedelnden Obotriten und den an der Havel beheimateten Hevellern verehrt. Im dünn besiedelten Sumpfland der Spree mutierte er jedoch zum Beschützer und Herrn der zahlreichen Reptilien, die sich den Lebensraum mit den Menschen teilten.
Ihm zu Ehren wurde das Wintersonnenwendefest zelebriert. Es war gleichzeitig Gerichtstag, an dem von den Ältesten Recht gesprochen wurde und es war der Beginn des neuen Jahreszyklus. Von nun an wurden die Tage wieder länger, ein beruhigendes Gefühl.
Die Lusizen, eine etwas loser Sammelbegriff für die »Stämme ohne Fürst«, die sich selbst dadurch definierten, dass sie anders waren als die übrigen Elbslawen, die ein geordnetes Staatswesen mit einem Fürsten als Oberhaupt vorweisen konnten, fühlten sich in ihren archaischen Strukturen recht wohl. Sie wurden gefürchtet von ihren Nachbarn und galten als wilde Krieger, die sich nicht scheuten, selbst mit den mächtigen fränkischen und sächsischen Herrschern jenseits der Elbe zu kämpfen. Sie bewahrten sich den Glauben an ihre alten Götter auch noch, als die übrigen Elbslawen längst schon christlich missioniert worden waren. Hier waren sie noch lebendig: Svantovit und Radegast, Crodo, Porevit und Flyn, Sava und die schöne Liuba, allen wurde noch der ihnen gebührende Respekt entgegengebracht.
Die lusizischen Priester achteten darauf, dass von außen keine christlichen Einflüsse in die Geisteswelt der »freien Stämme« gebracht wurden. Jegliche Missionsaktivitäten wurden bereits im Keime erstickt.
Auch heute konnten sie wieder ein paar Gefangene vorweisen, die sich als christliche Missionare entpuppt hatten. Es waren Angehörige der Heveller und Obotriten, allesamt vor Dezennien bereits von den Lusizen besiegte Stämme, die sich unter die Obhut des Sachsenkönigs Otto geflüchtet hatten. Sie versuchten immer wieder, die »Wilden« zu bekehren. Selbst östlich ihres Stammesgebiets gab es inzwischen christliche Königreiche, auch wenn diese eine ihnen verständliche Sprache sprachen. Die vereinten polanischen Stämme, oder wie sie sich neuerdings nannten, die Polen, hatten ein mächtiges Königtum errichtet und sich dem Christentum zugewandt. Ebenso die Pomoranen, die sich als Fürstentum Pommern neu formiert hatten.
Die lusizischen Stämme wollten davon nichts wissen. Sie fühlten sich in ihren alten Stammesverbänden ganz wohl. Frei wollten sie leben, ohne dass ein Fürst oder gar König ihnen sagte, was sie zu machen oder ein Bischof ihnen vorschrieb, was sie zu denken und zu glauben hatten.
Zufrieden mit den Vorbereitungen kehrten die beiden Priester wieder zurück in die Siedlung. Dort war inzwischen das Leben erwacht. Die Vorbereitung des Festes erforderte viel Aufmerksamkeit. Die Frauen kochten und brieten schon den ganzen Vormittag. Es sollte an nichts fehlen. Die Männer rollten drei Fässer mit selbstgebrautem Bier Richtung Heiliger Hain. Überall tobten die Kinder durch den Schnee in freudiger Erwartung des Festes, zu dem viele Gäste erwartet wurden.
Die Ältesten hatten sich bereits versammelt und den Hohen Rat einberufen. Es ging um die anstehenden Gerichtsfälle, die im Mittelpunkt der Feierlichkeiten standen. Drei Fremdlinge, wahrscheinlich christliche Missionare, warteten auf ihr Urteil, dazu gab es noch zwei Diebstahlsdelikte zu ahnden und einen Bruderzwist zu schlichten.
Die eigentlichen Feierlichkeiten setzten erst nach den Schiedssprüchen des Ältestenrats ein. Voller Vorfreude auf das zu erwartende Spektakel versammelten sich die Bewohner der Siedlung nach und nach auf dem Festplatz.
Auf dem Sitz am oberen Ende der langen Tafel nahm ein immer noch stattlicher Greis mit einer langen, grauen Haarmähne Platz. Sein üppiges, graues Haar wurde mit einem Silberreif gebändigt. Er trug einen dunkelblauen Umhang, der von einer goldenen Spange zusammengehalten wurde. Es war Cescimir, der den Vorsitz innehatte, ein in Ehren ergrauter Krieger, dessen ruhmreiche Taten nun schon einige Jahrzehnte zurück lagen, von denen aber zahlreiche Lieder seine noch zahlreicheren Siege immer noch verkündeten.
Ihm zur Seite saßen die beiden Hohepriester Dobislav und Bohimer, die wiederum zwei weitere Älteste, Rogvolod und Ludomir, als Nachbarn hatten.
Zuerst wurden die beiden Diebstahlsdelikte besprochen. Ein junger Bursche, noch unerfahren, war dabei erwischt worden, wie er ein wertvolles Messer einem alten Krieger entwendet hatte. Das Bürschchen, vielleicht siebzehn oder achtzehn Jahre alt, war vollkommen aufgelöst, weinte und schüttelte den Kopf. Die meisten Zuschauer hatten Mitleid mit ihm. Er war in der Siedlung bekannt und beliebt, seine Eltern hatte er bereits früh verloren, war in der Familie seines Onkels aufgewachsen.
Die Strafen für Diebstahl waren meist drastisch. Viel hing vom Wohlwollen des Ältestenrats ab. Der Bestohlene, ein angesehener Krieger, dessen Haus groß und reich ausgestattet war, hatte sein Anliegen wortreich vorgetragen. Das Messer sei wohl ein besonders wertvolles Werkzeug, was er von einem Kriegszug gegen die Ukranen im Norden mitgebracht hatte. Unersetzlich sei es und er habe mit seinem eigenen Blut dafür bezahlen müssen. Dabei verwies er auf zwei große Narben am rechten Arm, die er sich dabei zugezogen hatte, als er gegen die Ukranen gefochten hatte.
Die Befragung des Bürschchens war kurz, er gab alles zu und bat um Vergebung. Cescimir erhob seine Stimme. Er verurteilte das Bürschchen zu zwanzig Tagen Frondienst bei der Familie des Bestohlenen.
Der zweite Fall war da schon etwas kniffliger. Zwei Frauen klagten sich gegenseitig an. Jaromira, eine resolute Mutter mit straff geflochtenen blonden Haaren und üppigen Formen war schnaufend und laut zeternd in den Ring getreten. Sie sei immer noch vollkommen empört über die hinterhältige Tat ihrer alten Widersacherin Radmila, einer dunkelhaarigen Schönheit, die am anderen Ende des Ringes stand.
Sie beschuldigte Radmila, ihren mit edlen Steinen besetzten Silberkamm entwendet zu haben. Radmila bestritt es, erklärte weinend, dass der Kamm ihr von Jaromira geschenkt worden sei. Nach ein paar Tagen jedoch wollte Jaromira den Kamm zurück haben. Aber man dürfe doch ein Geschenk nicht zurückordern.
Jaromira bestritt dies jedoch vehement. Nein, es sei niemals von einem Geschenk die Rede gewesen, nur ausgeliehen hatte sie das wertvolle Stück.
Der Ältestenrat schien über den nichtigen Streit der beiden Frauen nicht sehr amüsiert zu sein. Missbilligend nahmen sie die wortreichen Erklärungen der beiden Frauen zur Kenntnis. Cescimir erhob sich, schnitt den streitenden Frauen das Wort ab. Da der Kamm für so viel Streit und Unfriede gesorgt habe, sei es nur gut und gerecht, das strittige Objekt als Opfergabe der Göttin Sava zu überbringen, um so den Hader zu beenden. Die beiden Frauen sollten daher gemeinsam zum Sava-Tempel gehen und den Kamm ihr überbringen, danach ihren Zwist beilegen und sich wieder versöhnen.
Etwas missmutig nahmen die beiden Frauen das Urteil entgegen. Der schöne Kamm war nun endgültig verloren.
Der Bruderzwist zwischen den beiden Söhnen des angesehenen Vjelemer war der dritte Fall, der geschlichtet werden sollte.
Milorad und Slavoljub waren bekannt als aufbrausende, jähzornige Burschen, die eifersüchtig darauf achteten, nicht übergangen zu werden, wenn es um den umfangreichen Familienbesitz ging. Der Grund für ihren Streit war die Nutzung des großen Bootes, mit dem sie die ausgelegten Reusen in den vielen Seitenarmen der Zpriaw abfuhren um die Fische zu transportieren, die sich darin verfangen hatten. Jeder wollte den Fischfang für sich haben.
Der Vater Vjelemer hatte bereits vergeblich versucht, die beiden Streithähne auseinander zu bringen. Als die beiden so in Rage versetzt waren, dass sie mit der Streitaxt aufeinander losgingen, schritt jedoch die Mutter ein und stellte sich mutig dazwischen. Sie entschied, den Streit vor den Ältestenrat zu bringen. Sollten doch die angesehenen Männer ein Urteil fällen, dass von den beiden Sturköpfen respektiert wurde.
Cescimir wusste von den Streitigkeiten im Hause Vjelemer jelemers. Schon lange schwelte dieser nun offen ausgebrochene Hader zwischen den beiden Brüdern. Sie waren fast gleich alt, nur ein Jahr lag zwischen ihnen. Beide waren hochgewachsene Recken, galten als fleißig und arbeitsam, waren zudem auch gewandt im Umgang mit Waffen und hatten sicherlich eine große Zukunft als Krieger vor sich.
Es galt, sie für die Gemeinschaft zu erhalten, ohne dass sie sich vorab die Köpfe einschlugen. Eine knifflige Angelegenheit. Cescimir zog sich mit den vier anderen Ältesten zur Beratung zurück.
Sie hatten nach einer geraumen Zeit des Beratens eine Lösung gefunden, die von beiden Brüdern akzeptiert werden konnte, ohne dass sie dabei einen Gesichtsverlust hatten. An allen geraden Tagen durfte Milorad das Boot benutzen und an allen ungeraden Tagen konnte Slavoljub damit fischen.
Die beiden Brüder schienen mit dem Urteil einverstanden sein. Sie mussten sich vor dem Ältestenrat noch die Hand geben und sich gegenseitig versichern, das Urteil zu akzeptieren. Mit finsterem Blick traten sie aufeinander zu und verkündeten etwas halbherzig zwar, aber dennoch laut genug, dass alle es hören konnten, ihre Feindschaft begraben zu wollen.
Der Höhepunkt des Gerichtstags war jetzt endlich gekommen: die drei Gefangenen wurden vorgeführt. Es schien so, als ob sie von vornehmer Herkunft waren. Sie trugen allesamt feingewebte Wollsachen, hatten aufwändige Verzierungen an ihren Mänteln und trugen edle Ledergürtel mit Silberschnallen. An den Füßen hatten sie mit Pelz besetzte Stiefel, ein Luxus, den sich nur wenige leisten konnten. Bei Ihrer Gefangennahme hatten die Lusizen ihnen drei Schwerter abgenommen, dazu noch einen Eschenbogen, einen Birkenholzköcher voller wertvoller Vierkantpfeile mit geschmiedeten Metallspitzen, zwei Wurfmesser und zwei Schmaläxte.
Ohne Zweifel, die drei Gefangenen schienen ein wertvoller Fang sein. Womöglich konnte man Lösegeld für sie verlangen.
Die drei Männer schauten trotzig auf den Ältestenrat, würdigten die übrigen Anwesenden keines Blickes. Sie wussten, was ihnen bevorstand. Der schlechte Ruf der wilden Lusizen war natürlich auch bis in ihre westlich gelegenen Heimatregionen vorgedrungen. Sie waren illusionslos, was ihr eigenes Schicksal anging.
Cescimir richtete das Wort an sie. Sie lauschten, verstanden zwar nicht alles, was er sprach, aber immer noch genug.
Sie sollten ihre Namen nennen und woher sie kamen.
Einer der drei Gefangen trat einen Schritt vor, erwies dem Ältestenrat eine Höflichkeitsbegrüßung und begann in einer den lusizischen Ohren unvertrauten Sprache zu sprechen.
Er nannte seinen Namen: Dragomir, zweiter Sohn des Pribislav, Fürst der Stodoranen, die von vielen auch Heveller genannt wurden.
Cescimir nickte. Wer seine beiden Begleiter seien, fragte er nach.
Dragomir sprach wieder in der etwas seltsam klingenden westslawischen Sprache, die den Lusizen einiges abverlangte, um verstanden zu werden. Seine Begleiter seien die edlen Krieger Vlad und Zdravko, beide aus ehrenwerten Familien.
Cescimir hakte nach. Was sie hier auf lusizischen Gebiet zu suchen hatten, wollte er wissen.
Wieder antwortete Dragomir nach einer kleinen Pause. Er begann einen längeren Monolog, von dem die anwesenden Lusizen nur wenig verstanden. Es war die Rede von einer Brautwerbung bei den Sprewanen, wo Milusa, die schöne Tochter des Sprewanenfürsten, im heiratsfähigen Alter darauf wartete, von ihm an den Hof des Fürsten zur Brenabor geholt zu werden.
Sein Bruder Vratislav sollte sie zur Frau bekommen. Im Schneesturm hatten sie ihren Weg verloren und anstelle auf der Insel Copnic in der Mündung der beiden Flüsse Dembrowa und Zpriaw, waren sie südlich in den dichten Sumpfwäldern, die den Lauf der Zpriaw säumten, vom Wege abgekommen und ins Lusizengebiet geraten.
Cescimir reimte sich die Inhalte aus den einzelnen Worten, die er verstand zusammen. Was der Heveller berichtete, klang logisch und konnte so stimmen. Er kannte die Sprewanenburg auf Copnic, wusste auch, dass Milusa eine Schönheit war.
Dennoch, er zweifelte… Es konnten natürlich auch Spione des Hevellerfürsten sein. Die unbotmäßigen Lusizen waren den übrigen westslawischen Fürstentümern, die sich längst mit den vordringenden Sachsen und Franken arrangiert hatten, ein Dorn im Auge.
Warum warb Vratislav nicht selbst um die schöne Milusa, schickte dafür seinen Bruder vor?
Es war durchaus üblich, dass andere Familienmitglieder zu solchen Zwecken die Werbung übernahmen, aber wenn es um eine sich anbahnende Vereinigung der beiden großen Fürstentümer der Heveller und Sprewanen ging, war es doch angebracht, selbst vorzusprechen, um den Sprewanenfürsten Jacza gnädig zu stimmen. Immerhin war Jacza kein Unbekannter, sein Ruf als mächtiger Kriegerfürst war überall in der elbslawischen Welt verbreitet.
Cescimir zog sich zur Beratung mit seinen Getreuen zurück. Er hatte ein ungutes Gefühl, dass der Heveller ihm nicht die ganze Wahrheit gesagt hatte.
Einen Urteilsspruch vertagte er auf den nächsten Tag. Die vernebelte Sonne hatte keine Kraft mehr und die Dämmerung zog bereits auf. Zeit der Geister. Keine gute Zeit, um mit klarem Verstand Recht zu sprechen.
Cescimir war ein ausgesprochen abergläubischer Mann, der jedes Omen beachtete und bei jeglicher Unsicherheit die Dienste einer Wahrsagerin beanspruchte. Die als Hexe gefürchtete Snezana, eine ältere Frau, die etwas abseits der Siedlung eine Hütte bewohnte, war Cescimirs Ziel. Er stapfte durch den hohen Schnee, der im Dämmerlicht des Tages bläulich schimmerte. Endlich tauchte die Hütte vor ihm auf, eingerahmt von Birken und Tannen duckte sie sich an den Rand des großen Sumpfwaldes.
Das alte Schloss Köpenick stand schon, als die Deutschen unter Albrecht dem Bären ins Land kamen. Jaczko oder Jasso, der letzte Wendenfürst, an dessen Bekehrung die schöne Schildhornsage anknüpft, residierte da selbst.
Nach seiner Unterwerfung wurde seine Residenz, eine Wenden-Veste, zur markgräflichen Burg, aber weder Bild noch Beschreibung sind auf uns gekommen, aus denen wir ersehen könnten, wie Schloss Köpenick zur Zeit der Askanier oder Bayern oder ersten Hohenzollern war. Es muss uns genügen, dass wir von seiner Existenz wissen. Auch seine Geschichte verschwimmt in blassen, charakterlosen Zügen und alles, was mit bestimmterem Gepräge an uns herantritt, ist das eine, das es in diesem alten Schlosse zu Köpenick war...
Theodor Fontane, aus »Wanderungen durch die Mark Brandenburg«, Band IV »Das Spreeland«
II
Liubusa, Snezanas Hütte, Blota - Spreewald
Wintersonnenwende, anno Domini 1063
Snezana war ungehalten. Eigentlich wollte sie zum Wintersonnenfest gehen, aber irgendwie schienen die Bewohner Liubusas sie vergessen zu haben. Keine der Frauen kam vorbei um sie zu bitten, mitzukommen.
Dabei hatte Snezana sich herausgeputzt, ihre besten Kleider aus der großen Truhe geholt, den Fuchspelzumhang ausgebürstet und die inzwischen ergrauten Haare kunstvoll geflochten, so dass sie unter die Dachspelzmütze passten. In ihrer Hütte war es warm, ein großes Feuer knisterte in der Mitte des Raumes, darüber hing ein Wasserkessel, der bereits dampfte. Snezana hatte getrocknete Kräuter, Lindenblüten und Brombeeren hineingeworfen, so dass der ganze Raum erfüllt war von deren Duft. Ein Hauch des Sommers kam zurück. Der Kräutersud war ein probates Mittel gegen die im Winter auftretenden Erkältungen, die auch um Liubusa keinen Bogen machten.
Kura, ihre Mitbewohnerin, plusterte sich. Kura war eine Mandelkrähe, die seit zwei Jahren bei ihr lebte. Snezana hatte sie damals im Frühling gefunden. Ihr Flügel war gebrochen. Behutsam hatte sie den schönen Vogel mit nach Hause genommen und gesund gepflegt. Kuras Flügel heilte wieder, aber fliegen konnte sie damit nicht mehr. Also blieb sie bei Snezana. Alle Dorfbewohner beneideten sie um den schönen Vogel.
Argwöhnisch beobachtete Snezana die Aktivitäten der Bewohner, warf auch immer wieder einen Blick hinüber zum Heiligen Hain, wo bereits die Pechfak-keln ihr unruhiges Licht verbreiteten.