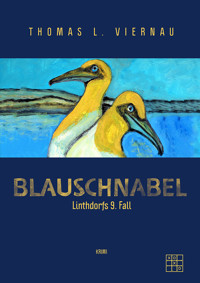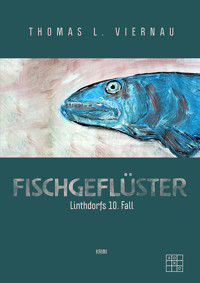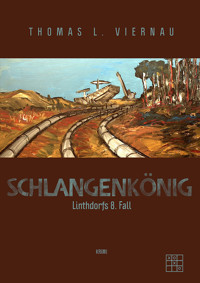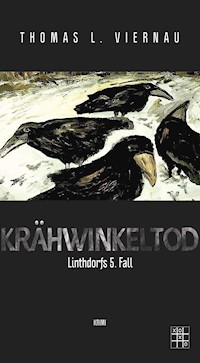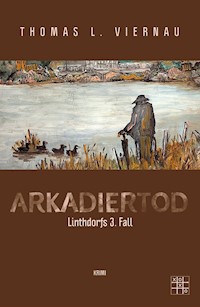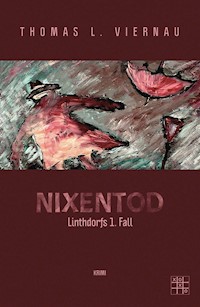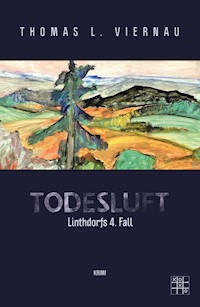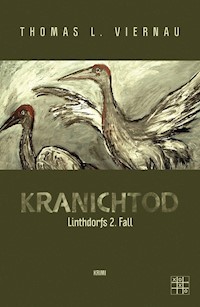
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Linthdorfs Fälle
- Sprache: Deutsch
Ein undurchsichtiges Geflecht aus Steuerhinterziehung und Kreditbetrug beschäftigt den zum Leiter einer neuen Sonderkommission ernannten Kommissar Theo Linthdorf. Quer durch ganz Brandenburg ziehen sich die Spuren diverser Scheinfirmen, die durch geschickte Transaktionen riesige Geldsummen ergaunern und die Behörden an der Nase herumführen. Die Ermittlungen führen Linthdorf schließlich auf ein altes Landgut im Norden Berlins. Unerklärlicherweise ereignen sich dort mehrere, ominöse Todesfälle. Eine Frau stirbt bei einem Verkehrsunfall, einem jungen Manne wird der Kopf abgetrennt, ein Steuerberater ertrinkt im Uferwasser eines Sees und ein einsiedlerischer Maler wird auf einem alten Friedhof zu Tode erschreckt. Die Begleitumstände der Todesfälle sind mysteriös. Da ist vor allem das Erscheinen der Weißen Frau, einem alten Spuk aus dem Mittelalter, und es gibt auch noch die vielen massakrierten Kraniche, die überall im Umfeld des Gutes entdeckt werden, die Linthdorf Stoff zum Grübeln geben. Ein Sumpf aus Intrigen wird sichtbar. Die handelnden Personen sind allesamt in einem eigenartigen Abhängigkeitsverhältnis in diesem Sumpf gefangen. Es ist eine mühselige Arbeit für den Kommissar und seine Mitarbeiter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas L. Viernau
Kranichtod
Linthdorfs 2. Fall
Kriminalroman
XOXO Verlag
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-011-8
E-Book-ISBN: 978-3-96752-511-3
© 2020 XOXO Verlag
Umschlaggestaltung: Grit Richter
Coverbild: Thomas L. Viernau
Buchsatz:
Alfons Th. Seeboth
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag ein IMPRINT
der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149
28237 Bremen
Alle im Roman vorkommenden Personen sind rein fiktiv. Sollte es zufällige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen geben, so ist das nicht beabsichtigt.
Personenverzeichnis
In Potsdam:
Theo Linthdorf, KHK beim LKA Potsdam
Dr. Nägelein, Kriminaloberrat, Dienststellenleiter im LKA Potsdam
Regina Pepperkorn, Profilerin (operative Fallanalytikerin)
Dr. Knipphase, Kriminaloberrat, BKA-Mitarbeiter
Auf Gut Lankenhorst:
Baron Rochus von Quappendorff, pensionierter Lehrer, Leiter des Vereins »Kultur-Gut Lankenhorst e.V. «
Rolf Bertram Leuchtenbein, Archivar und engster Vertrauter des Barons
Gunhild Praskowiak, Kulturaktivistin und Mitarbeiterin des Barons
Meinrad Zwiebel, Hausmeister und Parkgärtner
Mechthild Zwiebel, Ehefrau von Meinrad, Mitarbeiterin im Verein
Im Umfeld des Gutes – der Stiftungsrat:
Irmingard Hopf, geb. von Quappendorff, älteste Tochter des Barons
Clara-Louise Marheincke, geb. von Quappendorff, jüngste Tochter des Barons
Lutger von Quappendorff, Neffe des Barons, Investment-Manager
Gernot Hülpenbecker, Filialleiter der Märkischen Bank Oranienburg
Im weiteren Umfeld des Gutes:
Felix Verschau, Einsiedler und Maler
Roderich Boedefeldt, Dorfpolizist in Linum
Professor Dr. Horst Rudolf Diestelmeyer, Ornithologe und Hobbyangler
Weitere Personen:
Freddy Krespel, Fotograf, Freund von Linthdorf
Louise Elverdink, Kriminalhauptkommissarin aus Brandenburg/Havel
Matthias Mohr, Kriminaloberkommissar bei der Kripo in Eberswalde
Aldo Colli, Steuerfahnder aus Berlin
Dipl.Kfm. Müller, Meier, Schulze – alle drei stellv. Filialleiter der Märkischen Bank in Oranienburg
Rudi Wespenkötter – Wilddieb und Fallensteller
Alle im Roman vorkommenden Personen sind rein fiktiv. Sollte es zufällige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen geben, so ist das nicht beabsichtigt.
Prolog
Kraniche
... gelten als Glücksbringer. Ihr etwas heiseres, melancholisches Trompeten erfüllt jedes Jahr im Herbst und im Frühling die Luft über den weiten Ebenen der Mark Brandenburg.
Über 70.000 Kraniche werden inzwischen wieder auf den Landeplätzen im Havelländischen Luch, der Prignitz, im Rhinluch, den Niederungen an der Oder und den Sumpfwiesen an Elbe und Elster gezählt.
Die Großvögel sind ausgesprochen scheu. Glücklich kann sich derjenige schätzen, der den Tanz der stolzen Vögel schon einmal beobachten konnte.
In den letzten Jahren hat ein regelrechter Kranichtourismus eingesetzt. An den Rastplätzen der Kraniche kann man im Spätherbst zahlreiche Autos mit den verschiedensten Kennzeichen stehen sehen. Mit gebührendem Respekt nähern sich die Kranichfreunde ihren Lieblingen mit Teleobjektiven und Feldstechern.
Die Gemeinden haben viele ehemals landwirtschaftlich genutzte Flächen zu Landegebieten für die Zugvögel erklärt und so ideale Rastplätze für die Kraniche geschaffen. Kranichgucken ist inzwischen eine Art Volkssport geworden. Niemanden würde es einfallen, diese schönen Tiere zu ärgern oder gar zu jagen ...
Im Linumer Bruch
Sonntag, 15. Oktober 2006
Dieser Morgen schien einen der typischen Herbsttage hier im Luch zu gebären. Dichter Nebel hatte sich auf die Wiesen und Felder gelegt und eine undurchsichtige Welt geschaffen, in der Geräusche und Schatten dominierten. Vom Boden stieg eine feuchte Kühle auf, die alles durchdrang.
Mitten auf der großen Wiese vor der alten Eisenbrücke über den Alten Rhin konnte man zwei Schatten erkennen. Nur langsam bewegten sich die beiden Schatten vorwärts. Der Nebel schien die Bewegung zu schlucken. Nach ein paar Minuten wurden die Schatten zu den dunkel umrissenen Konturen zweier Männer. Ein etwas größerer, hagerer Mann im Parka und mit einem Schlapphut und ein untersetzter, kleiner Mann in einer karierten Wolljacke mit Kapuze stapften auf einem nur wenigen Naturfreunden bekannten Trampelpfad durchs Luch. Sie schienen in eine lebhafte Unterhaltung vertieft. Der dichte Nebel schluckte ihre Stimmen, aber die heftigen Armbewegungen ließen nur diesen Schluss zu.
Über der Nebelbank war ein Klangteppich aus einer überirdischen Welt zu vernehmen. Langgezogene, seltsam melancholische Töne, unterbrochen von schrillen Pfiffen. Pausen schien dieses Engelsorchester nicht zu kennen, dennoch war ein unverkennbarer Rhythmus in dieser Klangwelt auszumachen. Die beiden Gestalten im Nebel schienen den Klängen zu folgen. Einer der beiden hatte ein geheimnisvolles Kästchen an einem Gurtband umgehängt und eine etwas sperrige Antennenkonstruktion in seiner rechten Hand, mit der er sich langsam drehte und so die Richtung bestimmte.
Zielstrebig bewegten sich die beiden Schatten durch den Nebel zu den Engelsstimmen. Etwas schien die Aufmerksamkeit der beiden von dem Konzert abzulenken. Der hagere Mann eilte auf eine Stelle zu, die wie durch ein Wunder, vom Nebel verschont worden war.
Was er dort sah, ließ ihn erstarren. Sein etwas kleinerer Begleiter war inzwischen ebenfalls herangekommen. Der musste sich gleich wegdrehen. Das, was sich da auf dem Wiesenboden bot, ließ ihn sich übergeben.
Auf einer Fläche von vielleicht acht mal acht Metern lagen die Kadaver mehrerer Kraniche. Allen war der Hals mit einem scharfen Messer durchtrennt worden. Überall waren Blut und Federn. Es musste ein grässliches Gemetzel gewesen sein. Die Tiere hatten nicht fliehen können, denn ihre Beine hatten sich in ausgelegten Schlingen verfangen. In ihrer Todesangst hatten sie sich gegenseitig behindert und verletzt. Der hagere Mann holte seine Kamera hervor und fotografierte stillschweigend die Details des entsetzlichen Blutbads.
Erschüttert schaute er auf seinen kalkweiß gewordenen Partner. Wer machte denn so etwas? Diese Vögel wurden von allen Menschen gemocht. Sie taten niemandem etwas zuleide und ihre Gesänge verbreiteten eine ganz spezielle Art von Glücksgefühlen. Und dann so etwas!
Die beiden Wanderer sahen sich kurz an. Ein stilles Einverständnis schien sich da zwischen den beiden Männern einzustellen. Dieser Frevel musste publik gemacht und diejenigen, die dafür verantwortlich waren, einer gerechten Strafe zugeführt werden.
Langsam trotteten die zwei davon, beladen mit einer unsichtbaren Last, die ihnen Energie entzog und sich in ihre Seele fraß.
Linthdorfs Wochenende
Etwas Erstaunliches über wachsame Kraniche
Bereits bei den alten Griechen taucht der Kranich als besonders wachsames und kluges Tier auf. Er wird oft mit einem Steinchen im Schnabel dargestellt. Das Steinchen soll ihn daran hindern, zu trompeten und so die Aufmerksamkeit von bösen Räubern, wie etwa dem Adler, auf sich zu lenken.
Bei den Römern hatte dieser alte Mythos des »wachsamen Kranichs«, auf Lateinisch »Grus Vigilans«, ihn zum Symbol der römischen Tugenden »Vigilantia« (militärische Vorsicht), »Prudentia« (vernünftiges Handeln), »Perseverantia« (Beharrlichkeit) und »Custodia« (Sorgfalt) werden lassen.
Auf altrömischen Bildmotiven erscheint nun der Kranich mit einem Stein in der angezogenen Kralle. Sollte er einschlafen, würde er sofort vom Geräusch des herabfallenden Steins geweckt werden. Ein Motiv, das bis ins Mittelalter fort lebte. Viele Häuser und Burgen hatten solche Kranichbilder am Giebel oder am Portalbogen, um so die Wachsamkeit der Bewohner anzudeuten. In Otterndorf, einem kleinen Städtchen an der Nordseeküste, steht das »Kranichhaus«, an dessen Giebel folgender Spruch erhalten geblieben ist:
Der Kranich hält den Stein,
des Schlafs sich zu erwehren.
Wer sich dem Schlaf ergibt,
kommt nie zu Gut und Ehren.
Der Theologe Ambrosius, der auch als einer der wichtigsten Kirchenväter gilt, verwies in seinen Schriften auf das Gleichnis des wachsamen Kranichs für die Furcht vor Gott zum Schutz gegen Sünde und Teufelswerk. Das Fallen des Steins habe demnach eine ähnliche Wirkung wie das Läuten der Kirchenglocken. Die Menschen sollten sich Ambrosius zufolge mehr an den Kranichen orientieren und deren Sozialverhalten kopieren, wobei die Stärkeren die Schwächeren unterstützen müssten, ganz so, wie er es bei den Kranichen beobachtet hatte.
I
Linumer Teiche
Sonnabend, 21. Oktober 2006
Die Fahrt ins Linumer Bruch hatte Linthdorf schon lange geplant. Jedes Jahr fuhr er mindestens drei bis vier Mal hierher. Nicht nur die unzähligen Vögel am Himmel und auf den Feldern hatten es ihm angetan. Er liebte diese kurze Zeitspanne des Jahres, in welcher der Herbst noch einmal alle Reserven mobilisierte und eine Farbenpracht entwickelte, die von einem ganz besonderen Reiz war. Linthdorf war passionierter Hobbyfotograf. Zusammen mit seinem alten Freund Freddy Krespel und seinen beiden Söhnen, die inzwischen auch mit kleinen Digitalkameras ausgerüstet waren, zog es ihn die weiten Ebenen der brandenburgischen Luche. Ein spezieller Höhepunkt dieser Herbstausflüge war das Kranichgucken.
Irgendwann vor sieben oder acht Jahren war er auf diese eleganten Flieger aufmerksam geworden. Dicht über ihm waren ein paar Kraniche in einem großen Bogen eingeschwebt und dann mit wenigen Flügelschlägen auf der Wiese nur knapp fünfzig Meter vor ihm gelandet. Linthdorf fühlte sich plötzlich eigenartig glücklich und zufrieden. Als ob ihm eine schwere Last von der Seele fiel. Minutenlang beobachtete er den Tanz der großen Vögel. Er wusste, dass diese kurzen Augenblicke etwas besonders Seltenes waren. Normalerweise kam man an die scheuen Tiere nur auf eine Distanz von etwa dreihundert Metern heran. Die Kraniche achteten sorgsam darauf, dass dieser Sicherheitsabstand eingehalten wurde. Kam man näher, flogen sie davon. Aber irgendwie schien an diesem späten Nachmittag alles anders gewesen zu sein.
Vielleicht hatten sie ihn nicht bemerkt. Linthdorf maß stattliche Zwei Meter und war auch sonst nicht zu übersehen. Mit seinem breitkrempigen Hut und dem schwarzen Mantel sah er aus wie eine riesige Vogelscheuche. Möglicherweise fühlten sie sich jedoch nicht von diesem Riesen bedroht und ignorierten deshalb seine Anwesenheit. Er hatte jedenfalls seitdem schon öfters darüber nachgedacht, wieso sie ihn nicht bemerkt hatten und nahm es schließlich als eine besondere Gunst des Schicksals hin. Seitdem begann sich Linthdorf für diese Tiere intensiv zu interessieren. Mit seinem Interesse hatte er auch seine beiden Jungs und seinen Freund Freddy angesteckt.
Sie freuten sich im März auf die ersten zurückkehrenden Kraniche aus dem Süden und speziell auf die Wochen des Sammelns im Herbst. Dann trafen sich hier in den Luchgebieten Brandenburgs die Kraniche aus Skandinavien, dem Baltikum und Nordrussland um noch einmal Kraft aufzutanken bevor es auf den großen Zug nach Süden ging. Zigtausende der silbergrauen Vögel drängten sich dann auf den Luchwiesen, erfüllten die Luft mit ihren Trompetenklängen und flogen in Keilformation über den Köpfen der Beobachter.
Speziell für dieses Schauspiel hatte sich Linthdorf ein langes Wochenende frei genommen. Im Frachtraum seines Cherokee waren diverse Fotoapparate, Teleobjektive und Feldstecher, dazu ein paar Klappstühle, Thermoskannen mit heißem Kaffee und Proviant in Form von Äpfeln, Birnen und Wiener Würstchen. Auf den Rücksitzen hatten es sich seine beiden Jungs bequem gemacht und auf dem Sozius studierte Freddy Krespel eine Landkarte. Den Wagen, einen sogenannten SuV, also eine Mischung aus geländegängigem Jeep und bequemen Mittelklassewagen, fuhr er noch nicht lange. Im Sommer hatte sein alter Daimler den Geist aufgegeben. Als neuen Dienstwagen durfte er sich einen der requirierten Wagen aus dem Arsenal der »Beuteautos« aussuchen. Erinnerungen an die wilde Verfolgungsjagd am Finowkanal wurden wieder wach. Er griff sich daher nach kurzem Zögern den Cherokee, der inzwischen neu lackiert in einem freundlichen silbergrauen Metallic erglänzte.
Linthdorf summte eine Melodie vor sich hin, die er meist bei Ausflügen im Kopf hatte: die Barcarole aus »Hoffmanns Erzählungen«. Dabei störte ihn das Gedudel des Autoradios nicht. Die beiden Jungs hatten einen eigenartigen Musikgeschmack. Er konnte partout nichts mit den neuen Klängen und hämmernden Beats moderner Musikrichtungen anfangen. Aber er tolerierte es weitestgehend. Nur wenn es sich allzu schrill anhörte, drehte er den Sender raus. Dann gab es meist etwas Verstimmung.
Der Wagen bog am Ortsende von Linum in eine kleinere Seitenstraße, die direkt zu den Linumer Teichen führte.
Vor knapp 150 Jahren wurde hier im Linumer Bruch noch Torf gestochen. Die Gegend war ein wichtiger Lieferant dieses als billiges Brennmaterial hoch geschätzten Rohstoffs. Quer durch die Luchlandschaft gab es damals überall Torfstechereien. Nachdem die Kohle den Torf verdrängt hatte, verschwanden die Torfstecher aus der Landschaft. Zurück blieben tiefe Löcher in der Erde. Ein paar findige Leute kamen auf die Idee, diese Löcher zu fluten und in den neu entstandenen Teichen Fische zu züchten. Die Linumer Teiche waren so entstanden. Lange Zeit wurden sie speziell für die Karpfenzucht genutzt. Nach der Wende kamen französische Investoren nach Linum und machten den Teichfischern die Störzucht schmackhaft. Dieser inzwischen wieder im Brandenburgischen heimische Fisch wird vor allem wegen seines Rogens, dem begehrten Kaviar, gut bezahlt. Außerdem gilt sein Fleisch als eine Delikatesse. Das weiße Fleisch des Störs erinnert an junge Karpfen und ist auch als Räucherfisch ausgesprochen wohlschmeckend.
Linthdorf steuerte zielsicher ein unscheinbares Holzhaus direkt vor den Teichen an. Ein unverkennbarer Duft nach frischem Buchenholzrauch schlug ihm entgegen, als er die Tür des Autos öffnete. Seine Augen leuchteten auf und er schnüffelte geräuschvoll den rauchigen Duft ein. Krespel war inzwischen ebenfalls ausgestiegen und begann sogleich seine Kamera zu justieren. In der Luft war das tausendstimmige Konzert der gefiederten Gäste unüberhörbar. Schwäne flogen im Tiefflug ein, Graugänse zogen in schwindelerregender Höhe ihre Kreise und auf dem Wasser war ein buntes Sammelsurium von allen möglichen Federtieren zu entdecken: Blesshühnern paddelten aufgeregt zwischen den bunten Enten und Gänsen herum, weiße Singschwäne kreuzten wie Fregatten vollkommen stoisch auf dem Wasser und am Rande hatten es sich ein paar Graureiher gemütlich gemacht.
Krespels Kamera klickte im Sekundentakt. Auch Linthdorf hatte umständlich seine alte Praktika hervorgeholt. Er bevorzugte immer noch das Fotografieren mit Film. Diese alte Kamera hielt ihn davor zurück, ähnlich wie jetzt Freddy Krespel, wahllos in der Gegend herum zu knipsen. Er wusste, dass sein Filmvorrat begrenzt war. Das zwang ihn, sich stets zu überlegen, ob das Motiv wirklich ein gutes Foto hergab oder nur Banales abbildete. Zu Hause sortierte er dann noch einmal aus, so dass wirklich nur perfekt durchkomponierte Fotos in seinem kleinen Archiv verblieben. Für Linthdorf hatte das Fotografieren etwas Meditatives. Ein wenig Harmonie und Ordnung in seinem Leben, auch wenn es nur auf Zelluloid zu entdecken war, hatte immensen Wert für ihn. Die Fotos mit ihrer stillen Ästhetik waren ein Gegenpol zu seiner oft gewalttätigen und verstörenden Alltagswelt.
Zahlreiche Menschen waren hier versammelt, viele waren mit aufwändigen Fotoausrüstungen ausgestattet um dieses Naturereignis festzuhalten. Die Chance, auf engem Raume so viele Federtiere vor die Linse zu bekommen, hatte man nicht oft. Die kleine Holzhütte mit dem dazugehörigen Räucherofen war gut besucht. Auf den Außenbänken drängten sich die Menschen, ebenfalls an den Tischen im Schankraum.
Ein Duft nach frisch geräuchertem Fisch schlug Linthdorf entgegen und ließ ihn automatisch die Füße Richtung Räucherofen setzen. Krespel folgte etwas widerwillig. Er ahnte, dass es mit der guten Laune Linthdorfs sonst vorbei war, wenn er nicht bald etwas Schmackhaftes bekam.
»Mein Gott, Theo, nun reiß dich doch mal ein bisschen zusammen! Wir sind noch keine fünf Minuten hier und du denkst schon wieder nur ans Essen.«
Linthdorf blickte etwas verstört auf seinen mit Kameras behangenen Begleiter. »Mensch Freddy, wer weiß denn, wie lange es bei diesem Andrang noch was Jutes gibt. Komm schon, außerdem hab ich Hunger.«
Damit drängte er entschlossen durchs Gewühle.
Zehn Minuten später saß er mit einem großen Pappteller voller Fischleckereien, einem Pappbecher mit Bier und zwei Weißbrotkanten an einem großen Holztisch. Krespel hatte sich ein paar kleinere Fischhappen genehmigt und schaute etwas missvergnügt auf Linthdorfs Riesenportion. »Na, konnteste wieda ma nich jenuch kriegen, oller Fressbär!«
Linthdorf blieb erstaunlich gelassen, sortierte die Fischhappen und begann wortreich seinem Begleiter zu erklären, was ihm da entging: »Mensch, guck doch mal, Welsröllchen, Aalhappen, geräucherter Zander, Spießchen mit Lachs, Saibling, Lachsforelle, und als Krönung Stör!«
Schräg gegenüber Linthdorf saß ein Mann, der den Fischliebhaber mit dem großen Teller erstaunt anblickte. Vor ihm stand ein Pappteller, der mindestens genauso gut gefüllt war, wie der Linthdorfs. »Ich kenn Sie doch! Mensch, Linthdorf, ich bin’s: Hauptmeister Boedefeldt aus Linum! Erinnernse sich noch? Na das trifft sich ja jut ... Hähä!«
Linthdorf kam der kugelrunde Mann mit Igelfrisur und dem verschmitzten Gesicht bekannt vor. Natürlich, Roderich Boedefeldt, der findige Dorfpolizist, der erheblich bei der Klärung des Mordfalles Hirschfänger mitgewirkt hatte, war für Linthdorf kein Unbekannter. Seine Orts- und Menschenkenntnis hatte eine schnelle Klärung des Falles ermöglicht.
Linthdorfs Kollegin Louise Elverdink hatte so eine direkte Spur zu dem Psychopathen Peregrinus aufnehmen können. Die Ereignisse überschlugen sich damals. Ein Kollege aus Brandenburg war bei einer nervenaufreibenden Hetzjagd zu Tode gekommen. Die ganze Jagd lief innerhalb von Sekundenbruchteilen noch einmal durch Linthdorfs Hirnwindungen. Blitzlichtartige Bilderfetzen, die beklemmende Atmosphäre am nebligen Finowkanal und die zermürbenden Ermittlungen, die vollkommen ins Leere zu laufen schienen. Drei Monate im Winter hatte sich Linthdorf mit der Suche nach dem ominösen Nixenmörder beschäftigt.
Nachdem der Fall abgeschlossen war, hatte sich der Kommissar plötzlich leer und ausgebrannt gefühlt wie lange schon nicht mehr. Seinen ganzen Jahresurlaub hatte er gebraucht um wieder in die Balance zu kommen. Der Sommer war nur als eine kurze Episode von ihm wahrgenommen worden. Noch lange geisterten die toten Nixen und der Nixenschatz durch seine nächtlichen Träume, manchmal so intensiv, dass er plötzlich wie von einer Tarantel gestochen aufwachte, schweißüberströmt im Bett saß und Schwierigkeiten hatte, wieder einschlafen zu können. Er war selbst erstaunt über sich und seine Reaktionen auf dieses Verbrechen.
Eigentlich ließ er sonst seine Gefühle außen vor, wenn er ermittelte, aber hier lagen seine Nerven blank. Vielleicht waren es die vielen Todesfälle im Zusammenhang mit der Suche nach dem Schuldigen, vielleicht war es auch das etwas schale Gefühl beim Abschluss des Falles, versagt zu haben, da die wirklich Schuldigen mit einem blauen Auge davon gekommen waren.
Zweifel nagten an ihm, ob er denn auch wirklich konsequent genug gewesen war bei der Ermittlungsarbeit. Irgendwie hatte sein Chef es geschafft, die Arbeit auf der letzten Etappe zu sabotieren. Linthorf spürte dann wieder den Zusammenhalt des Klüngels, zu dem sich sein Chef bekannte und dem man mit normaler Polizeiarbeit nicht beikommen konnte.
Im Spätsommer hatte Linthdorf beschlossen, einen Schlussstrich zu setzen und sich dem Alltag und dem Jetzt zu widmen, da er sonst Angst bekam, in einer Depression zu versacken. Mit seiner ihm eigenen eisernen Disziplin begann er also wieder systematisch am normalen Leben teilzunehmen. Er traf sich mit seinen Freunden, ging abends öfters fort und fuhr an den freien Wochenenden auch wieder übers Land. Eine zerbrechliche Ausgeglichenheit stellte sich bei ihm ein.
Innerlich spürte er zwar noch immer den Unmut und das Unwohlsein, dass seit diesem letzten Winter in ihm rumorte, nach außen hatte er jedoch wieder seine ausgeglichene und ruhige Lebensart aufgenommen, so dass in seiner Umgebung keiner etwas von der seltsamen Unruhe Linthdorfs mitbekam. Manchmal glaubte er selber, dass alles wieder in bester Ordnung war. Aber dann schüttelte er diesen Trugschluss von sich ab. Spätestens wenn er an der Tür seines Chefs vorbei musste, war dieses unangenehme Gefühl wieder voll präsent.
Und just in diesem Augenblick, beim Anblick des friedlich ihm gegenüber sitzenden Dorfpolizisten Roderich Boedefeldt, stellte sich auch dieses Gefühl in voller Macht wieder in ihm ein, drängte sich in sein Gehirn und durchflutete wie ein dunkler Schatten sein Herz.
Beim Anblick dieses Mannes fiel ihm wieder seine Kollegin Louise Elverdink ein, die er seit dem Ende der Ermittlungen nicht mehr gesehen hatte und die bei ihm so etwas wie ein kleines Tauwetter ausgelöst hatte. Er wollte sich selbst nicht eingestehen, dass Louise ihm weit mehr bedeutete als nur eine kompetente Kollegin. Andererseits hatte er auch keine große Lust, sich wieder auf unbekanntes Glatteis zu begeben. Zu oft hatte er schon böse Einbrüche erlebt. Die Zeiten der Erholung wurden von Mal zu Mal immer länger und die Herzschmerzen erreichten ein Ausmaß, welches es selbst ihm mit seiner Selbstdisziplinierung immer schwerer machte, den Alltag zu meistern. Allerdings ahnte er auch, dass die Art und Weise zu leben, die er seit der Trennung von seiner Frau führte, keine große Zukunft hatte.
Ein ständiges Unzufriedensein hatte sich in ihm eingenistet. Linthdorf konnte es nur schwer beschreiben, denn eigentlich ging es ihm ja leidlich gut. Er hatte einen festen Job, der recht aufregend war, zwei wohl geratene Kinder, einen stabilen Freundeskreis, dennoch nagte das Unwohlsein an seinem Gemüt. Meistens ließ er solche Gedanken nicht zu. Dann flüchtete er in die Arbeit, oder, falls es mal so etwas wie Freizeit gab, trieb es ihn hinaus aus der engen Stadtwohnung ins Brandenburgische. Das war der eigentliche Grund für seine guten Kenntnisse der Mark. Endlos die Wege, die er befahren hatte, endlos auch die Zeiten, die er hier in der Einsamkeit verbrachte. Er war ein Eigenbrötler geworden ohne es zu merken.
Schmerzlich wurde ihm das bewusst, als er sich nach der Trauerfeier für Alfred Stahlmann von ihr verabschiedete. Die Zusammenarbeit mit ihr hatte ihn beflügelt. Er hatte sich an ihre dunkle Stimme und den leichten Duft nach ..., ja, wonach duftete Louise überhaupt? Linthdorf hatte eine Idee, die ihm aber zu verwegen erschien. Er kramte in seiner Manteltasche nach seinem Handy, durchforstete seinen Speicher und lächelte einen kurzen Moment später. Jetzt konnte er sich auch entspannt dem Dorfpolizisten zuwenden.
»Ja, Mensch Boedefeldt, klar kenn’ wir uns!«
»Was hat Sie denn hierher verschlagen?«
»Na, die Kraniche und natürlich der Fisch.«
Linthdorf grinste und zeigte auf seinen reichlich gefüllten Pappteller. Boedefeldt lachte und verwies ebenfalls auf seinen Teller. »Wir ha’m denselben Jeschmack. Jeräucherter Stör is wat janz feines ... Hmm!«
Linthdorf nickte wissend.
»Und wie geht’s sonst so? Viel Arbeit? Was macht denn Ihre nette Kollegin aus Brandenburch?«
»Naja, der übliche Kram. Viel Büroarbeit, viele Überstunden, wenig Freizeit. Sie kennen das ja. Und meine nette Kollegin ... Ja, also, die ist wieder in Brandenburg an der Havel. Hab sie lange nicht mehr gesprochen.«
»Mein Jott, Linthdorf! Die Frau ist doch ne wahre Sahneschnitte und sie ijnorieren se! Det kann doch nich wahr sein! Wie die Ihnen hinta her jekuckt hat ..., also, Mann o Mann! Det müssten se doch jespürt ha’m.«
Linthdorf war irritiert. Was der Dorfpolizist ihm da so leicht entrüstet zwischen zwei Fischhappen erzählte, lief ihm wie ein warmer Schauer den Rücken hinunter. Krespel und seine beiden Jungs beschäftigten sich glücklicherweise mit irgendwelchen bunten Heftchen und waren damit abgelenkt.
Verlegen lächelte er Boedefeldt an.
»Na ja, so richtig Zeit hatte ich bisher nicht.«
»Ach, kommen se, Linthdorf, Sie sind doch kein Kostverächter, nee, so sehnse wirklich nicht aus!«
»Ja, vielleicht sollte ich ...«
»Na klaar, sollten se ..., so lange ist die Frau nicht mehr frei auf’m Markt. Det können se mia glauben!«
Eigentlich war Linthdorf das Thema inzwischen zu privat geworden, aber was er da von dem Mann vor sich erfuhr, war viel zu interessant, um abzulenken. Dennoch wurden die beiden jäh unterbrochen. Ein älterer Herr im Pfadfinder-Outlook hatte sich plötzlich zu ihnen gesellt. Boedefeldt begrüßte ihn gleich überschwänglich: »Tach auch, Herr Professor!«
Der Angesprochene winkte ab: »Lassen se mang jut sein. Keine Titel, keine übertriebene Höflichkeit.« Dabei lächelte er kurz.
»Ach was, kommen se ran. Ich hab hier noch Platz jenuch.«
Der Mann im Tarnanzug rutschte vorsichtig mit auf die Bank. In seinen Händen war ebenfalls ein Pappteller, gefüllt mit Matjesheringen, Zwiebelringen und einer weißen Tunke.
Boedefeldt schielte genießerisch auf den Inhalt der runden Pappe: »Hmm, Herr Professor, aba da wissense schon, wat jut schmeckt!« Dabei ließ er wieder sein ansteckendes, dröhnendes Lachen ertönen.
Professor Dr. Dr. Horst Rudolf Diestelmeyer, Experte für Ornithologie, spezialisiert auf die seltenen Lemikolen, saß wie ein Häufchen Unglück neben dem runden Polizisten. »Ach, Boedefeldt, mir geh’n immer noch die armen Kraniche nicht aus’m Kopp. Nachts träum’ ich schon von diesen schrecklichen Bildern. Das ist viel schlimmer als die Sache mit der nackten Toten im Rhin. Wissen se, da war kein Blut bei, aber hier ... Alles voller Blut, ein Massaker!«
Boedefeldt nickte. Er war ja mit dabei gewesen, als der Professor die toten Kraniche gefunden hatte. Ein Skandal für das kranichverrückte Linum. Keinem der Bewohner war so etwas zuzutrauen und dennoch war es geschehen. Es konnte nur ein Insider sein, also ein Mensch mit spezieller Ortskenntnis. Aber alle Ermittlungen waren ins Nichts verlaufen. Boedefeldt blickte kurz zu seinem riesenhaften Gegenüber. Wenn einer etwas Licht in dieses ominöse Kranichmassaker bringen konnte, dann war es dieser Mann. Er räusperte sich und setzte zu einer kurzen Rede an. Linthdorf lauschte dem ungeheuerlichen Bericht des Dorfpolizisten. Der Professor warf ab und an ein paar Worte mit ein, um dem Ganzen etwas mehr Nachdruck zu verleihen.
Dann war plötzlich Ruhe. Boedefeldt und Diestelmeyer schwiegen, Linthdorf hatte aufgehört, seine Fischhappen weiter zu essen. Es dauerte noch mindestens ein paar Minuten bevor er mit leiser Stimme fragte: »Haben Sie Fotos vom Fundort? Gab es eine kriminaltechnische Untersuchung des Fundortes?«
Boedefeldt nickte. »Ick hab den janzen Vorjang bei mir im Büro. Kommense ma nachher rüba zu mia. Denn zeich’ ick Ihnen allet.«
II
Eine kurze Meldung im Ruppiner Tagesblatt
Rubrik »Was sonst noch passierte ... «
Tierquälerei
Unbekannte Täter haben im Naturschutzgebiet im Rhinluch unweit des Storchendorfes Linum zahlreiche Kraniche mit unzulässigen Schlingen gefangen und getötet. Der Naturschutzbund NABU und die örtlichen Polizeiorgane haben die Ermittlungen aufgenommen.
III
Berlin - Friedrichshain
Sonntag, 22. Oktober 2006
Linthdorf hatte schlecht geschlafen. Der Sonntagmorgen war grau und kalt. Ein Blick aus dem Fenster reichte vollkommen aus, um das festzustellen. Etwas verstört saß er auf der Bettkante und starrte vor sich hin. Die Bilder in seinem Kopf waren nicht so einfach weg zu bekommen. Es waren beklemmende Bilder, die ihm den Schlaf geraubt hatten.
Gestern am späten Nachmittag war er im kleinen Dienstzimmer Boedefeldts aufgetaucht. Boedefeldt hatte schon auf ihn gewartet. Eine Mappe mit großformatigen Fotos lag bereit. Linthdorf sah sich die Fotos mit den blutigen Kadavern der Kraniche an und sagte dabei kein Wort. Danach schob ihm der Dorfpolizist noch die Ermittlungsakte rüber. Viel war darin nicht zu lesen. Der oder die Täter schienen sehr professionell vorgegangen zu sein. Brauchbare Spuren waren nicht entdeckt worden. Die benutzten Schlingen konnten in jedem Bau- oder Gartenmarkt erworben worden sein und andere Spuren gab es einfach nicht mehr. Die Tiere waren beim Auffinden schon mindestens 24 Stunden tot. Etwaige Spuren im Gras waren durch den Dauerregen längst verwischt.
Linthdorf bat Boedefeldt, ihm Kopien von den Akten zu machen und die Fotos, die auch als Dateien auf dem Computer des Polizisten noch einmal vorhanden waren, per Email zu schicken. Er versprach Boedefeldt sein Bestes zu tun, um den oder die Täter dingfest zu machen. Auf der Rückfahrt hatte er Mühe, sich auf den Weg zu konzentrieren. Dicke Nebelschwaden lagen über der Landschaft und schluckten alles Licht und jedes Geräusch. Der Wagen rollte mit geringer Geschwindigkeit gen Berlin. Seine beiden Söhne schliefen auf den Rücksitzen und auch Freddy Krespel döste vor sich hin. Linthdorf war ganz froh, sich jetzt nicht unterhalten zu müssen. Die gerade gezeigten Bilder musste er erst einmal verdauen. Der sinnlose Tod so vieler unschuldiger Geschöpfe ging ihm aufs Gemüt, insbesondere da er diese spezielle Affinität zu den großen Vögeln hatte.
Es war noch dunkel draußen, aber er war hellwach. Er knipste den kleinen Radioempfänger an, der direkt neben dem Bett auf dem kleinen Bücherregal stand. Etwas Ablenkung war jetzt wichtig. Er konnte doch nicht den ganzen Sonntag in tiefem Selbstmitleid zerfließen. Es gab ja schließlich auch noch eine Außenwelt jenseits von Mord und Totschlag.
Ein Schlager aus den Siebzigern verkündete frohe Botschaften. Die beschwingte Melodie ließ Linthdorf die unruhige Nacht etwas vergessen und er schlurfte Richtung Küche. Mit routinierten Bewegungen füllte er gemahlenen Kaffee in eine sorgfältig gekniffene Filtertüte, füllte Wasser in die kleine Kaffeemaschine und steckte drei Schrippen in den Miniofen zum Aufbacken. Der Kühlschrankinhalt war übersichtlich. Linthdorf erfasste dies mit einem Blick. Ein einziges Glas mit Hagebuttenmarmelade stand da in der Mitte, am Rande waren noch zwei Konservendosen mit Thunfisch und eine angefangene Packung mit Edamer-Käsescheiben. Er seufzte. Eigentlich wollte er ja gestern noch einkaufen. Aber der Bericht Boedefeldts hatte ihm jegliche Lust auf den Discounter an der Ecke genommen. Seine beiden Söhne wollten noch zu einem Schulfreund, mit dem sie für ein Computerspiel verabredet waren. Krespel war ebenfalls unterwegs noch ausgestiegen um seine Getränkevorräte aufzufüllen.
Irgendwie hatte sich dann der Abend ereignislos vertan. Linthdorf war bei einer alten Heimatschnulze aus den fünfziger Jahren eingeschlafen, kurz nach Mitternacht aufgewacht und dann ins Bett geschlurft.
Und jetzt saß er an seinem kleinen Küchentisch, biss mit wenig Enthusiasmus in seine frisch aufgebackenen Brötchen und schlürfte dazu den etwas zu stark geratenen Kaffee.
Der gestrige Tag lag ihm quer auf der Seele. Die Ereignisse des letzten Winters hatten sich unbarmherzig konkret in Linthdorfs Gehirn wieder reaktiviert, so als ob das alles erst gerade passiert gewesen wäre.
Dazu dann noch Boedefeldts erschütternder Bericht über das Kranichmassaker. Aber irgendetwas Positives war ja auch hängen geblieben. Es war nur eine kurze Bemerkung des Dorfpolizisten über seine damalige Mitarbeiterin Louise Elverdink. Linthdorfs Gesicht wurde von einem kurzen Lächeln erhellt. Ja, natürlich. Er wollte sie einfach einmal anrufen. Wann, wenn nicht jetzt? Es war Sonntag. Kein Stress, kein Zeitdruck, keine störenden Zwischenrufe und anderweitigen Unterbrechungen. Er nahm noch einen Schluck Kaffee und griff dann das Telefon. Irgendwo im Speicher war ihre Nummer vorhanden.
»Hallo?«
»Ach, Herr Linthdorf! Gut, dass Sie anrufen. Sie wissen also schon ...?«
»Was? Wieso schon?«
»Ab morgen arbeiten wir doch wieder zusammen. Ich freue mich schon.«
»Oooh. Also ..., ja, also ... Ja, ich freue mich auch ... Ja, sehr sogar!«
»Sie wissen noch gar nichts davon?«
»Naja, nicht so ganz detailliert. Nägelein sagte mir etwas von einer neuen interdisziplinären SoKo, die gerade gegründet werden soll und dass er mich dafür ausersehen hat, dort mitzutun ...«
»Ja, es geht um großangelegte Geldwäsche und Steuerbetrug wohl auch. Wir werden uns dann morgen in Potsdam sehen. Ich freue mich.«
»Ja, ich auch ..., also bis morgen.«
So hatte sich Linthdorf das Telefonat zwar nicht vorgestellt, aber die Aussicht Louise Elverdink wiederzusehen, bereitete ihm sichtlich gute Laune. Er erinnerte sich auch wieder an das Gespräch mit Nägelein vom vergangenen Donnerstag.
Der hatte ihn zu sich rufen lassen, sorgfältig die Tür verschlossen und in seiner unnachahmlich betulichen Art ihm eröffnet, dass mal wieder etwas Großes auf die Abteilung zukam. Von ganz oben, also ja, von Ministerbeschlüssen und Staatssekretären mit Sondervollmachten, solle das ausgehen. Die Landeskassen seien nun schon permanent seit Jahren leer und riesige Geldströme würden in undurchsichtige Kanäle fließen und von Steuerbetrug und Hinterziehung war die Rede. Alles ein abgekartetes Spiel. Und jetzt habe man endlich genug von dieser Art Kriminalität.
Das wären ja schließlich keine Bagatellverbrechen oder Kavaliersdelikte und überhaupt, man habe sich geeinigt. Eine Super-Soko solle gegründet werden. Steuerfahnder, Leute aus dem Ressort Wirtschaftskriminalität und Verwaltungsspezialisten seien mit dabei. Und ja, er wurde gefragt, ob er einen Spezialisten habe, der Land und Leute gut kenne, und ja, natürlich fiel ihm da nur einer ein, eben Linthdorf.
Zurzeit sei ja im Bereich Kapitalverbrechen auch nicht so viel zu tun. Und Linthdorf sei ja nun mal eben ein moderater und intelligenter Mensch ...
Jedenfalls, nach knapp einer Stunde Monologisieren war Nägelein dann soweit, und eröffnete ihm, diese neu zu gründende SoKo leiten zu sollen. Linthdorf erbat sich noch ein Wochenende Bedenkzeit, aber er wusste bereits am Donnerstag, dass er keine wirklichen Gegenargumente für diese Aufgabe hatte.
Seit ein paar Wochen hatte es keine größeren Vorkommnisse mehr gegeben, die es galt mit vollem Einsatz zu bearbeiten. Er ackerte sich mühsam durch alte Akten durch, die schon seit langem auf ihren Abschluss warteten. Das war zwar sehr zäh, aber dafür auch nicht sehr nervig.
Also freute sich Linthdorf auf die neue Sonderkommission. Andere Gesichter, andere Aufgaben, eben mal nicht nur Mord und Totschlag.
Gut Lankenhorst
Etwas über die Symbolik der Kraniche
Kraniche, die großen Glücksvögel, haben die Menschen schon seit alters her fasziniert. Ihr eleganter Flug, die federleicht wirkenden Balztänze und ihr melodisches Trompeten hatten die Tiere stets als etwas Besonderes und Einzigartiges erscheinen lassen.
Die alten Griechen haben den Vogel den Göttern Apollo, Demeter und auch dem Götterboten Hermes bei gestellt. Er wurde daher auch immer mit den Eigenschaften dieser Götter belegt: Wachsamkeit, Klugheit und Glückseligkeit. Kraniche waren immer etwas vollkommen Positives. Ihr Auftauchen signalisierte den Menschen, dass die »guten Götter« in ihrer Nähe weilten und das Glück ihnen hold war.
Bei den alten Chinesen waren Kraniche ein beliebtes Motiv der klassischen Malerei. Sie symbolisierten dort Langlebigkeit und Weisheit. Speziell im Verhältnis des Vaters zu seinem Sohn wurden Kranichsymbole benutzt um Harmonie und Klugheit als Ausdruck deren inniger Beziehung zueinander sichtbar zu machen. Im alten Japan wurden Kraniche auch als Friedensbringer angesehen. Aus Papier gefaltete Kraniche symbolisieren dort die Sehnsucht nach Frieden und Harmonie.
Im mittelalterlichen Europa wurden Kraniche als Symbole für Vorsicht und Wachsamkeit angesehen. Als heraldisches Signum sieht man Kraniche sehr oft in den Wappen alter Adelshäuser auftauchen.
Später dann, in der höfischen Dichtung tauchen Kraniche als natürliche Protagonisten für das Erhabene, Edle auf. Schiller verwendete das Kranichmotiv in seiner Ballade »Die Kraniche des Ibykus«. In der Romantik wurde das Kranichmotiv von Malern und Dichtern ebenfalls in derselben Deutung genutzt.
I
Das Alte Gutshaus
Sonntag, 22. Oktober 2006
Das Gebäude ähnelte mehr einem etwas in die Jahre gekommenen Schloss als einem klassischen, märkischen Gutshaus. Früher war es einmal ein sehr wohlhabendes Anwesen. Zum Gut gehörte ein großer, verwilderter Park, dessen backsteinerne Umfassungsmauern noch recht intakt waren. Die Einfahrt wurde von einer alten Eichenallee geadelt. Das etwas schmucklose Tor hatte den diskreten Charme volkseigener Bauobjekte und stand in einem eigenartigen Kontrast zu der morbiden Pracht des Gutes.
Zum Gut gehörten auch zwei große Wirtschaftsgebäude – schmucklose, backsteinerne Quader mit Wellblechdach, eine verfallene Brennerei, deren viereckiger Klinkerschornstein wie ein mahnender Zeigefinger in die Höhe ragte und das Torhaus, ein Verwaltungsgebäude gleich hinter der Toreinfahrt, ein trutziger, einstöckiger Bau mit eigenem kleinen Obst- und Gemüsegarten. Im hinteren Teil des Parks blinkte ein kleiner Teich zwischen den Bäumen hervor. Am Ufer des Teichs lugte ein unscheinbarer Pavillon aus dem Röhricht.
Im Gutshaus brannte am Abend dieses nasskalten Oktobertages in allen Räumen Licht. Es schien eine gewisse Unruhe von diesem Lichtschein auszugehen. Ein zufällig vorbeischauender Beobachter würde hinter den Fenstern diverse Schatten herumhuschen sehen. Diese Schatten gehörten zu den Bewohnern des Gutshauses, die in einem heftigen Disput miteinander ihre Außenwelt vollkommen vergessen hatten.
Die einzige Person, die nicht herumlief und in einem alten Ohrensessel zu erstarren drohte, war ein älterer Herr in einer abgewetzten Strickjacke. Spärliche graue Haare, sorgfältig gescheitelt, bedeckten sein Haupt, eine runde Brille thronte auf der bemerkenswerten Charakternase, unter der ein leicht graumelierter Schnauzer wuchs. Die Augen schauten etwas müde durch die Brillengläser auf die unruhig herumschwirrenden Schatten. Diese wurden von drei weiteren Personen und einem riesigen Berner Sennhund erzeugt, die in dem großen, saalartigen Raum hin und her liefen. Zwischen den Personen tapste der Hund schwanzwedelnd herum.
Wortführer war eine robuste Dame, deren perfektes Make Up und strahlend blonde Frisur irritierten, denn sie war schon weit jenseits der Fünfzig angekommen. Eingehüllt in eine starke Duftwolke aus teurem Parfüm hatte der Hund Probleme, wenn er sich ihr näherte. Dennoch war seine Sympathie offensichtlich sehr groß für diese Frau. Stets hatte sie ein paar Leckerbissen bei sich und Streicheleinheiten ließen ihn den starken Parfümgeruch vergessen.
Ihre Gesten erinnerten an den Auftritt einer Diva. Sie war sich dessen bewusst und setzte ihre weiblichen Reize, die unverkennbar noch vorhanden waren, ständig bei ihren Reden mit ein, um ihr Anliegen besser zu vertreten. Mit Augenaufschlag und einer leicht affektierten Pose tänzelte sie um den großen ovalen Tisch.
Am anderen Ende des Tisches stand ein etwas unauffälliger Mann in grauer Joppe und mit graumeliertem Haar. Er trug eine Brille, Modell »John Lennon«. Ihm schien der Auftritt der mächtigen Blondine etwas Unbehagen zu bereiten. Sein Gesichtsausdruck war dementsprechend schwankend zwischen Verstörtheit und totalem Missfallen. Mehrfach versuchte er sich in den großen Monolog der Blondine einzuklinken, um beschwichtigende Worte zu finden. Nach drei kläglichen Versuchen ließ er es bleiben. Seine schwache Stimme wurde einfach ignoriert.
Der dritte Mann im Raum war ein ebenfalls schon etwas in die Jahre gekommener Waldschrat in typischer Waldmenschenkluft. Kariertes Hemd, Manchesterhose, Stiefel und eine olivgrüne Anglerweste ließen die Vermutung aufkommen, dass sein Aufgabenfeld vor allem außerhalb der vier Wände zu finden sei.
Die drei Personen, die wie Planeten um den ovalen Tisch mit dem alten Herrn an seiner Spitze kreisten, waren die Mitarbeiter von Baron Rochus Friedrich Achilles Helmfried von Quappendorff, dem Besitzer des Gutes Lankenhorst und der dazugehörigen Immobilien und Ländereien.
Es handelte sich dabei um Gunhild Praskowiak, die neben der Hausverwaltung auch für die Veranstaltungsplanung und Öffentlichkeitsarbeit des Gutes zuständig war. Der unauffällige Herr in Grau war der Archivar und persönliche Sekretär des Barons, Rolf Bertram Leuchtenbein und der Waldschrat, der neben dem wichtigen Posten des Hausmeisters auch gleichzeitig für den Park und den angrenzenden Forst zuständig war, hörte auf den freundlichen Namen Meinrad Zwiebel.
Die Stimmung im Raum war gereizt. Gunhild redete ununterbrochen auf die beiden Männer und den am Tisch sitzenden Baron ein. »Ick reiß mia hier den Arsch auf für den janzen Laden, kenn keinen Urlaub und keinen Feiaamd und seh nicht ein, det alles den Bach runtajehn zu lassen. Nu sachen se doch ooch ma was, Herr Baron ... Mein Jott, mit ihre Beziehungen is doch bestimmt noch wat drinne. Sie ham doch uns alle dafür ranjeholt, damit det Jut wieda een kultivierta Ort wird. Klappt doch ooch allet janz prima, und nu soll allet for die Katz jewesen sein ..., nee!«
Vor ihr hatte sich der große Hund hingesetzt und blickte sie mit seinen braunen Knöpfchenaugen erwartungsvoll an.
»Ach Brutus, ick kann jetzt nich ... Jeh ma zu deinem Herrchen.«
Etwas genervt zeigte sie ihre leeren Hände dem Hund, der diese mit seiner großen Zunge sogleich anfing, abzuschlecken. Zwiebel und Leuchtenbein mussten sich ein Grinsen unterdrücken. Beide wussten über die spezielle Affinität Gunhilds für alle Vierbeiner und speziell für Brutus Bescheid.
Aus dem Sessel des Barons war ein Seufzer zu vernehmen. »Leuchtenbein, was meinen Sie denn?«
Der Angesprochene zuckte mit den Schultern. »Naja, bis Jahresende kommen wir ja noch hin mit den Geldern. Aber dann wird es knapp. Die Stiftung hat die neuen Gelder noch nicht genehmigt und damit liegen viele der angefangenen Projekte erst mal auf Eis. Das wissen Sie ja auch. Sie sitzen ja im Stiftungsrat.«
»Ist ja schon gut, ich weiß um die Missstände ..., nun ja, also ..., morgen kommen die übrigen Stiftungsleute zum Quartalstreffen hier her. Die Probleme sind bekannt und werden von mir aufs Tapet gebracht. Ich hoffe auf ihre Kooperation, schließlich hängen ja auch ihre Arbeitsplätze mit daran.«
Damit erhob er sich ächzend aus dem Sessel, griff sich seinen mahagonibraunen Gehstock und schlurfte Richtung Tür.
Die drei Mitarbeiter des Barons blieben in dem großen Raum allein zurück. Etwas ratlos schauten sie sich an. Zwiebel grummelte etwas vor sich, was sich wie »Hat ja doch alles keinen Zweck.« anhörte. Leuchtenbein sank etwas verzagt in einen der überdimensionierten Sessel. Nur Gunhild Praskowiak schien sich von der deprimierenden Stimmung nicht anstecken zu lassen. »Nu wartet doch erst einmal ab. Bisher hamse det ja imma noch hinjebogen bekommen. Und wenn die anderen Stifter halbwegs mitmachen, sieht et doch jar nich so übel aus.«
Sie schien sich mit dieser kleinen Ansprache selber Mut machen zu wollen. Tief in ihrem Herzen hatte sie auch so ihre Zweifel am Gelingen des Projekts. Aber so viele Alternativen zu diesem anspruchsvollen Job gab es hier draußen in der tiefsten Mark Brandenburg eben nicht, also musste das Ganze weitergehen.
Gut Lankenhorst gehörte lange zu den Stiefkindern der Wende. Kein Mensch schien sich für das prächtige Gutshaus und dessen Park wirklich zu interessieren.
Die Familie von Quappendorff, uralter märkischer Adel, der schon vor den Askaniern ins Land gekommen war, hatte hier mehrere Jahrhunderte ihren Sitz. Ihre besten Zeiten lagen jedoch schon lange zurück. Vollkommen verarmt durch die beginnende Industrialisierung, mussten sie in der Gründerzeit ihren Stammsitz veräußern. Bereits nach dem ersten Weltkrieg war das Gut zwangsversteigert worden, als sich der damalige neue Besitzer, ein reicher Berliner Brauereibesitzer, verspekuliert hatte und sein ganzes Vermögen in der Inflation verloren gegangen war.
Ein Bankenkonsortium übernahm das Gut. Im Dritten Reich quartierte man Zwangsarbeiter ein, die in den benachbarten Rüstungsfabriken im Finowtal eingesetzt wurden. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden Umsiedlerfamilien in das Gutshaus gesetzt. Um mehr Zimmer zu bekommen, zog man kurzerhand neue Wände ein und verkleinerte so die eleganten Säle.
Später wurde das Hauptgebäude als Verwaltungssitz und Kulturhaus der ortsansässigen LPG genutzt. Dafür wurden die Wände wieder herausgerissen. Die Außenfassade bekam den DDR-typischen Rauputz verpasst und die Wirtschaftsgebäude wurden in Heu- und Strohlager umgebaut.
Nur der Park blieb erstaunlicherweise von den sozialistischen Umgestaltungen verschont. Er diente als malerisches Ambiente für ein Kinderferienlager, was zwischen den Bäumen eingerichtet worden war. Zehn Bungalows duckten sich im Schatten von Kiefern und Buchen.
Dann kam die Wende und das Gut wurde öffentlich zum Kauf angeboten. Das angrenzende Dörfchen Lankenhorst war viel zu klein, um eine solche finanzielle Last zu stemmen.
Spekulanten gab es in den ersten Jahren nach der Wende in Hülle und Fülle. Sie versprachen der Treuhand, die das Gut nach dem Zusammenbruch der DDR verwaltete, das Blaue vom Himmel. Wellness-Palast, Fünf-Sterne-Hotel mit Golfanlage und eigenem Reiterhof, Schönheitsklinik, Congress-Center ...
Die Bieter überschlugen sich in Fantasien für eine blühende Zukunft des Gutes. Keiner konnte jedoch ernsthafte Ambitionen nachweisen. So verblieb das Anwesen in der Treuhandverwaltung.
Irgendwann jedoch meldeten sich die Nachfahren derer von Quappendorff bei der Treuhand und bekundeten Interesse an dem alten Gut. Als sie erfuhren, was für Altlasten sie dabei mit zu übernehmen hatten, kühlte das Interesse merklich ab. Nur der alte Baron von Quappendorff, ein pensionierter Gymnasiallehrer, der seine frühe Kindheit noch in dem Verwaltungsgebäude von Gut Lankenhorst verlebt hatte und mit seinen Eltern 1945 Richtung Rheinland fliehen musste, brachte wirkliches Interesse für die geschundene Immobilie auf. Für die symbolische Summe von einer D-Mark erwarb er das Gut von der Treuhand.
Allerdings war mit diesem Vorzugskauf eine Klausel verbunden, die aus dem Gut in den nächsten Jahren wieder ein Schmuckstück in der Region werden lassen sollte. Der alte Herr verpflichtete sich in einem Zusatzvertrag mit der Treuhand und den örtlichen Behörden der neugegründeten Kommunalverwaltung zu recht umfangreichen Investitionen. Dabei ging es nicht nur um die Wiederinstandsetzung der Gebäude und des Parks, sondern auch um die nachhaltige Schaffung von Arbeitsplätzen und die Einbindung des Gutes in die kommunalen Strukturen.
Quappendorff hatte ehrgeizige Pläne. Er fühlte sich noch nicht zu alt für eine solche Aufgabe, zumal er seit acht Jahren nun schon als Witwer lebte und seit seiner Pensionierung vor einem Jahr nichts so richtig mit seiner Zeit anzufangen wusste.
Irgendwie hatte er es geschafft, seine Verwandtschaft zu überreden, mit zu machen bei der Wiedererweckung des alten Stammsitzes der Familie. Seine Verwandtschaft bestand in erster Linie aus vier Personen: da war seine Schwester Friederike-Charlotte von Quappendorff, genannt Friedel, eine in stiller Bescheidenheit ergrauten Dame, die seit dem letztem Jahr jedoch bettlägerig war und in einem Seniorenheim unweit Berlins betreut wurde. Zu seiner Schwester hatte der Baron kaum Kontakt. Sie war damals in den Osten gegangen, hatte da auch geheiratet, sich wieder scheiden lassen und nur wenig mit den anderen Quappendorffs zu tun.
Des Weiteren gab es noch seine beiden Töchter Irmingard-Sophie, genannt Irmi, und Clara-Louise, genannt Klärchen, beide gut situiert, verheiratet mit erfolgreichen Männern und mit einer Schar Kinder gesegnet, die entsprechend selbstbewusst auftraten, sowie seinen Neffen Lutger von Quappendorff, Sohn des leider viel zu früh verstorbenen Bruders Hektor Neidhardt von Quappendorff.
Sein Neffe machte ihm etwas Sorgen. Dessen Naturell war ganz anders als bei den übrigen Quappendorffs, von einem krankhaften Geltungsdrang bestimmt. Der Baron führte diesen Drang auf die mütterliche Seite Lutgers zurück. Sein Bruder hatte eine Frau geheiratet, die sehr viel Wert auf Titel gelegt hatte und dafür auch eine Ehe mit einem fast zwanzig Jahre älteren Mann eingegangen war. Rochus warnte seinen Bruder vor dieser Liaison. Ihm war es suspekt, was diese junge ehrgeizige Frau mit seinem stillen und introvertierten Bruder anfangen wollte. Der frühe Tod des Bruders war wahrscheinlich auch auf den hektischen Lebensstil seiner jungen Gattin zurückzuführen.
Alle drei waren im Stiftungsrat von Gut Lankenhorst. Dazu gesellte sich noch der Filialleiter der Märkischen Kreditbank aus der Kreisstadt Oranienburg, Gernot Hülpenbecker. Er verwaltete die Konten der Stiftung und war auch gleichzeitig zuständig für die persönliche Beratung Rochus‘ von Quappendorff in allen Geldfragen.
Der Stiftungsrat traf sich quartalsweise auf dem Gut Lankenhorst zu seinen Sitzungen. Eigentlich waren die Sitzungen des Stiftungsrates ja mehr ein Familientreffen, zumal Gernot Hülpenbecker fast schon als Familienmitglied angesehen wurde. Er war ein Studienfreund der Töchter des alten Barons und begleitete ihn durch die Jahre mit freundschaftlichem Rat und tatkräftiger Hilfe.
Die Idee, eine Stiftung aus dem alten Gut zu machen, war auch von Hülpenbecker gewesen. Alles andere jedoch war im Kopfe des alten Quappendorffs gewachsen. Endlich konnte er seine Vorhaben, die er schon als Gymnasiallehrer hatte, auch umsetzen. Überall, wo ihm die engen Strukturen der Schulverwaltung und die langsame Arbeitsweise der Behörden einen Strich durch die Rechnung machten, wurde er ausgebremst.
Aber dieses alte Familienanwesen, an das er sich kaum noch erinnern konnte, bot plötzlich Raum für all das, wofür sich der alte Herr Zeit seines aktiven Schullebens eingesetzt hatte. Durch den Wegfall der Mauer konnte er endlich seine langgehegten Pläne umsetzen. Er brauchte auch nicht lange zu argumentieren, um seine Töchter und letztendlich auch seinen Neffen für die Idee eines Kunst- und Kulturzentrums auf Gut Lankenhorst zu begeistern.
Alle wussten von seiner Passion. An seinem Gymnasium hatte er bereits vor über dreißig Jahren den Neubau einer schuleigenen Bibliothek mit Veranstaltungsräumen und kleiner Werkstatt durchgesetzt. Im Landkreis war man aufmerksam geworden auf ihn. Auch im Stadtrat engagierte er sich ehrenamtlich für diverse Kulturprojekte. Er war glücklich, dass auf seine Initiative hin direkt im Erdgeschoss des alten Rathauses eine Stadtgalerie eingerichtet und ein Posten des Ortschronisten ausgelobt wurde. Er kümmerte sich um den alten Stadtpark, der sonst wahrscheinlich zu Bauland umfunktioniert worden wäre, und er sorgte sich um die verkehrstechnische Anbindung der Dörfer aus dem Umland, so dass der Busverkehr im Kreisgebiet eine Vorbildfunktion für das gesamte Bundesland hatte.
Baron von Quappendorff war ein Philanthrop durch und durch. Ihm schwebte ein Schloss vor, dass für jeden zugänglich war und dass als kultureller Mittelpunkt die ganze Region mit erblühen lassen sollte. Die Gegend rings um Lankenhorst war bisher vom Aufschwung weitgehend verschont geblieben.
Von Berlin war es schon zu weit weg um noch vom »Speckgürtel« zu profitieren. Der »Speckgürtel« war ein knapp fünfzig Kilometer breiter Ring, der sich um die Hauptstadt zog. Die darin liegenden Ortschaften und Städte waren in den letzten sechzehn Jahren vom Glück begünstigt worden. Massive Investitionen in die Infrastruktur des »Speckgürtels« zahlten sich nun aus. Das Straßennetz war ausgebaut und modernisiert worden. Viele Orte hatten S-Bahnanschluss. Wohnparks und Gewerbegebiete schossen wie Pilze aus dem Boden und die Einwohnerzahl hatte sich fast verdoppelt. In den neuen, schönen Einfamilienhäusern wohnten gutverdienende Leute. Es gab viele Kinder und auch das Kulturangebot war entsprechend reichhaltig.
Fuhr man jedoch etwas weiter hinaus ins Brandenburgische, dann änderte sich die Gegend schlagartig. Dünn besiedelt war hier das Land. In den Dörfern wohnten meist ältere Menschen und die Verlierer der Wende. Die Dorfstraßen waren rumplig und die Fassaden warteten noch auf ihre Verschönerung. Alte verlassene Backsteinbauten wuchsen wie das Dornröschenschloss langsam zu. Keiner wusste mehr so genau, was da mal früher drin gemacht worden war. Geschlossene Dorfkneipen und Läden weckten Erinnerungen an einstige Prosperität.
Lankenhorst war so ein Dörfchen jenseits des »Speckgürtels«. Früher gab es hier sogar mal ein Kino. Das Gebäude stand sogar noch als baufällige Ruine mitten im Dorf. Bäume waren inzwischen hoch gewachsen und versteckten so gnädig den direkten Blick auf die Fassade. Auch die beiden Dorfkneipen waren schon seit Jahren verwaist. Der große Gasthof »Zur alten Linde« war mit dunkelbraunen Jalousien verbarrikadiert worden und die kleine Dorfkneipe mit dem verblassten Schild »Lankenhorster Krug« hatte nicht eine ganze Scheibe mehr. Die wenigen Kinder des Ortes hatten sich einen Spaß daraus gemacht, mit ihren Katapulten Zielschießen darauf zu veranstalten.
Etwas versteckt am Rande des Dorfes lag das alte Gut mit seinem Park und den alten Wirtschaftshöfen. Auch sie boten jahrelang ein Bild des Jammers. Seit drei Jahren war das Gut wieder belebt. Der alte Quappendorff hatte als erstes Fenster und das Dach des Gutshauses instand setzen lassen, dann die Räume renoviert und eine Zentralheizung einbauen lassen. Der Park wurde vorsichtig entrümpelt und der kleine Teich im hinteren Teil des Parks sah nach zwei Sommern schon wieder ganz manierlich aus. Dennoch war das Pensum der noch zu bewältigenden Aufgaben immens.
Quappendorff hatte vom Landkreis ein paar Strukturfonds anzapfen können und einige brauchbare Mitarbeiter wurden ihm auf Anfrage vermittelt. Aus der Vielzahl der Bewerber für die ausgeschriebenen Stellen hatte er sich drei Leute auserwählt. Den etwas unauffälligen Leuchtenbein, den praktisch veranlagten Zwiebel und die etwas schrille, dafür aber vielseitige Gunhild Praskowiak. Allesamt waren keine jungen Hüpfer mehr, hatten einige Brüche in ihrer Vita, aber waren doch für die Ideen des Barons zu begeistern. Im Übrigen arbeitete er sowieso lieber mit gestandenen Leuten als mit den jungen Hitzköpfen. Das hatte er lange genug als Lehrer praktizieren müssen – jetzt wollte er endlich einmal etwas effizient und zügig durchziehen.
II
Auszug aus dem Gutachten zur
Schätzung und Taxierung des Grundstücks Lankenhorst
A 47/2322/FG-XIII-Az. 03299/01
Lage des Grundstücks: äußere Ortslage Dorf Lankenhorst
Größe: 45 000 qm
Ausweisung: denkmalgeschütztes Ensemble bestehend aus:
1) Gutshaus, erbaut 1821, zweigeschossiger Bau mit
2 Seitenflügeln und Walmdach, überdachte Fläche 1175 qm
2) Torhaus, erbaut 1888, eingeschossiger Bau mit
ausgebautem Dachgeschoß, überdachte Fläche 147 qm
3) Pavillon, erbaut 1847, offener Rundbau, 22 qm
4) Eiskeller, wahrscheinlich 1823 erbaut, einsturzgefährdet
5) Park, alter Baumbestand mit 2400 Laubbäumen und ca.
3000 Nadelbäumen, darunter zahlreiche seltene Arten (u.a.
Eiben, Blutbuchen, Traubenstieleichen), Teich, ca.400 qm,
umlaufende Mauer aus Feldsteinen, zwei Parktore, Zugang zum
Hellsee mit Bootssteg und eigenem Ufer, befestigt
Gesamtschätzwert: 418 000 Euro
Gegenwärtiger Besitzer: Land Brandenburg
Pacht: Stiftung Kultur-Gut Lankenhorst e.V., vertreten durch Rochus von Quappendorff
Pachtdauer: 99 Jahre
gez. Dr. Achim Wellenkamp
Dipl. Architekt, Büro Wellenkamp & Möller, Eberswalde
III
Der Archivar
Rolf-Bertram Leuchtenbein war ein unauffälliger Mensch. Unauffälligkeit war sein Lebensprinzip. Schon als Schuljunge zeichnete er sich durch seine diskrete Art aus. Keiner bemerkte ihn so richtig. Auf dem Schulhof stand er immer etwas abseits, schaute zwar stets interessiert zu, wenn es ab und zu mal zu kleineren Prügeleien kam, aber beteiligen oder gar selbst einmal eine Prügelei anfangen, war nicht sein Ding.
In der Klasse saß er meist weit hinten, blickte oft interessiert aus dem Fenster, nahm aber ansonsten an dem ganzen Unterrichtsgeschehen nicht so richtig teil. Sowohl die Lehrer als auch seine Mitschüler waren etwas ratlos, wie man mit diesem offensichtlich recht langweiligen Menschen umgehen sollte. Seine Eltern, beide schon etwas älter – daher auch der etwas antiquierte Vorname – waren eigentlich ganz froh über den unauffälligen Nachwuchs. Er machte nicht diese Probleme, die andere Eltern mit ihren renitenten Kindern hatten, und er war auch nicht so anstrengend wie die übermäßig begabten Kinder, die ständig beschäftigt werden mussten, um ihren unnatürlichen Wissensdrang zu stillen. Eigentlich ein Glücksfall.
Seine Leistungen waren nicht überragend, aber auch nicht so schlecht, dass man sich schämen musste. Berti, so wurde er damals genannt, schlängelte sich überall durch. Er war der Idealtyp des Mitläufers. Wenn jemand in der Klasse über ihn stolperte, dann lag das vor allem daran, dass man ihn nicht bemerkte.
Berti trug stets ausgesprochen unauffällige Kleidung. Grelle Farben waren im suspekt. Sein Outfit war den Bedingungen einer Polytechnischen Oberschule in einem Berliner Vorort optimal angepasst. Jeans, meist in einem undefinierbaren Farbton zwischen Blau und Grau, graue Pullover und eine olivgrüne Jacke – anders sah man Berti eigentlich nicht in der Öffentlichkeit. Er war nicht groß, aber auch nicht klein. Berti bewegte sich in all seinen schulischen Entwicklungsphasen stets im Durchschnitt. Seine Stimme war nur sehr leise zu vernehmen. Lautes Gebrüll oder andere akustische Signale waren nie von ihm zu erwarten.
Einmal sollte er im Musikunterricht ein Lied singen. Alle waren gespannt und warteten auf diese ungewöhnliche Lautäußerung. Berti kniff. Er entschuldigte sich mit einer plötzlichen Erkältung, die ihn erwischt hatte. Der Musiklehrer schaute etwas ungläubig auf den Jungen und ließ ihn fortan in Ruhe. Es war mitten im schönsten Mai, als das passierte.
Auch später - Berti machte eine Lehre zum Versicherungskaufmann - fiel er durch seine unauffällige Art nicht weiter auf. Erstaunlich war dann jedoch, dass er nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Lehre nicht bei der Staatlichen Versicherung seinen Berufsweg begann. Er revoltierte.
Etwas Unerhörtes schien sich da in ihm seinen Weg zu brechen. Berti, der sich jetzt mit dem etwas cooleren Namen Rolfbert anreden ließ, bewarb sich bei der Stadtbezirksbibliothek von Berlin-Friedrichshain als Aushilfskraft. Natürlich wurde er genommen.
Hier schien er sich sichtlich wohler zu fühlen als im Versicherungswesen. Die Bücher um ihn herum schwiegen still und alles hatte seine Ordnung. Außerdem hatte er hier eine sehr nette und freundliche Kollegin. Eigentlich war es seine Chefin. Eine jugendlich frische, resolute Dame mit goldlockigem Wallehaar und wohlgeformten Rundungen. Allerdings hielt sich Rolfbert diskret zurück. Schließlich sollte man ja nicht während der Arbeitszeit ..., und überhaupt, eine Liaison d’Amour im Arbeitsverhältnis galt immer als problematisch.
Die Wende beendete das paradiesische Leben in den labyrinthischen Gängen der Bibliothek. Rolfbert wurde kurzerhand eingespart, die Stadt hatte andere Sorgen als das öffentliche Lesebedürfnis ihrer Bewohner. Nun fing ein harter und traumatischer Leidensweg für den schüchternen, jungen Mann an. Endlose Gänge durch die Arbeits- und Sozialämter der Stadt, ab und an eine Gelegenheitsarbeit, dann mal wieder eine Umschulung. Rolfberts Alltag wurde immer trister.
Wenig Erbauung hatte er noch. Es schien sich zu rächen, was einst so vorteilhaft war: seine Unauffälligkeit. Ein Wesenszug, der im real existierenden Sozialismus ein sorgenfreies und grundsolides Leben ermöglichte, der aber jetzt in der schrill bunten Welt der Selbstdarsteller und Möchtegernhelden eher kontraproduktiv war. Überall wurde er ignoriert und kam bei Bewerbungen nicht so recht zum Zuge. Stets drängelte sich ein anderer, meist unverschämter Mitbewerber vor und bekam auch stets die begehrte Stelle.
Ihm blieben meist nur tröstende Worte. Eines Morgens fand Rolfbert einen Brief vom Arbeitsamt in seinem Briefkasten. Er solle sich doch bitte bei einem Baron von Quappendorff vorstellen. Eine Stelle als Archivar wäre vakant. Zwar vorerst nur als Dreijahresvertrag, aber mit einem interessanten Einsatzgebiet und einer ganz ordentlichen Entlohnung.
Seufzend setzte sich Rolfbert an seinen Computer, kopierte kurz seinen Lebenslauf, die abgespeicherten Zeugnisse und Referenzen, und tippte eine kurze Bewerbung nach Standardmuster. Viel Hoffnung machte er sich ja nicht.
Ein Baron, nun ja, bisher hatte er mit dem Adel noch nicht so viel Erfahrungen sammeln können. Aber warum denn auch nicht.
Eine Woche später sprach er dann auf Gut Lankenhorst vor. Der ältere Herr in seiner grünen Strickjacke war ihm sofort sympathisch. Und eine Wohnung bot er ihm auch gleich noch an. Dann zeigte er ihm die Berge von Büchern in den alten Kellergewölben und auf dem Dachboden, die auf seine professionelle Begutachtung warteten. Ob er denn auch als persönlicher Sekretär ... Rolfbert nickte nur begeistert. Er war endlich angekommen.
IV
Aushang in diversen Dörfern und Städtchen der Regionen Oberhavel und Niederbarnim:
Kulturtage in Lankenhorst
Schloss Lankenhorst lädt ein zum Dritten Lankenhorster Kulturherbst:
Sonnabend, 28.10.2006
Auftaktveranstaltung mit dem Kammerorchester »Brenabor«
Sonntag, 29.10. 2006
Schlossparkfest mit Wildschwein vom Spieß, selbstgebackenem Kuchen, Live-Musik und Spielen
Vernissage in der Schlossgalerie: »Märkische Flecken und Dörfer – eine Hommage an Theodor Fontane« – neue Bilder und Graphiken von Brandenburger Künstlern
Montag, 30.10. 2006
Festsitzung des Anglervereins Oberhavel, Prämierung der Sieger vom Anglerwettbewerb »Quappe, Hecht & Zander«
Dienstag, 31.10.2006
Halloween-Feier mit Hexe Gunhildis am Lagerfeuer
Mittwoch, 1.11.2006
Halali – Konzert der Jagdhornbläsergruppe der Kreismusikschule Bernau
Donnerstag, 2.11.2006
Diskussionsrunde im Schloss »Lankenhorster Träume und Pläne«
Filmvorführung »Die Lemikolen Brandenburgs« von Prof. Dr. R. Distelmeyer
Freitag, 3.11.2006
Vortrag »Pilze – richtig sammeln und zubereiten«
Lampionumzug durch den Park »Auf den Spuren der »Weißen Frau« von Lankenhorst«
Samstag, 4.11.2006
Abschlussveranstaltung mit dem Harfenquintett »Veneziana« und anschließendem Comedy-Slapstick-Abend mit unserem Allround-Entertainer Siggi Keule-Paschulke
V
Lankenhorst - Das Alte Gutshaus
Sonntagnacht, 22. Oktober 2006
Der alte Quappendorff schlief schlecht. Schon seit vielen Jahren hatte er diese Probleme mit dem Einschlafen. Lange Zeit konnte er durch abendliche Einnahme von Baldrian-Tropfen dem Problem eine wirksame Lösung entgegensetzen. Aber seit längerem wirkten die Tropfen nicht mehr.
Er spürte es schon vor dem Zubettgehen. Immer wenn er sich aufgeregt hatte, blieb diese Anspannung in ihm, die es unmöglich machte, einzuschlafen. Heute war wieder so ein Tag. Die abendliche Diskussionsrunde mit seinen drei Getreuen und die hohen Erwartungen, die dem morgendlichen Stiftertreffen galten, erzeugten jenes, dem alten Baron so wohlbekannte Kribbeln, das ein Einschlafen unmöglich machte.
Oftmals half da ein nächtlicher Spaziergang durch den Park. Der Baron besann sich kurz und zog dann seine alten Stiefel an, warf seinen grünen Lodenmantel über und suchte auch seinen Schlapphut, den er immer bei seinen nächtlichen Ausflügen zu tragen pflegte.
Draußen war es neblig, feucht und kühl. Tief sog er die sauerstoffreiche Luft in sich ein und ging langsam los. Er lief immer eine Runde, die ihn quer durch den Park führte. Wenn er langsam ging, brauchte er zwanzig Minuten, wenn er rüstig ausschritt, schaffte er den Rundweg auch in einer Viertelstunde. Den Weg kannte er. Selbst im tiefsten Dunkel der Nacht wusste er, wohin er seine Füße zu setzen hatte. Zuerst kam immer das Wegstück quer durch die Rhododendron-Büsche.
Jetzt im Herbst waren sie zu unscheinbaren Schatten ihrer selbst geworden. An die Hecken schloss sich eine größere Wiese an. Der Weg zog sich linkerhand an einem kleinen Wäldchen entlang, bog dann scharf rechts ab und gabelte sich nach wenigen Schritten. Der rechte Weg führte weiter hinein in das Wäldchen, entlang der alten Parkmauer bis hinter, in den noch weitgehend unberührten Teil des Parks. Der linke Weg hingegen zog sich in einem sanften Bogen zu dem kleinen Pavillon und dem gleich dahinter liegenden Teich. Dieser Teil des Parks war von Meister Zwiebel bereits wieder instand gesetzt worden. Das Unterholz war ausgedünnt, neue Sträucher und Bäumchen angepflanzt worden und der Ententeich hatte eine neue Uferbefestigung bekommen. Zwiebel hatte sogar ein kleines Holzhüttchen gezimmert. Es stand nun mitten im Teich und diente den beiden Stockenten und ein paar Blesshühnchen als Unterschlupf.
Der Baron mochte diesen Teil des Parks sehr. Direkt am Teich hatte er eine Parkbank aufgestellt. Hier saß er oft und sah den gefiederten Bewohnern des Teichs bei ihrem Tun zu.
An dieser Stelle war auch der am weitesten entfernte Punkt seines Rundwegs erreicht. Meistens verweilte er hier kurz, genoss die vollkommene Stille, die ihn umgab.
Er hatte sich gerade bequem hingesetzt als er sie sah. Am anderen Ufer des kleinen Teichs bewegte sich durch den Nebel eine weiße Gestalt. Sie schien zu schweben. Lautlos wie die Erscheinung gekommen war, verschwand sie auch wieder. Dem Baron fröstelte es. Er schüttelte kurz den Kopf.
Wahrscheinlich narrte ihn sein übermüdetes Gehirn und gaukelte ihm Spukgestalten aus seinem Unterbewusstsein vor. Er erhob sich langsam und setzte seinen nächtlichen Rundgang fort. Das Gutshaus war als tiefschwarze Silhouette zu erkennen. Der Weg führte durch eine kleine Bodenwelle zurück. Hier wartete ein alter Eiskeller, der seit Urzeiten schon verfallen war.
Mit Zwiebel hatte er das alte Gewölbe begutachtet. Zwiebel meinte zwar, dass man den Keller wieder instand setzen könne. Aber das müsse wohl ein Spezialist machen. Er selbst traue sich das nicht zu. Der Baron hatte den Eiskeller daraufhin erst einmal verschließen lassen, damit nicht jemand dort noch verschüttet werden konnte.
Der alte Mann trabte tief in Gedanken versunken durch diese kleine Senke. Plötzlich streifte ihn ein kühler Luftzug. Er blickte kurz auf und sah direkt über dem Eiskeller wieder einen hellen Fleck im Nebel. Er rieb sich kurz die Augen und sah ein zweites Mal hin. Es schien die Silhouette einer Person zu sein. Aber so richtig fassbar war sie nicht. Die Konturen verschwammen. Ob es nun am Nebel lag oder an dem spärlichen Licht, das in dieser Oktobernacht nur die Lichtungen etwas erhellte, jedenfalls konnte der Baron nicht mit Sicherheit feststellen, ob ihm seine übermüdeten Sinne einen Streich spielten oder ob da wirklich etwas war.
Er beschleunigte seinen Schritt, zählte in Gedanken seine Schrittfrequenz und sah sich nicht mehr um. Es war alles etwas zu viel gewesen am heutigen Abend. Außer Atem erreichte er endlich das Gutshaus. Vorbei der Spuk, dachte er noch beim Eintreten und ging dann still und leise die Treppe hinauf zu seinem Schlafzimmer.