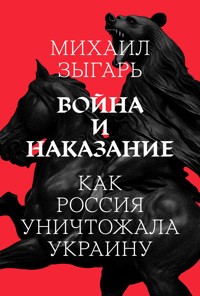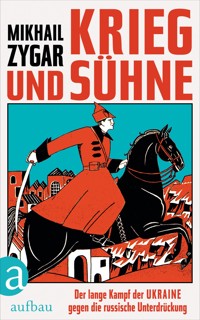
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mythen haben Russlands Krieg gegen die Ukraine den Boden bereitet. Von der Erfindung eines geeinten russischen Volks durch den deutschen Mönch Innozenz Giesel bis zum Narrativ einer russischen Krim – russische Propaganda nimmt die Ukraine und ihre Geschichte seit Jahrzehnten in Geiselhaft. In seinem die Jahrhunderte umspannenden Buch führt uns Mikhail Zygar zu den Ursprüngen von Russlands Imperialismus – und weist so den Weg aus seinen zerstörerischen Wahnvorstellungen.
»Zygar hat ein neues Genre erfunden. Wenn Tolstois Geschichte ein breiter Strom ist und die von Proust ein langsamer Fluss, dann ist Zygars eine Verfolgungsjagd.« Dmitri Muratow, Friedensnobelpreisträger 2021.
»Um Russlands Abstieg in den Abgrund und den blutigsten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg zu erklären, unternimmt Zygar eine unbequeme Neubetrachtung der jüngsten Vergangenheit. Sein Buch ist nicht nur ein Leitfaden für diese Vergangenheit, sondern auch ein kraftvoller Aufruf, die Gegenwart zu verändern.« Serhii Plokhy.
»Zygar ist einer der Helden des Widerstands in Putins Russland.« Washington Post.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
»Um Russlands Abstieg in den Abgrund und den blutigsten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg zu erklären, unternimmt Zygar eine unbequeme Neubetrachtung der jüngsten Vergangenheit. Sein Buch ist nicht nur ein Leitfaden für diese Vergangenheit, sondern auch ein kraftvoller Aufruf, die Gegenwart zu verändern.« Serhii Plokhy
Unmittelbar nach Beginn der Invasion in der Ukraine ergreift Mikhail Zygar – einer der besten Kenner des Putin'schen Regimes – Maßnahmen: Er verbreitet eine Petition gegen den Krieg, die von Tausenden unterzeichnet wird. Diese Tat führt zu einem neuen Gesetz, das Kritik am Krieg unter Strafe stellt. Zygar ist gezwungen, aus seiner Heimat zu fliehen.
In »Krieg und Sühne« zeigt er, wie mehr als 300 Jahre russischer Propaganda, Volksmärchen und Fantasy – von den legendären Taten der Kosaken bis zu den Spionageromanen der 1970er Jahre – dem russischen Krieg gegen die Ukraine den Boden bereitet haben. In einem anekdotenreichen Geschichtsbuch schlägt Zygar den Bogen von Katharina der Großen über den Zusammenbruch der Sowjetunion bis in die Gegenwart – und zeichnet den langen Kampf der Ukraine gegen die russische Unterdrückung nach. Er dekonstruiert die wirkmächtigsten Mythen und fordert von seinem eigenen Volk Sühne, ohne die ein Neubeginn undenkbar ist.
Über Mikhail Zygar
Mikhail Zygar, geboren 1981, war von 2010 bis 2015 Chefredakteur des unabhängigen russischen Fernsehsenders Doschd. 2015 erschien sein Bestseller »Endspiel. Die Metamorphosen des Wladimir Putin«. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine startete er eine Onlinepetition gegen den Krieg, musste seine Heimat verlassen und lebt nun in Berlin. Seit 2022 arbeitet Zygar, der im Dezember 2022 Prigoschins »Marsch auf Moskau« vorhersagte, als Kolumnist für »Der Spiegel«.
Marlene Fleißig, geboren 1992, übersetzte u. a. Bücher von Sheera Frenkel und Blake Gopnik.Sigrid Schmid, Jahrgang 1975, hat u. a. Bücher von Jaron Lanier und Harold James aus dem Englischen übertragen.Karlheinz Dürr, geboren 1947, hat u. a. Bücher von Noam Chomsky und Masha Gessen übersetzt.Jens Hagestedt, geboren 1958, ist der Übersetzer von u. a. Ronan Bergman und John Gray.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Mikhail Zygar
Krieg und Sühne
Der lange Kampf der Ukraine gegen die russische Unterdrückung
Aus dem Englischen von Sigrid Schmid, Marlene Fleißig, Jens Hagestedt und Karlheinz Dürr
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Editorische Notiz
Einleitung
Teil 1 — Sieben Geschichten kolonialer Unterdrückung der Ukraine
1: Der Mythos der Einheit — Wie Bohdan Chmelnyzkyj Moskau die Treue schwor
Die Erfindung der russischen Welt
Jelena von der Steppe
Leben im 17. Jahrhundert
Ein Moskau ohne Ambitionen
Die unabhängige Ukraine
Eine neue Weltordnung
Ewige Treue
Täuschung und Tod
Ruin und Vergessenheit
Sklaven und andere Güter
2: Der Mythos des Verrats — Wie Iwan Masepa mit Peter dem Großen brach
Der nackte Jüngling
Puschkin und sein Reiter
Der wahre Masepa
Eine nicht sehr glorreiche Revolution
Der erste Kaiser
Die Erste Srada
3: Der Mythos Krim — Wie Katharina die Große den Kosaken die Freiheit nahm
Kosak, Gelehrter, Hetman
Die Prinzessin und der Meuchelmörder
Kein Hetman mehr
Zwei Unabhängigkeitskriege
Krim und Sühne
Das Ende der Saporoger Sitsch
4: Der Mythos der Sprache — Wie Taras Schewtschenko gegen die Sklaverei kämpfte
Ein stilles, gutes Wort
Die Ketten sprengen
Die Verstümmelung der russischen Sprache
Die Vereinigten Staaten der Slawen
Ein furchtbarer Traum
Die Krim-Katastrophe
Das Ende der Leibeigenschaft
Es gibt keine ukrainische Sprache
5: Der Lenin-Mythos — Wie die unabhängige Ukraine entstand
Die Ukraine-Rus
Die Heimat der Revolution
Das demokratische Russland
Die erste Republik
Die Aufteilung des ehemaligen Russischen Imperiums
Katastrophe in Kyjiw
6: Der Mythos Wohlstand — Wie Stalin den Holodomor organisierte
Die leninistische Rus
Die Große Wende
Schädlinge, Simulanten, polnische Agenten
Der Stalin-Preis
7: Der Bandera‑Mythos — Wie die Ukrainer im Zweiten Weltkrieg kämpften
Der sowjetische James Bond
Zwischen zwei Reichen
Gegen alle
Teil 2 — Sieben aktuelle Geschichten über Unterdrückung in der Ukraine
8: Wieder vereint — Die Ukraine auf der Suche nach sich selbst
Bohdan-Chmelnyzkyj‑Park
»Verdienen wir diesen Außenseiterstatus wirklich?«
Umweltunfreundlich
Perestroika – aus Versehen
Russische Union
Erste Wahlen
Der erste Majdan
Die allergröße Show
9: Noch einmal Verrat — Leonid Krawtschuk zerstört die Sowjetunion
Hühnchen Kyjiw
Sperrstunde
Mein Mutterland, betrunken wie nüchtern
Unabhängigkeit auf dem Silbertablett
Comedian statt Präsident
Kirchenspaltung
Armee und Marine
Ein Krieg der Worte
10: Noch einmal die Sprache — Wie Leonid Kutschma den Teufel sattelte und nach Moskau flog
Den Satan reiten
Die Krim und der KGB
Das Imperium schlägt zurück
Clan-Kriege
KWN für Jelzin
Fast ein Champion
Eine verdammte Stadt
Dreihundert Dollar
Neues Fernsehen
Auf dem Weg nach Amerika
Zwei Familien
TV-Killer
Neujahrszauber und der Antichrist
Ein Journalist ohne Kopf
Ukraine ohne Kutschma
11: Noch einmal Bandera — Wie Putin die Saat für die Orange Revolution säte
Das Erbe der sowjetischen Geschichte
Wiktor und Wiktor
Tatsächlich … Liebe
»Du liebst uns nicht, Russland«
Freilauf
Der Pate
Nachfolger aus dem Osten
Noch einmal Beresowski
Terror und Wahlen
Militärparade in Kyjiw
Oranger Majdan
Kein Ort für Diskussionen
»Der Trend zum Zerfall«
Dritter Wahlgang
12: Noch einmal Erfolg — Wie Wiktor Janukowytsch die Orange Revolution überstand
Komsomol-Mitglieder an der Macht
Orange Plage
»Dann machen wir ihn gemeinsam fertig«
Nächtliche Vision
Die Gasmafia
Gasangriff
Überall herrscht »Srada«
Ukrainer und Kleinrussen
Musketiere
»Die Welt eines einzigen Hausherren«
Die Ukraine und die NATO
Krieg in Georgien
Große Koalition in der Ukraine
Patriarch von Kyjiw
Das Manhattaner Leben
Washingtoner Expertise
Amtszeit für die einen, Haftzeit für die andern
Sascha, der Zahnarzt
Wie Selenskyj sein Waterloo erlebt
Bolotnaja-Platz
13: Noch einmal Krim — Wie Putin den Krieg gegen die Ukraine entfesselte
Volldampf zurück
Niederlage am Geburtstag
Iron Majdan
Kekse oder Gas
Feuertaufe
Lasst die Spiele beginnen
Kniefall
Zwischenfall an der Grenze
Kleine grüne Männchen
Besondere Touristen
Danke, Donbas
Der Schütze gibt den Startschuss
Das Ende von Donezk
Das Reich des Bösen
Armee auf Urlaub
Lachen verboten
Minsker Abkommen
14: Noch einmal Lenin — Wie bei Wolodymyr Selenskyj der Spaß aufhört
Neues Jalta
Der Herrscher über den Osten
Diener des Volkes
Präsident und Showman
Der neue Wladimir
Schluss mit lustig
Neue Gesichter
Neujahrsneuigkeiten
Alki und Junkie
Anruf mit Folgen
Treffen mit Putin
Holocaustgedenken
Zurück in die Zukunft
In den Fängen der Pandemie
Revolution und Demütigung
Russland und Anti-Russland
Ein historischer Moment
Babyn Jar
Das Anti-Oligarchen-Gesetz
König Georg III.
Epilog
Anhang
Anmerkungen
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
Personenregister
Erläuterungen
Impressum
Editorische Notiz
Wir haben die Entscheidung getroffen, die ukrainischen Namen und Schreibweisen für ukrainische Personen- und Ortsangaben zu verwenden. Auch in historischen Zusammenhängen haben wir unser Bestes gegeben, die jeweils gültige Benennung zu wählen und nicht automatisch die in Deutschland meist in der russischen Schreibweise geläufige Version. So kennen wir zum Beispiel die ukrainische Hauptstadt – aus dem russischen Kyrillisch transkribiert – zwar als Kiew, aus dem Ukrainischen transkribiert ist die deutsche Schreibweise aber Kyjiw. Lediglich in ein paar Ausnahmefällen sind wir bei der medial präsenten Schreibweise geblieben (zum Beispiel bei »Klitschko« statt »Klytschko« oder »Tschernobyl« statt »Tschernobol«).
Einleitung
Dieses Buch ist ein Bekenntnis: Ich bekenne mich schuldig, die Zeichen nicht schon früher erkannt zu haben. Denn auch ich bin mitverantwortlich für den Krieg Russlands gegen die Ukraine, wie auch meine Zeitgenossen – und unsere Vorfahren. Auch die russische Kultur hat die Gräuel des Krieges mit ermöglicht.
Viele russische Schriftsteller und Historiker sind mitschuldig an diesem Krieg. Es sind ihre Worte, ihre Gedanken, die Putins Faschismus den Boden bereitet haben – obwohl nicht wenige von ihnen heute entsetzt wären, könnten sie die »Früchte« ihrer Arbeit sehen. Wir Russen haben nicht erkannt, wie tödlich die Vorstellung von Russland als einem »Großreich« war. (Sicherlich ist jedes Reich, jedes »Imperium« ein Unheil, aber über andere Imperien mögen andere Historiker urteilen.) Wir haben geflissentlich darüber hinweggesehen, dass die »große russische Kultur« über viele Jahrhunderte hinweg andere Länder und Völker verachtete, unterdrückte und vernichtete.
Damit eine russische Kultur – befreit vom Imperialismus – fortbestehen kann, müssen wir handeln. Wir müssen uns zunächst die Wahrheit über unsere Vergangenheit und unsere Gegenwart klar vor Augen führen.
Die russische Geschichte, die ukrainische Geschichte und in der Tat die Geschichte eines jeden Volkes enthält Mythen. Leider haben unsere Mythen uns in den Faschismus des Jahres 2022 geführt. Es ist an der Zeit, sie zu entlarven.
In diesem Buch geht es um Mythen und Menschen. Menschen, die vor hundert, zweihundert, dreihundert Jahren lebten und sich irgendwann in mythologische Gestalten verwandelten. Zwar starben sie, doch wurden sie nach ihrem Tod von den Historikern ihrer menschlichen Eigenschaften entkleidet: ihrer Schwächen, Leidenschaften, Zweifel und ihrer wahren Beweggründe. Sie wurden der unerbittlichen »Logik der Geschichte« unterworfen, die den Bedürfnissen derer dient, die die Macht innehaben.
Dieses Buch erzählt uns auch von unseren Zeitgenossen wie etwa Wolodymyr Selenskyj. Er und viele andere sind uns heute als reale Persönlichkeiten bekannt, aber auch sie werden schon bald zu unsterblichen und heroischen Figuren werden und uns in einer Generation wahrscheinlich bereits als legendäre Gestalten erscheinen. Und einer der Protagonisten dieses Buches, Putin, hat sich schon zu Lebzeiten in ein universales, wie aus einer anderen Welt stammendes Böses verwandelt. Ich werde versuchen nachzuvollziehen, wie das geschehen konnte.
Ich schreibe dieses Buch bewusst in moderner Sprache und im Präsens und bemühe mich, Parallelen zur Gegenwart aufzuzeigen, damit heutige Leserinnen und Leser nicht nur das Wort, sondern auch den Geist der jeweiligen Zeit erfassen können. Dafür werde ich mir zudem die Freiheit nehmen, hin und wieder »in die Köpfe« historischer Persönlichkeiten zu schauen und mir auszumalen, was sie gedacht haben in Momenten der Entscheidung.
Ich möchte, dass dieses Buch auch in einem Jahrhundert noch verstanden wird; es soll auch zukünftigen Leserinnen und Lesern Einblick in unsere Gedankengänge ermöglichen. Aus diesem Grund habe ich versucht, alle Charaktere als lebende Menschen darzustellen und nicht als historische Denkmäler. Ich möchte die alten Mythen entlarven, ohne die Historiker zu schonen – ohne Mitleid mit den Idolen von gestern und ohne Rücksicht auf die Gefühle meiner russischen Landsleute.
Natürlich kann dieses Buch Vergangenheit nicht ungeschehen machen und eine alternative Gegenwart herbeischreiben, aber es kann dazu beitragen, die Zukunft zu verändern. Nationalistische Geschichte ist eine Krankheit, an der viele Völker leiden. Das russische Volk kann die alten Mythen ausrotten, mit denen es infiziert ist.
Seit 2004 bereiste ich die Ukraine viele Jahre lang als Journalist. In dieser Zeit konnte ich Interviews mit allen ukrainischen Präsidenten führen und lernte sehr viele Politiker, wichtige Unternehmer, bekannte Reporter und auch Geistliche kennen. Ich war bei vielen wegweisenden und symbolischen Ereignissen anwesend, von den Gesprächen zwischen den Präsidenten Leonid Kutschma und Wladimir Putin im Jahr 2003 bis hin zur Feier in der Gedenkstätte Babyn Jar im Jahr 2021 anlässlich des 80. Jahrestages des Massakers an Zehntausenden Juden durch die Nazis, bei der Präsident Selenskyj ein neues Denkmal enthüllte.
Manchmal verbrachte ich auch längere Zeit in Kyjiw und in den umliegenden Regionen. So schrieb ich beispielsweise im Haus meiner Freundin Nadia in Butscha einen wesentlichen Teil meines Buches Endspiel. Inzwischen will Nadia allerdings nichts mehr mit mir zu tun haben: Weil ich Russe bin, hält sie mich für einen »Imperialisten«.
In den letzten Jahrzehnten habe ich auch als politischer Journalist in Russland gearbeitet, wobei ich mich bemühte, die hinter den Ereignissen verborgenen Ursachen und Beweggründe aufzudecken. Aufmerksam verfolgte ich die sich ständig verändernde Ukraine-Politik Russlands. Oft war ich entsetzt über das, was ich dabei hörte oder beobachtete, und ich habe nie einen Hehl aus meinen Überzeugungen als oppositioneller Journalist und Schriftsteller gemacht.
Im Jahr 2010 gehörte ich zu den Gründern des Fernsehsenders Doschd, des einzigen unabhängigen Nachrichtenkanals in Russland. 2014 wurde der Sender praktisch geschlossen, weil er aufrichtig und detailliert über den Euromajdan (in der Ukraine »Revolution der Würde« genannt) berichtet hatte. Beim Euromajdan hatten die Ukrainer, die der Korruption und des Machtmissbrauchs überdrüssig waren, die ukrainische Regierung gestürzt. Einen Monat vor der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim mussten auf Anordnung des Kremls alle russischen Kabel- und Satellitennetzwerke Doschd von ihren Senderlisten streichen.
Ich erinnere mich noch sehr gut an den 1. März 2014, als die russischen Senatoren (Mitglieder des Föderationsrates, des »Oberhauses« der Legislative) den Präsidenten ermächtigten, »russische bewaffnete Streitkräfte außer Landes einzusetzen« – womit sie praktisch dem Krieg gegen die Ukraine grünes Licht gaben. Am selben Tag teilte ich als Chefredakteur des Senders meinen Kolleginnen und Kollegen in einem Rundschreiben mit, dass wir von nun an, als Zeichen der Achtung für und der Solidarität mit der unabhängigen Ukraine, »v Ukraine« statt des im Russischen verwendeten »na Ukraine« schreiben würden, das von den Ukrainern als beleidigend empfunden werden konnte, weil die Präposition »na« die Ukraine eher wie eine Landschaft oder ein Teilgebiet denn als unabhängiges Land erscheinen lässt. Im Englischen hat »Ukraine« die Bezeichnung »the Ukraine« weitgehend verdrängt, während das Land im Deutschen noch immer überwiegend mit dem weiblichen Artikel bezeichnet wird.
Am 24. Februar 2022, dem Tag, an dem Putin eine groß angelegte Invasion der Ukraine befahl, verfasste ich einen Offenen Brief, der zunächst von mehreren russischen Schriftstellern, Filmemachern und Journalisten unterzeichnet wurde; später setzten Zehntausende Russen ihre Unterschrift darunter. Hier ist der Wortlaut der Briefs:
Der Krieg, den Russland gegen die Ukraine auslöste, ist eine Schande.
Er ist unsere Schande, aber leider werden auch unsere Kinder und noch weitere Generationen von Russinnen und Russen dafür Verantwortung tragen müssen. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder in einem Aggressor-Staat leben und sich schämen müssen, dass ihre eigene Armee ein unabhängiges Nachbarland angegriffen hat. Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger Russlands auf, zu diesem Krieg »Nein« zu sagen.
Wir glauben nicht, dass eine unabhängige Ukraine für Russland oder irgendeinen anderen Staat eine Bedrohung darstellt. Wir glauben Wladimir Putins Behauptung nicht, dass das ukrainische Volk von »Nazis« beherrscht werde und »befreit« werden müsse.
Wir fordern ein Ende dieses Krieges.
Kurze Zeit später musste ich nach Deutschland fliehen. Während meines ersten Jahres in Berlin hatte ich die Zeit, sämtliche Interviews noch einmal durchzulesen, die ich in den vergangenen 18 Jahren in der Ukraine und in Russland geführt hatte. Und ich sprach mit Hunderten Zeitgenossen über den Krieg – darüber, was uns hierhergebracht hatte, wo wir jetzt stehen. Aus diesen früheren und neuen Gesprächen entstand dieses Buch.
Das Buch umfasst zwei Teile. Es geht in ihm um Gegenwart und Vergangenheit – konkret um die historischen Mythen, aus denen die heutige Politik gewachsen ist und auf denen sie noch immer beruht. Sorgfältig und so unvoreingenommen wie möglich habe ich die historischen Quellen gelesen und versucht, die Ursprünge und Entwicklungen des brutalen Russischen Reiches nachzuvollziehen, die auch den derzeitigen Krieg ermöglichten. Dieses Buch ist nicht ein weiterer Versuch, eine Geschichte der Ukraine zu schreiben. Es ist vielmehr ein »Kriminalroman aus dem Blickwinkel des Verbrechers«, eine Chronik, wie Russland seit fünfhundert Jahren die Ukraine unterjocht.
Das Buch erzählt vom langen Weg in diesen Krieg – und von dem Weg zu Sühne und Strafe, der zweifellos noch vor uns liegt.
Nadia, ich bin kein Imperialist. Und ich schreibe dieses Buch, damit auch andere nicht zu Imperialisten werden.
Teil 1
Sieben Geschichten kolonialer Unterdrückung der Ukraine
1
Der Mythos der Einheit
Wie Bohdan Chmelnyzkyj Moskau die Treue schwor
Die Erfindung der russischen Welt
Kyjiw, 1670. Ein deutscher Mönch namens Innozenz Giesel schreibt ein Geschichtsbuch. Geboren in Königsberg und aufgewachsen in einer protestantischen Familie, zog er schon in jungen Jahren nach Kyjiw und trat zur Orthodoxie über.
Aber Innozenz schreibt nicht einfach nur ein Buch; er ist überzeugt davon, dass sein Geschichtsbuch dem orthodoxen Glauben, seinem geliebten Kyjiw und dem gesamten ukrainischen Gebiet nützen wird. Denn dieses sieht er bedroht: von den Muslimen, das heißt, vom Osmanischen Reich, aber auch vom Westen. Für ihn, einen Deutschen aus Ostpreußen, sind die Katholiken im 17. Jahrhundert eingeschworene Feinde Kyjiws, das gilt ganz besonders für das katholische Polen und den Jesuitenorden, der damals in diesem Teil Osteuropas großen Einfluss ausübt. Innozenz selbst ist kein einfacher Mönch; er ist Abt des wichtigsten Klosters in Kyjiw und somit eine wichtige politische Gestalt. Er nimmt in seinem Buch das auf, was die Kyjiwer Mönche vor ihm geschrieben haben, aber er fügt auch eine eigene, sehr bedeutsame Folgerung aus der Historie hinzu.
Wie bei mittelalterlichen Historikern üblich, beginnt Innozenz mit der Geschichte Noahs und erklärt, dass dessen Sohn Jafet als Stammvater aller Europäer angesehen werde. Doch dann springt die Erzählung zu Jafets sechstem Sohn Meschech oder Mesech, von dem der Legende zufolge das russische Volk abstamme und das Wort Moskva (Moskau) abgeleitet werde.[1]
Innozenz war nie in Moskau, aber sein Ziel ist es, die Illusion zu erzeugen, dass Moskau und Kyjiw eine gemeinsame Geschichte haben.
Ein heutiger Kritiker würde vielleicht behaupten, dass der aus Preußen stammende Innozenz das erfunden habe, was heute als Russkij Mir (russische Welt) bezeichnet wird – aber das wäre nicht ganz zutreffend. Im Grunde genommen erfindet er ein geeintes Volk, mit einer angeblich einzigen, einheitlichen Geschichte: Die sogenannte Rus[2] werde, so Giesel, von einem einzigen Volk bewohnt, dem russischen.
Bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts hatten die Moskauer Herrscher nur eine sehr verworrene und mythologisierte Vorstellung von ihrer Geschichte und ihren Vorfahren gehabt. Sie betrachten sich als Nachkommen und Erben sowohl der römischen Kaiser als auch der Kyjiwer Fürsten. Sie sind überzeugt, dass sich ihre Abstammungslinie bis zu Kaiser Augustus (63 v. Chr.–14 n. Chr.) erstreckt. Im Großfürsten Wolodymyr dem Großen von Kyjiw (ca. 958–1015) sehen sie das Band, das sie mit den römischen Cäsaren verbindet. Sie sprechen auch gerne von der Verbindung Moskaus zum orthodoxen Konstantinopel, das die Osmanen rund 200 Jahre zuvor erobert hatten.
Innozenz Giesel jedoch stellt eine konkrete Verbindung her und unterwirft ihr seine gesamte historische Logik: Nach seiner Weltanschauung war Kyjiw einst die Hauptstadt eines abstrakten, supranationalen Russlands. Dann wurde es Moskau. (Diese Vorstellung von Moskau als drittem Rom wurde bereits nach dem Fall Konstantinopels insbesondere unter Iwan dem Schrecklichen enwickelt.)
Für viele Zeitgenossen Giesels ist dieser veränderte Blick auf die Geschichte nichts weniger als revolutionär. Im 17. Jahrhundert bezeichneten sich nämlich noch die polnischen Könige als Herrscher der Rus; schließlich hatten Kyjiw und die umliegenden Gebiete seit vielen Jahrhunderten ihnen gehört. Hier bezieht sich der Begriff »Rus« daher auf einen Teil der polnisch-litauischen Union[3] , der mehrheitlich von orthodoxen Christen bewohnt ist. Die Polen weigern sich, die weiter östlich herrschenden »Moskauer« Zaren und ihre Untertanen als rus’ki (Russen), also »Volk der Rus«, zu bezeichnen. Aber Innozenz Giesel – mit anti-polnischer Note – schreibt von einem umfassenden »orthodoxen russischen Volk«, das alle Ostslawen (die Vorfahren der modernen Russen, Ukrainer und Belarusen) unter einem Schirm vereinige. In Moskau selbst denkt man anders darüber. Die Moskowiter Orthodoxe Kirche betrachtet nicht einmal die Kyjiwer Christen als Glaubensgenossen. Will ein Kyjiwer Bürger im 17. Jahrhundert nach Moskau umsiedeln, muss er sich erneut taufen lassen, da die Moskowiter Priester die ukrainischen Orthodoxen als Andersgläubige ansehen.
Innozenz’ Buch ist keine historische Studie, sondern ein Instrument, eine Art diplomatische Waffe. Es hat zum Ziel, Druck auf die Moskauer Diplomaten auszuüben, will den Zaren in Moskau dazu veranlassen, eine militärische Allianz mit den Ukrainern einzugehen und ihnen für ihren Krieg gegen Polen Sicherheitsgarantien zu geben. Um dieses Ziel zu erreichen, betreibt Giesel Geschichtsklitterung: Der »Beweis«, dass Kyjiw und Moskau direkt miteinander verwandt sind, soll es dem Zaren als Pflicht erscheinen lassen, Kyjiw zu unterstützen.
Innozenz Giesel veröffentlicht seinen tendenziösen Wälzer unter dem Titel Synopsis. Die Wirkung des Buches geht weit über die aktuellen politischen Fragen der Zeit hinaus; es wird recht schnell zum Bestseller. Und Synopsis findet, ganz wie geplant, auch beim damaligen russischen Zaren Alexei Romanow größten Anklang.
Es dauert nicht lang, bis eine zweite, dann eine dritte Auflage erscheint. Übersetzungen ins Lateinische und Griechische folgen bald darauf. In den 1700er-Jahren wird Giesels Buch unter Alexeis Sohn und Nachfolger, der später Peter der Große genannt werden wird, zu einem Standardwerk der russischen Geschichte.
In den folgenden Jahrhunderten wird Synopsis von russischen Gelehrten wie Wassili Tatischtschew, Nikolai Karamsin, Sergej Solowjow, Wassili Kljutschewski und anderen als eine Art Blaupause für ihre eigenen Versionen der russischen Geschichte benutzt. Giesels Buch bewirkt, dass fortan die gesamte Geschichte des russischen Staates mit dem längst vergangenen Fürstentum Kyjiw als Ursprungszentrum dargestellt wird. 1913 wird der Historiker und zukünftige Außenminister der kurzlebigen Provisorischen Regierung von 1917, Pawel Miljukow, selbst ein Schüler des oben erwähnten Kljutschewski, schreiben: »Der Geist der Synopsis herrscht uneingeschränkt über unsere Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts; er bestimmt die Vorlieben und Interessen der Leser, dient den meisten Forschern als Ausgangspunkt und fordert die ernsthaftesten von ihnen zu Auseinandersetzungen heraus. Kurz gesagt, bildet dieser Geist den Hintergrund der Entwicklung der Geschichtswissenschaft im vergangenen Jahrhundert.«
Die von Innozenz Giesel erfundene historische Logik erfreut die Moskauer Herrscher so sehr, dass sie bis ins 21. Jahrhundert die offizielle Version der Geschichte bleibt. So kommt es, dass noch heute die russischen Propagandisten – all jene, die behaupten, Russen und Ukrainer bildeten ein einziges Volk mit gemeinsamer Vergangenheit – sich die Ideologie eines Propagandisten des 17. Jahrhunderts zu eigen machen.
Jelena von der Steppe
Und alles nur aus Liebe. Ihr Name ist Jelena. Sie ist jung und schön, genau wie ihre Namensvetterin in der griechischen Mythologie, deren Entführung den Trojanischen Krieg auslöste. Jelena arbeitet als Kindermädchen im Haushalt eines reichen Ukrainers. Die Dame des Hauses, Hanna, ist schwer erkrankt und benötigt Hilfe bei der Erziehung der Kinder. Der Hausherr, Hannas Ehemann, findet Gefallen an dem jungen Kindermädchen, und schon bald wird sie seine Geliebte.
Doch auch ein wohlhabender Pole liebt und begehrt Jelena. Er träumt davon, sie aus dem Haus seines ukrainischen Nachbarn zu entführen und sie zu heiraten. In unserem 21. Jahrhundert würde eine solche Geschichte vermutlich in Tränen enden, aber das 17. Jahrhundert ist eine viel grausamere Zeit.
Der verliebte Pole heißt Daniel, sein ukrainischer Rivale Bohdan. Im Frühjahr 1647, 23 Jahre vor der Synopsis, nützt Daniel eine Abwesenheit Bohdans aus, überfällt mit seinen Bediensteten dessen Anwesen, steckt es in Brand, kidnappt Jelena und verprügelt überdies Bohdans zehnjährigen Sohn so brutal, dass der Junge wenig später stirbt.
Nach Rache dürstend, reist Bohdan nach Warschau, da die Ukraine zu diesem Zeitpunkt eine polnische Provinz ist. Zuerst wendet er sich an die Gerichtsbarkeit. Aber der Übeltäter Daniel Czapliński ist ein polnischer Edelmann und hochrangiger Staatsbeamter; das Gericht spricht Bohdan daher nur eine vergleichsweise lächerliche Entschädigung von 150 Florentinern zu. Bohdan jedoch glaubt, dass seine Ländereien (ganz zu schweigen von seinem Sohn und seiner Geliebten) mindestens das Zwanzigfache wert sind. Deshalb trägt er seinen Fall dem polnischen König persönlich vor.
Der Legende zufolge empfängt der König Bohdan in seinem Palast, aber heimlich und spät in der Nacht. Sie sind ungefähr im gleichen Alter und angeblich seit Langem miteinander bekannt, da der König Bohdan schon früher verschiedene hochgeheime Aufträge anvertraut hatte; beispielsweise sollte Bohdan die Unterstützung der Kosaken in den Kriegen gegen das Osmanische Reich sicherstellen, etwas, wofür dem König vom eigenen Parlament (dem Sejm) die nötigen Geldmittel verweigert worden waren. Bei der nächtlichen Begegnung jedoch redet sich der König zunächst einmal die eigenen Sorgen von der Seele: Er habe keine Macht, und der Adel sei außer Kontrolle, seufzt er. Als Antwort schildert ihm Bohdan das entsetzliche Unrecht, das ihm angetan worden sei. Aber der König will sich nicht in den Streit hineinziehen lassen und bemerkt nur lakonisch: »Wenn ihr Kosaken [das heißt, freie Söldner] wirklich so mutige Krieger seid und Waffen besitzt, warum kämpft ihr dann nicht für euch selbst?« Diese eher beiläufige Bemerkung und ihre Implikationen werden den Lauf der Geschichte verändern.
Bohdan kehrt in die Ukraine zurück und löst einen Aufstand gegen die polnischen Lehensherren aus, der als Chmelnyzkyj-Aufstand bekannt ist. Nur wenige Monate später kann er sich an seinem Erzfeind Daniel Czapliński rächen: Er besetzt dessen Anwesen, befreit Jelena und heiratet sie. Daniel sieht sich gezwungen, nach Polen zu fliehen.
Befassen wir uns nun etwas genauer mit den Hintergründen der Welt, in der Jelena und Bohdan lebten.
Leben im 17. Jahrhundert
Im Jahr 1647 ist Bohdan 51 Jahre alt. Das Land, in dem er lebt, hat viele Namen, einer der gebräuchlichsten ist »Ukraine«. Wenige Jahre später veröffentlicht der französische Militäringenieur und Kartograf Guillaume Levasseur de Beauplan seinen Reisebericht Beschreibung der Ukraine, der Krim und ihrer Bewohner. Der Autor, der die Ukraine bereist hatte, erklärt darin, dass diese gewöhnlich als Teil von Polen begriffen werde, »zwischen Muskowien und Transsylvanien gelegen«. Ein weiterer, insbesondere ab dem 18. Jahrhundert noch häufiger benutzter Name lautet Rus oder Malaja Rus (Kleine Rus). Einer Version zufolge, die heute von vielen ukrainischen Historikern geteilt wird, bezeichnet »Klein« hier den historischen Kern des Staates. Die nördlich gelegenen Gebiete wurden schlicht deshalb als »Große Rus« bezeichnet, weil sie größer waren. Im Laufe der Zeit wandelten sich diese Bezeichnungen zu Malorossija (Kleinrussland) – das heißt, Ukraine – und Welikorossija (Großrussland) für die Gebiete um Moskau.
Bohdan lebt in unruhigen Zeiten, selbst nach den damaligen Maßstäben. Europa wird von einem der tödlichsten Konflikte seiner Geschichte heimgesucht, gemessen an dem Anteil der Todesopfer an der Bevölkerung: Fast alle europäischen Staaten sind darin verwickelt oder vom Krieg betroffen und fünf bis acht Millionen Menschen kommen dabei ums Leben. Die Historiker werden den Konflikt als Dreißigjährigen Krieg bezeichnen. Er bricht aus, als Bohdan 22 Jahre alt ist, und dauert fast sein gesamtes Erwachsenenleben.
Der Krieg kurz und vereinfacht skizziert: Die europäische Supermacht jener Zeit wird als »das Reich« bezeichnet, auch deshalb, weil es kein anderes Großreich auf dem Kontinent gibt. Sein voller Name lautet Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ein Flickenteppich von Herzog- und Fürstentümern, von denen sich die meisten im 19. Jahrhundert vereinen werden. Die Reichshauptstadt ist Wien, und das Reich wird von der Habsburg-Dynastie regiert.
Der Krieg bricht 1618 zunächst als Konflikt zwischen dem Reich und Böhmen aus, das in der heutigen Tschechischen Republik liegt. Bei diesem großen Krieg des 17. Jahrhunderts geht es vordergründig um die Religion: das katholische Heilige Römische Reich und seine Verbündeten gegen die abtrünnigen protestantischen Fürstentümer. Doch schon bald gerät alles durcheinander, und die Menschen beginnen, sich gegenseitig abzuschlachten, gleichgültig, zu welcher Religion sie sich bekennen.
Im 17. Jahrhundert wird die Identität eines Menschen in erster Linie durch seine Religionszugehörigkeit definiert. Wie fast alle Ukrainer war auch Bohdan in einer orthodoxen Familie aufgewachsen. Im Alter von 15 Jahren wurde er jedoch in eine Jesuitenschule im damaligen Lwów geschickt, das heute Lwiw heißt (und von 1772 bis 1918 Lemberg hieß), wo man ihn natürlich dazu ermunterte, den katholischen Glauben anzunehmen – was er allerdings aus Prinzip ablehnte.
Mit 24 Jahren zogen Bohdan und sein Vater mit der polnischen Armee in den Krieg gegen die osmanischen Heerscharen. Die Osmanen siegten; Bohdans Vater blieb auf dem Schlachtfeld zurück; er selbst wurde gefangengenommen und in die osmanische Sklaverei verkauft (was im 17. Jahrhundert recht oft vorkam). Aber er hat Glück: Zwei Jahre später erkaufen seine Verwandten seine Freiheit.
Kaum aus der Sklaverei nach Hause zurückgekehrt, zieht der unbezähmbare Bohdan erneut in den Krieg. Denn im 17. Jahrhundert ist der Krieg die Hauptbeschäftigung vieler ukrainischer Männer. Damals sind die meisten Ukrainer Kosaken[4] ; sie verdienen sich ihren Lebensunterhalt nicht nur durch Landwirtschaft oder Handel, sondern hauptsächlich durch das Kämpfen. Und im kriegsgebeutelten Europa herrscht ein großer Bedarf an Söldnern.
Inzwischen sind nun auch die Franzosen in den Krieg gegen das Heilige Römische Reich eingetreten. Obwohl Frankreich ein katholisches Land ist, sieht der Erste Minister Kardinal Richelieu (der uns u. a. aus Alexandre Dumas’ Roman Die drei Musketiere bekannt ist) eine gute Gelegenheit für französische Gebietsgewinne auf Kosten der Habsburger. Das lutherische Schweden verspürt ähnliche imperialistische Gelüste, denn auch Schweden befindet sich im Krieg gegen das Reich. Als Richelieu stirbt, führt der neue Erste Minister Kardinal Mazarin die Politik seines Vorgängers fort. Im Jahr 1646 heuert Mazarin eine Abteilung ukrainischer Söldner an, die den unter spanischer Herrschaft stehenden Hafen Dünkirchen in Frankreich erobern sollen.
Der Legende zufolge kehrt Bohdan kurz nach der Dünkirchen-Mission nach Hause zurück und muss entdecken, dass sein Gut niedergebrannt und seine Geliebte entführt worden ist. Wie weiter oben bereits beschrieben, reagiert er zunächst wie ein treuer Untertan des polnischen Königs Wladyslaw IV., bringt seine Klage vor Gericht und trägt sie dann auch dem König persönlich vor. Doch die Behandlung, die ihm zuteilwird, beleidigt ihn; er beruft eine Versammlung der Kosaken aus der ganzen Ukraine ein, sammelt ein Kosakenheer um sich und ruft zum Aufstand auf. Bohdans Plan, sich gegen den König aufzulehnen, erweist sich als sehr populär: Die ukrainischen Bauern sind der wirtschaftlichen und religiösen Unterdrückung längst überdrüssig. Jeder hat seine eigenen Gründe, sich zu erheben; um Jelena geht es längst nicht mehr.
Aber Bohdan braucht einen Verbündeten. Der ideale Bundesgenosse im Kampf gegen Polen wäre das russische Zarentum im Norden, denkt er. Aber Moskau, Hauptstadt und Mittelpunkt des Zarenreiches, ist nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen zu sehr geschwächt. Bohdan bleibt nichts anderes übrig, als den südlichen Nachbarn zu umwerben: die Krim. In jener Zeit ist die Halbinsel ein großer muslimischer Staat – das Khanat der Krim, das noch immer von den Nachfahren des Dschingis Khan beherrscht wird.
Ein Moskau ohne Ambitionen
Was ist im 17. Jahrhundert mit dem Moskauer Zarentum los? Warum hält Bohdan Chmelnyzkyj den Zaren für schwach und zu jeder Hilfe unfähig? Tatsächlich hat das Land die Herrschaft Iwans des Schrecklichen noch nicht überwunden, der über 50 Jahre lang (anfänglich unter der Regentschaft anderer) die Macht innehatte und somit der am längsten regierende Herrscher der russischen Geschichte ist (nicht einmal Putin wird das übertreffen können … vermutlich). Iwan hat das Staatsgebiet beträchtlich erweitert, gleichzeitig aber sein eigenes Volk so unmenschlicher Unterdrückung unterworfen, dass die russische Gesellschaft noch Jahrzehnte nach seinem Tod 1584 zerrüttet und demoralisiert ist.
Über die innenpolitischen Probleme des Zarenreichs weiß Bohdan nur wenig. Er ist zehn Jahre nach dem Tod Iwans auf die Welt gekommen und hat noch nie von Iwan gehört, der den Beinamen »der Schreckliche«[5] erst ein Jahrhundert später von dem Historiker Wassili Tatischtschew erhalten sollte.
Während seiner Kindheit hört Bohdan jedoch viel von den Kriegen, die Polen gegen das Zarentum in Russland führt, und den immer neuen Versuchen Polens, einen eigenen Kandidaten auf den Moskauer Zarenthron zu setzen. 1610, Bohdan ist erst 15 Jahre alt, stürzt die Moskauer Elite (auch als Bojaren bekannt) den letzten Nachkommen einer Reihe von Zaren und trägt einem anderen 15‑Jährigen die Krone an: dem Erben des polnischen Throns und zukünftigen König Władysław IV.
Die Moskauer Bojaren haben nur eine Bedingung: der polnische Prinz muss vom Katholizismus zur Orthodoxie übertreten. Wäre die Forderung akzeptiert worden, hätte die Weltgeschichte wohl einen anderen Verlauf genommen. Aber Władysławs Vater, der amtierende polnische König Zygmunt III., der von den Jesuiten erzogen worden war, untersagt die Konversion seines Sohnes kategorisch. Er hat eine bessere Idee und schlägt sich selbst als neuen Zaren von Russland vor; nach seiner Krönung werde die Zwangskonversion der Bewohner des Moskauer Reiches zum Katholizismus erfolgen. Die Bojaren widersetzen sich; der Krieg bricht aus und die polnischen Truppen marschieren in Moskau ein. Die Kosaken kämpfen als Verbündete an der Seite Polens.
Für Bohdan ist daher das russische Zarenreich weniger eine Bedrohung als vielmehr ein dysfunktionales Land, bevölkert von orthodoxen Christen. Als Bohdan 17 Jahre alt wird, erfährt er, dass eine russische Volksmiliz Moskau zurückerobert hat und sich die Polen zurückgezogen haben. Und obwohl sich der junge Władysław immer noch Zar des Moskauer Reiches nennt, war in Moskau bereits ein Sprössling einer neuen Dynastie – der Romanows – zum Zaren gewählt worden. Doch noch für lange Zeit verzichteten die Moskauer Herrscher auf jegliche Eroberungsfeldzüge. Auch 35 Jahre später ist Bohdan und seinem kosakischen Heer bewusst, dass sie niemals die Moskauer Herrscher dazu überreden können, Polen den Krieg zu erklären. Deshalb wenden sie sich an das Khanat der Krim.
Die unabhängige Ukraine
Um einen wirklich großen Aufstand gegen Polen zu entfachen, muss Bohdan von den Kosaken in einem demokratischen Verfahren zum Hetman (Anführer oder Oberbefehlshaber) gewählt werden. Deshalb sucht er nun die Saporoger Kosaken auf, die im Südosten der Ukraine in einem semi-autonomen Gebiet Siedlungen und Verteidigungsstrukturen errichtet haben. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Festungsanlagen am Ende der Welt, die die Bewohner gegen Überfälle schützen sollen, vor allem gegen die Horden des Khans der Krim, die vom Süden kommend immer wieder in die Ukraine einfallen, die Siedlungen plündern und deren Bewohner in die Sklaverei entführen. Wer die TV‑Serie Game of Thrones gesehen hat, würde vermutlich die kosakischen Befestigungsanlagen mit der Mauer und der Nachtwache vergleichen. Das Kosakenheer bildet einen speziellen Teil der ukrainischen Gesellschaft; die Krieger gelten als besonders kühn und mutig, was sich in zahlreichen Volkslegenden über sie widerspiegelt. Und sie sind jederzeit bereit, sich einem Aufstand anzuschließen. So stellt sich das Kosakenheer mit seiner gesamten Kampfkraft hinter Bohdan, der erwartungsgemäß zum Hetman gewählt wird. Die Kosaken vertreiben die polnischen Befehlshaber; der ukrainische Aufstand breitet sich schnell immer weiter aus.
Warschau entsendet eine riesige Streitmacht, um die ukrainische Revolte (den Chmelnyzkyj-Aufstand) niederzuschlagen, und fordert sogar beim Moskauer Zaren Unterstützung an, der ironischerweise der Bitte nachkommt. Im Mai 1648 erringt Bohdan Chmelnyzkyjs Heer seinen ersten größeren Sieg bei der Stadt Schowti Wody. (Die Stadt liegt nicht weit von dem Ort entfernt, an dem 120 Jahre später die Kosakenstadt Krywyj Rih entstehen wird, in der 330 Jahre nach Bohdans Sieg der zukünftige ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj geboren werden wird.)
Nur wenige Tage danach stirbt der polnische König Władysław IV. an einer Nierenkolik. Wider Erwarten reagiert Bohdan betroffen auf die Todesnachricht, denn trotz seiner Rebellion gegen Polen hofft er immer noch, die Beziehungen zum polnischen König wiederherstellen zu können. Bohdans Plan sah nicht die vollständige Abspaltung von Polen vor; er wollte lediglich mehr Rechte und größere Autonomie erringen. Jetzt jedoch weiß er nicht, wer der nächste König Polens sein oder wem er zu gegebener Zeit am Verhandlungstisch gegenübersitzen wird.
In der Polnisch-Litauischen Adelsrepublik wird die Krone nicht vererbt, sondern der neue Monarch muss vom Parlament (dem Sejm) gewählt werden, der sich aus Vertretern des Adels und des Klerus von Polen und Litauen zusammensetzt. Bohdan folgert nach einigem Abwägen, die für ihn günstigste Option wäre es, wenn der neue Moskauer Zar Alexei Romanow auf dem polnischen Thron sitzen würde. Dem Zaren erscheint der Gedanke zwar verlockend, aber er zögert, den Vorschlag anzunehmen. Bohdan versucht gleichzeitig, mit Johann Kasimir zu verhandeln, dem jüngeren Halbbruder des verstorbenen polnischen Königs, der ebenfalls als aussichtsreicher Kandidat gilt. Während Alexei noch unschlüssig ist, wird Johann Kasimir gewählt.
Gleichwohl geht der Aufstand weiter: Die rebellierenden Bauern zerstören nun die Häuser der Polen und Juden auf ukrainischem Gebiet. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts leben ungefähr ein Drittel aller Juden in Polen-Litauen auf ukrainischem Boden. Viele arbeiten im Dienst der polnischen Verwaltung, vor allem als Steuereintreiber für den polnischen Adel.
Im Verlauf der Rebellion überfallen und plündern die Kosaken die Anwesen der Polen und töten ihre Bewohner. Und sie führen große Pogrome gegen die Juden durch. Durch den Aufstand sollen die Rechte orthodoxer Christen durchgesetzt werden, weshalb die Kosaken auch die Juden als Feinde betrachten und unter ihnen ein ähnlich großes Massaker anrichten wie unter den Polen. Im 17. Jahrhundert ist der Antisemitismus weit verbreitet und tief verwurzelt. In Europa sind Gerichtsverfahren gegen Juden, denen die Opferung christlicher Kinder vorgeworfen wird, nichts Ungewöhnliches. Nach dem Aufstand wird Bohdan für immer der Ruch eines brutalen Antisemiten anhängen.
Innerhalb weniger Monate sind die ukrainischen Gebiete von polnischen Adligen, Beamten, katholischem Klerus und Juden fast völlig »gesäubert«. Die Schätzungen der Zahl der Todesopfer dieser Zeit schwanken stark. Im 17. Jahrhundert wird dem menschlichen Leben nur geringer Wert beigemessen; jeder Konflikt fordert viele Opfer. Allerdings neigen manche Historiker auch dazu, die Zahlen immer weiter zu erhöhen.
Im Dezember 1648 zieht Bohdans Kosakenheer triumphal in die alte Hauptstadt Kyjiw ein. Er wird vom führenden Klerus feierlich willkommen geheißen: vom Metropoliten von Kyjiw, dem Archimandrit (Abt) des Kyjiwer Höhlenklosters Innozenz Giesel und sogar vom Patriarchen Paisios von Jerusalem, der sich zufällig auf der Durchreise nach Moskau in Kiew aufhält. Sie beglückwünschen Bohdan zu seinem Sieg und sprechen ihn sogar als Knjas an, ein Ehren- oder Adelstitel, der sich ungefähr mit »Fürst« übersetzen lässt und praktisch seine Anerkennung als Herrscher ausdrückt. Als Bohdan das hört, so stelle ich es mir vor, erlebt er seine eigene, innere Revolution: Bis zu diesem Augenblick ist ihm noch nie der Gedanke gekommen, dass die Ukraine ein eigener, unabhängiger Staat sein könnte – mit ihm als Herrscher.
Aber Bohdan möchte den Patriarchen zunächst einmal wegen einer ganz anderen Angelegenheit um Rat bitten: Seine geliebte Jelena war gezwungen worden, zum Katholizismus überzutreten und einen Polen zu heiraten, der aber inzwischen außer Landes geflohen ist. Würde es Jelena gestattet werden, sich von ihrem Ehemann in dessen Abwesenheit scheiden zu lassen und sich neu zu verheiraten, dieses Mal mit Bohdan? Der Patriarch hat keine Einwände (zumal er für sein Entgegenkommen sechs Pferde und tausend Goldmünzen erhält), und Bohdan und Jelena vermählen sich.
Eine neue Weltordnung
Der Chmelnyzkyj-Aufstand fällt mit einem weiteren historischen Ereignis zusammen: Am 24. Oktober 1648 werden in den deutschen Städten Münster und Osnabrück nach langen Verhandlungen zeitgleich zwei Friedensverträge unterzeichnet, die den Dreißigjährigen Krieg beenden. In der Historiographie werden sie zusammenfassend als »Westfälischer Friede« bezeichnet.
In den Friedensdokumenten wird den deutschen protestantischen Fürstentümern Religionsfreiheit zugesichert; für das (katholische) Reich jedoch bedeuten sie eine Niederlage. Der Niedergang des Reiches wird durch den Aufstieg zweier neuer europäischer Supermächte aufgewogen: Frankreich (das vom Reich die elsässischen Landgrafschaften hinzugewinnt) und Schweden (das die Vorherrschaft in der Ostsee erringen kann). »Russland« nimmt an dem Friedenskongress nicht teil. Diese einheitliche Bezeichnung für das Land ist in Europa noch immer unbekannt, aber die schwedische Delegation erwähnt den »Großfürsten von Moskau« im Friedensvertrag als einen – allerdings nicht kriegsbeteiligten – Verbündeten Schwedens.
Natürlich erfährt auch Bohdan Chmelnyzkyj, dass der Krieg vorüber ist; allerdings kann er sich kaum an eine Zeit ohne diesen Krieg erinnern. Er scheint nun die Bestimmungen des Westfälischen Friedens selbst ausprobieren zu wollen, indem er versucht, ähnlich wie die deutschen Fürstentümer Religionsfreiheit und Autonomie (allerdings innerhalb der polnisch-litauischen Adelsrepublik) für seinen Herrschaftsbereich zu sichern.
Von diesem Zeitpunkt an nimmt Bohdan Verhandlungen mit dem polnischen König auf, um für die Ukraine größtmögliche Unabhängigkeit und für den orthodoxen Klerus größtmögliche Rechte zu erreichen. Außerdem fordert er, neben den polnischen und litauischen Delegationen müsse auch eine ukrainische Delegation an der Wahl des neuen Königs teilnehmen. Während der Gespräche mit der polnischen Delegation bezeichnet sich Bohdan Chmelnyzkyj zum ersten Mal als »alleiniger Herrscher der Rus« – was bedeutet, dass er sich dem König gegenüber etwa so verhält wie ein sächsischer oder bayerischer Fürst gegenüber dem Kaiser (auch wenn es sich bei Bayern und Sachsen im Gegensatz zum Hetmanat um bereits etablierte Entitäten handelte). Doch die polnischen Diplomaten sind zu einer derart scharfen politischen Wende nicht bereit; die Verhandlungen scheitern.
Parallel zu den Gesprächen mit den Polen verhandelt Chelnyzkyj jedoch auch mit dem Moskauer Herrscher über eine mögliche militärische Allianz gegen die Polen. Zar Alexei I. lehnt ab; er betont zwar, dass er die Kosaken natürlich gerne unter seine Schirmherrschaft nehmen werde, sich aber nicht gegen die Polen stellen wolle. Wenn sich jedoch die Ukrainer aus eigenem Antrieb dem Moskauer Zarentum anschließen wollen, dann solle es so sein. Die Aussicht auf eine ukrainische Unabhängigkeit entspricht im Grunde nicht den Moskauer Interessen; aus der Sicht des Zaren ist Bohdan ein Aufrührer, der sich gegen seinen Monarchen auflehnt. Die ukrainische Bevölkerung ist zu »europäisch«: Sie besteht aus freien Kosaken und Bauern sowie einer westlichen Bildungselite und einem aufgeklärten Klerus, der, ähnlich wie die katholische Priesterschaft in Westeuropa, Latein spricht. Das Moskauer Zarenreich hingegen ist von strikter Zentralisierung und Bürokratie geprägt. Die Freiheit der Kosaken, verbunden mit einem demokratisierten Adel, erscheint Moskau zu westlich und fremdartig.
Nach den gescheiterten Verhandlungen mit Polen flammt der Krieg wieder auf und endet mit einem weiteren Sieg der Kosaken. Im Jahr 1649 unterzeichnen Bohdan und der polnische König Johann II. Kasimir einen Vertrag, durch den die Ukraine im Grunde als unabhängiges Gebiet, als eigenständiger Kosakenstaat, anerkannt wird. Dem Vertrag zufolge ist es den Juden verboten, in der Ukraine zu leben, und Tschyhyryn, die Heimatstadt des Hetmans, wird Hauptstadt.
Bohdan gründet neue staatliche Institutionen, wobei er im Wesentlichen polnische und osmanische Einrichtungen auf die Ukraine überträgt. Anstelle des Wahlkönigs soll ein Hetman (Bohdan selbst) herrschen; die Stellung des polnischen Adels (Szlachta) nimmt die kosakische Ritterschaft ein, die Rolle des Parlaments (Sejm) wird einem allgemeinen Rat (Rada), übertragen. Aber dieses staatliche Gebilde, das sogenannte Hetmanat, ist noch im Entstehen begriffen.
Das Problem des neuen Staates besteht darin, dass seine Bewohner in Massen die Landbewirtschaftung aufgegeben haben. Die neue Ukraine ist ein paramilitärischer Staat (die Eigenbezeichnung in den meisten Quellen lautet »Heer der Saporoger Kosaken«)[6] . Die Krieger genießen einen besonderen Status, was zur Folge hat, dass alle Männer dem Kosakenheer angehören wollen. In Kriegszeiten ist das zweifellos ein Vorteil, weil sich so neue Truppen relativ schnell mobilisieren lassen. Aber in Friedenszeiten stellt eine große paramilitärische Bevölkerung ein Entwicklungshemmnis dar.
Um 1649 ist Bohdan Chmelnyzkyj nicht der einzige europäische Politiker, der für sich einen eigenen Staat mit einer republikanischen Regierungsform schaffen will. Auf der anderen Seite des Kontinents wird etwa um die gleiche Zeit England zur Republik erklärt; König Karl I. wird enthauptet und ein Parlamentarier namens Oliver Cromwell tritt an die Spitze des Staates. Das ist nur eine von mehreren Parallelen zwischen Cromwell und Chmelnyzkyj; schon im 17. Jahrhundert werden Vergleiche zwischen beiden Männern gezogen. Sie sind fast im gleichen Alter, kommen fast gleichzeitig an die Macht, werden ungefähr um die gleiche Zeit sterben, die von ihnen geschaffenen Staatsgebilde brechen letztendlich zusammen und ihre sterblichen Überreste werden später aus den Gräbern gerissen und geschändet. Aber es sind auch diese beiden Männer, deren historische Tat für immer in der Geschichte ihrer jeweiligen Länder nachhallen wird: einen Aufstand gegen die Krone im Namen der Freiheit erfolgreich angeführt zu haben. Es ist unwahrscheinlich, dass Cromwell jemals von einem Bohdan Chmelnyzkyj gehört hat, aber in der Ukraine dürfte man mit Sicherheit von den englischen Bürgerkriegen und der Hinrichtung König Karls I. gehört haben – ein politischer und psychologischer Meilenstein von epischen Ausmaßen.
Ewige Treue
Der Krieg geht weiter: Der polnische König Johann II. Kasimir befielt einen neuen Feldzug gegen die Ukraine. Bohdan und sein Heer ziehen ihm entgegen; Jelena und Bohdans Kinder bleiben in Tschyhyryn. Doch dann geschieht etwas Entsetzliches: Bohdans ältester Sohn aus seiner ersten Ehe mit Hanna, der 19‑jährige Tymofij, tötet seine Stiefmutter Jelena und hängt ihre nackte Leiche an das Tor seines Elternhauses.
Die Quellen geben keine Auskunft über die genauen Hintergründe der Tat. Offenbar machte Tymofij Jelena für irgendein furchtbares Vergehen verantwortlich – die Erklärungen reichen von Gelddiebstahl über Ehebruch, Spionage für Polen bis hin zu heimlicher Korrespondenz zwischen Jelena und ihrem früheren Ehemann Daniel Czapliński. Manche Historiker behaupten, Tymofij habe seinen Vater in einem Brief über seinen Verdacht informiert. Es ist jedoch nicht bekannt, ob das vor oder nach dem Mord geschah.
Bohdans Reaktion ist ebenfalls nicht überliefert, aber er hat auch genug eigene Probleme: Wieder führt er Krieg gegen die Polen. Und die Truppen der mit ihm verbündeten Krimtataren unter Khan İslâm III. Giray ziehen sich unerwartet aus dem Krieg zurück. Bohdan versucht sie umzustimmen, wird aber von ihnen gefangen genommen. Trotz der Abwesenheit ihres Hetmans kämpfen die Kosaken weiter, erleiden jedoch eine Niederlage. Nach nur zehn Tagen lassen die Tataren Bohdan wieder frei, aber die Schlacht ist bereits verloren. Inzwischen rücken die Truppen des Großherzogtums Litauen von Norden durch das Gebiet vor, das heute als Sperrzone von Tschernobyl bekannt ist, und nehmen Kyjiw ein. Hetman Bohdan kann sich zwar nach seiner Freilassung noch an die Macht klammern, aber sein Herrschaftsgebiet ist bis auf die Woiwodschaft Kyjiw geschrumpft, also auf die Region um Kyjiw.
Wieder richtet sich seine Hoffnung auf eine Allianz mit Moskau, nachdem sich seine bisherigen Verbündeten, die Krimtataren, als so unzuverlässig und wankelmütig erwiesen haben. Bohdan ist überzeugt, dass es der Ukraine viel besser ginge, wenn es sich vom katholischen Polen trennen und sich unter die Schirmherrschaft des orthodoxen Zaren in Moskau stellen würde.
Nach 1652 verändert sich allmählich die Haltung Moskaus gegenüber der Ukraine. Als der Patriarch der Russisch-Orthodoxen Kirche (ROK) stirbt, tritt der Metropolit von Nowgorod, Nikon, an die Spitze der Kirche. Nikon ist ein Mann mit hochfliegenden Ambitionen; sich selbst sieht er als eine Art russischer Kardinal Richelieu (als Kleriker, der die politische Herrschaft ausübt). Er setzt die Transformation des russischen Zarenreichs in Gang, führt es aus dem Zustand der geistigen Dunkelheit und Unwissenheit und gibt den Anstoß zu seiner Verwandlung in das mächtige Russische Reich. Nikon macht dem Zaren klar, dass er mit der Unterstützung der Kosaken all die Ländereien zurückgewinnen könne, die er an die Polen verloren habe.
Bohdan befindet sich in dieser Zeit in einer recht heiklen Lage, da er gerade bei einem Feldzug in Moldau eine Niederlage erlitten und dabei neben vielen anderen Kämpfern auch seinen Sohn Tymofij verloren hat.
Am 8. Januar 1654 treffen Bohdan und Emissäre aus Moskau in der Stadt Perejeslaw zusammen, die genau auf halber Strecke zwischen der alten fürstlichen Hauptstadt Kyjiw und Bohdans neuer Hauptstadt Tschyhyryn liegt. Bohdan wird von Kosaken und Russen begleitet und betritt die Kathedrale mit der Absicht, dem Zaren Alexei den Treueschwur zu leisten. Aber just im entscheidenden Augenblick bricht ein Streit aus. Bohdan verlangt, Alexeis Repräsentant, der Bojare Wassili Buturlin, müsse im Namen des Zaren beschwören, dass die Kosaken ihre bisherigen Freiheiten behalten dürfen. Buturlin verweigert den Schwur, schlägt aber vor, dass Bohdan seine Wünsche schriftlich niederlegen und dem Zaren schicken solle – allerdings erst, nachdem er den Treueeid geleistet habe. (Für seine unnachgiebige Verhandlungsführung wird Buturlin später fürstlich belohnt – er erhält einen Pelzmantel, einen goldenen Becher und 150 Rubel). Der Hetman stimmt dem Vorschlag zu, und so leisten die Kosaken den Eid, »auf ewig Untertanen Seiner Majestät des Zaren der gesamten Rus und Seiner Erben« zu sein. (Derartige Formulierungen waren in der Frühen Neuzeit durchaus üblich; man schwor sich »ewige Liebe«, »ewige Treue« oder »ewige Freundschaft« – was jedoch Blutvergießen nicht verhinderte, weil beide Seiten stets behaupteten, die jeweils andere Seite habe den Schwur zuerst gebrochen.)
Nach dem Schwur legt Bohdan in einem ausführlichen Brief an den Zaren Alexei die Bedingungen und Klauseln des Beitritts der Ukraine zum Zarenreich Russland nieder: Die Ukrainer werden ihren eigenen Hetman wählen, der seine eigene Außenpolitik betreiben und Botschafter und Emissäre empfangen dürfe, worüber er aber den Zaren informieren werde. Sie verpflichten sich, keine Beziehungen zum polnischen König oder zum osmanischen Sultan zu unterhalten. Die Ukraine wird Steuern an Moskau zahlen, aber der Zar habe kein Recht, sich kosakische Besitztümer anzueignen. Die gesamte politische Struktur solle dieselbe bleiben wie unter polnischer Vorherrschaft, und der ukrainische Adel dürfe seine bisherigen Rechte behalten.
Zar Alexei akzeptiert sämtliche Forderungen – nicht jedoch die nach einer eigenständigen ukrainischen Außenpolitik. Aber natürlich wird der Vertrag von den beteiligten Parteien unterschiedlich ausgelegt. Die Kosaken haben schon früher diverse Verträge mit polnischen Königen geschlossen. In ihren Augen ist auch der neue Treuevertrag nichts weiter als irgendein diplomatisches Dokument, nur eben mit einem anderen Vertragspartner. Bohdan meint, der Vertrag könne jederzeit gebrochen werden, wenn Moskau seinen Verpflichtungen nicht nachkomme. Der Hetman hatte bereits seinen dem polnischen König geleisteten Schwur widerrufen, mit der Begründung, der König habe den Vertrag verletzt, weil er den orthodoxen Glauben nicht geschützt habe.
Der Zar hingegen hatte noch nie einen Vertrag mit seinen Untertanen abgeschlossen. Für ihn ist das Dokument in erster Linie ein Treueschwur und das Kleingeschriebene nichts als schmückendes Beiwerk.
Täuschung und Tod
Am 6. und 7. Juni 1654, sechs Monate, nachdem Bohdan Chmelnyzkyj dem Zaren in der Kathedrale von Perejeslaw Treue geschworen hatte, finden in anderen Ländern zwei wichtige Zeremonien statt. In Frankreich wird der 15‑jährige Ludwig XIV. in der Kathedrale von Reims zum König gekrönt. Und in Schweden wird der 32‑jährige Karl X. Gustav in der Kathedrale von Uppsala gekrönt. Seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges sind Frankreich und Schweden die mächtigsten Länder Europas. Die fast gleichzeitige Krönung der beiden Monarchen ist zwar Zufall, hat aber große symbolische Bedeutung. Denn Ludwig und Karl Gustav werden schon bald ein neues Europa formen.
Ludwig XIV. wurde schon im Alter von vier Jahren nominell König – nach dem Tod seines Vaters, Ludwig XIII. Er hatte eine schwierige Kindheit. Der Adel erhob sich gegen seine Mutter Anna von Österreich und ihren Liebhaber, Kardinal Mazarin, wodurch der kleine Ludwig gezwungen war, aus Paris zu fliehen. Doch damals waren Rebellionen gegen die Macht der Könige nichts Ungewöhnliches: die deutschen Fürsten hatten im Dreißigjährigen Krieg ihren Kaiser besiegt; in England stürzte Oliver Cromwell König Karl I. und ließ ihn hinrichten, und Bohdan Chmelnyzkyj befreite sein Land vom polnischen König. Fast während Ludwigs gesamter Kindheit kam es in Frankreich immer wieder zu Aufständen und Bürgerkriegen, der sogenannten Fronde, und führten letztendlich zu einer Art Diktatur unter einem der Rebellenführer, Louis II. de Bourbon, Prince de Condé. Nach dessen Flucht nach Spanien verlagerte sich die Macht wieder auf den jungen König Ludwig XIV., jetzt jedoch in einem Ausmaß, das sich selbst Monarchen des Mittelalters niemals hätten vorstellen können.
Im Jahr 1652 schreibt der 15‑jährige Ludwig einen Brief an das französische Parlament: »Alle Macht ist Unser. Wir üben sie nach Gottes Willen aus, und kein Mensch, welchen Ranges auch immer, kann sie beanspruchen.« Später wird Ludwig XIV. für seinen Ausspruch »L’État, c’est moi« (»Der Staat bin ich«) berühmt werden. Erstaunlicherweise kann sich dieser kindliche Maximalismus zum politischen Mainstream entwickeln, der Jahrhunderte überdauert und dazu führt, dass viele Führer bis zum heutigen Tag aus tiefster Überzeugung an ihr göttliches Recht auf Herrschaft glauben.
Karl X. Gustav ist älter als Ludwig XIV. Schon im Dreißigjährigen Krieg hat er erlebt, wie wichtig Siege sind. Er ist von imperialem Ehrgeiz erfüllt und überzeugt, dass die Ostsee ein schwedisches Gewässer werden müsse. Je eher desto besser.
In Russland ist um 1654 der Trend hin zu Absolutismus und Imperialismus noch nicht angekommen. Aber zum ersten Mal entschließt sich der Zar in Moskau, mit seinem Heer Polen-Litauen anzugreifen – im Bündnis mit Bohdan Chmelnyzkyjs Kosaken. Die verbündeten Streitkräfte besetzen das Gebiet des heutigen Belarus. Doch jetzt zerstreiten sich der Zar und der Hetman, da beide Anspruch auf die eroberten Gebiete erheben. Inzwischen hat jedoch der dort ansässige Adel die Vorherrschaft des Moskauer Zaren anerkannt, während die Bauern hoffen, als Untertanen des Hetman die kosakischen Freiheiten zu erhalten. In Massen schließen sich die belarusischen Bauern den Truppen der Kosaken an. Und so bricht der erste Konflikt zwischen den ukrainischen und den russischen Herrschern aus.
Der neue schwedische König Karl X. Gustav wiederum strotzt vor imperialem Ehrgeiz; auch er greift nun Polen-Litauen an. Die Adelsrepublik, bis vor kurzem noch ein stabiles System, muss plötzlich um ihr Überleben kämpfen. Doch nun ändert Moskau unvermittelt den Kurs: Zar Alexei strebt einen Waffenstillstand mit den Polen an. Ein geschwächtes Polen ist ihm als Nachbar lieber als ein starkes Schweden. Bohdan spricht sich dagegen aus – er ist nicht mehr an einem Frieden mit Polen interessiert. Ihm wird der Zugang zu den Verhandlungen zwischen Moskau und Polen verwehrt, weshalb er Verhandlungen mit dem schwedischen König aufnimmt und mit ihm ein anti-polnisches Bündnis schließt. Zuvor war der Vertrag von Perejeslaw zwischen Bohdan Chmelnyzkyj und dem Zaren schon von letzterem gebrochen worden, weil der Zar dem Kosakenheer keinen Schutz gegen Polen gewährte.
Im Oktober 1656 beginnen im heutigen Vilnius (Wilna) Verhandlungen zwischen Russland und Polen. Für die ukrainische Seite entwickelt sich daraus ein echtes Drama. Die polnische Seite besteht darauf, dass die ukrainischen Abgesandten nicht an den Verhandlungen teilnehmen dürfen. Außerdem werden diese von den Polen mit der Behauptung in die Irre geführt, dass der Zar zugestimmt habe, die hart erkämpften ukrainischen Gebiete den Polen zurückzugeben. Es ist eine Desinformation, aber die ukrainischen Emissäre glauben sie aufs Wort.
Bohdan und die Ukrainer sind entsetzt und überzeugt, dass sie von Zar Alexei betrogen worden sind. Selbstverständlich betrachtet sich Bohdan nun nicht mehr als Untertan des Zaren und sieht sich nicht mehr an den Vertrag von Perejeslaw gebunden. Im Bündnis mit Schweden und Transsylvanien führen die Kosaken den Krieg gegen Polen weiter und können sogar Krakau einnehmen. Und schon verhandeln Karl X. Gustav von Schweden, Bohdan Chmelnyzkyj und andere Bündnispartner über die Aufteilung Polens.
Im Juli 1657 stattet der Moskauer Emissär Wassili Buturlin Bohdan in Tschyhyryn einen Besuch ab. Bohdan, inzwischen ernsthaft erkrankt, hat bereits seinen 16‑jährigen Sohn Juri zum Nachfolger bestimmt. Die Gespräche sind hart: Buturlin und Bohdan beschuldigen sich gegenseitig, den Vertrag von Perejeslaw gebrochen zu haben. Kurze Zeit nach dem Zusammentreffen mit Buturlin erliegt der Hetman einem Schlaganfall. Bohdans Tod führt nicht nur zum Abbruch der nutzlos gewordenen Gespräche, sondern verhindert auch weitere Verhandlungen.
Ruin und Vergessenheit
Als Herrscher ist der 16‑jährige Juri Chmelnyzkyj weit weniger erfolgreich als sein Altersgenosse Ludwig XIV. Bohdans rechte Hand, der Heerführer Iwan Wyhowskyj, überredet den jungen Mann, die Hetmanschaft abzulehnen und sich stattdessen in Innozenz Giesels Lehranstalt aufnehmen zu lassen. Wyhowskyj wird nun selbst Hetman. Er ist zwar ein erfahrener Politiker, aber ihm fehlen Bohdans Charisma und Volksnähe.
Im September 1658, ein Jahr nach Bohdans Tod, schließt Hetman Wyhowskyj ein Abkommen mit Polen-Litauen, dem es letztendlich gelungen war, sich im Krieg gegen Schweden und dessen Verbündete zu behaupten. Als Republik Dreier Nationen schließen sich die ukrainischen Kosaken nun dem Verbund des Königreichs Polen und des Großfürstentums Litauen als dritter, gleichberechtigter Partner an. Dem orthodoxen Bekenntnis werden die gleichen Rechte wie dem Katholizismus eingeräumt, und die Ukrainer erhalten im Parlament dieselbe Zahl von Sitzen wie die Polen und Litauer. Der Hetman wird auch in Zukunft ohne Einmischung vonseiten Polens gewählt werden und behält das Recht auf eigene Münzen in der Ukraine. Im Krieg zwischen dem polnisch-litauischen König und dem Moskauer Zaren dürfen die Kosaken neutral bleiben; sollte jedoch Moskau die Ukraine angreifen, ist der König verpflichtet, die Ukraine zu verteidigen. Der Passus mit der größten Symbolkraft lautet: »Was immer unter Chmelnyzkyj geschah, wird der ewigen Vergessenheit anheimgestellt.« Das bedeutet, dass der Treueschwur der Ukrainer gegenüber dem Moskauer Zaren keine Bedeutung mehr hat. Damit war, juristisch gesehen, die Vereinigung der Ukraine mit Russland nach weniger als viereinhalb Jahren beendet. (Was allerdings die sowjetische Führung nicht daran hinderte, das Ereignis noch drei Jahrhunderte später zu feiern.)
Der sogenannte Vertrag von Hadjatsch regelt die Beziehungen sehr viel genauer als der Vertrag von Perejeslaw. Er wird am 16. September 1658 von den entsprechenden Diplomaten unterzeichnet. Allerdings verhandelt der Sejm erst im Mai des folgenden Jahres darüber – und dann geschieht etwas Furchtbares: Der Sejm streicht die entscheidenden Klauseln, die der Ukraine die staatliche Eigenständigkeit, die Gleichstellung der Orthodoxie und das Münzprägerecht sichern sollten. Der Vertrag wird in stark verwässerter Form ratifiziert, was bedeutet, dass Hetman Wyhowskyj seine ehrgeizigen Ziele niemals verwirklichen können würde, darunter auch sein Wunsch, den Titel »Großfürst der Rus« zu tragen. Das bedeutete das Ende seiner Karriere: Bohdans Anhänger und anti-polnische Kräfte setzen Wyhowskyj ab und wählen den inzwischen 18‑jährigen Juri Chmelnyzkyj zum neuen Hetman.
Doch Bohdans Fußstapfen sind zu groß für seinen Sohn. Zuerst unterzeichnet er einen neuen Vertrag mit Moskau (die »ewige Vergessenheit« gerät damit selbst in Vergessenheit), dann wiederum schwört er dem polnischen König Gefolgschaft, wird von den Truppen seines eigenen Onkels auf dem Schlachtfeld besiegt, verzichtet auf die Macht und zieht sich in ein Kloster zurück.
Danach beginnt eine Periode, die ukrainische Historiker fast poetisch als »Der Ruin« (Руїна) bezeichnen. Der Begriff umfasst zutreffend das, was von den kosakischen Träumen einer staatlichen Unabhängigkeit übrigbleibt.
Im Jahr 1667 schließen Russland und Polen einen Waffenstillstand und teilen die Ukraine unter sich auf. Polen erhält die sogenannte »rechtsufrige Ukraine«, das heißt, die Gebiete westlich des Dnipro, die »linksufrige Ukraine« fällt an Russland. Für die Kosaken stellt das einen schweren Rückschlag dar. Sie müssen erleben, wie ihr Land ohne ihre Zustimmung zerstückelt wird.
Sklaven und andere Güter
Ein Bild der europäischen Welt des 17. Jahrhunderts zu zeichnen ist keine leichte Aufgabe: nicht nur der technologische Stand, sondern auch die Werte sind völlig andere als heutzutage. Der Hauptunterschied besteht darin, dass es die meisten Länder, die wir heute kennen, damals noch nicht gab. Und für viele, die es schon gibt, ist es eine Zeit schneller kolonialer Entwicklung.
Zwar wirft die Annexion der östlichen Ukraine in Moskau alle möglichen Fragen und Zweifel auf, aber die Expansion nach Osten verläuft mit atemberaubender Geschwindigkeit. Auch in den Gebieten östlich der Grenze des damaligen Zarenreichs, am Ural, siedeln Kosaken. Es sind die gleichen freien Krieger wie die Bewohner der Ukraine, nur sprechen sie Russisch und sind Untertanen des Zaren. Sie sind es, die die Kolonisierung Sibiriens vorantreiben: die Unterwerfung der eingeborenen Völker jenseits des Uralgebirges.
Im Jahr 1648 gelangt der Kosake Semjon Deschnjow bis nach Amerika – über die Meeresenge zwischen der Tschuktschen-Halbinsel an der Beringstraße und Alaska. In den folgenden Jahrzehnten erobern Moskauer Truppen das östliche Sibirien und kämpfen die einheimische Bevölkerung nieder, wie etwa die Burjaten, eine mongolische Ethnie, die an den Ufern des Baikalsees siedelt.
Etwa zur gleichen Zeit werden benachbarte Gebiete von den Chinesen kolonisiert, die das Gebiet der heutigen Mongolei erobern. Die noch junge Qing-Dynastie gründet ein eigenes Reich, das bis ins frühe 20. Jahrhundert überdauert und nur wenige Jahre vor dem Sturz der russischen Romanow-Dynastie zusammenbricht. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts kommt es zu mehreren Zusammenstößen zwischen den Heeren des Moskauer Zaren und des chinesischen Kaisers, die sich aber letztendlich einigen: Die Mongolei gehört fortan zu China, Burjatien zum Zarenreich.
Es gibt zahlreiche Belege für die brutale Behandlung der Burjaten durch die Kolonialisten: Die Kosaken vergewaltigen Frauen, töten Kinder und versklaven die Einheimischen. 1661 gründen die Kosaken in den ehemals burjatischen Gebieten die Stadt Irkutsk.
Seltsamerweise sind es russische Vertragssoldaten aus der Region Burjatien, denen im Jahr 2022 während der russischen Besatzung der Umgebung von Kyjiw die schlimmsten Gräueltaten vorgeworfen werden, etwa in Butscha, Irpin und in dem Dorf Hostomel. Berichte von Augenzeugen zufolge kam es zu zahlreichen Vergewaltigungen und Morden.
Im 17. Jahrhundert sind Sklavenhandel und das Niedermetzeln der eingeborenen Bevölkerungen nichts Ungewöhnliches. Die Eroberung Sibiriens begann zwei Jahrhunderte vor der Kolonisierung Nordamerikas, hatte während dieser jedoch ihre Hochzeit. Im Jahr 1660 verfügt der englische König ein Staatsmonopol für den Handel mit »Mahagoni, Elfenbein, Negern, Sklaven, Tierhäuten, Wachs und anderen Gütern« aus Afrika. Die Royal African Company wird gegründet und entwickelt sich zu einer der größten Handelsgesellschaften, die fast hundert Jahre lang Sklaven von Afrika nach Nordamerika liefert.
Auch das Schicksal des heutigen New York entscheidet sich in jenen Jahren. 1655 erhebt sich der Stamm der Susquehannock gegen die niederländischen Siedler im Gebiet Nieuw-Amsterdam und tötet mehrere Dutzend Menschen. Zehn Jahre danach landen die Briten und besetzen die Siedlungsgebiete ihrer niederländischen Rivalen. Es folgen mehrere Besitzwechsel, während die eingeborene Bevölkerung sowohl unter den Briten als auch unter den Niederländern zu leiden hat. Doch schließlich, 1674, kommen die Europäer überein, dass New York (das frühere Nieuw-Amsterdam) Großbritannien zugesprochen wird; die Niederländer erhalten zum Ausgleich die südamerikanische Kolonie Surinam.
Ebenfalls 1674 veröffentlicht der Mönch Innozenz Giesel in Kyjiw seine Synopsis. Er will die Moskauer Herrscher dazu bewegen, die Gebiete der ukrainischen Kosaken nicht Polen oder dem Osmanischen Reich zu überlassen, sondern sie zu schützen. In seinem Buch endet die Geschichte Russlands mit dem Abkommen von Perejeslaw, als einer ruhmreichen, aber kurzlebigen Vereinigung von Kyjiw und Moskau. Den Namen Bohdan Chmelnyzkyj erwähnt er kein einziges Mal. Für die sowjetischen Führer des 20. Jahrhunderts wird Chmelnyzkyj ein Volksheld sein, aber in den Augen des Zaren Alexei im 17. Jahrhundert ist er ein gefährlicher Aufrührer. Giesel ist sich sicher, dass seine Moskauer Leserschaft nicht an Bohdan erinnert werden möchte.