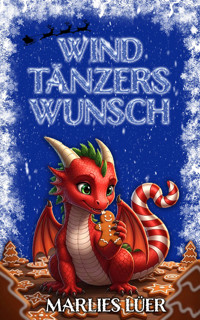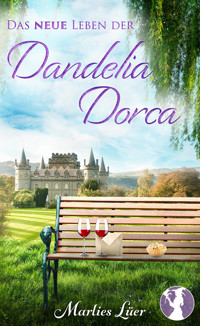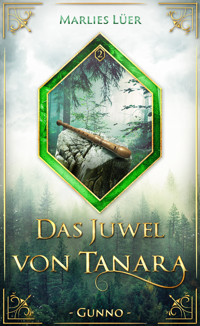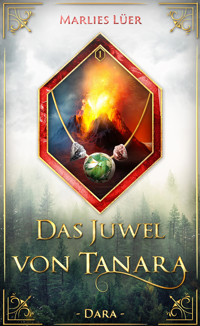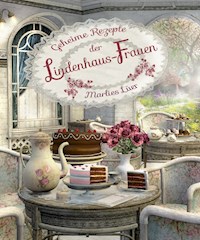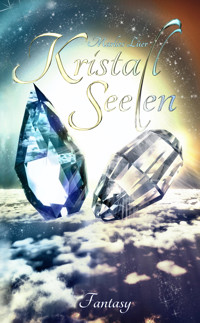
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In der Nacht, als die Sterne fielen, nahm das Unheil seinen Anfang. Raumont und Doran, die Zwillingsprinzen der Schwarzburg, sind zu Männern herangewachsen. In ihren Adern fließt dasselbe Blut, und doch könnte ihr Schicksal nicht unterschiedlicher sein. König Raumont überzieht gnadenlos die Nachbarlande mit Krieg. Ihm stehen die Etunaz zur Seite, geboren aus schwarzer Magie.
Doran sucht Verbündete, um dem ein Ende zu setzen. Ganz in seiner Nähe schlummert die Hoffnung im Wald. Der lebende Berg wartet mit Geduld auf die Geburt der Kristallseelen. Er hat die Ewigkeit auf seiner Seite, aber für die Menschen drängt die Zeit.
Leserstimmen:
Kristallseelen ist voller Magie. Man kann sie richtig fühlen. Eine tolle Geschichte mit süßer unschuldiger Liebe, Tragik/Trauer und noch viel mehr.
"Kristallseelen" fesselt von der ersten Seite an durch seine dramatische Handlung und ausgezeichnete Ausdrucksweise. Hier bekommt man einen Roman, der handwerklich auf höchstem Niveau steht und sicher nicht nur Fantasy-Fans begeistern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Sternfall (Vorgeschichte)
Prolog
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
-10-
Sieben Jahre später …
Widmung
Danksagung
Marlies Lüer
Kristallseelen
Impressum
© Marlies Lüer 2016
Esslinger Str. 22, 70736 Fellbach
Cover: Isabell Schmitt-Egner
Sternfall (Vorgeschichte)
Astur Taran, Spross verarmten Landadels und Hauslehrer der Schwarzburg, hielt sich vor Lachen den Bauch. Das personifizierte schlechte Gewissen, in Gestalt der Zwillingsprinzen, stand mit rußgeschwärzten Gesichtern vor ihm. Der Raum, wo er seine Experimente durchführte, qualmte und stank. Ja, er hatte sie reingelegt. Und ja, sie hatten es verdient.
„Na? War da jemand verbotenerweise an meinen Elixieren und den ungemein gefährlichen Pulvern zugange?“
Doran und Raumont wechselten einen kurzen Blick. Sie konnten es schlecht leugnen, angesichts der Umstände. Also gab es nur eins: Die „Ich bin ja so zerknirscht“-Schiene fahren und vielleicht auch ein wenig Mitleidsheischerei obendrauf. Einen Versuch war es wert.
„Es geschah in den Diensten der Wissenschaft!“ Etwas unsicher schielte Raumont zu seinem nur Minuten älteren Bruder Doran. Dieser verzog seinen Mund um wenige missbilligende Millimeter. Aha. Doch zu dick aufgetragen. Zweiter Versuch. „Wir wollten etwas Neues ausprobieren, um Euch, verehrter Herr Lehrer, damit zu überraschen und zu erfreuen. Ganz im Sinne von Innizittiatiewe.“
Das letzte Wort ging ihm nur schwer über die Lippen. Sein Bruder kommentierte das mit einem Zucken der linken Augenbraue und seufzte leicht.
„Was Raumont meint, ist …“
Astur Taran unterbrach ihn.
„Ich weiß sehr wohl, was er zu sagen versucht. Wann ihr Initiative ergreift und wann besser nicht, sollten die Herren Prinzen gründlich überdenken. Heute war es nur übelriechender Rauch. Beim nächsten Mal könntet Ihr in die Luft fliegen, wenn Ihr Euch mit verbotenen Substanzen ohne Aufsicht vergnügt. Dann wäre das Königreich ohne Thronfolger! Ihr habt Verantwortung dem Reich gegenüber und könnt nicht Euer Leben lang Lausbuben bleiben. Habt Ihr zwei das verstanden?“
„Ja, Herr Lehrer. Aber …“
„Kein Aber! Ab mit Euch an die frische Luft, bevor der König …“
„Du meine Güte!“
Von der Tür her kam ein quietschendes Atemgeräusch. Das ältliche Kindermädchen rang kreideweiß nach Luft. Ihre Schutzbefohlenen waren offensichtlich wieder einmal knapp dem Tode entronnen. Man konnte sie nicht einen Moment aus den Augen lassen, doch waren die beiden inzwischen Meister darin, ihrer Aufsicht zu entrinnen.
„Kein Grund zur Aufregung, meine Teuerste. Die Herren Prinzen haben eine wichtige Lektion gelernt. Sie können sie mitnehmen zum nächsten Waschzuber.“
Astur Taran rümpfte demonstrativ die Nase.
„Neue Bekleidung wäre auch kein Fehler.“
Die Amme watschelte herbei und packte die Missetäter am Kragen und schob sie eisern schweigend vor sich her.
Der Lehrer lächelte. Er mochte die Prinzen sehr. Doran, der leider einen verkrüppelten Arm hatte, war der Klügere der beiden. Es stand zu befürchten, dass sein Vater ihm die rechtmäßige Thronfolge verweigern würde. Ihr zehnter Geburtstag stand bald bevor. Der Tradition gemäß wurden adelige Jungen am Tag nach dem letzten Kindergeburtstag zum Jung-Mann erklärt. Für Raumont würde eine großartige Zeit anbrechen. Er war der fröhliche Raufbold, sein Bruder der Gewissenhafte, der Denker. Schwertkampf, Reiten, die Kunst der Kriegsführung und sportliche Ertüchtigung – das alles war ein Paradies für Raumont, der kaum stillsitzen konnte, weil er so viel Energie hatte. Doran hingegen liebte die Stille, das Lernen. Er begeisterte sich für Geologie und Sternenkunde, war ein hervorragender Leser und Schreiber. Wäre er kein Prinz, so würde er einen guten Anwalt abgeben, denn Gerechtigkeit war für ihn ebenso ein echtes Anliegen. Ach nein, dachte Astur, wäre er kein Prinz, hätte er gar keine Bildung. Die öffentlichen Schulen sind schon von König Thorwins Vater geschlossen worden, um die Machtposition der Adligen gegenüber dem gemeinen Volk zu stärken.
Er zuckte mit den Schultern und öffnete die Fenster in beiden Zimmern weit. Eine Meeresbrise erfrischte die Räume. Astur machte sich auf den Weg nach unten. Den Kopf wollte er freibekommen. Wie eine zähe Schliere lag Schwermut über seinem Herzen. Dieses Land wurde seiner Meinung nach falsch regiert. Doch ihn fragte ja keiner, jemand wie er wurde am Hof bestenfalls geduldet und nach Nützlichkeit bewertet. Im einfachen Volk schlummerte Potenzial. Ihm die Bildung zu verweigern, war als würde man Bäume am Wachsen hindern, nachdem man sie gepflanzt hatte.
Ein Angehöriger des Hochadels begegnete ihm auf der Treppe. Höflich blieb er kurz stehen, neigte sein Haupt, aber nicht weiter als unbedingt erforderlich, und wollte seinen Weg fortsetzen.
„Wollt Ihr nicht Euren Pflichten nachkommen, Hauslehrer?“
Irritiert sah Astur über die Schulter zurück. Der Adlige, ein entfernter Verwandter der Königin, schaute ihn hochmütig an und deutete auf das Schnupftuch, das auf der Treppenstufe lag. Ob verloren oder mit Absicht fallen gelassen – Astur wusste es nicht zu sagen.
„Ich muss Euch wohl nicht daran erinnern, dass Ihr im Rang weit unter mir steht. Ich warte.“
Zähneknirschend wandte Astur sich um und hob das Tuch mit spitzen Fingern auf und überreichte es dem Fettsack im Brokatgewand. Er hatte in den vier Jahren auf der Schwarzburg gelernt, sich zu beherrschen und zu verstellen. Wenn du wüsstest, wohin ich dir dein Tuch stecken möchte!
„Glaubst du, er schläft?“
„Der schläft nie, glaube ich.“
„Aber er hockt da und rührt sich nicht. Der pennt doch. Hat seinen Hut tief übers Gesicht gezogen. Seine Hunde sehe ich auch nicht.“
„Tu’s nicht, Raumont.“
Ein breites Grinsen sagte Doran, dass seine mahnenden Worte, wie fast immer, ungehört bleiben würden.
„Rrraaaaahr!“
Raumont rannte grölend mit ausgebreiteten Armen den Hang hinab und sah mit Entzücken, wie die Schafherde im Talkessel panisch auseinanderstob. Doran zögerte, er hielt Ausschau nach dem Schäfer und mehr noch nach seinen Hütehunden. Und richtig – der Alte hatte unter den Birken kein Nickerchen gehalten. Ein Fingerzeig, und schon liefen die Hunde aus ihrer Deckung los, die Herde unter Kontrolle zu bringen. Raumont bremste seinen Lauf ab und kam ins Straucheln. Fröhlich krakeelend lief er den Hang wieder hinauf und fand alles sehr komisch. Valdan, der Schafhüter, reckte wütend seinen Hirtenstab in die Luft und verfluchte offenbar die Ruhestörer – bis zu dem Moment, als er die Prinzen erkannte. Er nahm seinen Schlapphut ab und deutete eine Verbeugung an. Doran wusste, dass er zwar die Form wahrte, aber dennoch einen Weg finden würde, es ihnen heimzuzahlen. Ihnen. Nicht „ihm“. Er bekam leider auch immer sein Fett weg, obwohl Raumont den Unfug trieb. Als älterer Bruder trug er die Verantwortung. Diese vier Minuten machten viel aus. Was total ungerecht war.
Wenig später saßen sie in einem Pflaumenbaum und ließen es sich schmecken. Raumont hatte seinem Bruder ganz selbstverständlich beim Klettern geholfen, so wie Doran ihm beim Lernen half. Die Steine der blauvioletten, saftig-süßen Früchte spuckten sie in hohem Bogen auf die Streuobstwiese. Das Leben war schön. Das Licht war golden, denn die Sonne versank gerade im Meer. Selbst Raumont war für eine Weile still und zufrieden.
„Ob der Lehrer Vater erzählt hat, was wir heute angestellt haben?“
Doran fühlte sich unbehaglich, bei der Vorstellung, dem König gegenüber Rechenschaft abzulegen. Bei diesem Gedanken erschien das Licht der Abendsonne gleich weniger golden und auch die Pflaumen rumorten in seinem Bauch.
Raumont schüttelte nachdenklich den Kopf. „Glaub eher nicht. Der würde ja selber Ärger bekommen, weil er das Labor nicht abgeschlossen hat.“
„Schon merkwürdig. Der ist doch sonst so gewissenhaft.“
„Vielleicht war’s Absicht und er wollte uns Plage loswerden. BUMM! Verstehste?“
Raumont hielt sich den Bauch vor Lachen, als er Dorans entsetzte Miene sah.
„Mann, du fällst aber auch auf alles rein. Komm jetzt, wird dunkel. Ich will heim.“
Sie sprangen vom Baum und wischten sich die klebrigen Finger an der Hose ab. Unterwegs pflückten die Jungen einen Strauß Wiesenblumen für die Mutter. Vor dem Tor der Schwarzburg lief die Amme auf und ab und rang die Hände. Sie beschwatzte anscheinend die Torwache, nach den Prinzen zu suchen. Als sie die vermeintlich Verschollenen sah, huschten sowohl Freude und Erleichterung als auch Ärger nacheinander über ihr Gesicht. Geistesgegenwärtig teilte Doran hinterm Rücken den Strauß in einen kleinen und einen größeren. Mit einer artigen Verbeugung überreichte er ihr die Blumen, woraufhin sie einerseits dahinschmolz, andererseits ihren Schützlingen gern den Hosenboden versohlt hätte.
„Kommt schnell, gleich wird das Abendmahl gereicht. Ihr müsst euch waschen und umziehen. Heute speist die Königinmutter wieder mit der Familie. Ihr wisst ja, wie sie ist.“
„Großmutter ist wieder gesund? Oje.“
„Nana, nicht so frech. Ihr müsst ihr Respekt erweisen, Ihr königlichen Dreckspatzen. Ab zum Waschzuber!“
Diener trugen die Reste des Abendmahles aus dem Speisesaal. Der kleine Hofstaat, zu dem auch Astur Taran zählte, der ganz unten am Tisch seinen Platz hatte, fand sich zu kleinen Plaudergruppen zusammen, als unerwartet ein Licht am Himmel aufblitzte. Dann noch eins. Die Vögel, die die windzerzausten Bäume bewohnten, verstummten. Irritiert schauten die Menschen Richtung Fensterfront. Weitere Lichter fielen herab und zogen einen Schweif hinter sich her.
„Sternschnuppen?“, fragte General Tombla.
„Zu früh. Nicht in dieser Jahreszeit“, entgegnete Natta, die Königsmutter.
Astur Taran beugte sich weit aus einem Fenster und sah fasziniert zum Himmel hinauf. Ein Meteoritenschauer!
„Kommt her, Jungs, äh, Ihr Herren Prinzen. Das müsst Ihr sehen.“
Doran und Raumont sahen mit leuchtenden Augen dem Spektakel zu. Die ganze Abendgesellschaft drängte sich nun an den Fenstern. Als dann aber sirrende Geräusche hinzukamen und Feuerbälle verschiedener Größe auf das Land Schlag auf Schlag niederprasselten, gingen sie in Deckung.
Astur schrie: „Alle weg! Geht in Deckung!“
Er schob geistesgegenwärtig die Kinder in den kalten Kamin. Nur Sekunden später knallte ein glühender Stein in den Raum und setzte das Tischlaken in Brand. Der massive Eichentisch hatte nun ein qualmendes Loch. Die Gesellschaft hatte sich kaum von dem Schreck erholt, als ein Meteorit durchs Dach des Nordturmes schlug, wo auch das Studierzimmer lag, und eine Spur der Verwüstung hinterließ.
„Wir werden angegriffen!“, schrie König Thorwin. „Bringt Frauen und Kinder in Sicherheit, ruft zu den Waffen, Tombla!“
Astur rief, das sei sinnlos, eine Fehleinschätzung der Lage, aber der König beachtete ihn nicht. Und so fand sich die kleine, aber schlagkräftige Armee der Schwarzburg wenig später in voller Bewaffnung vor den Toren wieder, nach einem Gegner suchend, der nicht existierte. Ein Opfer gab es dennoch. Der Hauptmann der Reiterei wurde von einem winzigen Meteor getroffen und fiel tot zu Boden. Die Soldaten gerieten langsam, wie ihre Pferde, in Panik und wollten sich in den vermeintlichen sicheren Schutz der Burg zurückziehen, aber den Zorn ihres Königs fürchteten sie mehr. Auf Fahnenflucht stand der Tod durch Sturz von der Klippe.
Grimmig schweigend erkannte Thorwin seinen Irrtum und lenkte sein Pferd zurück, der Tross folgte ihm willig.
„Taran zu mir!“
„Sehr wohl, Eure Majestät.“
Sein persönlicher Diener eilte davon, den Hauslehrer zu holen. Er fand ihn völlig atemlos auf dem Westturm wieder, von wo aus er mit Begeisterung den Sternfall mit einem Fernrohr beobachtete.
„Astur! Was im Namen aller guten Geister macht Ihr hier oben? Ich suche Euch verzweifelt. Der König verlangt nach Eurer Anwesenheit. Er ist sehr schlecht gelaunt. Eilt Euch!“
„Siehst du das riesige Loch?“, fragte der Hauslehrer begeistert. Er deutete mit zitternder Hand auf die Einschlagsstelle im Nordturm, der halb in Schutt und Asche lag. „Er ist noch da! Ich werde ihn untersuchen. Das ist meine Chance auf Ruhm und Ehre, ich werde der erste sein, der einen gefallenen Stern wissenschaftlich untersucht.“
Dem Diener riss der Geduldsfaden. Er packte ihn am Kragen, zog ihn mit sich und hielt ihm unterwegs einen Vortrag über die bodenlose Dämlichkeit gewisser Leute, die ihren Herrscher warten ließen. Als die beiden eintrafen, kamen ihnen die Prinzen und Jolanda entgegen, die die undankbare Aufgabe hatte, die aufgeregten Knaben in ihr Zimmer zu bringen. Astur zwinkerte den Jungs noch schnell zu, bevor er das Gemach des Königs betrat.
Thorwin starrte ihn finster an. Er hasste es, wenn andere klüger waren als er.
„Woher hast du das gewusst, Lehrer?“
Astur zögerte verblüfft. Ihm war klar, dass die Frage auf den vermeintlichen Angriff zielte. Konnte der Herrscher wirklich so dumm sein?
„Majestät, niemand auf dieser Welt verfügte je über eine solch mächtige Waffe. Es ist ein Naturereignis. In alten Schriften gibt es Zeichnungen von ähnlichen Vorfällen. Ich hielt es bis dato für eine Übertreibung alter Gelehrter. Seit heute weiß ich es besser.“
„Passiert das bald wieder?“
„Unwahrscheinlich.“
„Was genau war das? Die halbe Burg ist zerstört.“
„Mit Verlaub, Herr, nur der Nordturm ist zerstört. Ich bitte untertänigst um die Erlaubnis, den Rest des Sternes bergen zu dürfen, zwecks näherer Untersuchung.“
„Stern, sagst du? Warum hat er sich vom Firmament gelöst? Haben die Götter ihn auf meine Burg geworfen? Und warum leuchtet der Stern nicht?“
Für eine Weile sah Thorwin verwirrt und müde aus. Astur hatte seinen König, diesen alten Haudegen, noch nie so schwach erlebt. Fast tat er ihm leid. Fast. Genauer gesagt, fast gar nicht. Er musste die Gunst des Moments ausnutzen, und zwar für sich selbst.
„Mein Herr, lasst mich das Phänomen wissenschaftlich untersuchen, und ich werde euch alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten können. Das wird Zeit brauchen. Ich brauche auch einen neuen Studierraum. Bitte gestattet, dass der Unterricht der Herren Prinzen vorübergehend ausgesetzt wird.“
Thorwin nickte. Die Jung-Mann-Feier stand eh bevor. Danach hatte der Lehrer aus seinen Diensten entlassen werden sollen, was ihm natürlich niemand gesagt hatte, aber nun erschien es ihm vorteilhafter, den dünnen Hering noch dazubehalten.
„Geh nun und beginne gleich Morgen mit deinen Studien. Nimm, was du brauchst. Der Verwalter soll dich in allem unterstützen. Ich erwarte wöchentlichen Bericht.“
Astur Taran verneigte sich und verließ den Raum, verbarg seine Begeisterung, so gut es ging.
Doch war dies der Tag, an dem das große Unglück begann.
Zuerst gab es mehrere kleine Unglücksfälle. Stürze, Verbrühungen. Leitern brachen unerwartet zusammen. Pferde siechten und starben. Dann schlich monatelang eine seltsame Krankheit durch die Burganlage, befiel auch die umliegenden Dörfer. Einigen Menschen fielen die Haare aus, sie hatten Bauchweh und manche starben sogar. Die meisten Adligen verließen unter einem Vorwand die Schwarzburg, besuchten angeblich hilfsbedürftige Verwandte oder wollten auf ihren eigenen Ländereien nach Recht und Ordnung schauen. Als nächstes folgten Missernten in der näheren Umgebung. Die Großmutter der Prinzen fiel zunehmend in Düsterkeit und zeitweilige Verwirrung. Für die Königin begann eine schwere Zeit, denn Natta ließ fortan an ihr kein gutes Haar, hetzte ihren Sohn Thorwin gegen die eigene Frau auf. Die Wesensveränderung war erschreckend.
Sie beriet sich oft mit der Heilerin Alrun, die von der großen Daranta höchstpersönlich ausgebildet worden war. Doch auch sie konnte sich anfänglich keinen Reim darauf machen, weshalb die Königsmutter das Blau ihrer Augen verlor, aber nicht ihre Sehkraft.
„Frau Königin, ich habe den Verdacht, dass etwas Böses mit dem Stern vom Himmel gefallen ist und sich in den Mauern der Burg eingenistet hat. Auch der Hauslehrer zeigt Wesensveränderungen. Er ist förmlich besessen von seiner Forschung.“
Die Herrscherin teilte die Meinung der Heilerin, doch der König wollte nicht auf sie hören. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte man den Brocken geschmolzenen Gesteins längst über die Klippen gestürzt.
„Alrun, was ich dir jetzt sage, musst du unbedingt für dich behalten.“
„Ja, Herrin.“
„Manchmal sehe ich etwas.“
Die Heilerin horchte auf.
„Seit dieser Nacht der fallenden Sterne sehe ich manchmal eine Art schwarzen Staubes durch die Burg schweben. Er fühlt sich kalt an. Eiskalt. Manchmal lässt er sich auf den Köpfen und Schultern der Diener nieder, schwebt dann weiter. Manchmal sinkt er auch in ihre Haare ein. Selbst beim König habe ich das beobachten können. Der Staub verweilt lange bei ihm. In dieser Zeit ist er dann besonders ungnädig und beachtet weder mich noch unsere Söhne.“
Sie atmete schwer, das Thema ängstigte sie. Einige Male hatte die Schwärze versucht, auch sie zu befallen. Aber etwas schien sie zu schützen, ebenso Doran und Raumont.
„Das Zeug hat wirklich etwas Böses an sich. Und es hat dieselbe Farbe wie Nattas Augen.“
„Frau Königin, ihr sprecht aus was ich denke.“
„Und weißt du auch, was ich denke, Alrun?“
„Ja.“
Die Königin begann zu weinen.
„Die Kinder und ich sind hier nicht mehr sicher. Ich fürchte, dass Natta mir etwas antun wird. Und sie verachtet neuerdings Doran. Wegen seines Armes! Aber er kann doch nichts dafür.“
„Und Ihr auch nicht, Frau Königin. Ihr seid ebenso unschuldig an seiner Behinderung. So etwas passiert nun mal hin und wieder unter der Geburt. Es ist tragisch, aber das Leben ist gefährlich. Vom ersten Lebenstag an. Alle Frauen wissen davon ein Lied zu singen. Übrigens, Euer Doran ist sehr klug und feinfühlig. Er hat noch vor mir geahnt, dass das Böse über uns gekommen ist in der Nacht des Sternfalls.“
„Wirklich? Zu mir hat er nichts gesagt, der gute Junge. Ich werde meinem Gemahl nie verzeihen, dass er Doran nicht als Thronfolger eingesetzt hat. Die Jung-Mann-Feier sollte der schönste Tag im Leben eines Jungen sein, aber er hat seinen Erstgeborenen vor aller Welt gedemütigt. Ich hatte immer geglaubt, Doran würde der nächste König sein und Raumont sein oberster Minister und Feldherr. Das wäre ein Segen für das Reich gewesen. Ich bin mir sicher, Natta hat das von Thorwin verlangt. Er hört fast immer auf seine Mutter. Sie umgarnt neuerdings auch Raumont. Ich hoffe, ihr Einfluss auf ihn ist nicht stärker als meiner. Alrun, da ist noch etwas, was mir auch große Sorgen macht:
Sie hetzt gegen das Waldvolk!“
Raumont konnte nicht in den Schlaf finden. Etwas ging da draußen vor. Sein Bruder schnarchte leise neben ihm. Kurz überlegte er, ihn zu wecken. Den Gedanken verwarf er sofort wieder, denn Doran würde ihm doch nur sagen, er solle gefälligst weiterschlafen. Da! Es klirrte wieder leise. Er kannte dieses Geräusch, denn seit einigen Monaten wurde er im Kampf ausgebildet, wie es einem Thronfolger zustand. Ein wahrer König musste ein ganzer Mann sein, er musste mit seiner Armee in die Schlacht ziehen können. Dafür brauchte man einen klugen Kopf, ein wackeres Herz und zwei starke Arme. Was Ersteres anging, war er sich nicht ganz sicher, was seine Person betraf. Doch Mut und Kraft hatte er im Übermaß.
Er zog leise Kleidung und Stiefel an, schlich sich hinunter auf den Burghof zu den Stallungen. Schnell sattelte er sich ein Pferd und ritt Richtung Burgtor. Aber dann wurde er gewahr, dass die Männer der Nahkampftruppe an den Ställen vorbeischlichen und durch das kleine Tor, das zur Klamm führte, zu Fuß entschwanden. Er kehrte um und ließ sein Tier auf dem Burghof zurück. Die Zügel schleiften über den Boden. Plötzlich legte sich ein kalter Schleier um seine Schultern. Raumont erschauerte. Er verspürte den unwiderstehlichen Drang, kalten Stahl in seinen Händen zu halten. Kurz entschlossen rannte er zur nächsten Waffenkammer, nahm sich ein Schwert und folgte den Männern. Es dämmerte schon. Der Abstieg durch die Klamm verlief ruhig und geordnet. Das spärliche Licht des herannahenden Tages reichte aus, um sicheren Tritt zu haben. Raumont verhielt sich geschickt, niemand bemerkte ihn. Um keinen Preis hätte er sich zurückschicken lassen wollen. Er wollte seinem Vater, den er an der Spitze der Truppe längst ausgemacht hatte, beweisen, dass er ein vollwertiger Kämpfer war.
Sie drangen immer tiefer in den Wald ein, der Holderforst reichte von den Flüssen bis zum Berg, auf dem die Schwarzburg thronte. Raumont beobachtete, wie ein seltsamer dunkler Nebel über der Truppe schwebte und sich auf ihre Haare legte, in Augen und Ohren eindrang, Mann für Mann. Er fühlte sich frei und unbesiegbar. Doch als er verstand, wer das Ziel des Überfalles sein würde, wurde sein Herz schwer. Mutter hatte immer schöne Geschichten über die Waldleute erzählt, und manchmal sang sie auch deren Lieder.
Kurz darauf hörte er die ersten Schmerzensschreie. Die Männer seines Vaters kannten kein Erbarmen. Ihm wurde übel vom Anblick der sterbenden Waldmenschen, die sich in ihrem Blut wälzten und er musste sich übergeben. Verachtenswerter Schwächling … zischelte eine Stimme in seinem Kopf. In diesem Moment begriff Raumont, dass ein Dämon alle Königstreuen in seiner Gewalt hatte. Mit einem Gefühl, als würde er mit eiskaltem Wasser übergossen, nur anders herum, von unten nach oben, verließ die Schwärze seine Gedanken und Gefühle und breitete sich verstärkt über die Meuchelmörder aus. Denn genau das waren die Soldaten an diesem Tag – Mörder!
Prolog
Ein Laib Brot und zwei Käse, mehr braucht es nicht, um einen Tyrannen zu stürzen, dachte Alrun und stöhnte leise, als sie ihre Position etwas veränderte. Sie lehnte am Stamm einer Trauerweide und hätte gern gekichert, weil sie es liebte, fröhlich zu sein, aber dafür war der Schmerz zu stark. Die alte Heilerin blinzelte und wischte sich kalten Schweiß von der Stirn. Ihr Atem wurde immer flacher. Sie hatte nicht mehr viel Zeit. Mit einer gewaltigen Kraftanstrengung zog sie sich an den tiefhängenden Zweigen des Baumes hoch. Ihr war schwindelig. Blut rann ihr heiß den Rücken herunter.
Ein Laib Brot, zwei Käse und ein Leben.
Ihres.
-1-
Der Feldweg war staubig. Bolda trat hin und wieder gegen loses Geröll, immer, wenn Wut und Scham einen neuen Höhepunkt erreichten. Sein Selbsthass brannte nicht weniger stark als die Sonne, die gleißendes Licht über das Land warf und die Ernte gefährdete. Der grobe Sack auf seinem Buckel war gefüllt mit angewelktem Sommerkohl und einigen roten Zwiebeln. Er hielt ihn mit der rechten Hand fest. In der linken trug er in einem auf die Schnelle geflochtenem Beutel aus Brennnesselfasern eine Kostbarkeit: Sechs Enteneier. Mutter wird weinen vor Glück, dachte der Junge.
Dies war sein siebzehnter Sommer. Und er konnte sich an nur wenige andere Sommer entsinnen, die so viel Leid über die Dörfer der Umgebung gebracht hatten, wie dieser es tat. Der König der Schwarzburg hatte die Etunaz ausgeschickt. Immer und immer wieder. Sie holten sich kräftige junge Männer und pressten sie in den Kriegsdienst. Man munkelte auch von Schlimmerem, aber keiner wusste so recht, was das sein könnte. Auch Frauen stahlen sie hin und wieder. Die Dörfer wurden immer schwächer. Gerüchte machten sich breit, bald wäre seine Heimat an der Reihe.
Die Götter mussten ihr Antlitz abgewandt haben von diesem Teil der Welt. Bolda wusste nicht warum. Womit hatten sie sich versündigt? Sie arbeiteten von früh bis spät und zahlten, wenn auch murrend und fluchend, ihre Steuern, wie es die Pflicht eines Untertan war. Auch, wenn der König ein schlechter war.
Vielleicht ist es die Boshaftigkeit unter den Menschen, überlegte er. Erda, die Tochter des Schweinebauern, war in seinen Augen die Boshaftigkeit in Person. Jedenfalls wenn es um ihn selbst ging. Seit sie ihre blonden Haare hochgesteckt trug – das Zeichen für die Heiratsfähigkeit – spottete sie lauthals über seine Missgestalt. Als sei es nicht Bürde genug, einen Buckel zu haben, täglich Schmerzen zu leiden und in Mutters Augen neben all der Liebe auch die leise Verzweiflung zu sehen, dass ihr einziger Sohn ein Krüppel war. Seit Vaters Tod war das Leben sehr schwer geworden.
Heute hatte Erda es besonders arg getrieben, als er am Dorfbrunnen kurze Rast einlegte, um Wasser zu trinken. Einige Mädchen des Großdorfes hatten sich dort versammelt, um anschließend gemeinsam zum Fluss zu gehen. Sie trugen Körbe mit schmutziger Wäsche.
„Bolda“, hatte Erda gesäuselt, „wohin des Wegs? Willst du deine Angebetete mit deinem Duft nach Schweiß und Holzkohle betören? Oder singst du ihr ein Liedchen vor?“
Sie wandte sich mit einem süffisanten Lächeln an das Mädchen, das als einzige barfuß ging.
„Gunni, sag, was treibt ihr so des Nachts im Heu? Fährt er mit seinen schwarzen Fingern über deine weißen Brüste?“
Das rundliche Mädchen senkte erst verschämt den Blick zu Boden. Dann aber straffte sie ihre Schultern und starrte Erda frech in die Augen.
„Ganz sicher treiben wir was Besseres als du und dein Hohlkopf von Liebhaber.“
Dann zwinkerte sie Bolda aufmunternd zu, packte ihre Schmutzwäsche und ging hüftenschwingend Richtung Fluss. Die anderen Mädchen liefen ihr kichernd und schwatzend hinterher, Erda hatte das Nachsehen.
„Von einem Krüppel lässt man sich nicht mal anfassen“, murmelte sie und spuckte Bolda vor die Füße.
Bolda fragte sich seit diesem denkwürdigen Moment, ob Gunni ihn vielleicht wirklich mochte und ob sie mit ihm tatsächlich ins Heu gehen würde. Warum ließ sie ihn gut dastehen vor Erda? Sie hatten doch nie was miteinander gehabt. Ein leises Lächeln stahl sich auf seine Lippen. Er mochte ihre rosigen, vollen Wangen und die hellblauen Augen, die Art wie sie ging … Für eine Weile war er glücklich und entspannt und schwelgte in schönen Bildern und Gedanken, malte sich seine erste Nacht im Heu aus. Doch dann stolperte er über eine Fahrrinne und ließ vor Schreck den Sack fallen. Geistesgegenwärtig hatte er die Eier hochgehalten und den Göttern sei Dank blieben sie unversehrt. Schwer atmend richtete Bolda sich auf und legte die kostbaren Enteneier vorsichtig auf einem Büschel vertrocknetem Gras ab und machte sich daran, das Gemüse wieder einzusammeln. Als er seinen Heimweg fortsetzen wollte, fiel ihm eine Staubwolke weiter vorne an der Biegung zum Waldrand auf, wo der Weg zum Kleindorf führte, wo die Köhlerhütte lag.
Ein Fuhrwerk, heute? Der Kesselflicker war erst in zwei Monaten wieder fällig. Allerfrühestens! Kam etwa fahrendes Volk? Das wäre eine willkommene Abwechslung in der Ödnis seiner Tage. Konnte er wirklich so viel Glück haben? Er wollte so gern den einarmigen Jongleur wiedersehen. Seit er diesen Mann lachend und feixend Bälle werfen gesehen hatte, obwohl er ein Krüppel war, war sein Inneres um einen Gedanken bereichert. Nämlich um den, dass jeder, wirklich jeder, etwas aus seinem Schicksal machen konnte. Allerdings musste er in der folgenden Zeit feststellen, dass Jonglieren doch nicht sein Ding war. Die Rüben waren einfach nicht rund genug dafür. Ja, es hatte wohl an den Rüben gelegen, nicht an ihm. Oder doch? Manchmal, wenn ihm die Arbeit zuwider war, als Vater noch lebte, malte er sich aus, wie er mit den Fahrenden durchbrannte, sich von ihnen mitziehen ließ in ein abenteuerliches, freies, wildes Leben. Er stellte sich vor, dass sie in ihm, in Bolda dem Köhlersohn, etwas sahen, was normale Leute nicht sahen: Etwas Besonderes. Ja, wusste man es denn, ob man nicht doch einen Schatz in sich trug? Einer, der nur entdeckt und nach oben gezerrt werden musste, aus den Niederungen des Alltags?
Er hätte es wissen müssen. Glück war nicht für einen wie ihn bestimmt. Sein Körper reagierte in diesem Moment mit Angst, bevor Auge und Verstand erfassten, wer jetzt wirklich auf ihn zukam. Da wehte ihm auch schon der Hauch der Verwesung entgegen, der die Etunaz, die Schergen des Königs, stets umgab. Bisher hatte er nur davon gehört. Jetzt aber wurde seine Nase Zeuge, dass die Gerüchte um die Wesen der Verdammnis keineswegs Übertreibungen waren.
Hektisch schaute er sich um. Hier war nichts, wirklich rein gar nichts, wo er sich hätte verstecken können. Sein Herz schlug schnell. Die Felder zu beiden Seiten waren abgeerntet. Der schützende Wald lag weit hinter den sich schnell nähernden Etunaz, das Großdorf zur anderen Seite war längst außer Sichtweite. Er war die perfekte Zielscheibe. Bolda beeilte sich, die Eier zwischen den abgeernteten Getreidehalmen zu verbergen und häufelte etwas Erde über das Säckchen. Dann nahm er Haltung an. Zumindest in seiner Vorstellung stand er aufrecht, bereit, seinem Schicksal ins Auge zu blicken.
Und dann näherte sich das Fuhrwerk auch schon mit Getöse. Der Gestank der Etunaz war unbeschreiblich widerlich und wurde nur noch von ihrem Aussehen übertroffen. Bolda sah fassungslos auf die Mischwesen, halb Tier, halb Mann. In ihren Augen stand blanker, seelenloser Wahnsinn. Einer saß auf dem Kutschbock, zwei hockten auf dem … Käfig. Bolda starrte auf die Gefangenen. Halb bewusstlos lagen sie da, gestapelt wie Mehlsäcke. Den einen kannte er. Torin Rotschopf, aus dem Dorf am breiten Fluss. Er musste sich gewehrt haben, denn er war grün und blau geschlagen, blutete noch aus einer Platzwunde an der Stirn.
Der Etunaz mit der Schweinenase brachte brutal den Karren zum Stehen, als er auf Boldas Höhe war. Die hochnervösen Zugtiere, die einmal Pferde gewesen sein mochten, stampften widerwillig auf und das Leittier schnappte tückisch nach Boldas Arm, um seinen Unmut zu verdeutlichen. Bolda sprang ein Stück rückwärts, verfehlte die Eier nur um einen Fingerbreit. Mittlerweile zitterte er am ganzen Körper und hatte einen Brechreiz. Eines der Ungeheuer richtete mit einem Knurren eine Frage an den Kutscher, der der Anführer der kleinen Truppe zu sein schien. Abschätzig betrachtete er den Jungen am Wegesrand. Er knurrte zurück und machte mit seiner Pranke eine derbe Geste. Bolda brauchte keinen Übersetzer, um diesen wortlosen Dialog zu verstehen. Krüppel wie ihn hielten sie für nutzlos. Plötzlich – ein scharfer Schmerz hinter der Stirn. Ein fremder Geist ergriff von ihm Besitz!
Frauen? Der Etunaz begann, seine Gedanken zu durchwühlen.
Bolda sank auf die Knie und hielt sich stöhnend den Kopf.
Wo sind eure jungen Frauen?
Unwillkürlich musste Bolda an Erda, Gunni und die anderen Mädchen denken, die jetzt am Fluss beim großen Felsen waren, um die Wäsche zu waschen. Zu seinem Entsetzen spürte er die Zufriedenheit des Scheusals, es hatte bekommen, was es wollte. Der Karren setzte sich wieder in Bewegung. Torins Augen waren jetzt offen. Mühsam reckte er eine Hand durch die Eisenstäbe.
„Hilf mir, Bolda“, flüsterte er.
Machtlos starrte Bolda dem Karren hinterher. Torins Hand hing nun schlaff herab. Bald schon verlor er ihn ganz aus den Augen, denn die jetzige Geschwindigkeit des Karrens war nur mit purer Hexerei zu erklären. Für einen winzigen, wirklich winzigen Moment dachte er an die boshafte Erda, die nun ihre Strafe bekommen würde. Doch dieser Moment war noch nicht vergangen, als er realisierte, dass auch die nette Gunni und die anderen Mädchen sich in großer Gefahr befanden. Und selbst Erda hatte nicht so ein Schicksal verdient.
Was konnte er tun?
Die Antwort lautete: Nichts.
Der Fels am Fluss war viel zu weit weg, als dass er sie hätte warnen können. Weinend sammelte er seine Beutel auf. Er hatte die Mädchen nicht verraten wollen. Das Scheusal hatte ihm seine Gedanken gestohlen, wie hätte er das verhindern können? Er war doch nur der bucklige Bolda … Niedergeschlagen setzte er einen Fuß vor den anderen, bis er sein Elternhaus betrat. Schweigend legte er die Lebensmittel auf den Holztisch, setzte sich auf seinen Schemel und starrte erschöpft vor sich hin. Seine Mutter humpelte auf ihn zu. Ihre alte Hüftverletzung quälte sie stärker als sonst.
„Du bist zurück! Schön, dann können wir endlich wieder Gemüse essen. Und Enteneier auch? Ach, du bist der Beste!“
Die Freude auf ihrem Gesicht schwand, als sie ihn genauer ansah.
„Junge, hast du etwa geheult?“ Sie strich ihm tröstend übers Haar. „Haben sie dich wieder verspottet? Sag mal, du zitterst ja! Ist was passiert? Oder bist du krank?“
Bolda schniefte und wischte sich ungeschickt den Rotz mit dem Handrücken übers Gesicht.
„Ich … die Etunaz, Torin …“, stammelte er. „Und ich wollte nicht, dass er in meinen Kopf reingeht.“
Suchend blickte er sich um. Eine schreckliche Ahnung machte sich in ihm breit. „Mutter, wo ist Amareile? Ich kann sie weder sehen noch hören.“
„Ich habe sie vorhin zum Fluss geschickt, die Reusen kontrollieren. Wieso?“
„Was?“
Boldas Herz fing an zu flattern. Er wollte aufspringen, zum Fluss laufen und seine Schwester retten – stattdessen fiel er ohnmächtig zu Boden.
Amareile stieg geschickt die Uferböschung hinab. Die Fischreusen waren ihre Idee gewesen, und sie hatte sie eigenhändig aus Weide geflochten. Es war verboten, im Fluss zu fischen. Die Bewohner der schwarzen Burg, die wie ein fetter, böser Geier über die Dörfer missgünstig wachte, wollten alle Fische für sich haben. Ihre Gier und die Ungerechtigkeit waren eine echte Bedrohung für die einfachen Menschen geworden. Als ihre Eltern noch Kinder gewesen waren, konnten diese im Grunde jeden Abend satt ins Bett gehen. So hatten sie es erzählt. Es sei denn, es gab Missernten durch Dürre oder Getreidefäule durch Feuerkäfer. Das war eben Naturgewalt. Man nahm es als gegeben hin. Besonders Vater, der deutlich älter als die Mutter gewesen war, erzählte früher gern von den guten alten Zeiten, als das Waldvolk noch im Holderforst lebte und seine schützende Magie wirkte.
Amareile hatte gern auf seinem Schoß gesessen, an seine breite, väterliche Brust gelehnt, wenn er mal zuhause war. Sie lauschte oft mehr dem Klang seiner schönen, tiefen Stimme als den Geschichten an sich. Amareile dachte nach und berührte dabei ihren Armreif aus Holz, der ihren linken Oberarm zierte. Der Vater hatte ihn für sie geschnitzt. Eingebrannte Farnblätter schmückten ihn. Es mussten wohl fünf Sommer vergangen sein, seit sie den Vater zu Grabe tragen mussten. Oder waren es doch schon sechs? Köhler und Teerschweler wurden nie alt. Zu giftig die Gase, zu gefährlich die Arbeit mit dem Feuer.
Sie war noch klein gewesen, als die Mutter ihren Ehemann tot neben dem Meiler auffand. Doch jetzt war sie Dreizehn. Sie war groß und stark und trug ihren Teil zur Ernährung der Familie bei. Und wenn es auf verbotene Art und Weise war …
Ein unerwartetes Geräusch alarmierte sie. Flink ließ sie das Seil, das eine der Reusen an Ort und Stelle hielt, wieder los und verbarg sich im Schilf. Als sie eine vertraute Mädchenstimme fluchen hörte, entspannte sie sich und kletterte neugierig die Böschung hoch.
„Gunni! Was ist los?“
„Ach, Amareile, so ein Mist aber auch! Ich bin auf eine scharfkantige Muschel getreten. Sieh dir die Bescherung an.“
Gunni setzte ihren Wäschekorb ab und ließ sich in den Sand fallen. Ihre Ferse blutete stark.
„Aus dem Wäschewaschen wird heute nix. Ich werde nach Hause humpeln. Erda, die blöde Gans, macht sich auch noch über mein Pech lustig. Hätte nicht viel gefehlt und ich hätte sie der Länge nach in den Fluss geschubst. Das nächste Mal mache ich das auch.“
„Binde lieber was über die Wunde, damit kein Dreck reinkommt“, schlug Amareile vor. „Weißt du noch, was mit dem Schäfersohn passiert ist?“
„Mal nicht das Böse in den Sand, Reilchen. Ich brauche mein Bein noch. Schließlich will ich beim nächsten Winterfest mit deinem Bruder den Reigen tanzen.“
„Davon hat Bolda gar nichts gesagt!“
Gunni lächelte verschmitzt. „Er weiß es auch noch nicht. Was denkst du, Reilchen, ob er mich wohl mag?“
„Bolda spricht nie über Mädchen. Ich glaube, er kann sich gar nicht vorstellen, dass eine ihn mag. Hast du ihn so richtig von Herzen gern?“
Das Leuchten, das über Gunnis Gesicht ging, war Antwort genug. Amareile schnappte sich energisch eins der Tücher aus dem Korb mit der Schmutzwäsche, das, was noch am saubersten aussah, und band es energisch um Gunnis Fuß. „Soll ich dir den Korb nach Hause bringen?“
„Nee, lass mal. Geht schon. Kümmere dich lieber um deine Reusen und lass dich nicht erwischen.“
„Du weißt …?“
Gunni zwinkerte ihr verschwörerisch zu und machte sich auf den Heimweg.
Amareile sah ihrer Freundin hinterher, ein spitzbübisches Grinsen im Gesicht. Es sah komisch aus, wie Gunni den Korb auf ihren üppigen Hüften abwechselnd balancierte, breitbeinig humpelte und offenbar zu jedem Schritt einen Fluch murmelte.
Soso. Bolda hat also eine Verehrerin aus dem Großdorf. Wie ich meinen Bruder kenne, ahnt er wirklich nichts“, dachte Amareile und begann eifrig Pläne zu schmieden. Seine wuscheligen Haare könnten einen Schnitt vertragen. Und die Fingernägel sollte er sauberer halten, pechschwarz wie die immer waren. Aber, genaugenommen war das ein vergebliches Unterfangen. Köhler waren nie richtig sauber. Am Buckel ließ sich nichts ändern, aber offensichtlich war das etwas, woran Gunni sich nicht störte. Oder nicht allzu sehr.
Amareile rutschte die Uferböschung hinab, kühlte ihre Füße im Fluss. Vier Buntflossen zappelten in den Reusen, doch sie wollte noch nicht nach Hause, wo eine Menge Arbeit auf sie wartete. Ein wohltuender, leichter Wind kam auf und brachte weiße Wolkenfetzen mit sich. Die alte Ziegen-Dorla aus der schiefen Hütte hatte einen Wetterumschwung angekündigt, erinnerte sich Amareile, und lauschte dem vergnügten Geplapper der Wäscherinnen hinter der Flussbiegung, das der Wind zu ihr trug. Sie überlegte, sich der Gruppe anzuschließen, ein wenig Tratsch und Klatsch wäre ihr heute ganz recht. Die Fische konnten warten. Deren Schicksal war besiegelt, ohne Wenn und Aber. Plötzlich verstummte das Gelächter, machte einer unheilvollen Stille Platz. Und dann hörte sie auch schon den ersten, spitzen Schrei. Alarmiert sprang Amareile auf … hin- und hergerissen zwischen dem Drang zu flüchten und dem Wunsch zu helfen. Doch, konnte sie das überhaupt? Dunkelheit breitete sich über der Flussaue aus. Ein unbeschreiblich widerwärtiger Gestank und das Rauschen von Flügeln waren das Letzte, was sie wahrnahm. Ihr Leben, wie sie es kannte, endete.
Gunni war schon fast in der Mitte des Dorfes angelangt, als sie nicht mehr weitergehen konnte. Der Verband war längst durchgeblutet und sie hatte eine Spur hinterlassen. Ihr Blut vermischte sich mit dem Staub der Straße. Schlecht gelaunt ließ sie ihren Korb fallen und setzte sich auf den dicken Stamm, der müden Dörflern und Reisenden am Brunnen Erholung bieten sollte. Sie hätte den inzwischen aufgekommenen, leichten Wind genießen können, wenn da nicht so ein ziehendes Gefühl in ihrer Brust wäre … eine Vorahnung. Vor zwei Nächten hatte sie geträumt, schwarzer, stinkender Regen würde über dem Großdorf und der ganzen Flussaue niederfallen. Unheimlich. Sie legte ihren verletzten Fuß auf das Knie, wickelte den Lappen ab und betrachtete den Schlamassel. Der pochende Schmerz ließ sie unwillkürlich an den Schäfersohn denken. Dardan, der Kürschner, kam des Wegs und rümpfte die Nase angesichts der Wunde.
„Mädel, da haste abba Pech gehabt, oder? Warte, ich hol meine Handkarre und bring dich nach Haus. So kannste ja nich laufen.“
Kurz darauf hockte Gunni in der Karre, ihren Wäschekorb unverrichteter Dinge auf dem Schoß. Sie war dem Mann wirklich dankbar für seine Hilfe. Dafür nahm sie gern in Kauf, sein Geschwätz anzuhören über schlecht laufende Geschäfte und überteuerte Preise in den Tavernen der Stadt am Ende des Tales. Sie waren fast schon vor dem Haus ihrer Tante angelangt, als Dardan plötzlich blass wurde und unvermittelt schwieg.
„Was …?“, begann Gunni, doch er hieß sie mit barscher Geste schweigen. Mit einer Geschwindigkeit, die sie dem Grauhaarigen nicht zugetraut hätte, rollte er den Karren samt Gunni in die nächstgelegene Scheune und verriegelte das Tor von innen.
„Den Gestank erkenne ich auch aus weiter Ferne“, flüsterte er.
„Etunaz!“
Als es später Abend war, versammelten sich die Bewohner des Großdorfes auf der Tenne. Sieben Mädchen waren der Gemeinschaft verlorengegangen. Teils standen die Menschen weinend, teils mit versteinerten Gesichtern beisammen. Ein Läufer hatte die Nachricht gebracht, dass aus dem Dorf am breiten Fluss zwölf junge Männer und Halbwüchsige von den Etunaz geraubt worden waren. Aus dem Kleindorf war ein einziges verlorenes Mädchen zu beklagen.
„So kann das nicht weitergehen!“, rief der Dorfvorsteher. „Der König ist ein widerlicher Blutsauger, der seinem Volk die Lebenskraft nimmt.“
„Kaldur, sei vorsichtig mit deinen Worten. Man weiß nie, ob nich ‘n Spion in der Nähe ist“, meinte Dardan.
„Das ist mir egal! So geht das nicht weiter“, wiederholte Kaldur sich. „Allesamt Ungeheuer! Und der König ist das größte Übel! Der hat das zu verantworten! Ich bringe ihn eigenhändig um!“, schrie er mit hochrotem Kopf.
Seine Schultern bebten. Tränen des Zorns rannen seine faltigen Wangen herab.
„Sie haben mein Mädchen“, stammelte er noch. Dann gaben seine Knie nach und er brach zusammen.
„Ihn hat der Schlag getroffen!“, rief Dardan. „Da, seht, der Mund hängt schief. Die Götter mögen ihm beistehen“, flüsterte er betroffen.
Eins der alten Weiber gab einen verächtlichen Laut von sich.
„Als ob es die Götter interessieren würde, wie es uns hier unten ergeht.“
Sie zeigte mit ihrem gichtigen Finger auf den Bedauernswerten zu ihren Füßen.
„Da, schaut nur alle hin. Er wird kalkweiß. Das Leben verlässt ihn schon. Ihm geht es besser als seiner kleinen Tochter. Die Schwarzburg ist ein böser Ort. Besser tot, als dort!“
Die Dorfbewohner gerieten nun teils in Streit, teils wurden sie lethargisch. Doch als die Frau vom Schweinebauern, die heute drei Töchter auf einen Schlag verloren hatte, anfing zu kreischen, wurden alle still. Die feiste Matrone baute sich vor Gunni auf und packte grob in ihre Haare. „Du! Warum bist du als einzige den Etunaz entkommen? Du warst doch auch am Fluss! Wieso haben sie dich nicht mitgenommen?“
„Lass mich los, du tust mir weh!“
„Sag, was hast du ihnen für deine Freiheit geboten? Hast du ihnen verraten, wo die Mädchen sind?“
Sie war so erregt, dass ihr ein Spuckefaden vom Kinn tropfte.
„Der Waschplatz unter dem Felsvorsprung ist vom Weg aus nicht einsehbar. Ich weiß, dass diese Ungeheuer mit dem Karren unterwegs waren. Troddla hat sie vom Weinberg aus gesehen. Woher haben sie es also gewusst? Doch nur von dir!“
Sie schüttelte das Mädchen brutal durch, bis die Umstehenden ihr Einhalt geboten. Gunnis Tante drängte sich durch die Menge nach vorne und gab der Schweinebäuerin eine schallende Ohrfeige.
„Wage es nicht, meine Nichte jemals wieder anzurühren! Untersteh dich, ihr etwas so Ungeheuerliches anzudichten!“
Gunni wimmerte: „Ich habe mich an einer Muschel verletzt, darum bin ich gleich vom Waschplatz wieder weg. Wollte nach Hause zur Tante.“
„Ach, und dann bist du wohl dem Karren gar nicht erst begegnet, was? Das glaube ich dir einfach nicht. Es gibt doch nur den einen Weg.“
„Aber ich bin zunächst am Flussbett entlanggegangen. Da ist es nicht ganz so staubig und hart, ich wollte doch nur meinen Fuß schonen.“
Die Tante legte schützend ihren Arm um Gunni und funkelte wütend die Bäuerin an.
Eine Großdörflerin, dürr wie eine Heuschrecke, warf mit schneidender Stimme ein: „So, so. Und wer kann das bezeugen, dass du über die Flussaue zurück ins Dorf bist? Wir waren doch alle auf den Feldern oder in den Ställen bei der Arbeit.“
Gunnis Gesicht leuchtete auf. „Amareile kann das! Ich habe mit ihr gesprochen und sie hat mir den Lappen um den blutenden Fuß gewickelt.“
Ein Mann aus dem Kleindorf trat näher. Er starrte Gunni in die Augen. Misstrauen stand ihm ins Gesicht geschrieben.
„Wie praktisch“, sagte er leise. „Denn Amareile ist auch fort. Die Etunaz haben sie mitgenommen.“
Gunni brauchte eine Weile, um die Tragweite seiner Worte zu verstehen. Schließlich rollten dicke, heiße Tränen ihre Wangen herab. Das liebe Reilchen!
„Dann steht Aussage gegen Aussage“, schnarrte die Schweinebäuerin. „Ich klage Gunni des Verrats an!“
Dardan holte zum Schlag aus. „Du böses Weib! Verkriech dich lieber bei deinen Schweinen. Geh zu deinem Mann, der besoffen vor eurer Hütte liegt. Unser Dorfvorsteher liegt hier tot herum. Du kannst jetzt gar keine Klage führen.“
Er wandte sich um zu den Dörflern, die unruhig beisammenstanden.
„In den Zeiten der Not muss man zusammenhalten! Wir dürfen uns nich gegenseitig zerfleischen und beschuldigen. Gunni war immer ein gutes Mädchen. Immer hilfsbereit und freundlich. Ich glaube ihr! Hab sie in der Karre geschoben, weil der Fuß blutig war. Niemand entkommt den Schergen des Königs, wirklich keiner.“
Seine Lippen zitterten. Für einen furchtbaren Moment lang war er in seiner Vergangenheit gefangen. Er sah, hörte und roch … er hatte damals gesehen, wozu Etunaz imstande waren – dann riss er sich mit aller Kraft zusammen und lenkte sein Bewusstsein wieder zurück in die Gegenwart. Ihm war übel. Er musste tief Luft holen, ehe er weitersprechen konnte.
„Das könnt ihr mir ruhig glauben. Ich hab das schon mal erlebt“, fügte er leise hinzu. „Und nun lasst uns den armen Kaldur aufbahren. Wie es ihm als Dorfvorsteher zusteht! Wir trauern um die Töchter und Söhne der Dörfer und um einen guten, klugen Mann. Wird Zeit, nach einem Priester auszuschicken.“
Eine so lange Rede hatte der Kürschner noch nie gehalten. Dardan schubste die Schweinebäuerin grob beiseite, als sie heulend auf Gunni und ihre Tante wieder losgehen wollte. Der Schmerz in ihrer Seele brachte ihre schlechteste Seite zum Vorschein.
Einige Wochen später saß Ruta, Gunnis Tante, bei Lalinda auf der Bank vor der Köhlerhütte. Sie genossen zusammen die letzten Strahlen der untergehenden Sonne. Nach dem Überfall der Etunaz hatte es einen Wetterumschwung gegeben, der zwei Wochen lang massiven Regen und Stürme mit sich brachte und dann herbstliche Kälte. Wo vorher Hitze und Trockenheit die Ernte bedrohten, so waren es nun Staunässe und Schimmel, die einen Hungerwinter ankündigten. Schwermut hatte sich über das Tal der drei Dörfer gelegt. Dennoch – das Leben musste weitergehen. So war es immer gewesen. So würde es immer sein.
„Dann sind wir uns also einig? Ich gebe ihr als Mitgift meine Milchziegen und den Bock mit, dazu Bettwäsche und Geschirr. Und einen Silbertaler, ihr ganzes Erbe. Mein Bruder und seine Frau, Gott hab sie selig, haben jahrelang gespart und hart gearbeitet für die Zukunft ihres einzigen Kindes. Das Geld ist für Notzeiten. Oder wenn Gunni einen Heiler aus der Stadt brauchen sollte.“
„Ich schwöre dir, Ruta, ich werde das Geld nicht anrühren. Es sei denn, es ist für Gunnis Wohl. Ist sie ansonsten gesund?“
„Ja, Lalinda. Gesund und starrköpfig. Du wirst deine liebe Not und Freude mit ihr haben.“
Ruta lächelte ihre Banknachbarin an. Sie überlegte, ob sie einige von Gunnis Streichen zum Besten geben sollte, entschied sich aber dagegen.
„Als Gegenleistung für meine Ziegenherde bringt ihr mir Käse und zu den Feiertagen ein Zicklein, damit ich auch mal Fleisch habe.“
Lalinda seufzte. „Dann ist es beschlossene Sache. Bolda wird Gunni zur Frau nehmen. Ich kann gut verstehen, dass du sie aus dem Großdorf raushaben willst.“
Ruta legte ihre warme Hand auf Lalindas Unterarm. Irritiert über so viel Nähe, schaute sie Ruta fragend an.
„Sie wird dir deine liebe Amareile nicht ersetzen können, aber vielleicht hast du doch deine Freude an einer Schwiegertochter. Gunni ist ein gutes Mädchen. Und sie mag deinen Bolda wirklich gern.“
-2-
Immer dieses stinkende Blut in den Fugen! Amareile schrubbte auf Knien den Dreck weg. Die schwarzen Fliesen, die mit Glimmer durchsetzt waren, strömten großzügig Eiseskälte aus. Die doppeltgelegte Schürze aus Sackleinen versagte kläglich in ihrem Auftrag, ein wenig Wärme und Schutz zu spenden. Drei Jahre! Drei verdammte Jahre in den Diensten der Schwarzburg … Amareile schnaubte belustigt und packte die grobe Wurzelbürste fester als nötig. Was hieß hier Dienste? Sklaverei war das, nichts anderes. Wütend schrubbte sie die Fuge sauber, dann die nächste und die nächste. Doch war ihr Los noch eines der halbwegs erträglichen. Angewidert nahm sie ein Knochenfragment, das sie im geronnenen Blut gefunden hatte und warf es zielsicher in den Eimer, der dafür vorgesehen war. Hier kam nichts um. Alles wurde wiederverwendet, bis zum letzten Krümel oder Fetzen. Amareile tauchte die Bürste in den Eimer mit dem Seifenwasser. Jetzt kam das Schlimmste. Die großen, in den Boden eingelassenen Kessel mussten von den Überbleibseln der Opfer des königlichen Magiers befreit und danach auf Hochglanz gebracht werden. Seit sie dort Reste von Torins Kopfhaut samt Haaren gesehen hatte – seine Haarfarbe war einzigartig und unverkennbar – begleitete sie dieser Anblick in ihren Alpträumen.
Wenn kein Wunder geschah, würde sie diese Arbeit bis zum letzten Atemzug verrichten müssen. Drei Mal hatte sie vergeblich versucht, sich selbst umzubringen. Drei Mal wurde sie gerettet. Sie hasste diese Kammer. Sie hasste dieses Sklavenleben. Sie hasste inzwischen auch die Götter, die ihr nicht einmal den erlösenden Tod und somit die Freiheit gönnten. Es war geradezu lächerlich schwer, sich hier umzubringen, obwohl dies ein Ort des Todes war! Der erste Versuch scheiterte daran, dass die vermeintliche Giftflasche gar kein Gift enthielt, sondern ein Elixier, das Knochen und Muskeln stärkte. Beim zweiten Versuch – sie wollte sich in die Flammen stürzen, die die Kessel zum Glühen brachten – erwischte sie der zu klein geratene, schmierige Etunaz mit dem Frettchengesicht, der der persönliche Diener des Magiers war.
Ihren letzten Versuch hatte sie vor einer Woche unternommen. Sie stürzte sich erfolgreich von der Mauer des Ost-Turms. Die wachhabenden Soldaten hinderten sie nicht daran, denn Sklaven gab es hier reichlich. Es starben immer wieder welche. Und wenn schon! In sicherer Erwartung und Vorfreude auf den Tod fiel sie einige Sekunden lang, um dann in einem wohlgefüllten Heuwagen zu landen, der zufällig des Weges kam.
Nun war guter Rat teuer. Eine Flucht war ausgeschlossen. Hier kam niemand mehr raus, jedenfalls nicht die, die die Schwarzburg unfreiwillig betreten hatten. Plötzlich wurde ihr übel und sie begann zu zittern. Ihre Hände waren eiskalt. Amareile konnte es nicht verhindern, sich zu übergeben. Die Kessel! Diese grauenvollen Kessel … Es war ihr heute schier nicht möglich, sie zu reinigen. Angewidert wischte sie sich über den Mund. In ihrem Magen brannte es säuerlich.
Ein Gepolter an der Tür schreckte sie auf. Zwei Etunaz schleppten einen Bewusstlosen in die Kammer. Grobschlächtig wuchteten sie den Bedauernswerten auf eine Art Tisch. Der Magier Tarrantok folgte ihnen. Er trug einen knöchellangen, schwarzen Lederumhang über Hose und Hemd, die ebenfalls schwarz gefärbt waren. Eine schwarze Lederkappe bedeckte enganliegend seinen haarlosen Schädel. Amareile war sich sicher, dass sein Herz in seiner Brust ebenso schwarz war. Mit einer herrischen Geste forderte er schweigend das Mädchen auf, diesen Raum unverzüglich zu verlassen. Auf allen Vieren kroch sie auf den Gang, denn aufrecht gehen oder stehen durften Sklaven nicht in Gegenwart des Magiers, des Königs oder der hohen Beamten. In genau dieser Reihenfolge. Sie hatte längst erkannt, dass die wahre Macht hier durch schwarze Magie ausgeübt wurde und der König nur die Nummer Zwei war. Ein verdammt gutaussehender König. Leider durch und durch verdorben.
Weil ihre kalten Knie so wehtaten, richtete sich Amareile vor der Kammer langsam und vorsichtig auf und achtete für einen Moment nicht auf ihre Umgebung. Ein kleiner Trupp Soldaten marschierte kraftvoll um die Ecke des Ganges und einer der Männer stolperte über sie. Seine Kameraden lachten ihn aus, weil er auf dem Rücken lag und wie ein Käfer zappelte. Es machte ihm Mühe, in der schweren Rüstung wieder aufzustehen.
Der zu kurz geratene, kleinköpfige Etunaz mit den langen Armen stand als Wachhabender an der Tür zur Kesselkammer und amüsierte sich mit aller Schadenfreude über das Schauspiel, das ihm geboten wurde.
Amareile drückte sich an die Wand. Ein kurzer Blick sagte ihr, dass sie sich nicht einfach davonstehlen konnte, denn in Erwartung eines unverhofften Amüsements gruppierten sich die Männer um sie und den Gefallenen. Als er sich aufgerappelt hatte, ballte er seine Faust.
„Du!“ Seine Nasenflügel bebten. „Du nutzloses Ding!“
Amareile konnte nur noch ihre Arme hochreißen und sich dann zu einer Kugel zusammenrollen, als die Schläge auf sie niederprasselten. Sie wagte nicht zu schreien. Der Magier mochte keine Störungen.
„Hört sofort damit auf!“
Amareile öffnete ein Auge einen Spalt breit, als sie die Altfrauenstimme hörte und einen ihr unbekannten Geruch wahrnahm. Süßlich, mit einer fruchtigen Schärfe. Auf einmal war ihre Angst verflogen. Wie durch einen Wasserschleier hindurch sah sie die altersfleckige Hand, die ihr hilfreich entgegengestreckt wurde. Voller Vertrauen ließ sie sich von der Alten hochziehen. Ihr war, als wäre sie federleicht. Alles war auf einmal so schön! Nichts tat mehr weh. Wieso hatte sie sich eben noch gefürchtet?
Die Soldaten machten dümmliche Gesichter. Einer lächelte versonnen und verdrehte die Augen zur Decke, als würde er dort etwas Herrliches sehen. In der Luft schwebten rosa schimmernde Partikel wie Staub.
„Komm, Kind. Lass uns verschwinden. Die werden gleich furchtbar wütend, wenn die Wirkung nachlässt.“
Amareile ließ sich in einen schmalen Nebengang ziehen, der auf eine hölzerne, schäbige Tür zuführte. Sie schlüpften hindurch und befanden sich in einer verlotterten Abstellkammer.
„Dort hinein!“
In den Schrank? Das Hochgefühl verflüchtigte sich langsam und die Realität kehrte zurück. Offenbar sollte sie sich vor den Soldaten im Schrank verstecken. Gerne. Das war besser als Prügel zu beziehen. Jedenfalls für den Moment.
Die Alte grinste sie verschmitzt an. Sie schlüpfte auch in den Schrank, schob die Rückwand auseinander und schob ihren Schützling auf den Treppenabsatz, der sich dort offenbarte. Sorgfältig verschloss sie die Geheimtür hinter sich und verriegelte sie.
„Hier kommt jetzt keiner mehr durch“, raunte sie und wies das Mädchen an zu schweigen und der Treppe möglichst geräuschlos nach unten zu folgen.
„Nach zweiundzwanzig Stufen kommt ein Treppenabsatz. Taste dich an der Wand voran. Das wiederholt sich dreimal.“
Amareile brannten Fragen auf der Zunge, aber sie beherrschte sich. Zudem musste sie sehr auf ihre Schritte achten, weil es so dunkel war. Hin und wieder fiel durch kleine Scharten in der Steinmauer etwas Licht auf die Stufen. Im Vorbeigehen erkannte sie, dass der Mörtel herausgekratzt war und einzelne Steine fehlten, die Scharten waren offenbar nicht von Anfang an gewollt eingebaut. Eine Geheimtreppe? Ob es davon noch mehr gab? Obwohl sie nun schon etwas mehr als drei Jahre in der Schwarzburg ihr Dasein fristete, kannte sie nur ein begrenztes Areal. Sklaven durften sich nicht außerhalb der ihnen zugewiesenen Arbeitsbereiche bewegen.
Sie eilten immer tiefer hinab. Als es stockfinster wurde, sagte die Alte leise, sie solle sich nicht fürchten, gleich wären sie da. Wenig später hörte Amareile ein Scharren und Schieben und es fiel Licht auf die letzten Stufen. Schließlich stand sie in einem wohlig warmen Raum, der durch einen gusseisernen Ofen geheizt wurde. Über dem Ofenrohrknick war ein Brett in die Wand eingelassen. Eine Katze lag dort und beäugte den Neuankömmling gelassen.
„Willkommen in meinem bescheidenen Reich.“
Misstrauisch sah sich Amareile im Raum um. Sie sah kleine Kessel auf einem gemauerten Herd, in denen Flüssigkeiten brodelten. Glasphiolen, Messer und Spatel und anderes mehr an seltsamen Gerätschaften, waren auf einem Tisch ordentlich aufgereiht. An der schmalen Wand des Raumes befand sich ein hohes Regal, erbaut aus stabilem Holz. Die Bretter wiesen florale Schnitzereien auf. Das mussten wohl Bücher sein, die da ordentlich aufgereiht standen. Sie hatte sowas schon einmal gesehen. Bei Tarrantok, dem Schwarzmagier. Bücher waren nichts für einfache Leute. Es war ihnen streng verboten, das Lesen zu erlernen. Vom Schreiben ganz zu schweigen.
„Bist du auch Magier?“, fragte sie freiheraus. Besser, sie wusste gleich Bescheid, was ihr nun blühte. Am Ende geriet sie hier vom Regen in die Traufe.
Verblüfft und auch belustigt schaute die Alte sie an.
„Nein, Kind. Ich bin Alrun, die Heilerin und Hebamme. Hast du mich noch nie gesehen oder von mir gehört?“
Amareiles Gesicht hellte sich auf. „Dann gehörst du zu den Guten hier?“, fragte sie vertraulich.
„Sei beruhigt, Kind. Wir Frauen müssen an diesem Ort des Schreckens zusammenhalten.“
„Was war das für ein seltsames Gefühl, das dieses rosa Pulver mir gemacht hat?“
„Ah, das Zeug hast du also gesehen, ja? Du kannst beobachten. Gut, gut.“
Mit neuem Interesse betrachtete die Heilerin das Mädchen. Sie schien aufgeweckt zu sein. Ob sie auch vertrauenswürdig war?
„Das war Rhodosa-Pulver. Ich verwende es bei schweren Geburten oder Schockzuständen.“
Mit einem bitteren Unterton lachte sie leise und sagte: „Und wenn man es auf gesunde, wache Leute anwendet … naja, du hast ja gesehen, wie dämlich dieses Soldatenpack plötzlich dreingeschaut hat. Bei manchen Leuten würde ich mir wünschen, es hätte lebenslange Wirkung.“
Alrun warf einen prüfenden Blick auf die kleine Platzwunde unter Amareiles Auge. Das umliegende Gewebe schwoll schon an.
„Das haben wir gleich. Setz dich mal da auf die Bank am Fenster. Wie heißt du denn? Ich kann ja nicht immer Kind zu dir sagen.“
„Amareile.“
Die Heilerin tupfte mit einem sehr sauberen Tuch eine hellblaue Flüssigkeit auf die Wunde und Umgebung. „Kann sein, dass das etwas brennt. Lässt aber gleich nach. Spätestens übermorgen siehst du aus wie neugeschlüpft“, versuchte sie einen Scherz.
Das Mädchen schwieg und sah sie ernst an.
„Amareile also. Schöner Name. Und von wo kommst du?“
„Ich bin die Tochter von Lalinda und Torben. Wir sind die Köhlerfamilie aus dem Kleindorf. Mein Bruder heißt Bolda. Aber Vater ist tot.“
Alrun dachte kurz nach.
„Ah, dann bist du aus der Gegend vom breiten Fluss, stimmt‘s?“
„Ja, da gibt es das Großdorf, das Kleindorf und das Breiteflussdorf. Das ist viel größer als das Großdorf. Wenn man dem breiten Fluss folgt, dann kommt man irgendwann nach …“
„Nach Maressa, der Stadt im Flussdelta. Ich weiß.“ Alrun lächelte traurig. „Das ist meine Heimat. Ich stamme aus einem Vorort von Maressa.“
„Haben dich auch die Etunaz …?“
„Nein, die gab es damals noch nicht. Es waren nur einfache Soldaten von Thorwin, dem Vater des jetzigen Königs Raumont. Aber sie haben mich nicht geraubt, sondern gekauft. Das war nach der großen Hungersnot. Ich war zur Waise geworden, vierzehn Jahre alt. Und so war es einfach für meine Verwandtschaft, einen Esser loszuwerden und auch noch einen kleinen Gewinn dabei herauszuschlagen.“
Alrun beendete die Wundbehandlung und schloss mit der erstaunlichen Aussage: „Es war nicht mein Schaden.“
Amareile machte große Augen. „Wie meinst du das?“
„Wäre ich bei meiner Verwandtschaft aufgewachsen, hätte ich die Wahl gehabt, eine Lumpensammlerin zu werden oder auf Ratten und Ungeziefer Jagd zu machen. Nichts gegen diese ehrenwerten Berufe“, Alrun zwinkerte Amareile belustigt zu, „doch ich wollte immer schon etwas aus mir machen. Mein Glück war es, von der großen Daranta als Lehrmädchen angenommen zu werden. Ach, das ist so lange her! Damals herrschte hier noch halbwegs Recht und Gesetz.“
„Daranta?“
„Ja! Habt ihr in eurem Dorf nie von ihr gehört? Sie war die beste Heilerin und Hebamme des Königreiches. Und als wäre das nicht genug, war Daranta auch Hohepriesterin der Lichtgöttin. Ich verehre sie zutiefst. Leider ist sie längst in das Reich der Ewigkeit eingegangen.“
Amareile zuckte mit den Schultern. „Wir sind nur einfache Leute. Zu uns kommt keiner. Wir werden von allein gesund, oder wir sterben. Und bei der Geburt hilft die Mutter oder die Nachbarin, wer eben gerade da ist. Die Heiler aus den Städten sind für uns einfach zu weit weg und auch zu teuer. Und Wanderheiler sind nicht alle vertrauenswürdig. Die meisten würden sogar ihre Pisse als Medizin verkaufen.“
Alrun legte dem Mädchen tröstend die Hand auf die Schulter. „Die Welt ist ungerecht, vor allem zu den Armen.“
„Wie lange darf ich hierbleiben und mich vor den Soldaten verstecken?“
„Wenn du willst, kannst du als mein Dienstmädchen hierbleiben. Ich brauche jemanden, der saubermacht und aufräumt. Magst du?“
„Ja!“ Amareile sprang begeistert von der Bank auf. Und ließ gleich die Schultern entmutigt sinken. „Aber der Magier … und der Verwalter, die werden mich suchen und bestrafen!“
„Das lass mal meine Sorge sein. Als ich dich in Bedrängnis vorfand, war ich eh auf dem Weg zu Tarrantok. Ich gehe jetzt wieder zu ihm und kläre das. Auch mit dem Verwalter. Während ich weg bin, fegst du den Boden.“
Auf dem Weg zur Tür rief Alrun noch über die Schulter: „Und lass dich nicht von der Katze ärgern!“
Alrun nahm den offiziellen, längeren Weg zu den Gemächern des Magiers. Die Geheimtreppe benutzte sie nur in Notfällen. Mit Unbehagen registrierte sie das Getümmel in der Burg. Viel zu viele Soldaten liefen hier herum, als dass sie sich noch länger der Vorstellung hingeben könnte, dass nicht schon wieder ein Krieg bevorstünde. Hörte das denn nie auf? Diese Gier nach Macht und Gold! Abscheulich. Eine reiche Stadt nach der anderen in den Nachbarländern unterwarf sich. Die Alternative wäre Tod durch selbstentfachendes Feuer. Widernatürliche Flammen, die solange brannten und fraßen, bis alles, jedes lebendige Wesen innerhalb der Stadtmauern, vom Erdboden getilgt war und der Magier den Flammen Einhalt gebot.
Widerstand war zwecklos. Nach der vierten völlig zerstörten Stadt war ein Klima der Angst zum Alltag geworden. Alrun nutzte jede Gelegenheit, sich über die Lage im Reich zu informieren. Händler, Bittsteller, Fahrendes Volk – jeder wusste etwas zu berichten.