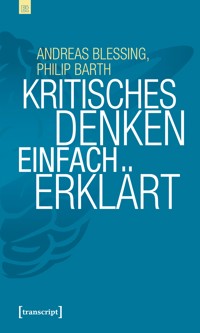
20,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Edition transcript
- Sprache: Deutsch
Warum ziehen uns bestimmte Podcasts, Zeitungen oder Social-Media-Kanäle geradezu magisch an? Oft, weil sie unsere Meinung zu einem bestimmten Thema bestätigen – und genau darin liegt die Gefahr. Unser Gehirn verlangt nach Bequemlichkeit und einfachen Antworten, kann uns aber auch systematisch in die Irre führen. Andreas Blessing und Philip Barth gehen diesen Denkfehlern auf den Grund und zeigen, warum unser Verstand manchmal gegen uns arbeitet. Dazu entlarven sie logische Fehlschlüsse und geben Tipps und Tricks, wie man den eigenen Geist schärfen kann. Der alltagsnahe Leitfaden bietet eine Anleitung zum kritischen Denken für alle, die sich von ihrem eigenen Verstand keinen Streich spielen lassen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Editorial
Die Edition transcript versammelt anspruchsvolle Monographien aus den Kultur-, Geistes- und Sozialwissenschaften. Nach wie vor gilt die Monographie in diesen Disziplinen als via regia der Publikation, ist aber vor allem infolge wissenschaftspolitischer Veränderungen im Rückgang begriffen. Dieser problematischen Entwicklung begegnet die Edition transcript durch eine Neubelebung des zugleich anspruchsvollen und erschwinglichen monographischen Buches.
Der disziplinenübergreifende Ansatz der Reihe befördert nicht nur den Austausch zwischen den Disziplinen, sondern erzeugt eine editorische Verdichtung des Mediums Monographie, die ihre besonderen Qualitäten akzentuiert.
Ein wissenschaftlicher Beirat der Reihe und eine hohe Qualitätskontrolle verbürgen die Ausgewähltheit der Beiträge der Edition.
Andreas Blessing (Dr. phil.), geb. 1977, ist in eigener Praxis tätig als Neuropsychologe und Psychotherapeut. Seit 2018 ist er Co-Host des Wissenschaftspodcasts »Kritisches Denken«.
Philip Barth (Dr. Sc.), geb. 1981, ist Curriculumsentwickler an der ETH Zürich und seit 2018 Co-Host des Wissenschaftspodcasts »Kritisches Denken«.
Andreas Blessing, Philip Barth
Kritisches Denken einfach erklärt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de/ abrufbar.
2025 © transcript Verlag, Bielefeld
Hermannstraße 26 | D-33602 Bielefeld | [email protected]
Alle Rechte vorbehalten. Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
Umschlaggestaltung: Kordula Röckenhaus
Umschlagabbildung: geralt / www.pixabay.com (bearbeitet)
Druck: Elanders Waiblingen GmbH, Waiblingen
https://doi.org/10.14361/9783839401378
Print-ISBN: 978-3-8376-7435-4 | PDF-ISBN: 978-3-8394-0137-8
ePUB-ISBN: 978-3-7328-0002-5
Buchreihen-ISSN: 2626-580X | Buchreihen-eISSN: 2702-9077
Inhalt
Vorwort
Was ist kritisches Denken?Oder: die rote oder die blaue Pille?
Gute ArgumenteOder: Ein Spielplatz ist nur bei Sonnenschein schön
Unser persönliches Modell der WeltOder: Was hat eine flache Erde mit der Lebensrealität zu tun?
VerfügbarkeitOder: Der Unterschied zwischen Diabetes und Vulkanausbrüchen
AnkereffektOder: Die erste Zahl entscheidet
BestätigungsfehlerOder: Wie gegensätzliche Weltanschauungen nützlich sein können
Halo-EffektOder: Der schöne Schein
Sunken-cost fallacyOder: Wie man die Schrottpresse vertagt
UmsonstOder: Wie die Gratismentalität unsere Entscheidungen beeinflusst
Die Krux mit den HeuristikenOder: Ein Lob den Abkürzungen
MustererkennungOder: Überall Muster – selbst bei Knieoperationen
Post hoc – ergo propter hocOder: Danach, also deswegen
Kausalität und KorrelationOder: Viele Störche, viele Kinder
VorurteileOder: Schädliche und hilfreiche Voreingenommenheit
Unbewusste ManipulationOder: Wir mögen, was wir kennen
Wider die AutoritätenOder: Die Krux mit den Experten
Umgang mit UnwissenOder: Das unbekannte Unbekannte
HalbexpertenOder: Wieso es Millionen Bundestrainer gibt
InformationsflutOder: Vom Hexenhammer zu Bullshit, Fake News und Donald Trump
Filterblasen und EchokammernOder: Wie der Algorithmus uns steuert
Weiterverbreitung von (Falsch-)NachrichtenOder: Was Olaf Scholz und Angela Merkel in den Mund gelegt wird
Ist kritisches Denken wissenschaftliches Denken?Oder: Von Zeus’ Blitzen und kreationistischen Fossilien
Was wir tun sollenOder: Wenn die Ethik mit ins Spiel kommt
PerspektivenwechselOder: Das große Ganze im Blick behalten
Das richtige MaßOder: Wie man Bluthochdruck totdenken kann
Wahrscheinlichkeit und wissenschaftliches ArbeitenOder: Vom Zaubern und der Menschheit in einem Apfel
Aufbau und Auswertung von ExperimentenOder: Das Alter und andere Störvariablen
Ein Lob der WissenschaftOder: Der steinige Weg zur Magnetresonanztomographie
Der PrävalenzfehlerOder: Der Unterschied zwischen Bibliothekaren und Landwirten
Am Ende
Die Autoren
Literatur
Vorwort
Ein Buch zum Thema kritisches Denken entsteht wie vieles – unerwartet. Wenn Sie schon einmal auf einem Kindergeburtstag waren, dann kennen Sie vielleicht die Situation, in der anwesende Eltern die seltene Gelegenheit nutzen, sich zu unterhalten. Endlich sind die Kinder beschäftigt und schieben Kuchen in die kleinen Münder, spielen oder packen Geschenke aus. Im Alltag zwischen Kindergarten und Arbeit bleibt wenig Platz für Gespräche mit anderen Erwachsenen und Themen abseits von Organisatorischem, Beruflichem oder Erziehungsfragen. Da wird gerne über Astrophysik, ethische Fragen der Gentechnik oder Erkenntnismöglichkeiten des Menschen diskutiert. So ist es uns, Philip und Andreas, auf einem Kindergeburtstag auch geschehen. Rückblickend waren allerdings beide der Ansicht, das Thema bei unserem ersten Zusammentreffen nicht abschließend besprochen zu haben. Wir ahnten bereits, dass daraus ein größeres Projekt entstehen würde. Zunächst führte uns die gemeinsame Begeisterung für wissenschaftliches Denken in einen Verein für Humanismus und Aufklärung. Schnell wurde uns klar, dass wir da etwas Eigenes auf den Weg bringen müssen. Der Wissenschaft und den Wissenschaftlern eine Stimme geben und nachdenken übers Denken, möglichst frei von Interessenkonflikten. Zweifellos gibt es bereits zahlreiche Zeitschriften, Bücher, Dokumentationen und Podcasts zu verschiedensten wissenschaftlichen Themen, doch was macht wissenschaftliches Denken eigentlich großartig, wie kann man es lernen, vermitteln, wie können wir unser Denken verbessern? Der Kritisches Denken Podcast war geboren (http://kritisches-denken-podcast.de). Im Podcast diskutieren wir miteinander und mit verschiedenen Gästen über Themen rund um die Wissenschaft. Ich, Philip Barth, bin promovierter Physiker und Biologe und ich, Andreas Blessing, bin promovierter Psychologe – wir gehen aber auch anderen Themenbereichen auf den Grund. Endlich wollen wir nach langer Beschäftigung mit dem Thema kritisches Denken und unzähligen Gesprächen einige der für uns wichtigsten Überlegungen in diesem Buch für Sie zusammenfassen und Sie mitnehmen auf unserer Reise. Das hilft nicht zuletzt uns selbst, unsere Überlegungen zu sortieren. Während wir im Podcast ein sehr breites Spektrum an Themen abdecken und viele davon vertiefen, wollen wir uns hier auf Grundlagen des kritischen Denkens konzentrieren. Wir stellen unsere Gedanken leicht verständlich und mit konkreten Beispielen dar und hoffen, dass wir Sie für das Thema begeistern können. Fühlen Sie sich bitte immer angesprochen, auch wenn wir sprachlich die weibliche oder männliche Form wählen.
Unser Ziel ist es, Ihnen Impulse zu geben, selbst kritisch und selbstkritisch zu denken und wichtigen Fragen nachzugehen.
Warum treffen wir oft irrationale Entscheidungen? Weshalb sind viele Argumente unbrauchbar? Wie kommt es, dass wir unsere Kompetenz oft überschätzen? Weshalb folgen wir oft Autoritäten? Weshalb verbreiten sich Falschinformationen besonders schnell? Auf diese Fragen und noch viele andere möchten wir eingehen. Legen wir also los.
Was ist kritisches Denken?Oder: die rote oder die blaue Pille?
Da Sie ein Buch zum Thema kritisches Denken in den Händen halten, fragen Sie sich vielleicht, was kritisches Denken genau bedeutet? Wir fragen uns das seit einigen Jahren. Weshalb ist die Frage nicht leicht zu beantworten? Eine allgemeingültige Definition, was kritisches Denken kennzeichnet, gibt es nicht, denn niemand hat einen Alleinanspruch auf eine solche Definition. Würden Sie sich auf die Suche nach einer Definition begeben (Google bietet da den einen oder anderen Treffer an), würden Sie von verschiedenen Autoren unterschiedliche Definitionen und Erläuterungen finden. Manche Autoren beschreiben Eigenschaften von kritischen Denkerinnen, sie seien skeptisch, open minded, respektieren Evidenz und Schlussfolgern, respektieren Klarheit und Präzision, betrachten verschiedene Standpunkte, sind fähig, so objektiv wie möglich zu bleiben bei der Bewertung von Informationen, fokussieren sich auf Fakten und die wissenschaftliche Beurteilung. Die Liste ließe sich fortsetzen. Anderen Autoren gelingt es, klare Kriterien zu beschreiben, die mehr oder weniger umfangreich sind. Am Ende dieses Buches werden Sie eine Idee davon haben, was wir unter kritischem Denken verstehen. Dabei verzichten wir auf eine ausführliche Untersuchung der historischen Wurzeln des Begriffs oder langatmige Diskussionen über eine genaue Bedeutung, vielmehr möchten wir den Begriff mit Leben füllen und Ihnen helfen, Ihren Verstand noch besser zu nutzen. Sie werden eine eigene Idee davon haben, was kritisches Denken bedeuten kann, oder Ihre bestehende Vorstellung vielleicht um den einen oder anderen Aspekt ergänzt haben. Unsere Vorstellung von der Begriffsbedeutung bleibt auch für uns nur vorläufig, denn stetig lernen wir dazu. Es gilt: Wer denkt, kann seine Meinung ändern. Das gilt nicht zuletzt für uns, denn kritisches Denken heißt auch selbstkritisches Denken. Wenn Sie also finden, dies oder jenes hätten wir unbedingt berücksichtigen sollen, lassen Sie es uns wissen.
Eine kurze sprachliche Annäherung bleibt uns nicht erspart, um mögliche Missverständnisse zu vermeiden und Bedeutungen abzuleiten. Beginnen wir zunächst beim Begriff »kritisch«. Kritisch meint hier nicht die Art von Kritik, der wir uns aussetzen, wenn wir uns beispielsweise sozial unangemessen verhalten oder unsere dürftigen Gesangskünste einem unfreiwilligen Publikum zumuten. Das Wort Kritik geht ursprünglich auf ein griechisches Wort mit der Bedeutung »unterscheiden«, »trennen« zurück. Es geht darum, etwas zu unterscheiden. Beim kritischen Denken kann es einerseits darum gehen, zu unterscheiden, was wirklich zutreffend bzw. wahr ist und was nichtzutreffend ist. Andererseits kann es darum gehen, zu unterscheiden, welches Verhalten uns zu einem gut gewählten Ziel führt und welches nicht. Da wir davon ausgehen, dass es das Ziel von kritischem Denken ist, wirklich gründlich nachzudenken, müssen vernünftige Ziele verfolgt werden. Es geht darum, herauszufinden, wie die Welt wirklich ist, und um unser Verhalten in dieser realen Welt. Wenn Sie lieber in einer Traumwelt leben, wird kritisches Denken wohl nicht das Richtige sein. Vielleicht kennen Sie den Film Matrix, in welchem der zentralen Figur Neo eine rote und eine blaue Pille angeboten werden. Wenn er die rote Pille nimmt, wird er in einer eventuell unerfreulicheren Realität aufwachen. Entscheidet er sich für die blaue Pille, wird er in einer schönen virtuellen Welt weiterleben. Welche Wahl würden Sie treffen? Wenn Sie lieber die schöne Illusion vorziehen und sich nicht wie der Charakter im Film entscheiden, dürfen Sie kritisch hinterfragen, ob Sie dieses Buch weiterlesen, oder es lieber verschenken möchten. Dieser Hinweis ist durchaus ernst gemeint, es kann beängstigend sein, sich mit Unzulänglichkeiten und Unfreiheit menschlichen Denkens auseinanderzusetzen.
Aber nein, wunderbar, Sie entscheiden sich für die rote Pille. Eine gute Wahl, aber denken Sie daran, dass Sie das Buch auch später noch jederzeit zuschlagen und weglegen können, wenn das Lesen schlechte Gefühle in Ihnen auslösen sollte. Fangen wir nun an, kritisch zu denken und somit gründlich nachzudenken. In der Beschreibung »gründlich nachdenken« steckt bereits etwas Wesentliches: Gründe. Wenn wir nachdenken, tun wir das, um gute Gründe für unsere Annahmen zu finden, die diese Annahmen stützen. Wenn wir einen Grund finden, der zu einer Annahme nicht vernünftig passt, wie zum Beispiel »dieses Buch ist langweilig, weil Buchstaben viele Ecken haben«, dann wird unsere Annahme nicht gestützt. Dass Buchstaben einen Zusammenhang mit der Annahme aufweisen, sollte nachvollziehbar sein. Sonst können wir damit, dass Buchstaben eckig sind, alles Mögliche begründen, zum Beispiel, dass wir ohne Sauerstoff ersticken.
Beim kritischen Denken ist die Begründung ein zentraler Punkt. Sie darf nicht beliebig sein, sondern soll gut sein. Nun, was ist eine gute Begründung? Wenn ich, Andreas, mit meinem Sohn Jannik draußen bin, und er mich fragt, ob wir Pfützenspringen sollen, ist es eine gute Begründung, wenn ich ihm sage, dass ich heute ich keine Lust auf Pfützenspringen habe? Möglicherweise. Meinem Sohn zumindest könnte dies ausreichen. Hier geht es allerdings nicht um eine Begründung, die geprüft werden kann und entweder wahr oder falsch ist. Vielleicht werden alltagstaugliche Möglichkeiten zur Überprüfung solcher Aussagen von Hirnforschern irgendwann entwickelt, könnten Sie einwenden. Meine Begründung, dass ich zum Pfützenspringen keine Lust habe, meinte ich aber als Willensbekundung und nicht primär als Aussage über die möglicherweise prüfbaren Zustände in meinem Gehirn.
Nicht alle Sätze machen Aussagen über die Beschaffenheit der Welt. Ich kann sagen: »Es wäre schön, wenn Sie jetzt ganz aufmerksam und konzentriert lesen würden.« Damit sage ich noch nichts darüber aus, was gerade geschieht. Ich habe einen Wunsch formuliert. Auch könnte ich sagen: »Liebe Leser, herzlich Willkommen auf dieser Seite!« Auch diesen Satz kann ich nicht auf Wahrheit prüfen. Über Pfützenspringen allerdings könnte man kritisch nachdenken. Denken Sie zum Beispiel darüber nach, was die Frustration kindlicher Bedürfnisse für Konsequenzen hat. Oder was das Pfützenspringen in Form von notwendig werdenden Reinigungsaufgaben und entsprechendem Wasserverbrauch und Einsatz von Waschmitteln mit sich bringt. Ob Pfützenspringen mit Kindern allgemein empfehlenswert ist, war jedoch nicht Teil meiner Willensbekundung. An dieser Stelle möchten wir kurz für Sie zusammenfassen, dass es beim kritischen Denken insbesondere um die Wahrheit von Aussagen, also um Feststellungen über die Beschaffenheit der Welt geht. Aussagen können wahr oder falsch sein und der kritische Denker möchte wissen, was von beidem zutrifft. Da dieses Ziel meist nicht erreichbar ist, begnügen wir uns damit, festzustellen, was wahrscheinlicher zutrifft. Wir benötigen gute Gründe für unsere Überzeugungen. Um etwas zu begründen, werden immer Argumente angeführt. Wenn Sie bisher nicht sicher waren, was ein Argument ist, nun haben wir es für Sie erklärt. Ein Argument ist der Versuch einen Standpunkt zu stützen.
In verschiedenen Situationen werden ganz unterschiedliche Maßstäbe an die Qualität einer Begründung angelegt. Eines ist aber der gemeinsame Nenner: Wenn wir eine wirklich gute Begründung für eine Überzeugung wollen, dann sollten Argumente logisch korrekt sein. Aber was bedeutet das eigentlich, »logisch«?
Gute ArgumenteOder: Ein Spielplatz ist nur bei Sonnenschein schön
Was ist ein gutes Argument? In der Logik wird untersucht, ob ein Argument folgerichtig ist. Kinder lernen schon sehr früh zu argumentieren. Ob ihre vorgebrachten Argumente jeweils gut sind, sollte man jedoch prüfen. Ich, Andreas, erinnere mich, wie ich mit meinem damals dreijährigen Sohn auf dem Spielplatz stand und er offenbar gerne nach Hause wollte. Seine Argumentation ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, da er recht hartnäckig war und die Argumente von ihrer Struktur her durchaus gut waren. Diese interessanten Argumente werde ich später noch mit Ihnen teilen, doch zunächst möchte ich die grundlegende Funktionsweise von Argumenten ausführen.
Argumente bestehen immer aus mehreren Aussagen im ersten Teil (Prämissen), aus denen dann etwas folgt (Konklusion). Das, was aus den Aussagen im ersten Teil folgt, ist der Standpunkt, der gestützt werden soll. In der täglichen Kommunikation mit unseren Mitmenschen sind wir es gewohnt, ständig mit verschiedensten Argumenten konfrontiert zu werden. Aufgrund der Menge und der Gewohnheit machen wir uns wenig Gedanken über jedes einzelne dieser Argumente, bzw. es fehlt uns im Alltag die Zeit, uns kritisch mit allen diesen Argumenten unserer Mitmenschen auseinanderzusetzen. Zumindest entdecke ich, dass es mir selbst in der Regel so geht.
Vielleicht kommen wir am ehesten dann ins Nachdenken, wenn uns ein Argument geliefert wird, welches für uns ganz offensichtlich nicht funktioniert. Lassen Sie uns daher genau so ein nicht folgerichtiges Argument als Beispiel nehmen, um es kritisch zu hinterfragen:
Die Schatten der Bäume werden gegen Abend länger, deshalb müssen wir nach Hause gehen.
Die Aussage, wir müssten nach Hause gehen, folgt nicht logisch daraus, dass die Schatten der Bäume länger werden. Dieses Argument ist logisch nicht gültig. Damit ein Argument funktioniert, benötigen wir nicht nur Annahmen und einen daraus folgenden Standpunkt, sondern der Übergang von den Annahmen zum Standpunkt ist von Bedeutung. Die Annahmen müssen den Standpunkt begründen. Dass dies im Beispiel nicht gegeben ist, erkennen Sie sofort, da der erste Teil (die Prämisse) mit der Schlussfolgerung (Konklusion) nichts zu tun hat. Es muss eine Verbindung zwischen beiden Teilen geben. Aber auch dann ist das Argument nicht immer gültig.
Ein weiteres Beispiel eines ungültigen Arguments wäre das Folgende:
Scheint die Sonne, ist es schön auf dem Spielplatz. Die Sonne scheint heute aber nicht. Deshalb ist es nicht schön auf dem Spielplatz.
Weshalb ist dieses Argument nicht gültig? Nehmen wir an, die erste Aussage (Scheint die Sonne, ist es schön auf dem Spielplatz.) wäre zutreffend. Dann würde daraus nicht folgen, dass es nicht schön ist, wenn die Sonne nicht scheint. Weshalb folgt nicht, dass es nicht schön ist? Es kann auch schön sein, wenn die Sonne nicht scheint. Darüber, wie es sich verhält, wenn die Sonne nicht scheint, sagt die erste Aussage nichts aus. Vielleicht ist es auch schön auf dem Spielplatz, wenn die Sonne nicht scheint, aber beispielsweise gemeinsam gespielt wird. Lediglich wenn die Sonne scheint, könnten wir schlussfolgern, dass es schön ist. Lassen Sie uns nun ein gültiges Argument daraus machen:
Nur wenn die Sonne scheint, ist es schön auf dem Spielplatz. Heute scheint die Sonne nicht, deshalb ist es nicht schön.
Das wäre ein gültiges Argument. Ob die Aussage, dass es nur schön ist auf dem Spielplatz, wenn die Sonne scheint, richtig ist, ist eine andere Frage. Diese Annahme kann durchaus falsch sein. Wir beschäftigen uns gerade ausschließlich mit der Gültigkeit, also der Frage, ob der Übergang von den Annahmen zum Standpunkt, der gestützt werden soll, korrekt erfolgt. Und wir sehen, dass es viele Möglichkeiten für Fehler gibt.
Ungültig wäre auch das folgende Argument:
Wenn die Sonne scheint, ist es schön auf dem Spielplatz. Es ist heute schön auf dem Spielplatz. Es scheint also die Sonne.
Es ist eben denkbar, dass es auch ohne Sonne schön ist. Deshalb folgt nicht logisch, dass die Sonne scheint.
Vielleicht ist Ihnen an diesen einfachen Beispielen aufgefallen, dass es nicht immer ganz einfach ist, ein ungültiges Argument zu erkennen. In einer Diskussion treffen wir in einem günstigen Fall auf gültige Argumente





























