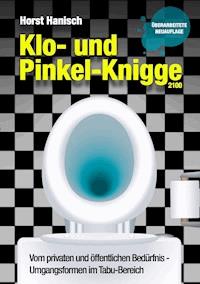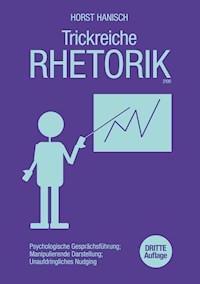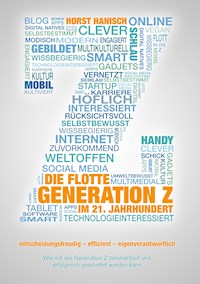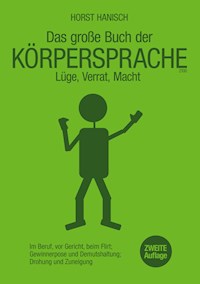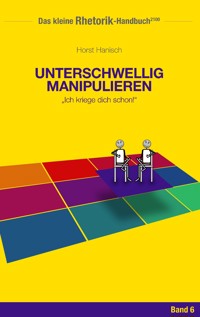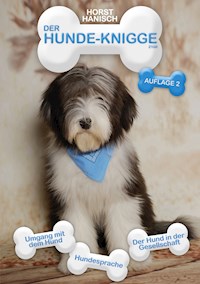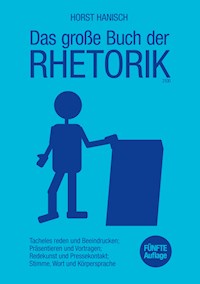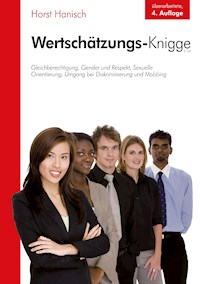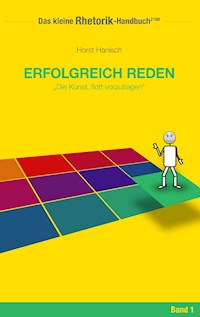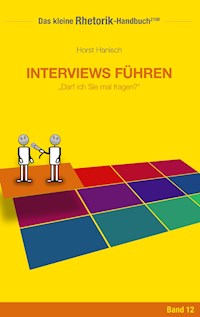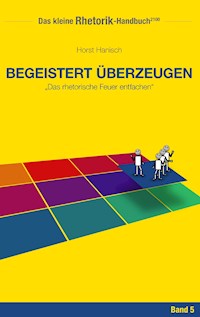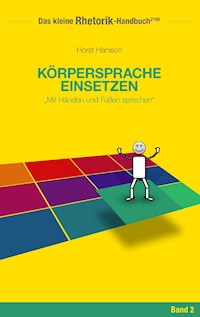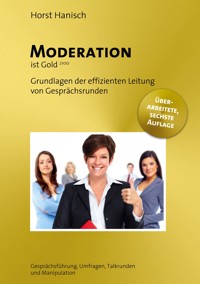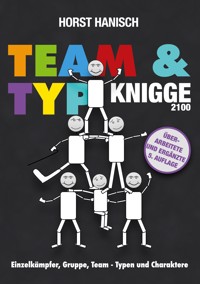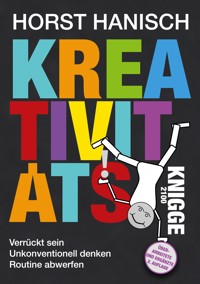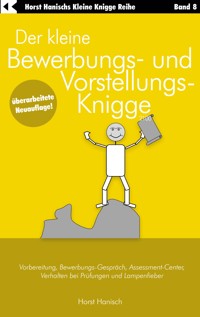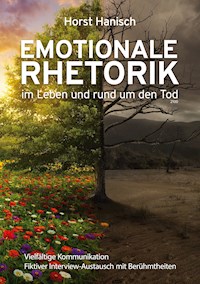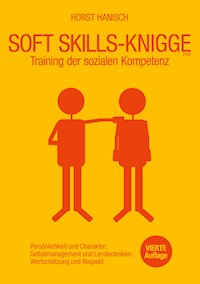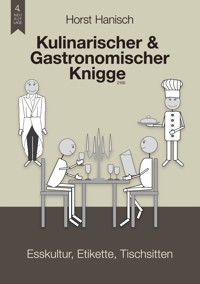
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Von Esskultur, Etikette, Tisch- und Trinksitten, Knigge, Umgang und Rituale rund um den kulinarischen Genuss. Ein nicht unbeachtlicher Teil des abwechslungsreichen Lebens hat mit dem Verzehr von Rohem oder Zubereitetem, mit Trinken diverser wohltuender Flüssigkeiten, und mit dem atmosphärischen Drumherum zu tun. Lassen Sie die Thematik einmal aus Sicht des Gastes, ein anderes Mail aus Sicht des Gastgebers, aber auch des Gastronomen betrachten. Schauen Sie den Ablauf einer Einladung, von den notwendigen Vorbereitungsar¬beiten, über das herzliche Begrüßen und Betreuen der Gäste, inklusive kurzweiligem Smalltalk, bis hin zur Persönlichkeit des Gastes angepassten Kommunikation an. Klären Sie die Fragen rund um den Tisch. Was ist wie und wo eingedeckt? Welche Blume sagt was aus? Wie kann dekoriert werden? Welche Umgangsformen werden bei Tisch erwartet? Beleuchten Sie das Verhalten bei Tisch, angefangen von einer hörenswerten Tischrede, über die korrekte Umsetzung des Probeschlucks bis hin zum souveränen Umgang mit möglichen Pannen. Tauchen Sie ein in die Themenvielfalt der Getränke, angefangen bei Aperitif, über Wasser, Wein, Bier, Digestif bis hin zum Heißgetränk. Dann natürlich das Speisenangebot; Fingerfood, Snacks, gesetzte Menüs, Speisenbuffets und andere mehr. Was gibt es bei ausgefallenen, kulinarischen Köstlichkeiten zu beachten? Darf eine Grille im Schokomantel mit den Fingern zu Munde geführt werden? In welche Rolle Sie auch schlüpfen, Gast, Gastgeber oder Gastronom, ein freundliches und wohltuendes gast-freundliches Auftreten wird hoch geschätzt. Das Buch sollte ein Muss sein für den modernen Gast, den perfekten Gastgeber und den kundenorientierten Gastonomen, um ihnen allen für ihren gegenseitigen empathischen Umgang ein 'Danke' zuzurufen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Friedel und Fred
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS
PROLOG
D
IE
M
ADE IM
S
PECK
,
ODER
…
… die Grille im Schokomantel?
TEIL I GÄSTE UND GASTGEBER, SMALLTALK, PLATZIERUNG UND BLUMEN-SPRACHE
KAPITEL 1 – GAST UND GASTGEBER
DIE OFFIZIELLE EINLADUNG
„W
IR ERLAUBEN UNS
, S
IE HERZLICH EINZULADEN
…“
Einladung analog und digital
Antwort auf eine Einladung
EINLADUNG ZUM ESSEN AUßER HAUS
„D
ARF ICH
S
IE ZUM
E
SSEN EINLADEN
?“
Einladung außer Haus
Catering
Ist eingeladen gleich eingeladen? Oder doch Selbstzahler?
Übersichtsblatt für die Service-Leitung
DIE GÄSTE TREFFEN EIN
„T
RETEN
S
IE EIN
“
Pünktlichkeit und Akademisches Viertel
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben …
„Darf ich bei der Garderobe behilflich sein?“
Hände waschen
G
RÜßEN
– B
EGRÜßEN
„Hallo allerseits“
Auf den Tisch klopfen
Gleichgeschlechtliche Paare
Menschen mit eingeschränkter Mobilität
Aberglauben
HABITUS – AUFTRETEN UND UMGANGSFORMEN
D
IE
H
ALTUNG DES
G
ASTES
„Wie die Umstände, so auch die äußere Erscheinung.“
KAPITEL 2 – SEKT UND SMALLTALK
DER APERITIF
E
IN
G
LAS
C
HAMPAGNER ODER EINEN
S
HERRY
?
Das Getränk vor dem Essen
‚Mise en place’ in Geschäftsräumen
Der Aperitif als Appetit-Anreger
Anbieten des Aperitifs
Wie voll werden die Gläser geschenkt?
Sherry
VOM SMALLTALK ZUM BIGTALK
D
IE
K
UNST DES KLEINEN
G
ESPRÄCHS
Wann wird Smalltalk geführt?
Ziel eines Smalltalks
Tabuthemen
Korrekt geführter Smalltalk
E
INSTIEG IN DEN
S
MALLTALK
Smalltalk
Geeignete Smalltalk-Themen
Unverfängliche Themen
Die linke und die rechte Hand
Mauerblümchen oder Kontakt aufnehmen? – Zugehen auf eine Gruppe
Hin und wieder die Gruppe wechseln
DIE TISCH- UND SITZORDNUNG
W
ER SITZT WO
?
Wohin bin ich platziert?
Sitzordnung der Gäste – Paarweise oder getrennt bei großen Feiern?
Tafelformen
Führungskarten
KAPITEL 3 – PRÄSENTE UND BLUMEN
GESCHENKE, MITBRINGSEL UND BLUMEN
K
LEINE
G
ESCHENKE ERHALTEN DIE
G
ASTFREUNDSCHAFT
„Das wäre aber nicht nötig gewesen …“
Mitbringsel
Geldgeschenke
Gutscheine
Weihnachten und Geschenke
Beliebte Weihnachtsgeschenke
„S
CHENKST DU MIR
R
OSEN
…“
Blüten, Blumen und Blätter
Pflanzen, Arrangements, Kakteen
Sag es mit Blumen! Die Blumen-Sprache
AUF DEM GLATTEN PARKETT
D
AS
T
ANZBEIN SCHWINGEN
„Darf ich bitten?“
TEIL II EVENTS UND FEIERN, DEKORATION UND MOTTOS, SPEISEN- UND GETRÄNKEBUFFET
KAPITEL 4 – GELUNGENE FESTE
FESTE UND FEIERN
D
ER PASSENDE
R
AHMEN FÜR DEN GEGEBENEN
A
NLASS
Der, die oder das Event?
Gründe für Events
Der Jahreswechsel und seine Glückssymbole
Käsewürfel und Trauben auf dem Spießchen
Mettigel
Des Deutschen Lieblingsspeise – Ein Hoch auf die Kartoffel
M
OTTO FÜR EINEN
E
VENT
Ein Besuch im Moulin Rouge
Beispiele einiger Mottos
D
EKORATION UND
G
ESTALTUNG
Gestaltungstipps für verschiedene Anlässe
Die Dekoration für das Buffet
Ein Motto auch bei der
Tischdekoration
Kinderpartys
Familienfeiern
V
ORBEREITUNGSARBEITEN
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen
P
ARTY
, P
ARTY
, P
ARTY
Flying Buffet, Fliegendes Buffet
Fingerfood
Snacking
Der große Tag ist da
Alle Sinne einbinden
„Danke fürs Kommen“
Das Team-Event
KAPITEL 5 – RUND UM DAS BUFFET
SPEISEN- UND GETRÄNKEANGEBOT IN BUFFETFORM
G
RÖßERE
A
USWAHL ODER EHER
U
NRUHE
?
Vor- und Nachteile des Buffetservices
Gehen zum Buffet und Bedienen am Buffet
DIE KLASSISCHEN SPEISEN- UND GETRÄNKE-BUFFETS
S
PEISEN
-B
UFFETS
Das Speisen- und das Getränke-Buffet
Salat-Buffet
Fisch-Buffet
Schweden-Buffet – Smörgåsbord
Kalt-Warmes Buffet
Kaltes Buffet
Bauernbuffet
Barbecue
S
PEZIELLE
B
UFFETS
Kontinentales Frühstücks-Buffet
Brunch
Käse-Buffet
Canapé-Buffet
Kuchen-Buffet
Eis-Buffet
Dessert-Buffet
„Voller Bauch studiert nicht gern.“
G
ETRÄNKE
-B
UFFETS
Das Aperitif-Buffet
Getränke-Buffet
Champagner-Buffet
DER PROFESSIONELLE BUFFETAUFBAU
A
UFSTELLEN DES
B
UFFETS
Raumwahl für ein Buffet
Laufrichtung des Gastes
Tischwahl und Form des Buffets
Richtlinien beim Aufstellen des Buffets
BUFFET-BESPANNUNG
Das Skirting
Buffet-Skirtings
Kunstvolle Buffet-Bespannung
TEIL III ESSKULTUR, ZU HAUSE UND IN DER GASTRONOMIE, BEI TISCH, DAS ARBEITSESSEN
KAPITEL 6 – ESSKULTUR UND STIL BEI TISCH
DAS AUFFINDEN DES RESTAURANT - TISCHES
I
M
R
ESTAURANT
Tischsitten
Das erste Restaurant und die Französische Revolution
Auf dem Weg zum Tisch
DIE PLATZIERUNG
„D
ARF ICH BITTEN
?“
Aufsuchen des Platzes
Die Tischkarte
Sich hinter die Sitzplätze stellen
Abendtasche
Wann wird sich gesetzt?
Dem Gast beim Hinsetzen helfen
DIE BENUTZUNG DER GEDECKTEILE
„O
H
S
CHRECK
,
WAS WIRD WOZU BENUTZT
?“
Das Gedeck
Messer, Gabel, Scher und Licht
DIE BESTECKSPRACHE
D
AS
B
ESTECK KOMMUNIZIERT MIT DEM
S
ERVICE
-P
ERSONAL
Benutzen der Besteckteile
Bestecksprache
Linkshänder
DIE ‚GEBROCHENE‘ SERVIETTE
D
AS
A
UGE ISST MIT
Die Mundserviette
Dekorations-Servietten
Tafelaufbauten
Guten Appetit
AUFSTEHEN WÄHREND DES ESSENS
„I
CH MUSS MAL
…“
Aufstehen oder nicht?
UNPASSENDES BEI TISCH
„W
ARUM RÜLPSET UND FURZET
I
HR NICHT
?“
„Hat es Euch nicht geschmecket?“
Das mobile Telefon
„Gesundheit!“
Die Nase pudern oder die Wimpern nachziehen
PEINLICHKEITEN UND PANNEN
Die berüchtigte Sauce auf der Kleidung
KAPITEL 7 – GASTGEBER BEIM GESCHÄFTSESSEN IM RESTAURANT
DAS GESCHÄFTSESSEN
L
IEBE GEHT DURCH DEN
M
AGEN
Das Arbeitsessen im Restaurant
W
HO IS WHO IM
R
ESTAURANT
?
Herr Ober – Frau Ober
KI und die Zukunft – Die Künstliche Intelligenz
DIE MENÜKARTE UND DIE SPEISEKARTE
D
IE
M
ENÜKARTE IM
B
ANKETTGESCHÄFT
Vom Gastgeber selbst erstellte Menükarte
Die korrespondierende Getränkefolge im Menü
D
IE
S
PEISEKARTE IM
‚À-
LA
-
CARTE
-G
ESCHÄFT
’
Die Speisekarte
Die Damenkarte – die Gastkarte
Die Getränkekarte
DIE TISCHREDE
„E
S BEGAB SICH IM
J
AHRE DES
G
RÜNDERS
, 1862, …“
Der Zeitpunkt der Tischrede
Die Stegreifrede
Unterhaltung während des Essens
DER SPEISENSERVICE
V
ON DER
V
ORSPEISE BIS ZUM
D
ESSERT
Bei Tisch
Knochen und Kerne
Fingerschale
TRINKKULTUR
„F
ISCH MUSS SCHWIMMEN
“
Gläser im Gedeck
Die Getränkefolge
D
ER
W
EINSERVICE
Der Weinservice
Hat der Wein Korken?
Der Probeschluck
Reihenfolge beim Einschenken
Die Tafel ist eröffnet – Das erste Getränk
DER KAFFEESERVICE
D
AS
K
AFFEEGETRÄNK NACH DEM
E
SSEN
Die Speisen sind verzehrt
Der Kaffee in der Thermoskanne?
DIE REKLAMATION
„D
AS SCHMECKT JA WIE EINGESCHLAFENE
F
ÜßE
“
Die Gäste sind wählerischer denn je
Gerechtfertigtes Reklamieren
„Der Kunde ist König.“
BEZAHLUNG UND TRINKGELD
E
S WIRD ZUR
K
ASSE GEBETEN
Die Rechnung
Trinkgeld
DAS AUFHEBEN DER TAFEL
I
RGENDWANN IST
S
CHLUSS
…
… und jetzt ist irgendwann – Das Beenden des Anlasses
Verlassen des Restaurants
TEIL IV UMGANG MIT SCHWIERIG ZU ESSENDEN SPEISEN, EXOTISCHEN FRÜCHTEN UND SUSHI
KAPITEL 8 – LECKERES, UNGEWOHNTES, SCHWIERIG ZU ESSENDES
ESSEN MIT HÄNDEN UND BESTECKTEILEN
S
CHWIERIG ZU ESSENDE
S
PEISEN
Füße waschen und auf dem Boden sitzen
Die Aufgaben der Bestecke
DIE ERSTE MAHLZEIT AM TAGE
B
EIM
F
RÜHSTÜCK
Die wichtigste Mahlzeit am Tage
Das Frühstücks-Ei
Omelette vom Straußenei
VORSPEISEN, SUPPEN UND ALLTÄGLICHES
„L
ASST UNS BEGINNEN
“
Kaviar
Spaghetto und Spaghetti
Pizza aus Neapel
Das Geheimnis der Trüffel
Suppe mit Blätterteighaube
Bouillabaisse
Hering – der jungfräuliche Matjes
Die bayerische Weißwurst
Halve Hahn
Weck, Worscht un Woi
AUF DEM STEHEMPFANG
„B
ITTE BEDIENEN
S
IE SICH
“
Fingerfood
Kanapees (Canapés)
Snacks
Flying Buffets
DIE KLASSISCHEN MEERESFRÜCHTE
V
ON
A
USTER BIS
H
UMMER
Austern – Die Perlen des Meeres
Miesmuscheln im Sud
Jakobsmuschel – Coquille Saint-Jaques
Riesengarnelen
Hummer
Seeigel
Exotische Früchte des Meeres
F
ISCH ALS
H
AUPTGERICHT
Forelle Müllerin
Gegrillte Seezunge
K
NIFFLIGES ALS
H
AUPTGERICHTE
Spargel
Fondue Bourguignonne – Fondue Chinoise
S
USHI UND ANDERES
A
SIATISCHES
Beim Chinesen
Auf nach Japan
Sushi
R
EGIONALES
– W
IENER
S
CHNITZEL UND
S
CHNITZEL
W
IENER
A
RT
Das gute, alte Wiener Schnitzel
Regionales
KAPITEL 9 – KÄSE, EXOTISCHE FRÜCHTE, KUCHEN UND SÜßES
KÄSE SCHLIEßT DEN MAGEN
N
ACH DEM
H
AUPTGERICHT
– oder auch nicht
Käsegruppen
Die Käse-Platte
Käseangebote
Käsefondue
Darreichungsformen von Käse
KUCHEN, TORTEN UND GEBÄCKSTÜCKE
D
IE KLEINEN
K
ALORIENBOMBEN
… und dann gleich zwei Stück
Frankfurter Kranz und Sacher-Torte
Streuselkuchen
Farbenprächtige Cupcakes
Tea-Time
Petits Fours, Pralinen und Konfetti
Dominosteine – Notpraline
Macarons
Marzipan
S
ÜßES
Die Schlagsahne
Speiseeis
Cassata alla Siciliana und Cassata-Eisbombe
Softeis
WELT DER EXOTISCHEN FRÜCHTE
A
PFELBANANE BIS
Z
WERGPOMERANZE
Exotische Früchte
KAPITEL 10 – EXKLUSIVES, EXOTISCHES UND EXTREMES
DER MENSCH LEBT NICHT VOM BROT ALLEIN
E
XKLUSIVES
Safran
Gold, Blattsilber und Silberflocken
Perlen vor die Säue werfen?
Manna – die Speise aus dem Himmel
B
LÜHENDE
S
CHÖNHEITEN
Vom Gänseblümchen bis zur Rose
Dahlie und Fuchsie
Rosen, Gänseblümchen und andere
Kapuzinerkresse
Kakteen
A
USGEFALLENES
„Gibt es etwas Exotisches?“
Von Zwei- und Vierbeinern
Meerschweinchen
Strauß
Zebra und Pferdefleisch
Kamel und Dromedar
Antilope
Auf den Hund gekommen
Innereien
U
NGEWÖHNLICHES
Insekten
Heuschrecken
Quallen
Schlange
Krokodil und Alligator
Astronautenkost
E
XTREMES
Fugu – Das giftige Vergnügen
Hoden und Penis
Kiviak
T
ABU
-G
ERICHTE
… und was es sonst noch so auf der Welt gibt
Menschenaffen, Wildkatzen und Nashörner
Schildkröten
Haifischflossen
Wale
Froschschenkel
Schwalbennestersuppe
Singvögel und Ortolane
A
US DEM
V
OLLEN SCHÖPFEN
Völlerei – Maßloses Übertreiben
Tischlein deck dich
Rituale
…
UND WAS ES NICHT GIBT
Kapitän Nemo
Schlaraffenland
Und wie ernähren sich die Götter?
TEIL V SERVICE VON APERITIF, WEIN, CHAMPAGNER, BIER, DIGESTIF UND HEIßGETRÄNK
KAPITEL 11 – GETRÄNKE BEI TISCH UND VERANSTALTUNGEN
WASSER UND SOFTDRINKS IM TAGUNGSGESCHÄFT
D
AS
G
ETRÄNK ZUR
B
ESPRECHUNG
Kaffee oder Wasser?
Mineralwasser
Eiswürfel
Kokosnusswasser
S
AFT
„Voll im Saft stehen“
Tomatensaft im Flugzeug
Zaubertrank
Vorkoster und Mundschenk
KAPITEL 12 – BIER AUF WEIN, DAS LASSE SEIN
BIER
D
AS KÜHLE
B
LONDE UND DAS BRAUNE
G
EHEIMNISVOLLE
Met – Honigwein
Umtrunk
Bier trinken statt in Bier ertrinken
Pils, Kölsch, Altbier oder Weizenbier?
König Gambrinus
Herrengedeck
WEIN
D
ER
W
EINSERVICE
„Im Wein liegt die Wahrheit“
Die Weinflasche wird präsentiert
W
EIN UND
S
TIL
Trinkfreuden – Das passende Weinglas
Trinktemperatur
Glühwein
CHAMPAGNER
D
AS
G
ETRÄNK DER
K
ÖNIGE UND DIE
, …
Wie voll werden die Gläser geschenkt?
KAPITEL 13 – VON COCKTAILS UND HOCHPROZENTIGEM
„GESCHÜTTELT, NICHT GERÜHRT“
W
ER
S
ORGEN HAT
, …
… hat auch Likör
DER DIGESTIF
V
ON
C
OGNAC BIS
L
IKÖR
Digestif – Das Getränk nach dem Essen
Service des Digestifs
AN DER BAR
E
IN
O
RT MIT
A
TMOSPHÄRE
Entspannen an der Hotel-Bar
Die amerikanische Bar
Cocktail – der Hahnenschwanz?
Arak, Tuak, Tuba und Palmwein
Vom Whisky und Whiskey
Cognac
Sake
‚Geschüttelt oder gerührt?‘ – Der Martini-Cocktail
Singapore Sling
Pitahaya-Cocktail
Mocktail
„VOLL WIE EINE HAUBITZE“
A
LKOHOL
: S
UCHT ODER
G
ENUSS
?
Alkoholische und alkoholfreie Getränke
Nunc est bibendum – Jetzt ist es Zeit zu trinken
Voll wie eine Strandhaubitze
KAPITEL 14 – DAS HEIßGETRÄNK
KAFFEE
V
OM
E
SPRESSO BIS ZUM
M
OKKA
Kaffee – das verteufelte Getränk?‘
Kaffee international
Kopi Luwak
TEE
D
AS AROMATISCHE
G
ETRÄNK
Der Fünf-Uhr-Tee
SCHOKOLADE
D
AS
G
ETRÄNK DER
A
ZTEKEN
Kakao oder Schokolade
Service von Trinkschokolade
EPILOG
D
EM
B
AUCH SCHMEICHELN
Das Leben genießen
STICHWORTVERZEICHNIS
UMGANG MIT MENSCHEN
Adolph Freiherr Knigge
Prolog
Die Made im Speck, oder …
„Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.“
Eugen Berthold Friedrich Brecht (Die Dreigroschen Oper), dt. Schriftsteller und Regisseur
(1898 - 1956)
… die Grille im Schokomantel?
Das große Thema dieses Buchs dreht sich um Kulinarisches und Gastronomisches.
In der lateinischen Sprache gibt es ‚culinarius‘, was soviel bedeutet wie ‚auf feiner Kochkunst bestehend‘. Beim Kulinarischen geht es um die Kunst der Speisenzubereitung, die für den Genuss zubereitet wird. Auch wenn das vorliegende Buch kein Kochbuch ist, behandelt es viele Themen, die den Einsatz von Speisen (und Getränken) betreffen.
Die griechische Sprache bietet ‚gastronomia‘ an, was so viel wie ‚Magenkunde‘ oder ‚Bauch‘ bedeutet. Es geht um die Bewirtung, den Verzehr von Speisen (und Getränken), sowie die Berücksichtigung der Tisch- und Trinkkunst. Dem Magen soll geschmeichelt werden, was der ‚wachsende‘ Bauch manchmal auch anderen Personen offenbart.
Im vorliegenden Buch werden keine Unterschiede zwischen der Systemgastronomie (zum Beispiel Fast-Food), der ‚rustikalen‘ Gaststätte, der ‚regionalen‘ Küche (ein ehemaliger deutscher Bundeskanzler kredenzte seinen Staatsgästen gerne eine seiner Lieblingsspeisen: Saumagen) oder der ‚gehobenen‘ Gastronomie, deren Regeln weltweit gelten, gezogen.
Auch gelten viele Angaben für den privaten Bereich zu Hause, das Verhalten im Restaurant bis hin zur Situation bei großen Veranstaltungen.
Gastrosophie – Komponenten der Bereiche Kulinarisches und Gastronomisches
Bei der Bearbeitung der Bereiche Kulinarisches und Gastronomisches bleibt es nicht aus, auf bestimmte ‚Komponenten‘ zu stoßen, die das Thema einnehmen.
Der Oberbegriff lautet Gastrosophie. Der altgriechische Begriff ‚gaster‘ steht für ‚Bauch‘ und ‚sophia‘ für ‚Weisheit‘. Damit ist die Weisheit, das Wissen rund um die Ernährung – die Zufriedenstellung des Bauchs – gemeint.
So gehören mehrere Komponenten in den gastrosophischen Bereich. Unter anderem folgende Bereiche:
Esskultur: Das Umfeld der Ernährung, auch Dekoration, sowie die regionale Berücksichtigung der Speisen.
Zum Beispiel: Eingedeckter Tisch, Buffetgestaltung, Serviettenformen, welche Speisen gehören zusammen?, Besonderheiten von Gerichten mit regionalem oder nationalem Bezug.
Trinkkultur: Verhalten rund um die Zubereitung, den Service und den Genuss von Getränken
Zum Beispiel: Kaffee- und Teeservice, Probeschluck beim Wein, passende Cocktails im Barservice.
Tischsitten: Die Art und Weise, wie in Gesellschaft bei Tisch Speisen und Getränke konsumiert werden.
Zum Beispiel: Wann wird mit dem Essen begonnen? Benutzen von Bestecken oder mit den Fingern Speisen zuführen?
Ritual: Festgelegter, feierlicher, formaler Ablauf mit Symbolcharakter.
Zum Beispiel: Einzelne Schritte bei einer japanischen Teezeremonie, oder Vorgehensweisen bei Hochzeitsfeiern. Zuprosten und Anstoßen.
Etikette und Knigge: Festgelegte Regeln der gesellschaftlichen Umgangsformen und Anleitungen und Anregungen zum sozialen Zusammenleben mit anderen. Anstand (‚schickliches Benehmen‘, Benimm) und Manieren (lat. ‚manuarius‘ für ‚passend‘):
Zum Beispiel: Nicht kreuz und quer reden bei Tisch, Höflichkeiten, Hierarchie, Anredeformen. Rolle Gastgeber/Gastgeberin, Betreuung von Ehrengästen, Beachtung der Dienstleister, wie das Servicepersonal. Das menschliche Miteinander, Wertschätzung, Toleranz.
Habitus: Die Gesinnung, Geisteshaltung und die Grundhaltung eines Menschen.
Zum Beispiel: Das arrogante oder empathische Auftreten, die Ausstrahlung (Aura) und die Art der positiven oder negativen Einstellung zu Lebenssituationen.
Eine Menge Bereiche, die die vorliegende Thematik der Gastrosophie betreffen. In der Praxis werden sich einige Komponenten immer mal überschneiden.
Viele der Texte sind aus den kleinen Knigge-Ratgebern (siehe Buchanhang) entliehen, um ein zusammenhängendes Gesamtbild der Themen rund um das Kulinarische und Gastronomische abzubilden.
Der Genussmensch
Uns geht es gut, wir sind glücklich, wir können das Leben genießen. Zumindest die meisten von uns. So wird mancher sagen: „Die leben ja wie die Maden im Speck!“
Damit soll ausgedrückt werden, dass wir mehr oder weniger alles essen und trinken können, was wir wollen (und medizinisch betrachtet: dürfen) und zumindest theoretisch auch (fast) alles käuflich ist, was das kulinarische Angebot hergibt.
Statistisch gesehen, verbringt der Mensch 50.000 Stunden seines Lebens (das sind immerhin etwa fünfeinhalb Jahre, 24 Stunden lang, dauernd, ohne Schlaf) mit dem Verzehr von Speisen und Getränken, wobei echte Trinkgelage nicht eingerechnet sind.
Im Laufe des (Durchschnitts-)Lebens, gerechnet bei 75 Jahren, sollen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, angeblich Folgendes verzehrt haben:
4.600 kg Brot und Brötchen, aber nur 670 kg Schokolade, 725 kg Nudeln, allerdings mehr als 17.250 Eier. 90 kg Chips, aber weit mehr als 3.850 kg Fleisch, etwa 5.100 l Tee, sowie 12.650 l Kaffee (Liter, nicht Tassen!), beruhigenderweise nur etwa 6.600 l Bier (wobei es hier ganz bestimmt Menschen gibt, die die Statistik ins Wackeln bringen könnten).
Fairerweise muss angemerkt werden, dass in den Industrienationen bedauerlicherweise auch tonnenweise Lebensmittel weggeworfen werden. Aber das ist ein anderes Thema. Bei obigen Zahlen (aus verschiedenen Quellen und unterschiedlichen Jahren, aber immer auf Deutschland bezogen) lässt sich sehr leicht der Eindruck gewinnen, dass ein beachtlicher Teil unseres abwechslungsreichen Lebens mit dem Verzehr von Rohem oder Zubereitetem, mit Trinken diverser wohltuender Flüssigkeiten und mit dem atmosphärischen Drumherum zu tun hat.
Der Gast, der Gastgeber und der Gastronom
Ein Grund mehr, weshalb das vorliegende Buch einen Einblick in die Materie geben soll. Lassen Sie uns die Thematik einmal aus Sicht des Gastes, ein anderes Mal aus Sicht des Gastgebers, aber auch aus der des Gastronomen betrachten.
Schauen wir uns den Ablauf einer Einladung, von den notwendigen Vorbereitungsarbeiten, über das herzliche Begrüßen und Betreuen der Gäste, inklusive kurzweiligem Smalltalk, bis hin zur Persönlichkeit des Gastes angepassten Kommunikation an.
Klären Sie die Fragen rund um den Tisch. Was ist wie und wo eingedeckt? Welche Blume sagt was aus? Wie kann dekoriert werden? Welche Umgangsformen werden bei Tisch erwartet? Und wie läuft denn nun das Verhalten bei Tisch, angefangen von einer hörenswerten Tischrede, über die korrekte Umsetzung des Probeschlucks bis hin zum souveränen Umgang mit möglichen Pannen.
Tauchen Sie ein in die Themenvielfalt der Getränke. Der Umgang mit jeder Getränkegruppe wirft Fragen auf, angefangen bei Aperitif, über Wasser, Wein, Bier, Digestif bis hin zum Heißgetränk.
Und dann natürlich das Speisenangebot; Fingerfood, Snacks, gesetzte Menüs, Speisenbuffets und andere Angebotsformen mehr.
Was gibt es bei ausgefallenen, kulinarischen Köstlichkeiten zu beachten? Darf eine Grille im Schokomantel mit den Fingern zu Munde geführt werden? Ja. Wie lautet die Pluralform von ‚Spaghetti’? Spaghetti ist bereits die Mehrzahlform. Ja, wie ist dann die Einzahlform? Spaghetto! Haben Sie es gewusst? Bravo!
Egal, ob zu Hause, während des Arbeitsessens oder anlässlich eines ausgefallenen Events – die meisten Anwesenden bevorzugen es, sich selbstsicher und selbstbewusst, ohne egoistisch und aufdringlich zu wirken, bewegen zu können.
In welche Rolle Sie auch schlüpfen, Gast, Gastgeber oder Gastronom, ein freundliches und wohltuendes gast-freundliches Auftreten wird hoch geschätzt.
Im vorliegenden Buch wird deshalb in 14 Kapiteln neben der Basis auf die Themenvielfalt der kulinarischen und gastronomischen Feinheiten und Raffinessen eingegangen.
Das Buch sollte ein Muss sein für den modernen Gast, den perfekten Gastgeber und den kundenorientierten Gastonomen, um ihnen allen für ihren gegenseitigen empathischen Umgang ein ‚Danke‘ zuzurufen.
Viel Spaß beim Lesen der folgenden Seiten – und genießen Sie mal die Heuschrecke im Schokoladenmantel. Guten Appetit!
Horst Hanisch
Teil I Gäste und Gastgeber, Smalltalk, Platzierung und Blumen-Sprache
Kapitel 1 – Gast und Gastgeber
Die offizielle Einladung
„Wir erlauben uns, Sie herzlich einzuladen …“
„Ich bin ein Gast auf Erden.“
Paul Gerhardt, dt. Kirchenlieddichter
(1607 - 1676)
Einladung analog und digital
„Eine Einladung in Papierform?“ So mögen viele – vorwiegend die ‚jüngere Generation‘– denken. „Papierverschwendung, kostet zu viel, dauert zu lange – und ist altmodisch.“ Das mag alles stimmen.
Aus Zeit-Ersparnisgründen, aus der Idee, um Porto zu sparen, oder aus – echten oder vorgeschobenen – Umweltschutz-Gründen gehen auch vermehrt Unternehmen zur virtuell übermittelten Einladung über.
Ja, es mag sein, dass es im Zeitalter der elektronischen Kommunikation im ‚familiären’ Rahmen auch möglich ist, eine Einladung per E-Mail zu verschicken.
Trotzdem: Wer es ‚seriös‘, ‚wertvoll‘ bevorzugt, wird auf die Papiervariante – auf edles Papier – nicht verzichten wollen. Immerhin sollen die meisten Einladungen etwas Besonderes bedeuten und natürlich auch in sehr guter Erinnerung bleiben.
„Jemanden einladen heißt, ihm seine Zuneigung beweisen.“
Die Überschrift ist ein Zitat vom französischen Schriftsteller René François Armand ‚Sully‘ Prudhomme (1839 – 1907), immerhin der erste Nobelpreisträger für Literatur. Die Aussage zeigt die besondere Wertschätzung, die der Einladende dem Gast gegenüber zeigt.
Nicht nur eine hochoffizielle Feier ist ein Grund, eine Einladung auszusprechen. Auch eine kleine ‚gemütliche Kaffeetafel’, ein Treffen am Abend, um ein Gläschen Wein miteinander zu trinken, oder eine informelle Grillparty hinterm Haus sind Anlässe für eine Einladung.
Sogar eine klassische Einladung zum Abendessen unterliegt gewissen Kriterien.
Dabei ist darauf zu achten, dass auf der Einladung die folgenden vier Punkte vermerkt werden.
Datum
Uhrzeit
Ort
Anlass
Die Einladung muss natürlich nicht mehr – wie früher üblich – durch einen Boten überreicht werden. Es genügt vollauf, die Einladung brieflich zu verschicken. Adressat und Absender gehen aus der Umschlag-Beschriftung hervor.
Die Einladung selbst wird handschriftlich vom Gastgeber beziehungsweise von beiden Gastgebern unterschrieben.
Je persönlicher und aufmerksamer die Einladung gehalten wird, desto mehr Wert wird auf die individuelle Gestaltung der Einladungskarte gelegt.
Handgeschriebenes, auch wenn das mehr Aufwand bedeutet, steht immer noch an erster Stelle. Hier ist eine sehr gute, unbedingt leserliche Handschrift gefragt. Der Verfasser vermeidet Schreibfehler oder Korrekturen.
U.A.w.g.
Nichts geändert hat sich an dem Hinweis ‚U.A.w.g.’ Die Abkürzung heißt: ‚Um Antwort wird gebeten’, was an sich schon eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
Beachten Sie die zu treffenden Vorbereitungen, wie Einkäufe, Organisation und Arrangements. Es ist mehr als unhöflich, auf eine Einladung nicht zu reagieren, sei es als Zusage oder als Absage.
Antwort auf eine Einladung
Beantworten Sie alle Einladungen deshalb möglichst umgehend, spätestens aber innerhalb einer möglicherweise angegebenen Frist. Wählen Sie bei der Antwort die gleiche Form, in der Sie eingeladen wurden.
Sollten Sie der Einladung nicht folgen wollen, sagen Sie bestenfalls sofort dankend ab. Begründen Sie nach Möglichkeit Ihre Absage.
Wenn Sie eingeladen sind, heißt das nicht, dass Ihr soziales Umfeld mit eingeladen wurde. Es gilt als unhöflich, eine weitere Person unaufgefordert mitzubringen.
Unschön ist es, den Einladenden unnötig auf eine Antwort warten zu lassen. Manche Gäste reagieren überhaupt nicht, da sie die Empathie dem Gastgeber gegenüber vermissen lassen.
Andere halten sich mit der Zusage bewusst zurück – es könnte ja noch eine andere – eine interessantere – Einladung erfolgen.
Das ist zwar denkbar, dem Einladenden gegenüber aber bestimmt nicht fair, sich so kalkulierend zu verhalten.
Während der Einladung
Auch wenn der Anlass noch so begeisternd ist, bedeutet das nicht, dass manche Gäste sich gehen lassen. Besser: Bewahren Sie immer eine entsprechende Form. So, dass am nächsten Tag keine peinlichen Gewissensbisse zu beklagen sind.
Gehen Sie vorsichtig mit Alkoholgenuss um. Bei vielen Menschen hebt Alkohol die Stimmung und vernachlässigt gegebenenfalls die gewünschten Umgangsformen.
Nach der Einladung
Aus Sicht des Gastgebers: Gäste zum Besuch animieren kann aufwendig sein. Gäste wieder zu verabschieden ist manchmal noch schwieriger, speziell, wenn sie sich ‚festsetzen‘. Deshalb: Als Gast wissen Sie, wann Sie aufbrechen werden. Vermeiden Sie – Ausnahme: Sie sind der einzige Gast – dass Sie als Letzter gehen.
Bedanken Sie sich am nächsten Tag kurz für die Einladung. So bleiben Sie als Gast in guter Erinnerung.
Die Gäste treffen ein
„Treten Sie ein“
„Pünktlichkeit ist der Dieb der Zeit.“
Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde, engl. Schriftsteller
(1854 - 1900)
Pünktlichkeit und Akademisches Viertel
Das Akademische Viertel: Gibt es das überhaupt noch? Das sogenannte ‚akademische Viertel‘ stammt aus vergangenen Zeiten, als die einzige Uhr in der Stadt am Kirchturm hing.
Beim Schlag der vollen Stunde hieß es: Auf zum Unterricht beziehungsweise zur Uni! Deutlich überholt im Zeitalter der Armbanduhren und Zeitangaben auf den Smartphones.
Bei Einladungen mit überschaubarer Gästezahl gilt die angegebene Uhrzeit als vorgegeben. Ist vereinbart 19:00 Uhr, bedeutet das 19:00 Uhr. Es gilt als unhöflich, jetzt später zu erscheinen.
Bei größerer Gästezahl wird der Gastgeber es einrichten, eine gewisse Zeitspanne – die dann auch als Aperitif-Zeit genutzt werden kann – einzuplanen.
Auf der Einladung könnte dann zum Beispiel stehen: Aperitif zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr. Dann gilt 19:30 Uhr als spätester Zeitpunkt. Sollten Sie folgende Abkürzungen vorfinden, stehen diese für:
c.t.
cum tempore
‚mit Zeit‘. Eingeweihten offenbart diese Abkürzung, dass sie 15 Minuten später kommen können als angegeben. Statt 10:00 Uhr erst um 10:15 Uhr.
s.t.
sine tempore
‚ohne Zeit‘. Das bedeutet, dass bei der Zeitangabe 10:00 Uhr die Veranstaltung auch um 10:00 Uhr beginnt.
Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige und der Königinnen!
Der Gastgeber richtet sich genau auf den angegebenen Zeitpunkt ein und nicht auf einen späteren. Dies gilt ganz besonders in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, sowie in einigen anderen Ländern, wie Japan.
Allerdings ist es ebenso unschicklich, bereits vor dem angegebenen Zeitpunkt zu erscheinen. Falls Sie vor der angegebenen Zeit ankommen, wäre ein kleiner Spaziergang angebracht.
Zu früh angekommen?
Der Gastgeber könnte bei einem zu früh eintreffenden Gast – will er ihm doch seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenken – unter Umständen in arge Bedrängnis für noch zu erledigende Vorbereitungen kommen.
In anderen Ländern können deutlich andere Zeitvorstellungen gelten. So ist es in einigen afrikanischen und südamerikanischen Ländern durchaus üblich und auch richtig, erst eine volle Stunde oder noch später als zum angegebenen Zeitpunkt zu erscheinen.
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben …
Angeblich soll der ehemalige sowjetische Staatspräsident Michail Sergejewitsch Gorbatschow (1931 – 2022) diese Äußerung getätigt haben. Ok, es wurde aus dem Zusammenhang gerissen, aber das soll hier unberücksichtigt sein.
Es geht auch ohne Bestrafung. Trotzdem wird absolute Pünktlichkeit – in diesem Fall vor Beginn anwesend – erwartet: Theater/Oper/Konzert, Kino, Gottesdienst, Arztbesuch, Prüfungen.
Zu spät kommen – aber noch vor Beginn
nach der Pause im Theater
an schon Sitzenden so vorbeigehen, dass der Rücken zur Bühne zeigt. Der Sitzende steht – wenn möglich – auf.
in der Kirche
am schon Sitzenden so vorbeigehen, dass der Rücken nicht zum Altar zeigt. Die Sitzenden rücken, wenn möglich – auf.
Wer zu spät kommt entschuldigt sich.
Platznachbarn dezent grüßen, zumindest zunicken.
„Darf ich bei der Garderobe behilflich sein?“
Wenn die Garderobe entgegengenommen wird, ist es korrekt, dass der eingeladene Herr seiner Begleitung aus der Garderobe hilft und die Garderobe an den Gastgeber weiterreicht.
Sicherlich ist es bei größeren Veranstaltungen angebracht, jemanden dafür abzustellen, die Garderobe entgegenzunehmen und zu verwahren.
Der Herr zeigt der ihn begleitenden Dame die nötige Höflichkeit, wenn er sich um ihre Garderobe kümmert. (Das Gleiche geschieht später bei der Verabschiedung.)
Es ist aber immer die Pflicht des Gastgebers oder einer von ihm beauftragten Person, die Garderobe der Dame beziehungsweise des Gastes zu verwahren.
Währenddessen legt der Herr seine Garderobe ab und reicht sie an den Gastgeber weiter.
Jedem – unabhängig des Alters – darf grundsätzlich aus der Garderobe geholfen werden. Diese Hilfe kann eingeleitet werden mit der rhetorischen Frage:
„Darf ich Ihnen bei der Garderobe behilflich sein?“, um – ohne die Antwort abzuwarten – zu helfen.
Die Handschuhe
Besonders ältere Damen trugen hin und wieder Handschuhe, die sie auch anbehielten.
Dazu die Bemerkung: Ältere Damen bevorzugten in früheren Zeiten Handschuhe, damit das Gegenüber die vom Alter gezeichneten Hände nicht sehen konnte. In ‚edlen’ Kreisen taten dies übrigens auch die Herren.
Alle anderen Handschuhe, Wetter- oder Winterhandschuhe werden mit der Garderobe abgegeben.
Bei der Begrüßung wird zuerst der rechte Handschuh ausgezogen und mit der linken Hand gehalten, damit die rechte Hand zum Gruß frei ist.
Die Garderobe im Restaurant
Findet die Einladung in einem Restaurant mit eingerichteter Garderobe statt, geben die Gäste dort ihre Garderobe selbst ab, bevor sie zu den Gastgebern gehen.
Der Herr hilft der Dame beziehungsweise dem Gast aus dem Mantel, überreicht ihn zusammen mit seinem Mantel der Garderobiere und nimmt gegebenenfalls die Garderobenmarke entgegen.
Ist eine solche Garderobe nicht eingerichtet und sind stattdessen nur Garderobehaken angebracht, hilft auch hier der Herr zuerst der Dame aus dem Mantel und hängt ihn auf.
Erst dann zieht er den eigenen Mantel aus, um ihn aufzuhängen. Die Dame wartet solange neben ihrem Begleiter.
Vor dem Betreten des Veranstaltungsraums besteht die Möglichkeit, sich die ‚Hände zu waschen’, was heißt, die Toiletten aufzusuchen, bevor die Eingeladenen gemeinsam den Festraum betreten.
Hände waschen
Vielleicht wollen die Gäste noch einen kritischen Blick in den Spiegel werfen, die Frisur zurechtrücken, die Brille putzen (zum Beispiel bei Schnee oder Regen) oder ganz einfach die Toilette benutzen.
Der weitsichtige Gastgeber zeigt deshalb unaufgefordert zu Beginn eines Besuchs, wo die Gästetoilette zu finden ist. Er gibt den Hinweis: „Hier können Sie sich die Hände waschen.“
Gemeint ist: Hier können Sie die Haare kämmen, das Make-up kontrollieren und Vergleichbares – und natürlich auch die Einrichtung nutzen.
Die Gäste werden damit auch wissen, wo die Toilettenräume zu finden sind und müssen später nicht extra danach fragen. Auch dann nicht, wenn sie sie später aufsuchen wollen.
Interessanterweise ist es vielen Menschen unangenehm, nach dem Gäste-WC zu fragen.
Sollten die Gastgeber versäumt haben, auf diesen Ort hinzuweisen, fragt der Gast zum Beispiel „Wo bitte, kann ich mir die Hände waschen?“
Tischzucht
Ab dem 13. Jahrhundert bis ins auslaufende Mittelalter gab es sogenannte Tischzuchten. Sie dienten dazu, richtiges Benehmen bei Tisch zu beschreiben. Zuerst gedacht für den Adel, später für die Bürger.
Zucht stand dabei für Ordnung, sowie Gehorsam und Disziplin. Manche meinen, es müsse auch heute noch „Zucht und Ordnung“ herrschen.
Aus einem Text des deutschen Dichters Hans Sachs (1494 – 1576), der später in diesem Ratgeber nochmal auftaucht, stammen folgende Zeilen:
„Hör, Mensch! wenn du zu Tisch willst gahn,
Dein Hand sollt du gewaschen han. …
Am Tisch setz dich nit oben an,
Der Hausherr wölls dann selber han! …
Daß du nit schmalzig machst den Wein!
Trink sittlich und nit hust darein!“
Grüßen – Begrüßen
„Eine gewisse Leichtigkeit im Umgange also, die Gabe, sich gleich bei der ersten Bekanntschaft vorteilhaft darzustellen, mit Menschen aller Art zwanglos sich in Gespräche einzulassen und bald zu merken, wen man vor sich hat, …, das sind Eigenschaften, die man zu erwerben und auszubauen trachten soll.“
Adolph Freiherr Knigge, aus dem Buch
„Über den Umgang mit Menschen“, 1788
(1752 - 1796)
„Hallo allerseits“
Es gibt einen Unterschied zwischen grüßen und begrüßen.
Sie grüßen beim Betreten und Verlassen eines Bahnabteils oder eines Wartezimmers, beim Platznehmen und Aufstehen in einer Gaststätte, falls noch Fremde am selben Tisch sitzen; im Theater oder Konzertsaal die links und rechts sitzenden Nachbarn.
Der Gast tritt ein und wird vom Gastgeber begrüßt.
Grundsätzlich wird der Gastgeber – sollten keine Angestellten oder freundliche Hilfskräfte den Empfang übernehmen – den Gast zuerst ins Gebäude bitten, um ihn anschließend höflich willkommen zu heißen.
Er wird nicht vergessen, sich zu bedanken (!), dass der Gast seiner Einladung Folge leistet. Der Gastgeber bedankt sich für den Besuch. Es stellt damit den Gast als ‚wertvoll‘ dar.
Sehr hilfreich erweist sich die Begrüßung an der Tür durch einen Firmenangehörigen, einen Familienangehörigen oder eine Hilfskraft. Vor allem, wenn eine größere Anzahl Gäste erwartet wird, ist der Gastgeber nicht an einen einzelnen Gast ‚gebunden’.
Es wird doch eine Weile dauern, bis er sich dem nächsten widmen kann. Er ist nicht ‚belegt’ und kann sich allen Gästen gleichermaßen zuwenden.
Übrigens: Das Fernsehgerät laufen zu lassen bei Gästebesuch wirkt nicht zwingend als gastorientiertes Verhalten.
Auf den Tisch klopfen
Sitzen mehrere Gäste schon bei Tisch, kann der später Dazukommende mit den Finger-Knöcheln einer Hand zweimal kurz auf die Tischplatte klopfen. Dieses Klopfen gilt als Begrüßung.
Da eine andere Regel sagt, dass sich erst gesetzt wird wenn alle Gäste anwesend sind und wieder eine andere Regel sagt, dass es unhöflich ist zu spät zu kommen, gilt das Klopfen auf die Tischplatte nur in bestimmten Fällen.
Zu einer Besprechung wird der Spezialist gebeten. In diesem Fall sitzen die anderen Teilnehmer bereits am Tisch. Der Spezialist betritt jetzt den Besprechungs-Raum.
Um nicht jedem die Hand geben zu müssen – das könnte zeitraubend sein oder eine bestehende Kommunikation stören – kann hier zur Begrüßung das Klopfen auf den Tisch sinnvoll sein.
Auch bei einer vorzeitigen Verabschiedung passt das Klopfen auf die Tischplatte. Die anderen Gäste oder Teilnehmer einer Veranstaltung bleiben noch sitzen. Der Weggehende will auch hier die Kommunikation der Gäste untereinander nicht stören.
Allerdings ist es unabdingbar, sich vom Gastgeber beziehungsweise der Gastgeberin mit Handschlag zu verabschieden.
Gleichgeschlechtliche Paare
Beispielgebend wird in den beschriebenen Situationen bei einem Paar von einer Dame und einem Herrn ausgegangen. Wie wird sich richtig verhalten, wenn zwei Damen oder zwei Herren, offensichtlich als gleichgeschlechtliches Paar auftreten?
Gehen Sie gedanklich nicht von Dame und Herrn aus, sondern von
Gastgeber/Gastgeberin und
Gast/Gästin
Damit ergibt sich die Möglichkeit, dass zwei Damen oder zwei Herren gleichzeitig auftreten und zwar
eine der beiden Personen tritt in der ehemaligen Herren-Rolle (jetzt Gastgeber/Gastgeberin-Rolle) auf und
die andere tritt in der ehemaligen Damen-Rolle (jetzt Gast/Gästin) auf.
Um die Rollenverteilung für Dritte sichtbar zu machen, gehen/stehen und damit auch sitzen die beiden (aus deren Blickrichtung betrachtet) so:
Gastgeber/Gastgeberin in Blickrichtung links
Gast/Gästin in Blickrichtung rechts
Beide sitzen nun nebeneinander. Gastgeber/Gastgeberin dunkel dargestellt, Gast/Gästin gestreift.
Womit die Frage nach der Platzierung bei Tisch geklärt ist.
Im Sinn der Gleichberechtigung werden gleichgeschlechtliche Paare selbstredend ‚gleichberechtigt‘ behandelt.
Das gilt selbstverständlich auch für den Umgang mit Personen, die sich dem Dritten Geschlecht zuordnen oder sich in anderer Form einer nichtbinären Geschlechtsidentität verbunden fühlen.
Menschen mit eingeschränkter Mobilität
Als Behindertenfeindlichkeit wird die Ablehnung, Diskriminierung und das Drängen der Menschen mit Behinderungen an den Rand der Gesellschaft verstanden.
Als Behinderung wird die individuelle Beeinträchtigung eines Menschen bezeichnet, die vergleichsweise schwer und/oder lang anhaltend ist.
Die Diskriminierung erfolgt aufgrund eines psychischen oder allgemein körperlich außergewöhnlichen Zustandes. Zwar regeln zahlreiche Gesetze und Verordnungen, wie Diskriminierungen vermieden werden müssen.
Aber die Praxis zeigt immer wieder wie knifflig – weil ungewohnt – es scheint, mit Mitbürgern und Mitbürgerinnen dieser Personengruppe umzugehen.
Haben früher noch viele von ‚Behinderten’ oder ‚behinderten Menschen’ gesprochen, so wird heute in erster Linie der Mensch gesehen.
Also muss es korrekt heißen ‚Mensch mit Behinderung’, oder besser ‚Mensch mit eingeschränkter Mobilität’. Dabei sind sowohl die Einschränkungen der körperlichen als auch der geistigen Mobilität gemeint.
Es kann jeden treffen! Ein Unfall ist schnell geschehen. Soll es nie passieren! Zeigen Sie Verständnis den Betroffenen gegenüber und unterstützen Sie Hilfestellung wie aufgelistet.
Ratschläge für den Umgang mit …
… Sehgeschädigten:
Wenn Sie mit einem Sehgeschädigten sprechen, sprechen Sie direkt mit ihm – nicht mit der Begleitperson.
Unterstützen Sie nur dort, wo das
fehlende Sehvermögen
auszugleichen ist.
Wenn Sie einen Sehbehinderten zu einem Ort führen, zum Beispiel zu einem Sitzplatz im Restaurant, legen Sie seine Hand auf die Stuhllehne, damit er sich orientieren kann.
Bei Tisch nehmen Sie die Angaben eines Zifferblatts zur Orientierung. „Das Glas steht auf 3 Uhr.“ „Das Gemüse liegt auf 11 Uhr auf dem Teller.“
Geben Sie genaue Erklärungen. Wörter wie „dort, da hinten, hier drüben“ helfen dem Gesprächspartner nicht.
Kündigen Sie an, wenn Sie das Gespräch beenden oder sich entfernen.
(Quelle: Deutscher Blindenverband e. V.)
… Schwerhörigen und Ertaubten:
Wenn Sie mit einem Hörgeschädigten sprechen, sprechen Sie direkt mit ihm – Schauen Sie ihn an, damit er Ihnen von den Lippen ablesen kann.
Platzieren Sie sich in gute Lichtverhältnisse, sodass der Gesprächspartner Ihre Mimik gut erkennen kann.
Fragen Sie nach, ob der Schwerhörige Sie verstehen kann.
Schreiben Sie gegebenenfalls wichtige Angaben, wie Daten, Termine, Zahlen, Adressen und so weiter auf.
(Quelle: Deutscher Schwerhörigenbund e. V.)
Aberglauben
Auch wenn Sie nicht abergläubisch sind – Ihr Gast könnte es sein. Deshalb bringen Sie Ihren Gast nicht in Verlegenheit!
Vermeiden Sie, Hände über Kreuz zu reichen.
Vermeiden Sie, genau 13 Personen an derselben Tafel zu platzieren. Weiterhin zählt zum Aberglauben, was hier folgt. Es soll Glück bringen:
Schornsteinfeger berühren
Geschirr/Scherben zum Beispiel beim Polterabend
Glücksschwein zu Silvester, aber auch ein 4-blättriges Kleeblatt
Es soll Unglück bringen:
Wenn das Käuzchen schreit, stirbt im Haus jemand.
Wenn die Möbel knarren, stirbt jemand in der Verwandtschaft.
Dreht sich der Bräutigam oder die Braut nach der Trauung im Hochzeitszug um, so sucht sie beziehungsweise er sich einen anderen Mann oder eine andere Frau.
Wenn sich ein starker Wind erhebt und der Schleier der Braut auffliegt, werden sich die jungen Leute nicht gut vertragen.
Ein zerbrochener Spiegel bringt gleich sieben Jahre Unglück.
Salzstreuer umschütten.
Brotlaib auf den Rücken legen.
So können Sie 13 Personen platzieren, ohne dass alle 13 an einer Tafel sitzen. Sie schieben zwei unterschiedliche Tisch aneinander. Auf diese Weise kann dem Aberglauben ein Schnippchen geschlagen werden.
Oder Sie ergänzen einen vierzehnten Platz, auf dem Sie einen ‚Platzhalter‘ (zum Beispiel ein Plüschtier) platzieren.
Auf diese Weise sind vierzehn Gedecke vorgesehen. Gleichzeitig wurde die Unglückszahl 13 ‚ausgetrickst‘.
Habitus – Auftreten und Umgangsformen
Die Haltung des Gastes
„Was wir jetzt wie das liebe Brot brauchen, ist weder Monarchie noch Republik, weder Königschafft noch Präsidentschaft, sondern königswürdige Gesinnung.“
Friedrich Lienhard; dt. Schriftsteller
(1865 - 1929)
„Wie die Umstände, so auch die äußere Erscheinung.“
Bei aller Betrachtung der Speisen, der Getränke und des Drumherums, darf der Mensch nicht vergessen werden. Der Mensch in der Rolle als Gast/Gästin oder Gastgeber/in.
Erasmus von Rotterdam (1469 – 1536), holländischer Theologe, gibt schon einen Hinweis zum sichtbaren Erscheinungsbild eines Menschen: „Wie die Umstände, so auch die äußere Erscheinung.“ Glücklicherweise hat es die Natur eingerichtet, viele verschiedene Charaktere entstehen zu lassen. Beim Zusammentreffen mehrerer Gäste wirken einige sofort aufgeschlossen, andere halten sich dezent zurück.
„Was bist du denn für einer? Wessen Geistes Kind bist du?“ So mag sich mancher Gast fragen, wenn er andere Anwesende beobachtet. „… so, wie der sich verhält …“
Die Geisteshaltung ergibt sich durch die Gesinnung. Nämlich: Wie zeige und ‚gebe ich mich‘ anderen gegenüber? Wie denke ich über andere? Aus der Gesinnung und der Geisteshaltung ergibt sich die Haltung des Menschen – oder etwas altmodischer ausgedrückt –, das Gehaben.
Das Gebaren, also das Gehaben ist die Art, wie eine Person auftritt, wie sie sich benimmt. Tritt ein Gast übertrieben arrogant auf, wird unter Umständen von einem hochnäsigen Gehabe gesprochen. „Fürchterlich, dieses arrogante Gehabe.“
Der Begriff ‚Habitus‘ (lat. ‚habere‘ für ‚haben‘, ‚Gehaben‘), obwohl selten gebraucht, ist ein relativ wichtiger Begriff im Bereich der Gastrosophie. Auch wenn er aus dem sprachlichen Gedächtnis vieler verblasst oder verschwindet, drückt er doch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das zwischenmenschliche Miteinander aus.
Frei übersetzt bedeutet Habitus das Gebaren, die Haltung, das Erscheinungsbild eines Menschen. Habitus demonstriert die Art, wie der Mensch denkt, wie er sein Leben führt, wie er seine Ziele verfolgt, wie er auftritt, sein Erscheinungsbild und natürlich auch, wie er mit anderen Anwesenden umgeht.
Im Privaten, im Beruflichen, als Gast oder Gastgeber, als Kunde oder Dienstleister.
Das Innere bestimmt das Äußere
Durch seine Prägung besitzt ein Mensch eine innere Einstellung zu allem Möglichen. Diese Einstellung tritt nach außen durch seine Erscheinung auf.
Begegnet ein Gast einem – ihm nicht bekannten – anderen, fällt beispielsweise sofort die Kleidung auf. Wirkt diese gepflegt, lässig, konservativ, farbenfroh, modern, trendig, polarisierend, auffallend, provozierend und so weiter?
Und weitere Fragen stellen sich: Passt das Outfit zum Anlass des Treffens, zur Jahreszeit und vor allem zur Person selbst? Falls ja, dann ist sie stimmig.
Die Kleidung sagt bekanntlich viel über ihren Träger aus. Rückschlüsse auf die Persönlichkeit werden automatisch gezogen. Vorurteile sind allgegenwärtig. Gegebenenfalls geht es sogar so weit, dass Vermutungen auf Vorlieben und Stärken gezogen werden. Bisher gesammelte ‚Voreingenommenheit‘ steckt den Betrachteten in eine bestimmte Charakterschublade.
Nicht nur die Kleidung passt zur Person, sondern auch Schmuck, Accessoires, Frisur, Make-up und so weiter. Dinge, die der Gast an oder mit sich trägt.
Ausstrahlung – Aura
Im nächsten Schritt mag die Bewegung des anderen Gasts auffallen. Seine Körpersprache, die Körperhaltung, seine Körpersignale geben bewusst und unbewusst Hinweise auf den emotionalen Zustand eines Menschen.
Wirkt die Person entspannt, gestresst? Geht sie flott oder bummelt sie nur? Schaut sie interessiert oder desinteressiert?
Eine Königin würde nicht zu einem Termin rennen, sollte sie sich verspätet haben. Sie wird ‚würdigen‘ Schritts zum vereinbarten Ort schreiten – eben ihrer Rolle, ihrer Stellung entsprechend. Sie bewegt sich passend zu ihrem Habitus – würdevoll.
Die französische Königin Marie-Antoinette von Österreich-Lothringen (1755 – 1793), verheiratet mit Ludwig XVI. (1754 – 1793) schritt am 16. Oktober 1793 erhobenen Hauptes aufs Schafott auf dem ‚Place de la Révolution‘.
Sie wusste, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte. Trotzdem hielt sie ihre würdevolle Haltung bei. Das Volk meinte bewundernd: „Sie sieht aus wie eine Königin.“
Im Lateinischen steht das Wort ‚aura‘ für ‚Lufthauch‘ oder für ‚Lichtglanz‘. Ein Hauch ist gerade noch wahrnehmbar.
‚Schwebt‘ ein Gast an einem anderen vorbei, ist ein Lufthauch zu spüren. Die vorbeigehende Person hat eine ‚matte‘, kaum wahrnehmbare, oder eine ‚glänzende‘ Ausstrahlung.
Demnach verbreitet eine Person eine nicht greifbare – aber trotzdem wahrnehmbare – Aura um sich, wohlgemerkt allein durch ihr Auftreten inklusive der Körperhaltung, der Kleidung, der Mimik und Ähnlichem. Sie dominiert mit ihrer Erscheinung sofort die Situation.
Andere Gäste verhalten sich dann schon fast ehrfürchtig, fast ein wenig unterwürfig. „Da passt alles.“
Der bewunderte Gast bewegt sich selbstbewusst, unbeeindruckt von anderen, und scheint keine Scheu zu haben, sich durch die Menge der Anwesenden zu bewegen. Manch einer wird deshalb neidisch. Er möchte gerne auch solch ein beeindruckendes Erscheinungsbild sein Eigen nennen.
Wer fair ist, hält sich mit einer Wertung anderer zurück. Egal, wie er sich verhält, wird er als Gast wertgeschätzt und ihm gleichartig freundlich begegnet.
Die Haltung des Gastes entscheidet mit, wie harmonisch ein Zusammentreffen anlässlich einer Einladung verläuft. Seine guten Umgangsformen helfen dabei.
Wer will, kann ‚würdig‘ auftreten. Mit Würde, so wie es Marie-Antoinette tat, obwohl sie wusste, was Schlimmes passieren würde.
Jeder kann dazu beitragen, das Zusammenkommen ‚würdevoll‘ und erinnerungswert zu gestalten.
Kapitel 2 – Sekt und Smalltalk
Der Aperitif
Ein Glas Champagner oder einen Sherry?
„Beim Bordeaux bedenkt, beim Burgunder bespricht, beim Champagner begeht man Torheiten.“
Jean Anthelme Brillat-Savarin, frz. Schriftsteller
(1755 - 1826)
Das Getränk vor dem Essen
Der Aperitif gilt als appetitanregendes Getränk, das vor dem Essen gereicht wird. Dies kann am Tisch erfolgen oder auch in einem besonderen Raum.
Der Aperitif soll trocken, fruchtig oder bitteraromatisch sowie kühl und erfrischend sein. Zu den klassischen Aperitif-Getränken zählen zum Beispiel:
Wein-Aperitifs
Martini, Cinzano, Dubonnet
Bitter-Aperitifs
Campari, Amer Picon, Cynar
Anis-Aperitifs
Pastis, Pernod, Ricard
Aber auch Mixgetränke werden gewählt.
Cocktails
Manhattan, Martini dry, White Lady, Side Car
Aperitif in einem separaten Raum
Lassen es die räumlichen Gegebenheiten zu, kann in einem Raum, der zwischen dem Hauseingang/Wohnungseingang und dem Zimmer liegen sollte, in dem das Essen gereicht wird, der Aperitif angeboten werden.
Bei sonnigen Temperaturen eignen sich auch Balkon und Terrasse.
Warten auf die Gäste
Die Gäste haben bereits die Garderobe abgelegt, wenn sie den Aperitif-Bereich betreten.
Der Aperitif wird gereicht oder der Gast bedient sich selbst. Die Zeit vor dem Essensbeginn wird genutzt, um sich gegenseitig bekanntzumachen, beziehungsweise um vorgestellt zu werden und vor allem, um auf die anderen Gäste zu warten.
Der Aperitif gibt den Gästen die Möglichkeit, sich zu ‚akklimatisieren’.
Solange der Aperitif eingenommen wird, können sich die künftigen Tischpartner kennenlernen, um dann gemeinsam zur Tafel zu gehen.
Ist kein Tischplan aufgestellt, kommen die Paare zusammen an den Tisch. Singles suchen sich vorab ihre Tischpartner, um dann ebenfalls gemeinsam zur Tafel zu gehen.
‚Mise en place’ in Geschäftsräumen
Mise en place des Aperitif-Buffets heißt die Vorbereitung des Aperitifs und die Bereitstellung der benötigten Hilfsmittel. Bei vielen Gästen kann auch ein Aperitif-Buffet aufgebaut werden.
Angenommen, Sie möchten in Ihren Räumen ein Aperitif-Buffet aufbauen lassen. Gehen Sie wie folgt vor:
Auf einen, auf festen Füßen stehenden Tisch wird ein sauberes Tischtuch gelegt oder ein Tafeltuch rund um den Tisch gespannt.
Die Seite des Tisches, die beim Betreten des Raumes gesehen wird, kann ‚bespannt’ (Skirting) werden. Ein besonderes Tuch wird mit Nadeln so angeheftet, dass es kunstvolle Falten wirft (siehe bei Buffetbespannung).
Auf dem Buffet stehen
Zutaten und Hilfsmittel wie zum Beispiel:
Sherry, trocken
Bitter, wie Campari
(Orangen-)Saft, frisch gepresst
Champagner oder Sekt
eventuell Cocktails
Mocktails (Cocktails ohne Alkohol)
Dazu die nötigen Gläser und Materialien wie zum Beispiel:
Sherrygläser
Longdrinkgläser
Sektgläser
Champagnerschalen oder Sektkelche
Glaskaraffe für Saft
kleine Tabletts
Eiswürfel im Eiswürfelbehälter
Eiszange auf Mittelteller
Weinkühler auf Mittelteller, über dem Kühler eine Handserviette
Knabbereien wie Erdnüsse, Oliven ohne Kerne, Salzgebäck in Schälchen
Oder auf kleinen Tellern:
kleine (Papier-)Servietten
Kerzenschmuck, Kerzen
Blumenschmuck
Selbstverständlich ist es möglich, nur ein ausgesuchtes Aperitif-Getränk zu reichen, wie Kir Royal, Hugo oder Sekt/Orange. Dieser Aperitif darf bereits eingeschenkt sein und wird auf Tabletts präsentiert.
Etwa fünfzehn Minuten vor dem Eintreffen der ersten Gäste soll der Aperitif-Raum fertig hergerichtet sein.
Falls geraucht werden darf
Falls im privaten Umfeld geraucht werden darf: Aus hygienischen Gründen sollten die Aschenbecher auf kleinen Tischen oder anderen Abstellmöglichkeiten im Raum verteilt sein. Dort können auch benutzte Gläser abgestellt werden. Kleine Päckchen mit Streichhölzern neben die Aschenbecher legen. Auch können Standascher im Raum aufgestellt werden.
Die Zeit, in der sich Nichtraucher in eine rauchfreie Zone flüchten mussten ist vorbei. Stattdessen wird den Rauchern ein geeigneter Raucherbereich zugewiesen.
Der Weinkühler – der Sektkühler
Sie werden zu etwa einem Drittel mit Eiswürfeln gefüllt und kurz vor Eintreffen der ersten Gäste mit einem weiteren Drittel kaltem Wasser aufgefüllt.
Die Sektflaschen werden in die Kühler gestellt und die Handserviette über den Kühler gelegt. Wenn sich die Gäste selbst bedienen sollen, können die Flaschen vorher geöffnet werden.
Flaschengrößen
1/4-Flasche (Pikkolo, Piccolo)
0,187 l
2 Gläschen
1/2-Flasche (Demi)
0,375 l
kleiner Anlass zu zweit
1/1-Flasche
1 x 1/1
0,750 l
6 bis 8 Glas
Magnum
2 x 1/1
1,5 l
wenn sein soll es sehr repräsentativ
Doppel-Magnum (Jeroboam)
4 x 1/1
3 l
Rehoboam
6 x 1/1
4,5 l
außergewöhnliche Größen für außergewöhnliche Gelegenheiten
Methusalem
8 x 1/1
6 l
Salmanasar/Salmanazar
12 x 1/1
9 l