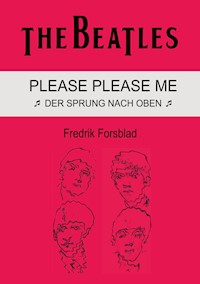Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kunst, Arbeit und Freiheit gehören zu den Grunddimensionen menschlicher Existenz; sie sind zugleich Bedingungen jener Selbstentfaltung, in der der Mensch als schöpferisches, handelndes und freies Wesen sich selbst verwirklicht, erfährt und verwandelt. Die Arbeit konzentriert sich auf folgende entscheidende Punkte: In der Kunst gibt es drei Metamorphosen: die ästhetische Kontemplation, die Schöpfungskraft und die Ekstase! Jede dieser drei geistigen Verwandlungen tragen den Künstler und die Künstlerin kurzzeitig hinaus aus dem normativen Raum der Gesellschaft und befreien ihn von den drückenden Verpflichtungen der sozio-ökonomisch-politischen Institutionen. Im zweiten Schritt wird die Welt der Arbeit untersucht. Es beginnt mit einer Analyse, wie der ökonomische Raum beschaffen ist, welche Bedeutung die Warenform, vor allem welche Macht das Geld über uns hat und wie die demokratischen Strukturen in der Arbeitswelt ausgeprägt sind. Als abschließender Punkt wird der Freiheitsbegriff behandelt, wie ihn Immanuel Kant aufgestellt hat. Wir verfolgen diesen Begriff hin zur Formulierung der Würde des Menschen. Schließlich werfen wir einen kurzen Blick auf die aktuelle politische Situation und fragen, inwieweit die Freiheit als das höchste Gut, das wir haben, Verwirklichung finden kann und wenn ja, um welche Freiheit es sich handelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. KUNST
Drei Metamorphosen
Präliminarien zur Kunstphilosophie Schopenhauers
Schopenhauers Kunstphilosophie
Nähere Betrachtung der Platonischen Idee
Hinein in die helle Kammer: künstlerische Kreativität
Musik als Vorschein des Noch-Nicht
Kunst und Gesellschaft
Kunst als uneinheitlicher Begriff
Der falsche Schein der Kunst
Die heimliche Allianz von Kunst und Kapital
In und Gegen – außen bleiben
Dritter Ausweg: Ekstase aus dem Geist der Musik
Vorh. Überlegungen zum Begriff der Ekstase
Hinein in die Ekstase
Zur Verdeutlichung der heutigen Situation:Kunst im Mittelalter
Der mittelalterliche Künstlertypus
II. ARBEIT
Historisch bedingter Bedeutungswandel der Arbeit
Die Dominanz des ökonomischen Raums
Welt als Geld und Ware
Arbeitskraft
Das Dilemma des Mehrwerts
Mögliche Einwände gegen die Mehrwerttheorie
Zum Gesetz der tendenziell fallenden Profitrate
Der Fetischcharakter der Ware
Was ist Eigentum?
Gesellschaft und Geist
Die Identität von Waren- und Denkform
Die Transformation von der Waren- zur Denkform
Erklärung des Intellekts
Geld
Implikationen des Tausch- und Geldverkehrs
Parmenides’ Begriff des Seins
Der Einfluss abstrakten Denkens …
Ein Fazit aus der Sohn-Rethelschen These
Kleiner Exkurs: Gott und Geld
Verwirklichung in der Arbeit und Risiken
Freiheit in der Arbeitswelt
Recht versus Moral
III. FREIHEIT
Ein aufgeklärtes Leben
Der methodische Weg zur transzendentalen Freiheit
Zur Kritik der kantischen Erkenntnistheorie
Zum Problem der sogenannten Willensfreiheit
Die sinnliche im Gegensatz zur intelligiblen Welt
Die Freiheit des Willens - welche?
Die moralische Freiheit, wie sie Kant versteht
Kritik am kantischen Freiheitsbegriff
Die Begründung der Moral durch Freiheit bei Kant
Der kategorische Imperativ
Zum Begriff der Würde
Der Begriff der Würde bei Kant
Kritik an der Ethik und am Begriff der Würde von Kant
Würde als Möglichkeit des Noch-Nicht
Der Begriff der Würde per legem
Das Falsche im Richtigen & das Richtige im Falschen
1. Gefährdete Grundlagen
2. Zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland
3. Grundrisse einer Parteien-Oligarchie
4. Meinungsbildung und Kontrolle
Eine Einschätzung der politischen und gesellschaftlichen Situation
Was ist richtig, was ist falsch?
Wenn das Unbehagen wächst …
Ein Plädoyer: Alle(s) für die Freiheit?
Literaturverzeichnis
Netzquellen
KUNST • ARBEIT • FREIHEIT
In das Ganze hineingelockt …
Einleitung
Ein kleiner, doch fester Punkt – so heißt es bei Archimedes von Syrakus – würde genügen, die Welt aus den Angeln zu heben. Eine Schnittstelle dieser Art, das wissen wir heute, gibt es nicht. Vielmehr erleben wir eine sich wandelnde Welt, in der sich ‚poco a poco’ normative Konturen auflösen – so sehr, dass eher diese entfesselte Schöpfung uns aus den Angeln hebt, als dass wir sie bewegen könnten.
Wie lässt sich dem schützend entgegensteuern? Wie kann man sich in seinem Dasein behaupten, wenn Werte erodieren und ökonomische, ökologische sowie politische Systeme kollabieren? Ein erfülltes, Glück bringendes Leben muss ein solches sein, in dem die innere Überzeugung und Sinngebung des Einzelnen gesellschaftlichen Widerhall findet. Je größer die Übereinstimmung zwischen subjektiven und objektiven Werten gesellschaftlicher, ökonomischer und sittlicher Art ist, desto erfüllter gestaltet sich das Leben. Der hierfür nötige Schutzraum ist uns – noch – gegeben. Unverzichtbar sind dabei die verbürgten Rechte, die einen solchen Freiheitsraum schaffen – einen Raum, den es zu nutzen gilt, der geschützt, gepflegt und, wenn nötig – wie seit dem russischen Überfall auf die Ukraine – auch verteidigt werden muss. Allerdings nicht vorrangig mit den Mitteln todbringender Waffen, die die westliche Rüstungsindustrie gewinnbringend zur Verfügung stellt, sondern maßgeblich mit den diskursiven Mitteln, die eine demokratisch gestimmte Verfassung nicht nur rechtlich, sondern ebenso moralisch gebietet. Für autonome, selbstbestimmte Wesen muss der Diskurs der einzig gangbare Weg sein – koste es, was es wolle. Das fordert die Vernunft, insofern sie sich als wahrhaft aufgeklärt versteht. Wird diese Sichtweise abgelehnt, liegt der Verdacht nahe, dass partikulare, meist monetäre, mitunter auch ideologische Interessen schwerer wiegen als die Ehrfurcht vor dem Prinzip Leben – einem Leben, in dem jedes einzelne zählt. Das darf nicht geschehen.
Die vorliegende kleine Untersuchung beginnt mit dem möglichen individuellen Rückzug in ein kreativ-künstlerisches Dasein. Die Frage, die sich dabei auftut, ist, wohin genau sich ein Individuum zurückziehen kann, wenn es sich kreativ entfaltet. Gibt es im heutigen globalen Weltgeschehen noch ein Refugium, das sich dem verpflichtenden sozial-ökonomischen Gewebe entzöge? Wenn Kunst den Anspruch vertritt, das Nicht-Identische zu sein, indem es für den Wirtschaftsbetrieb Nutzloses produziert, jedoch in gewichtigem Maße dabei transzendierend sinnstiftend verfährt, ist dies ein guter Grund, Künstler zu sein oder ein solcher zu werden. Der Widersinn dabei jedoch ist, dass die Kulturindustrie den getätigten Sinn von dem, was Kunst ist und sein kann, kommerzialisiert und den Sinn am wirtschaftlichen Erfolg festmacht. Wie verhält sich der Künstler, wenn sein Kunstobjekt zum Fetisch herabgewürdigt wird? Wie verdirbt das Geschäft den Sinn von Kunst? Gibt es für den Künstler aus diesem Dilemma einen Ausweg? Diese dialektische Klemme des „In” und „Gegen”, des Kunstschaffens in einem von der Ökonomie gesonderten Raum und der Kommerzialisierung und Herabwürdigung der Kunst zur beliebigen Ware, gilt es auszubalancieren und einen Ausweg zu finden.
In einem zweiten Schritt werden in der hierarchisch gegliederten Arbeitswelt die demokratischen Unzulänglichkeiten der derzeitig waltenden Ökonomie des Spätkapitalismus beleuchtet. Wenn man davon ausgeht, dass politisches Handeln bereits in der Basis beginnt und zugleich damit der Anspruch erhoben wird, bis in die feinsten Verästelungen des sozialen Miteinanders demokratisch zu wirken, muss man feststellen, dass das Berufsleben in vielen Bereichen von diesem Prozess ausgeschlossen ist. Noch immer weist die Arbeitswelt totalitäre Strukturen auf, die diesem Anspruch widersprechen. Zugleich offenbart sich im Bereich der Arbeit der alles überdeckende kapitalistische Geist, in dem nichts zählt außer Profit. Den arbeitenden Menschen, die vor der Industrialisierung noch eine Sinnerfüllung in der tätigenden Arbeit erfuhren, werden in der Produktion der Waren Kraft und Hoffnung geraubt und im immer weiter vorantreibenden Fortgang „Geld-Ware-noch mehr Geld” in die Entfremdung getrieben.
Das dritte Kapitel beleuchtet gesellschaftliche Strukturen, die auf der einen Seite einen Rollenzwang provozieren können, mit denen der sensible Einzelne zu kämpfen hat, doch andererseits Freiheit garantieren, die jedoch nur in Form von Abhängigkeit wachsen kann. Lässt sich dabei das eigene Selbst als letztes Ressort der rettenden Erlösung ins Auge fassen? Es wird sich zeigen, dass nur eine spezifisch innere Haltung des jeweils Einzelnen im freien Austausch mit gesellschaftlichen, ökonomischen Normen und Werten darüber entscheiden kann, ob ein integres Leben in Würde und Anstand möglich ist. Hierfür wird der Freiheitsbegriff beleuchtet, insbesondere wie Immanuel Kant diesen in seiner praktischen Philosophie ausgearbeitet hat, da allein über diesen Weg der Begriff der Würde im deutschen Grundgesetz Eingang gefunden hat. Die grundlegenden menschlichen Werte im verfassungsrechtlichen Kanon aufgenommen zu haben, heißt jedoch noch nicht, sie verwirklicht zu haben, obgleich das Streben nach der Realisierung – wobei der Kampf gegen antidemokratische Strömungen von rechts und links dazugezählt werden – eine stete Herausforderung und Aufgabe für die sich in der Verantwortung befindende Regierung bleibt. Solange dieses Streben nach dem Ideal der Würde anhält, so lange wird das gesellschaftliche Leben erträglich sein, auch wenn überall, in allen Bereichen, sich Aporien zeigen, die unüberwindbar scheinen. Die Frage bleibt bis zum Schluss des Büchleins offen: Gibt es für jeden Einzelnen einen Ausweg aus dem „Ganzen”, und wie sieht dieser aus? Die Frage zu guter Letzt: Was ist dieses Ganze, in das wir alle hineingelockt worden sind? Das Ganze ist das umgreifende Synonym für Welt mit der abschließenden Bedeutung, dass alles, was war, was ist, was sein wird, alles, was im Bereich des Wirklichen und Möglichen ist, Gegenstand einer Betrachtung sein kann. Über das Ganze lässt sich damit sagen, es ist alles und schließt nichts von sich aus. Eine weitere Bestimmung kommt dem Ganzen nicht zu, denn alles, was sich denken und sagen lässt, spielt sich innerhalb dieses Ganzen ab. Auch das Vergangene, in der Geschichte unendlich weit zurück Liegende, ist nichts anderes als dieses im Ganzen – eben zu einem anderen Zeitpunkt. Alles, was innerhalb dieses Ganzen geschieht, lässt sich beschreiben – aber das Ganze selbst nicht. Denn alles Hinausfragen über das Ganze nach einem Woher, Wozu oder Wohin bedarf eines quasi göttlichen Standpunktes außerhalb von allem, um das Ganze zu beleuchten, aber dann wäre das Ganze nicht mehr das Ganze … Käme die Welt von irgendwoher, von einem transzendenten Punkt, wäre sie nicht mehr das Ganze. Die Frage nach dem Wozu ruft einen außerweltlichen Schöpfer auf den Plan mit einem aufgegebenen Sinn, der individuelles Streben ad absurdum führen würde.
Die Frage nach einem Wohin unterstellt ein Ziel und ist genauso unsinnig wie die Frage nach einem Woher – das Ganze bleibt, egal, wie man es dreht und wendet, als Ganzes unerkennbar.
* KUNST *
Drei Metamorphosen
Gleich vorweg: Kunst hat die immanente Kraft des Zerstörens. Sei es die Emanzipierung disruptiver Künstler von deren Arbeitgebern, vornehmlich der Kirche, wie es im 19. Jahrhundert geschah, oder sei es die Zertrümmerung und Auflösung bestehender Konventionen des Kunstsystems und Normen der Kultur. Dass dies geschieht, dafür sorgt der Umstand, dass Kunst nicht nur gesellschaftliches Tun und Denken in ihrem Wirken reflektiert und abbildet, sondern sich auch in einem realen Zusammenhang mit eben dieser Gesellschaft befindet. Zum Glück ist in den westlichen liberal-demokratischen Systeme die Kunst frei.1 Verfassungsrechtlich geschützt steht Kunst mitsamt ihrem Subversionspotential in einem Spannungsfeld, in dem Repräsentation und nachhängende Kritik einhergehen. Kunst ist per se ein Abbild der Zeit, gleich wie dekorativ oder provokativ sie ausfällt. Wann immer die Gefahr besteht, dass gesellschaftlich Freiheiten eigeschränkt werden, greift Kunst warnend ein. Der bedeutendste Gegner der Kunst jedoch ist die Wirtschaft mit der allumgreifenden Verwertbarkeit und Konsumierbarkeit, gegen die sich Kunst in ihrer Produktion auflehnt, ja auflehnen muss!
Explizit soll das Ringen um die Stellung der Kunst und der unglaublichen Kraft ihrer inneren Strukturen und Möglichkeiten in der Auseinandersetzung mit äußeren Widerständen der Gesellschaft und Ökonomie aufgezeigt werden. Widerstand gegen vereinheitlichende Tendenzen des Zeitgeistes und der dominierenden Kulturindustrie sind nur ein Merkmal von Kunst. Obgleich dieser Aspekt wichtig ist, da sich Kunst besonders bewährt beim Aufdecken konstituierender Formen der Verblendung, von der jede Gesellschaft, auch die liberalste, heim-gesucht wird, herbeigeführt durch überholte Glaubensvorstellungen, Narrative und vor allem durch das giervolle Trachten nach Profit. Bei diesem Kampf geht es nicht vorrangig um künstlerische Autonomie, die sich in der Freiheit des Kunst-schaffenden finden würde, es geht auch nicht um reines Gefallen, also um eine Ästhetik des Sich zeigen Wollens, denn damit würde eine kommerzielle Anerkennung erfolgen just von der Seite, deren bestehende Verhältnisse angeprangert werden sollen. Solch ein Zuspruch muss vermieden werden.
Es geht um klarere, bessere Abgrenzungen der Kunst, mit der sich Kunst als Kunst gegenüber dem Etablierten behaupten kann. Das geschieht nicht allein durch Rückzug in das große Gegen. Das allein wäre Rebellion und Sache politischer Akteure. Wir reden vom großen Rückzug ins Innere des Künstlers, von einer dadurch entstehenden Erhabenheit, durch die drei Metamorphosen entstehen, die hier thematisch erörtert werden.
Die erste Verwandlung findet statt im Akt der sogenannten ästhetischen Kontemplation, bei dem sich das von einem Werk ergriffene Individuum geistig aufhebt. Es hört auf, es selbst zu sein. Der Begriff „ästhetische Kontemplation” ist der Kunstphilosophie Schopenhauers entwendet, der wiederum angeregt war von Kants „interesselosem Wohlgefallen”. Der Wille kommt im Prozess der ästhetischen Kontemplation zur Ruhe. Kein Trieb, keine Begierde, keine Störgeräusche des Lebens durchkreuzen das Bewusstsein. Die Welt löst sich auf, wird zum relativen Nichts: Nichts bleibt dem Künstler, außer in Losgelöstheit und Selbstvergessenheit sich mit dem ästhetischen Objekt zu identifizieren. Der Künstler ist in diesem Moment ganz kunstgeschautes Objekt, er gibt sich völlig auf, er ist schauendes Medium. Hierbei ist nun zu fragen, was das ästhetische Subjekt sein soll, und mit dieser Frage stoßen wir ab dem nächsten Kapitel tief in das metaphysische Kunst-Konstrukt Schopenhauers.
Die zweite Metamorphose ist der innere Rückzug in die Kreativität. Um sich diesem Phänomen behutsam anzunähern, könnte man diesen Rückzug als die Einkehr in einen „hellen Raum”, umschreiben, einen Raum, in dem der Künstler geistig sprüht. Es ist ein imaginärer Nicht-Ort, in dem die künstlerische Versenkung im eigenen Schaffen im Vordergrund steht, und in dem das Individuum im kreativen Prozess sich kurzzeitig in tonalen Stürmen und flirrendem innerlichen Erzittern und Ergriffenheit aufhebt. Es ist eine helle Kammer der Transzendenz, in der Neues entsteht, geschmiedet als letzter Sinn, als sinnvoller Halt, im Hier und Jetzt, wo jegliche Identitätslogik am Nichtidentischen zerschellt. Kreativität ist ein Geschenk, geschöpft aus dem eigenen Inneren. Wenn Ideen sich formen und vom Künstler Besitz ergreifen, ist die helle Kammer betreten. Und diese Kammer wird erst verlassen, wenn ein Werk vollendet ist.
Und schließlich als letzte große Metamorphose des Künstlers gibt es die Ekstase, in der man mit geschärften Sinnen eine höhere Seins-Ebene erklimmt. Schlagartig wird man von dieser Stimmung erfasst, sie kommt ohne Warnung, ähnlich einem epileptischen Anfall. Und wenn die Ekstase überkommt, versinkt alles herum wie im Rausch. Eine trunkene Nüchternheit befällt den Künstler. Alles, was in diesem Stadium fokussiert wird, tritt in übermächtiger Schärfe auf. Der Rest herum versinkt im Nebel. Die Blicke des Ekstatikers brennen Löcher in das Sein, doch nichts verbrennt. Alles herum ist klar und deutlich. Es ist der Zustand einer höheren Ahnung.
Allen drei Verwandlungen, oder besser Metamorphosen, ist gemeinsam, dass der Künstler sich in einem gehobenen Seinszustand befindet, bei der die Selbstfindung und Selbstverwirklichung garantiert sind. Bei Eintritt dieser drei Zustände entrückt das von diesen wilden Mächten erfasste Individuum in den kreativen Prozess der Versenkung, der Loslösung vom Alltäglichen, was klar gedeutet werden kann als eine Möglichkeit des großen Heraustretens aus erdrückenden Verhältnissen falschen Lebens.
Präliminarien zur Kunstphilosophie Schopenhauers
Arthur Schopenhauer wurde 1809 in Göttingen an der Georgia Augusta immatrikuliert. Zunächst für ein Semester als Student der Medizin. Jedoch zum zweiten Semester wechselte er über zur philosophischen Fakultät. Zu Hilfe kam ihm bei dem anstehenden Fakultätswechsel Gottlob Ernst Schulze, der kurz zuvor die Universität in Helmstedt verlassen hatte und einem Ruf nach Göttingen gefolgt war. Schulze war als Verfasser des „Aenesidemus”, einem Buch, in dem er skeptisch die Vernunftkritik Kants hinterfragte, zu diesem Zeitpunkt ein berühmter Mann. Der junge Schopenhauer las damals zum Einstieg in die Philosophie Schriften von Schelling. Das wusste Schulze und gab ihm den Rat, sich ausschließlich dem Studium der Schriften Platons und Kants zu widmen und sich vorderhand weder mit Aristoteles noch Spinoza zu beschäftigen, bis diese erste Aufgabe bewältigt war. Ein folgenreicher Schritt, den Schopenhauer getreu befolgte, und den er, wie er später oft bekundete, nie bereute. Schulzes Rat wird verständlich, wenn man sich die damalige Zeit vergegenwärtigt. Die große Zeit der Universität Jena, für eine kurze Spanne Zentrum des geistigen Geschehens, war abgelaufen. Die Lehrtätigkeit Fichtes endete nach dem berühmten Atheismusstreit 1799, und Schelling verließ Jena 1803. Fichte zog weiter nach Berlin und hielt dort seine berühmte Vorlesung über die „Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters”, der später seine „Reden an die deutsche Nation” folgten, mit denen er den Übergang von der Philosophie zur politischen Bedeutsamkeit vollzog. Schelling hingegen zog 1803 nach Würzburg, von dort drei Jahre später nach München. Mit den „Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit”, einem Werk, das stark beeinflusst war von Jakob Böhme, machte er noch einmal auf sich aufmerksam, bis er anschließend für mehrere Jahrzehnte verstummte. Während die Epoche für Fichte und Schelling abgelaufen war, war die große Zeit Hegels noch nicht angebrochen. Sein Werk „Phänomenologie des Geistes”, vollendet in den Tagen der Schlacht bei Jena, ging nach Erscheinen 1807 in der Öffentlichkeit völlig unter. Hegel war von 1806 bis 1808 Redakteur einer Zeitung in Bamberg und anschließend Rektor des Nürnberger Gymnasiums bis 1816. Beide Posten vermittelte ihm sein bester Freund Friedrich Immanuel Niethammer, der wie Hegel Stipendiat im Tübinger Stift war und ab 1807 das Amt des bayerischen Zentralschulrats innehatte.2 Erst ab 1818, mit der Berufung an die Universitär Berlin, begann sein gewaltiger Einfluss auf das Geistesleben in Deutschland.
In dieser geistigen Situation formte sich Schopenhauers philosophisches Verständnis. Mit den beiden Positionen Platon und Kant war die Philosophie Schopenhauers in ihren Grundzügen vorherbestimmt. Aus der von Schulze anfänglich übernommenen Skepsis gegenüber der kantischen Philosophie insbesondere gegenüber dem kantischen Ding an sich formte Schopenhauer seine eigene Denkweise heraus. Ab 1811 löste er sich geistig von Schulze und begann seine selbständige Auseinandersetzung mit den Schriften Kants. Es sollte noch Jahre dauern, bis das System der „Welt als Wille und Vorstellung” entstehen sollte. 1812 wechselte Schopenhauer über zur Universität in Berlin und hörte Vorlesungen von Fichte und Schleiermacher. Was in diesen Jahren bleibt, ist Schopenhauers Einwand gegenüber dem kantischen Ding an sich, das er wie Jacob Sigismund Beck, Gottlob Ernst Schulze, Friedrich Heinrich Jacobi und Salomon Maimon für die schwache Seite der kantischen Philosophie hielt.
Schopenhauer zaubert nach dem Ende seines Studiums eine originell idealistische Philosophie hervor, die besticht durch eine radikale Distinktion von Vorstellung und Wille, wodurch ein Riss sich auftut, der durch die ganze Welt sich zieht. Auf der einen Seite ist das Erkenntnisvermögen, ganz im Sinne Kants verstanden, mit dem man nur Erscheinung – bei Schopenhauer Vorstellung – erhält, aber nicht zum Wesen der Welt vordringen kann. Auf der anderen Seite steht ein Wille, den Schopenhauer zum alles durchdringenden Prinzip erklärt. Um diese beiden Seiten zu erklären und in Verbindung zu setzen, folgen im Hauptwerk „Die Welt als Wille und Vorstellung” in vier Büchern erstaunliche Wechsel und ein überraschendes Zusammenbringen konträrer Betrachtungsweisen. Schopenhauer operiert dabei mit Übergängen von der erkenntnistheoretischen in die physiologische und von der logischen in die psychologische Kategorie. Es gibt ein Gegen- und Ineinander, ein Verschlungen-Sein von Tatsachen der Erfahrung mit Tatsachen jenseits aller Erfahrung, wobei gerade hier Platons Einfluss deutlich wird: der Versuch, über zwei Elemente Herrschaft zu gewinnen: es ist ein Hinüber- und Herübergleiten zwischen dem Reich der Vorstellungen und dem Reich der Dinge an sich, ein Erfassen, ein In-Beziehung-Setzen und Verbinden des Getrennten, das sich zweier verschiedener Organe, zweier Sprachen bedienen muss, und das nur mühevoll mit den Worten und Begriffen unserer Sprache bewältigen werden kann, die ausschließlich dem Reich der Vorstellung angehört, da der Mensch über kein Erkenntnisorgan verfügt, das die Grenzen möglicher Erfahrung übersteigen könnte. Denn es gibt keine Worte und Begriffe, die, frei von aller Bindung an die Anschauung, unmittelbarer Ausdruck metaphysischer Einsichten sein könnten. Eigentlicher Sinn wechselt mit Deutung und Gleichnis, jedoch blitzt im Zeichen des Bekannten, erkenntnistheoretisch Fassbaren, das Unbekannte, Unfassbare auf. Wobei Schopenhauer klar ist, dass es keine erschöpfende, sondern stets eine annähernde Erkenntnis an den Willen geben kann. Jede Erkenntnis, die uns das Wesen der Welt, das eigene innere Wesen enthüllt, bleibt gebunden an das vorstellende Bewusstsein, und so bleibt das Ding an sich als Adäquat des Willens immer nur erkennbar im Verhältnis zur Erscheinung. Was nun der Wille an sich ist, vor aller Erscheinung und somit vor aller Erkenntnis, ist nicht zu beantworten. Hier ist die von Schopenhauer vorgegebene Grenze, wo diskursive Philosophie endet. Und hier, an dieser Naht zwischen Willen und Vorstellung, an diesem Grenzposten allen Erkennens, setzt Schopenhauer im dritten Buch seines Hauptwerkes „Die Welt als Wille und Vorstellung” mit der Kunst an.
Schopenhauers Kunstphilosophie
Wir dürfen nicht vergessen, dass Schopenhauer das Weltgefüge aus dem Vernunft- und Sinnlosen verstehen wollte. Um mit Nietzsche zu sprechen: „Der grundlose, erkenntnislose Wille offenbart sich, unter einen Vorstellungsapparat gebracht, als Welt.” Und dieser Wille ist es, der das Leiden in dieser Welt verursacht. Schopenhauer sieht das Leben als von einem nimmer satten und unbefriedigten Willen getrieben, der Leiden verursacht. „Alles Wollen entspringt aus Bedürfnis, also aus Mangel, also aus Leiden.”3 Der Mensch ist in seiner primären Eigenschaft als vom Willen geplagt täglich großen und kleinen Unfällen ausgesetzt, ein durch und durch hilfsbedürftiges Wesen, welches in ständiger Sorge und Furcht lebt. Hinzu kommt das Wissen um die eigene Endlichkeit sowie die reflektierende Betrachtung des Leidens und der Not des Lebens, was den Impuls erklärt, Trost zu finden und hierfür eine metaphysische Auslegung der Welt zu finden. Wäre das Leben endlos und schmerzlos, würde das von Schopenhauer gepriesene metaphysische Bedürfnis des Menschen entfallen. Jedoch dem Leiden gilt es zu entgehen, aber wie, wenn der metaphysisch erkannte Urgrund der Welt nichts anderes ist als dieser Wille und auch alles, was ist, was erkennbar ist, Objektitäten des einen Willens sind?
In den ersten zwei Büchern des ersten Bandes der „Welt als Wille und Vorstellung” legt Schopenhauer die Welt als Vorstellung und anschließend die Welt als Wille dar. Im dritten Buch endlich befasst sich Schopenhauer mit dem großen Feld der Kunst, dessen vorrangige Aufgabe es sein soll, so heißt es verheißungsvoll, sich vom Dienst des Willens zu befreien. Denn Kunst – neben der Mitleidsethik im vierten Buch – bietet die Möglichkeit, sich diesem Willen kurzzeitig zu entziehen. Der Schlüssel hierfür liegt, wie oben schon angeführt, in der Möglichkeit, sich ganz der ästhetischen Betrachtung hinzugeben, durch die man den Willen vorübergehend zum Schweigen bringen und eine Form von kontemplativer Ruhe und Erhebung erleben kann. In der ästhetischen Erfahrung tritt das Individuum aus seiner subjektiven, willensbestimmten Perspektive heraus und nimmt eine objektive Haltung gegenüber der Welt ein. Diese ermöglicht eine tiefere Einsicht in die wahre Natur der Dinge, da man sie nicht mehr nur im Kontext des persönlichen Wollens betrachtet. In diesem willenlosen Zustand erfasst man die sogenannten platonischen Ideen. Sie sind dasjenige, was den sich fortwährend ändernden Vorstellungen zugrunde liegt. Und sie garantieren das Höchstmaß an objektiver Erkenntnis. Hier macht sich der einstige Einfluss Schulzes bemerkbar, denn Schopenhauer greift zurück auf einen zentralen Begriff Platons, der zwischen der sinnlich wahrnehmbaren Welt und einer übergeordneten, metaphysischen Welt der Ideen oder Formen unterscheidet. Während die sinnlich wahrnehmbare Welt ständigem Wandel und Vergänglichkeit unterliegt, sind die Ideen ewig, unveränderlich und vollkommen. Anders formuliert: Die Ideen sind die Urbilder oder archetypischen Formen aller Dinge in der sinnlich wahrnehmbaren Welt. Jede konkrete Erscheinung oder jedes Objekt in der materiellen Welt ist nur eine unvollkommene Kopie oder Abbildung dieser perfekten und ewigen Ideen. Bedeutsam ist, dass diese Ideen laut Platon unabhängig von der sinnlichen Welt existieren. Während bei Platon die Erkenntnis der platonischen Idee nicht über die Sinneswahrnehmung, sondern ausschließlich über den Intellekt erfahrbar ist in Form einer Anamnese, liegt bei Schopenhauer eine erkenntnistheoretische Trennung vor. Die platonische Idee wird dadurch erreicht, indem das betrachtete Objekt nicht in die subjektiv gegebenen Formen Raum, Zeit und Kausalität eingegangen sind, sondern lediglich Objekt für ein Subjekt sind. Mit diesem Negieren der Verstandeskategorien überwindet der Intellekt den Willen, schaltet ihn kurzzeitig aus. Damit diese Überwindung des Willens möglich ist, muss der Intellekt überwiegen, was selten genug der Fall ist. Aber wenn der Zustand gegeben ist, tritt über die verkürzte Wahrnehmung das Erfassen der platonischen Idee ein. Bei Platon existiert die Idee unabhängig vom sinnlich wahrgenommenen Gegenstand. Aristoteles kritisierte diesen Umstand und forderte, dass die Idee als Allgemeinheit in den Einzeldingen existieren muss, wobei noch nicht entschieden ist, ob es sich bei dieser Angelegenheit um ein logisches oder ontologisches Problem handelt. Bei Schopenhauer liegt das Sachproblem klar auf der Hand. Da die Platonische Idee grundlegend Objekt für ein Subjekt ist, korrespondiert sie mit den Dingen in der Vorstellungswelt. Die Frage stellt sich jedoch, ob man diesbezüglich zwischen Idealismus und Materialismus unterscheiden muss.4 Das genetische und kognitive Verhältnis von Denken und Sein wird bei Schopenhauer nicht im Medium abstrakter Begrifflichkeit geklärt, sondern durchaus auf historisch-materialistischem Boden, beispielsweise wenn er den Menschen als praktisches Wesen definiert: denn das Ursprüngliche an ihm, der Wille, prämiert über den Intellekt. Dieser ist nur sekundär, untergeordnet, der Ladenschwengel des Willens. Hieraus ergibt sich, dass die von Schopenhauer geforderte Demarkationslinie zwischen Realem und Idealem so ausfällt, dass „die ganze anschaulich und objektiv sich darstellende Welt, mit Einschluss des eigenen Leibes eines Jeden, samt Raum und Zeit und Kausalität, als Vorstellung, dem Idealen angehört; als das Reale aber allein der Wille übrig bleibt ... Wille und Vorstellung allein sind von Grund aus verschieden, sofern sie den letzten, nicht hinterschreitbaren Gegensatz in allen Dingen der Welt ausmachen. Das vorgestellte Ding und die Vorstellung von ihm ist dasselbe, aber auch nur das vorgestellte Ding, nicht das Ding an sich selbst: dieses ist stets Wille, unter welcher Gestalt auch immer er sich in der Vorstellung darstellen mag.”5 Schopenhauer ist aus methodischen Gründen Idealist, weil nur dadurch belegt werden kann, dass die Erscheinung durch den Intellekt bedingt ist und somit die objektive Welt in Abhängigkeit von unserem Intellekt steht. Wollte man hingegen eine materialistische Denkweise voraussetzen, also ein objektiv Gegebenes als letzten Erklärungsgrund allem vorausschicken, könnte man zwar verfolgen, wie die organische Natur und auch das erkennende Subjekt hervorgehen, dabei würde man aber übersehen, dass alles, was ist, durch das erkennende Subjekt bedingt ist.
Auf der Grundlage der verschiedenartigen Objektivationen des Willens stellt Schopenhauer eine Hierarchie der Künste auf, basierend auf ihrem Vermögen, den Willen zu suspendieren und die Ideen als die ewigen Formen der Dinge zu offenbaren. Architektur und die bildenden Künste (Malerei, Skulptur) stehen dabei am unteren Ende, da sie noch stark mit der materiellen Welt verknüpft sind. Musik hingegen, die er als höchste Kunstform betrachtet, hat die einzigartige Fähigkeit, direkt den Willen selbst zu repräsentieren, ohne die Umwege über die Welt der Erscheinungen eingehen zu müssen. Damit sieht Schopenhauer die Musik als eine unmittelbare Darstellung des Willens. Sie drückt das Wesen der Welt und des menschlichen Daseins in ihrer reinsten Form aus, ohne auf konkrete Vorstellungen angewiesen zu sein. Auf diese Weise, als unmittelbarer Ausdruck des Willens, hat Musik eine besonders starke emotionale und metaphysische Wirkung auf den Menschen. Aber die Frage hierbei ist, wie Wohlgefallen und Freude an einem Gegenstand möglich sind, ohne irgend eine Beziehung desselben auf unser Wollen? Schopenhauers Antwort darauf ist, dass wir in der Schönheit der Kunst allemal die wesentlichen und ursprünglichen Gestalten der belebten und unbelebten Natur, also Platos Ideen derselben, auffassen, und dass diese Auffassung zu ihrer Bedingung ihr wesentliches Korrelat, das willensreine Subjekt des Erkennens, d.h. eine reine Intelligenz ohne Absichten und Zwecke, habe. Allgemein und zugleich populär redend kann man den Aussprach wagen: die Musik überhaupt ist die Melodie, zu der die Welt der Text ist. Wer den Zustand der ästhetischen Kontemplation erreicht und damit die Fähigkeit besitzt, die Welt auf eine besonders objektive und klare Weise zu sehen und diese Einsicht in Kunst zu überführen, verfügt über künstlerisches Genie. Der Betrachter oder Hörer des Kunstwerks hingegen kann durch das Kunstwerk des Genies eine ähnliche Erfahrung der objektiven Erkenntnis machen und so eine tiefe ästhetische Erfahrung erleben. Schopenhauer betrachtet die Kunst als einen bedeutsamen Ausweg, sich dem Leiden der Welt zu entziehen, indem sie dem Menschen ermöglicht, den Willen zu transzendieren und eine tiefe, kontemplative Ruhe zu finden.
Nähere Betrachtung der Platonischen Idee
Es ist für Schopenhauer ein empirisch nachweisbares anthropologisches Grundproblem, dass Intellekt und Wille auseinandergerissen sind. Der Mensch ist mit sich entzweit, und in dieser seiner Zerrissenheit erlebt er die Welt. Genau an dieser Nahtstelle, an diesem Riss zwischen dem Denken und dem unentwegten, rätselhaften Wollen setzt Schopenhauers Philosophie an. Nicht umsonst heißt das Hauptwerk „Welt als Wille und Vorstellung”, wobei letzteres hervorgebracht wird vom Intellekt.
Schopenhauer seziert den Willen, den er zweiteilt: zum einen entdeckt er diesen erlebbar als tief-persönliche Erfahrung im eigenen Selbst, erkannt durch die Formen unseres Intellekts. Jede Regung des Leibes ist dabei zweifach gegeben: zum einen als Bewegung des Körpers in Zeit und Raum, erkannt durch die Formen des Intellekts und somit den Gesetzen der Natur unterworfen, die in der Welt der Vorstellung herrschen und zugleich als Regung des Willens in Form eines Motivs. Motiv und Bewegung sind hierbei identisch, doch zweifach erfahrbar. Die Identität desselben. Erfahrbar im eigenen Körper durch das Bewusstsein. In einem nächsten kühnen Schritt überträgt er diese psychologische Innenschau mit dem im eigenen Selbst gefundenen Willen im analogen Verfahren auf die gesamte Natur und interpretiert den Willen dadurch als metaphysisches Prinzip der Welt. Die eigene innerste Regung wird als treibende Kraft von Welt erkannt. Was hier Schopenhauer philosophisch vollbringt, ist eine Metaphysik a posteriori, nicht gerechtfertigt durch Begriffe, sondern begründet in der Anschauung und aus der Erfahrung und somit empirisch belegbar. Mit dem Gang ins „Innere” macht Schopenhauer die große Entdeckung seines Lebens: den Willen, der sich in uns tief im Innern regt, und er erkennt in diesem Willen das kantische „Ding an sich”. Dieses von Kant aufgestellte Postulat eines Dinges an sich, das mit den Sinnesorganen und Formen des Intellektes niemals erkannt werden könne, wurde oftmals kritisiert. Schopenhauer war nun der Ansicht, dass der Wille dasjenige sei, was Kant vergeblich postuliert hatte. Jedoch, schränkt er ein, erkennen wir den Willen nicht an sich, sondern nur dasjenige, was durch die Formen des Intellekts uns gegeben ist, also einen in die Erscheinung getretenen Willen. Aber dasjenige, was vor aller Erkenntnis des Intellekts als Kraft in uns waltet, das ist das Ding an sich, der Wille an sich, der Kern der Welt, der fühlbar ist, doch erkenntnistheoretisch verschlossen bleiben muss. Schopenhauer verzichtet methodisch darauf, das Hin- und Herleiten zwischen dem Reich der Vorstellungen und dem Reich der Dinge an sich argumentativ bewältigen zu müssen. Denn für solch ein Verfahren bedürfte es für ein Erfassen zweier verschiedener Sphären auch zweier verschiedenen Sprachen, was unmöglich ist, da alle Worte und Begriffe der Sprache im Reich der Vorstellung eingeschlossen sind. Wir besitzen kein Erkenntnisorgan, das die Grenzen möglicher Erfahrung sprengen könnte. Außerhalb der Erkenntnisformen – und hier ist Schopenhauer ganz im Sinne Kants Idealist – ist der Wille Einheit, Ganzheit und ohne Kausalität auch Grundlosigkeit, doch im Individuum wird der Wille erst in den Formen Raum, Zeit und Kausalität erfasst. Um diesen Umstand zu veranschaulichen, zieht Schopenhauer eine andere Lösung vor. Er changiert bewusst zwischen der transzendental-idealistischen und physiologisch-materialistischen Perspektive, wodurch gewollt Brüche entstehen, die den Riss, der durch die Welt geht, veranschaulichen. Auf der einen Seite ist das Gehirn Erkenntnisträger, auf der anderen Seite wird es zum Erkenntnisobjekt. Das Gehirn gehört einerseits zu den Erscheinungen der Außenwelt und ist als Gehirnmasse physiologische Bedingung des Erkenntnisvermögens, durch welches die Außenwelt wiederum im Gehirn erscheint. Die Welt ist im Kopf – transzendental-idealistisch betrachtet – und der Kopf ist zugleich in der Welt als objektivierter Wille und somit Erscheinung. Beide Positionen bestehen für sich: die Welt hat von der Außenperspektive her betrachtet empirische Realität, vom Intellekt betrachtet ist sie transzendentale Idealität. Obgleich bei der physiologisch-materialistischen Sichtweise nicht vergessen werden darf, dass es stets bei der Betrachtung der Außenwelt eines Intellekts bedarf, um zu dieser Einsicht zu gelangen. Erst dann ist der verengt transzendental-idealistische Blick auf die Welt aufgebrochen. Durch den ermöglichten Perspektivwechsel erhält die Erkenntnistheorie eine aufschlussreiche Dynamik. Doch auch mit dem Perspektivwechsel ist die Frage nicht geklärt, wie man sich dem Willen als Ding an sich annähern könnte. Denn allen Bemühungen zum Trotz ist der Einblick auf den Willen vor aller Erscheinung nicht gegeben, kein Wunder, die materialistische Perspektive zeitigt ebenfalls nur Erscheinungen. Die Erkenntnis, die uns das Wesen der Welt enthüllen sollte, bleibt immer an das vorstellende Bewusstsein und damit an die nicht vermeidbaren Bedingungen des Vorgestellt-Seins gebunden. Selbst die Eindrücke und Empfindungen, die uns das Selbstbewusstsein liefert, wenn wir uns unmittelbar als wollend erfassen, liefern keine umfassende, sondern nur eine näherungsweise Erkenntnis des Dinges an sich. Eine Brücke zwischen Erscheinung und Ding an sich können wir nicht schlagen. Das ominöse Ding an sich ist immer nur im Verhältnis zur Erscheinung Ding an sich, wie auch die Erscheinung immer nur im Verhältnis zum Ding an sich Erscheinung ist. Was der Wille außerhalb der Erscheinung, außerhalb des Erkenntnisvermögens ist, überhaupt, warum er überhaupt ist und uns erscheint, muss unbeantwortet bleiben. Hier endet alle Erkenntnis.
In Schopenhauers Philosophie ist der Wille das allem zugrundeliegende – alles, was ist, ist Ausdruck dieses einen Willens, indem alles, was ist, eine Objektivität dieses Willens ist. Doch durch das erkennende Subjekt ist dieses Prinzip nur empirisch erfahrbar und auch durch das perspektivische Changieren des kognitiven Blickwinkels bleibt der Wille relativiert. So gibt es im Drehen des Betrachtungswinkels kein Erstes, kein Grundlegendes, weder ein erkennendes Subjekt, noch ein Wille, da dieser relativiert wird durch das Erkennen. Alles ist miteinander verknüpft und verwoben. Weder ist der Intellekt der Ausgangspunkt des philosophischen Systems, noch lässt sich der Wille in seiner Blindheit als Prinzip ohne Erkenntnisvermögen näher bestimmen. Alles bleibt relativistisch in der Schwebe. Aus dieser wird der Wille weiter konkretisiert.
Wichtig ist nun, wie Schopenhauer den Willen im Verhältnis zum Intellekt näher bestimmt. Metaphysisch betrachtet ist der erkenntnislose, unzerstörbare Wille als das vorherrschende Prinzip erkannt worden, und damit ist der Intellekt zwangsläufig nichts anderes als eine Funktion des Willens zum Leben. In der Regel, so führt Schopenhauer aus, ist der Intellekt des Menschen so wie das der Tiere auf die Befriedigung materieller Bedürfnisse ausgerichtet. Nahrungsaufnahme, Begattung und Sicherheit sind die natürlichen Ziele des menschlichen Erkennens. Mit diesen subjektiven, rein von persönlichen Interessen geleiteten Gebrauch zeigt sich der Intellekt ganz im Dienst des Willens. Er ist nichts anderes als ein Sklave der Notdurft. Die Tatsache, dass der Mensch in seiner Erkenntnisausstattung gegenüber der Tierwelt Vernunft besitzt und somit über abstraktes begriffliches Denken verfügt, besagt nur, dass der Mensch kraft des erweiterten Umfangs seines Intellektes in der Lage ist, noch gezielter seine natürlichen Bedürfnisse zu befriedigen.
Ist Schopenhauers Akt der ästhetischen Anschauung Teil eines Zirkels, bei dem zu fragen ist, ob er der Natur geschuldet und real bestehend ist oder einer falschen Denkweise entspringt? Dieser ästhetische Akt soll nämlich bewirken, dass das verbindende Band von Wille und Intellekt auseinanderreißt. Allerdings entspringt der Intellekt einer Gehirnmasse, die genauso objektivierter Wille ist, wie das, von dem er getrennt werden sollte. Wie löst man also den Willen vom Willen, lautet demnach die Frage!
Die Welt ist objektivierter Wille, der erkannt wird. Nichts anderes. Jedoch ist auch die Erkenntnis ebenso eine Objektität des Willens, allerdings auf einer höheren Stufe, entstanden als ein kognitives Mittel zur Erreichung komplizierterer Zwecke, nämlich für die Erfüllung eintretender Motive. Hier greift Schopenhauer weit der Evolutionstheorie voraus. Hier denkt er offen dynamisch-geschichtlich.
Das entwickelte Gehirn objektiviert sich wie jede andere zeitliche Form des Willens durch körperliche Zellen, also durch Nerven, Blut und Gehirn entsteht Denken. (Jede Synapse zündet den Willen, und der Wille zündet die Synapsen.) Wenn das Denken also Ausdruck des manifestierten Willens ist, so folgert Schopenhauer, steht die Erkenntnis, da sie dem Willen ursprünglich entspringt, und daher nichts anderes ist als dieser Wille, diesem zu treuen Diensten. Denken gehorcht dem Willen und somit gehorcht der Wille in einer höheren Potenz sich selbst. Wie sollte sich das Denken diesem Dienst entziehen können? Und von was würde sich Denken entziehen?
Der Intellekt mit seinen apriorischen Formen Raum, Zeit und Kausalität – Schopenhauers verkürzte Darstellung der aristotelisch-kantischen Kategorienlehre – ist der bedingende Ausgang und Ursprung der allgemeinen Gesetzmäßigkeit, die im durchgehenden Kausalnexus der Natur ihren Ausdruck findet. Insofern ist Schopenhauer der kantischen Erkenntnistheorie treu geblieben, dass das erkennende Subjekt mit seinen Formen konstituierend der Natur gegenübersteht. Alle sinnlich wahrgenommenen Gegenstände stehen gemäß dem „Satz vom Grunde” in einem Kausalnexus von Ursache und Wirkung, „vermöge welcher nichts für sich Bestehendes und Unabhängiges, auch nichts Einzelnes, Abgerissenes Objekt für uns sein kann.” (Vierfache Wurzel, §16, S. 27) Eine Erkenntnis des An-sich der Welt wird durch die Vorstellung gemäß dem Satz vom Grunde nicht gewonnen. Die apriorischen Formen der subjektiven Erkenntnis bedingen die angeschauten Dinge nur als Erscheinung. Sie geben nur den formalen, aber nicht realen Hinweis auf das Objekt. Aber gerade der reale Hinweis auf das Objekt ist bei der ästhetischen Betrachtung von grundlegender Bedeutung. Die formale Seite der Objekte hingegen ist dasjenige, was dem Willen gemäß von Interesse ist. Dasjenige, was in der Zeit, an einem bestimmten Ort, unter den jeweiligen Umständen, aus nachvollziehbaren Ursachen, mit entsprechender Wirkung ist, wird vom Individuum erkannt und regt den Willen an. Höbe man alle Relationen des Objektes auf, würde das Objekt verschwinden.
Das eigentlich Wirkliche oder vielmehr der adäquate Repräsentant des eigentlich Wirklichen ist nun die „Platonische Idee”. Sie ist die adäquate Objektivität des Willens. Während die Erscheinungen aufgrund des Satzes vom Grunde einer zufälligen, flüchtigen Form unterliegen, wofür die Form der Zeit verantwortlich ist, kommt der „Idee” bleibende, wahre Bedeutung zu. Die subjektiven Anschauungsformen des Individuums vermitteln den Eindruck der Vielheit, des Wechsels und des Entstehens und Vergehens. Diese Erkenntnisformen bilden das letzte Prinzip aller Endlichkeit.- Die „Idee” hingegen ist weder vielfältig, noch kommt ihr Veränderung geschweige Entstehung oder Vergänglichkeit zu. Die „Idee” bleibt davon unberührt, da der Satz vom Grunde auf die Erkenntnis der „Idee” nicht anwendbar ist. Obwohl die Formen des Satzes vom Grunde in der ästhetischen Anschauung aufgehoben werden, muss ein letzter Erkenntnisrest übrigbleiben: die Form des Objekt-Seins für ein Subjekt. Alle anderen Formen der Erkenntnis hingegen sind aufgehoben. Es ist, laut Schopenhauer, die „erste und allgemeinste Form aller Erscheinung, d. i. Vorstellung.” (WI, S. 206) In diesem Zusammenhang greift Schopenhauer auf Platon und Kant zurück, um an deren Formen der „Platonischen Idee” und des „Dinges an sich” den eigenen Standpunkt herauszuarbeiten. Die „Platonische Idee” als das Korrelat der ästhetischen Anschauung ist Vorstellung in ihrer ersten und allgemeinsten Form. Damit ist die Idee ein Objekt und als Vorstellung anschaulich erkennbar. Kants „Ding an sich”, das Schopenhauer dem Willen gleichsetzt, ist hingegen nicht in der Vorstellung objektiviert (Obgleich bereits der Begriff „Ding” Anschauungsformen impliziert), ist nicht Objekt für ein Subjekt, und somit von der „Platonischen Idee” unterschieden.
Wie geht nun dieser Akt von sich? Es ist eine Frage der Balance zwischen Wille und Intellekt. Obgleich Gehirn und Denken Objektitäten des Willens sind, hat die Erkenntnis, wenn sie stark genug ist, die Kraft, sich von dem zu lösen, was es im Grunde ist und erkennt: Wille. Schopenhauer hat diesen Akt, wie überhaupt seine gesamte Metaphysik aus der eigenen Erfahrung geschöpft. Jeder, der sich in ein Kunstwerk vertieft hat, kann diesen Prozess nachvollziehen. Wenn der Blick sich auf das Kunstobjekt richtet, alles andere herum allmählich ausblendet, sich selbst dabei vergisst, ganz dieses Objekt ist und nichts mehr anderes ist. Es ist der Übergang, wie Schopenhauer sagt, von der gemeinen Erkenntnis, die nur einzelne Dinge auffasst, zur höheren Erkenntnis, in der man sich „verliert”. Erblickt man die zeitlose „Platonische Idee”, erblickt das erkennende Subjekt einen adäquaten Repräsentanten des Willens. Das reine, schmerzlose Subjekt des Erkennens wird augensonnenhaft, ist kein Individuum mehr, kennt kein Wollen und keinen Schmerz mehr, wird Selbsterkenntnis des Willens. Subjekt und Objekt sind nicht mehr zu unterscheiden, in der anschaulich erfassten Idee sind sie beide aufgehoben und eins. Der Wille erkennt sich selbst und dadurch bekommt man in bestimmter Weise einen tieferen Blick in die Welt. In der kontemplativen Betrachtung von Kunstwerken oder der Natur wird eine distanzierte Perspektive zu sich selbst eingenommen, und die platonischen Ideen werden als die Essenz der Dinge erfasst. Es scheint eine Paradoxie zu ein, dass beim Eintritt der ästhetischen Anschauung der Wille ganz aus dem Bewusstsein verschwindet. Aber das muss geschehen, weil in der Betrachtung des Willens die Regungen des eigenen, individuellen Willens ausgelöscht sind. „Reines Subjekt des Erkennens werden, heißt, sich selbst loswerden: weil aber dies die Menschen meistens nicht können, sind sie zur rein objektiven Auffassung der Dinge, welche die Begabung des Künstlers ausmacht, in der Regel, unfähig.” (P II, §205, S. 443)
Die ästhetische Erfahrung ist eine Form der temporären Erlösung von den Leiden des Lebens, verursacht durch den unerbittlichen Drang des Willens.
Die platonischen Ideen bei Schopenhauer sind keine metaphysisch unabhängigen Entitäten wie bei Platon, sondern durch gesteigerte Erkenntnis Ausdrucksformen des allumfassenden Willens. Sie bieten eine Möglichkeit, die tiefere Realität hinter der Welt der Erscheinungen zu erkennen.
Die ästhetische Anschauung funktioniert, weil nach Schopenhauers Lehre der Widerstreit allen Seins in der Möglichkeit der Vielheit beruht, die wiederum durch das Erkenntnisvermögen des Menschen wie auch des Tieres gegeben ist. Die Platonische Idee nun ist der Grenzposten der „Vereinzelung” des Willens, sie ist nicht dieser Wille, doch eine adäquate Idee davon, da sie eingetreten ist in die Form des Objekt-Seins, hingegen der Wille vor allen Formen des Erkennens nicht vorstellbar ist. Zumindest ist die veranschaulichte Idee dem Willen adäquat, das bedeutet, wer die Idee Kraft des gesteigerten Intellekts erfasst, ist dem Wesen der Welt deutlich näher gerückt, dem alltäglichen Sein hingegen entrückt. Mit der Abkehr von der Vielheit der Erscheinungen sind auch die eigenen Befindlichkeiten ausgelöscht und somit sind Wünsche, Ängste, Begierden nicht mehr vorhanden – es existiert die reine Erkenntnis in Form der angeschauten Idee, das abstrakte Vermögen ist dabei nicht im Spiel. Das Versenken spielt ausschließlich in der Anschauung statt. Mit dem Negieren des „principium individuationis” als die alltägliche Wahrnehmung in Zeit und Raum und der dadurch ermöglichten Vielheit und Veränderung, bleibt nur die angeschaute Einheit, die repräsentativ die Natur widerspiegelt: beginnend bei der unbelebten Materie mit der Idee der Schwere, aufsteigend zur organischen Materie, repräsentiert in der Idee der Kristallisation, fortfahrend im Tierreich mit dem Eintreten in das Reich der Reize und schließlich gipfelnd beim Menschen, in dem der Wille sich mit den anschaulich-abstrakten Erkenntnismöglichkeiten ein Licht gezündet hat, aber nicht zum Behuf des abusiven sich selbst Erkennens, sondern allein, um den Motiven des Willens besser gerecht zu werden. Die Möglichkeit des sich Versenkens ist gegeben, sie ist empirisch nachweisbar. Man muss nun nicht der Philosophie Schopenhauers exakt folgen, um das große Potenzial dieser geistigen Handlung zu erkennen. Versenkung ist das Betreten eines Raumes, in dem nicht nur der Wille schweigt, sondern auch alle gesellschaftlichen Verstrickungen und Verblendungen entfallen. Hier ist der Künstler bei sich, losgelöst von allem und ganz allein.
Hinein in die helle Kammer: künstlerische Kreativität
Kreativität ist die Fähigkeit, aus dem Nichts – gottesgleich – etwas Neues und Originelles zu erschaffen. Sie ist eine fundamentale geistige Kraft, durch die Wirklichkeit geprägt und geformt wird. Denn sie besitzt die ungeheure Eigenschaft, Neues in die Welt zu setzen – Kraft des Geistes. Und so verändert sich Welt, verändern sich die Werte in ihr, verändert sich aller Sinn. Was wäre die Welt ohne Kreativität?
Schon Platon beschäftigte sich mit dem Phänomen des geistigen Schöpfens und erkannte seine ungeheure Bedeutung – allerdings fehlte im griechischen Kulturraum der Begriff der Kreativität, der erst später Einzug fand in der lateinischen Sprache. So findet man in der Vulgata und auch in den vorhandenen Fragmenten der Vetus Latina (beide viertes Jahrhundert) erste Hinweise auf den Begriff Kreativität. In der Übersetzung der Genesis des Alten Testaments heißt es: „In principio creavit Deus caelum et terram”6, womit zum Ausdruck gebracht wird, dass es ein intelligentes Wesen gewesen sein muss, welches die Welt erschaffen hat. Das Wort creare/schöpfen kommt dem zufolge nur einem göttlichen Wesen zu, dass in der Lage ist, aus dem Nichts etwas zu schaffen. Ex nihilo creatio! Eine voraussetzungslose Schöpfung, die aus dem Meontischen kommt.
Platon verwendete für die künstlerische Tätigkeit des Menschen den Begriff der poiesis. Und auch bei ihm gilt: Der Mensch ist nicht in der Lage, wie ein Gott aus dem Nichts zu schaffen. Künstlerische Arbeit, sei es ein Bild, ein Text, eine Skulptur etc. alles Geschaffene ist nur eine Nachahmung der Natur. Eine Imitation des Gegebenen. Denn nur das vom Demiurgen Geschaffene kann vom Künstler erkannt, nachgeahmt und materiell bearbeitet werden. Der Künstler kann lediglich mit dem Geschaffenen umgehen. Doch Platon unterscheidet zwischen menschlicher und göttlicher poiesis. Während der Demiurg die Urbilder und Ideen schafft, nach deren Gesetzen und Regeln die materielle Welt sich als Abbild verhält, kann der künstlerisch begabte Mensch Kraft seines Geistes die Urbilder erkennen, aber nur inadäquat wiedergeben. Allerdings anerkennt Plato eine göttliche Kraft, die den künstlerischen Menschen überkommt: es ist der Zustand des Rausches, in dem der Mensch Großes zu schaffen vermag: „Nun aber werden die größten aller Güter uns durch den Rausch zuteil, wenn er als göttliches Geschenk verliehen wird… der aus Gott stammende Rausch (ist) edler als die von Menschen stammende Besonnenheit.” 7 Wenn also der Künstler in die geistige Nähe Gottes rückt, das Geschenk des Rausches empfängt, wird er beseelt von Kräften, die die Urbilder deutlicher werden lassen. Im Enthusiasmus (der Besessenheit von Gott) und der Mania (der manischen Begeisterung) wird der Künstler vom Göttlichen ergriffen, wird Kunst mehr als bloße Nachahmung, da sie nunmehr teilnimmt an den wesenhaften Urbildern der Welt. Nicht umsonst hat sich auch unser heutiger Sprachgebrauch an die Tatsache angelehnt, dass Ideen jemandem „zukommen” (mir kommt da eine Idee, ich bin auf einen Gedanken gestoßen etc.), als dass Ideen aus dem Inneren selbst strömen.
Für den graecophilen Alt-Philologen Friedrich Nietzsche gibt es zwei Arten, kreativ zu sein: Zum einen gibt es das Apollinische, das für Ordnung, Maß, Harmonie, Klarheit und die Welt der Formen und Begrenzungen steht. Es ist das Prinzip des Traumbildes, das die chaotische Wirklichkeit in eine fassbare und verständliche Form gießt. Apollinische Kunst, insbesondere die dorischen Säulen, die Tempel, Plastik und die epische Dichtung, schafft eine ideale Welt der Schönheit, die den Menschen von der chaotischen, zerstörerischen Realität distanziert. Zum anderen gibt es als Gegenpol das Dionysische, das das Rauschhafte, Ekstatische und Maßlose verkörpert. Es repräsentiert das Chaos, die Auflösung der Individuation und das Einswerden mit dem universellen Lebensstrom. In der Musik und ehemals im Kult der Dionysos-Dithyramben zeigt sich diese Dimension als ekstatische Erfahrung, in der die Grenzen der Individuation aufgehoben werden. Es sind zwei grundlegend verschiedene, aber dennoch untrennbare Prinzipien, die, wenn sie im Kunstwerk sich vereinen, die Realität umfassend abbilden, die für Nietzsche zerrissen und widersprüchlich ist – genau aus diesem Grund stehen die beiden Prinzipien Apollinisch und Dionysisch in einem