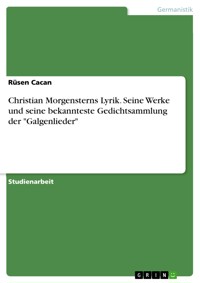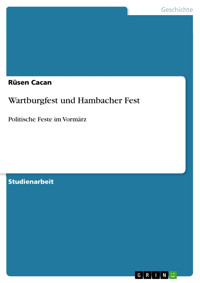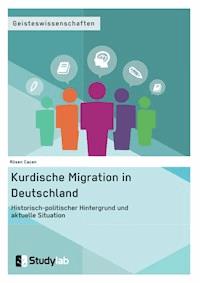
Kurdische Migration in Deutschland. Historisch-politischer Hintergrund und aktuelle Situation E-Book
Rüsen Cacan
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die kurdische Frage rückte in den 90er Jahren durch den zweiten Golfkrieg, den Krieg zwischen der kurdischen Widerstandsbewegung und dem türkischen Militär in der Türkei sowie durch die vehementen Proteste von Angehörigen der kurdischen Minderheit in der Bundesrepublik Deutschland in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses. Diese Arbeit geht der Frage nach, wie sich die Tatsache auswirkt, dass kurdische Einwanderer im Unterschied zu vergleichbar großen Migrantengruppen nicht über die institutionalisierte Lobby eines Herkunftsstaates verfügen. In meiner Arbeit werden die sozioökonomischen und politischen Hintergründe von Kurden betreffenden Fragen nachgegangen. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei dem türkisch-kurdischen Konflikt in der Türkei, bei den Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit kurdischen Demonstrationen in der Bundesrepublik sowie der grundsätzlichen Frage des Umgangs mit Minderheiten in erster Linie um ein Problem handelt, das politisch zu lösen wäre. Umgekehrt gehen aber politische Interpretationen der kurdischen Frage und gesellschaftliche Diskurse über Kurden in die pädagogische Theorie und Praxis ein. Um dem auf die Spur zu kommen, ist ein interdisziplinärer Ansatz notwendig, der übergeordnete Zusammenhänge mit einbezieht. Es ist notwendig, auf den historisch-politischen Hintergrund der kurdischen Frage, wie sie sich in der Türkei, im Irak, Iran und in Syrien stellt, einzugehen sowie die Interessen zu hinterfragen, die den Entscheidungen der deutschen Politik in Bezug auf die kurdische Frage zugrunde liegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Vorwort
In meiner Arbeit werde ich die historisch-politischen Hintergründe der kurdischen Frage in den vier Herkunftsstaaten (Türkei, Iran, Irak und Syrien) der kurdischen Migranten darstellen, so dass man die Möglichkeit hat, die Geschichte kurdischer Zuwanderung nachzuvollziehen und die Situation der kurdischen Migranten einzuordnen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1. Einführung in die kurdische Geschichte
1.1 Ethnogenese
1.2 Geographische Lage
1.3 Geschichtlicher Überblick
1.4 Die Kurdische Sprache
1.5 Religionen
1.6 Soziale Strukturen
1.7 Demographische Entwicklungen
1.8 Die wirtschaftliche Lage
2. Die Situation der Kurden in den Herkunftsländern
2.1 Türkei
2.2 Iran
2.3 Irak
2.4 Syrien
2.5 UdSSR
3. Flucht aus Kurdistan
3.1 Konflikten zwischen Religionen
3.2 Wirtschaftliche Gründe
3.3 Politische Verfolgung
4. Migration
4.1 Definition
4.2 Kurdische Migranten in Deutschland
4.2.1 Kurdische Arbeitsmigranten
4.2.2 Kurdische Flüchtlinge
4.3 Aufenthaltsgesetze
4.4 Asylrechte
5. Allgemeine soziale Situation der Kurden in Deutschland
5.1 Lebensbedingungen der Kurden in Deutschland
5.2 Sozial und kulturelle Rechte
5.3 Politische Rechte
5.4 Die kurdische Frauen
5.5 Kurdische Organisationen
5.6 Die Bildungssituation der Migranten in Deutschland
5.7 Förderung der Muttersprache
5.8 Kurdische Medien
6. Der Bezug Deutschlands zur Kurdenfrage
6.1 Die Beziehung zwischen Deutschland und Türkei
6.2 Einfluss der türkischen Regierung gegenüber Kurden in Deutschland
7. Selbstwahrnehmungen von Kurden
7.1 Bewusstsein der Kurden in Deutschland
7.2 Differenzierungen unter kurdischen Migranten
7.3 Politische Differenzierungen zwischen kurdischen Migranten
8. Integration
8.1 Integrationspolitik
8.2 Integration und Diskriminierung
8.3 Integration und Kurdenspezifische Migrationspolitik
9. Resümee
Einleitung
Die kurdische Frage rückte in den 90er Jahren durch den zweiten Golfkrieg, den Krieg zwischen der kurdischen Widerstandsbewegung und dem türkischen Militär in der Türkei sowie durch die vehementen Proteste von Angehörigen der kurdischen Minderheit in der Bundesrepublik Deutschland in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses. Diese Arbeit geht der Frage nach, wie sich die Tatsache auswirkt, dass kurdische Einwanderer im Unterschied zu vergleichbar großen Migrantengruppen nicht über die institutionalisierte Lobby eines Herkunftsstaates verfügen.
In meiner Arbeit werden die sozioökonomischen und politischen Hintergründe von Kurden betreffenden Fragen nachgegangen. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei dem türkisch-kurdischen Konflikt in der Türkei, bei den Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit kurdischen Demonstrationen in der Bundesrepublik sowie der grundsätzlichen Frage des Umgangs mit Minderheiten in erster Linie um ein Problem handelt, das politisch zu lösen wäre. Umgekehrt gehen aber politische Interpretationen der kurdischen Frage und gesellschaftliche Diskurse über Kurden in die pädagogische Theorie und Praxis ein. Um dem auf die Spur zu kommen, ist ein interdisziplinärer Ansatz notwendig, der übergeordnete Zusammenhänge mit einbezieht. Es ist notwendig, auf den historisch-politischen Hintergrund der kurdischen Frage, wie sie sich in der Türkei, im Irak, Iran und in Syrien stellt, einzugehen sowie die Interessen zu hinterfragen, die den Entscheidungen der deutschen Politik in Bezug auf die kurdische Frage zugrunde liegen.
Im Laufe der Geschichte wurde der Name Kurdistan im unterschiedlichen geografischen und politischen Sinn verwendet und bezeichnete dabei jeweils Gebiete unterschiedlicher Lage und Ausdehnung. Der Begriff „Kurdistan“ entstand erstmals im elften Jahrhundert, ohne geographisch eingegrenzt zu werden. Die Kurden wurden durch die staatlichen Grenzen zuerst in zwei Teile zwischen Perser und Osmanen geteilt. Im Vertrag von Lausanne (24. Juli 1923) wurden die neuen Machtverhältnisse zwischen der Türkei und den Besatzungsmächten Vereinigtes Königreich, Frankreich und Italien festgesetzt sowie vertraglich niedergeschrieben. Das Siedlungsgebiet der Kurden befand sich von da an in vier Staaten, nämlich der Türkei, im Iran, Irak sowie in Syrien. Diese Grenzen jedoch definierten keineswegs Barrieren innerhalb des kurdischen Volkes.
Die Kurden leben meistens in der Türkei, im Irak, im Iran, in Syrien und in der Ex-Sowjetunion. Dabei gibt es nur wenige Zugeständnisse von offizieller Seite, wie die fehlende amtlich anerkannte Sprache und Schrift. Oft werden sie durch eine strikte und unnachgiebige Assimilierungspolitik schon in ihrer Heimat „zu Fremden“ gemacht. Sie leben im eigenen Land unter mangelhaften Versorgungsbedingungen in den Bereichen Kultur, Sprache, Bildung, Gesundheit sowie unter allgemein sehr eingeschränkten wirtschaftlichen Bedingungen, bis hin zur tiefsten Armut. Die Entwicklung der kurdischen Potentiale wird in den kurdischen Landsteilen durch die politischen Bedingungen unterdrückt, bzw. schon deren Entstehung verhindert.
In Deutschland ist die Frage nach der Integration als Bedarf der rechtlichen und demokratischen Klärung der Ausländersituation entstanden. Nach fast 50-jähriger Immigration leben inzwischen etwa eine Million Kurden in Europa. Sie sind als Arbeitsimmigranten aus der Türkei, dem Iran, Irak und aus Syrien, Armenien und Aserbaidschan gekommen oder mussten ihre Heimat als Flüchtlinge verlassen. Seit kurdische Gastarbeiter mit ihren Familien nach Deutschland gekommen sind, gibt es eine Frage nach deren Lebensbedingungen und Integration. Das Thema der kurdischen Integration in Deutschland bedarf einer Aufstellung von weiteren Daten und Fakten über ihre Lebenssituation, einer Darstellung über Deutsche sowie des kurdischen Integrationsprozesses in seiner chronologischen Reihenfolge. Dabei sind auch Faktoren wie die Einflüsse politischer Ideen und Kräfte zu berücksichtigen.
Nach der rechtlichen Situation lassen sich die kurdischen Migranten in der Bundesrepublik wie folgt einteilen: in Arbeitsmigranten, Flüchtlinge sowie Asylbewerber und Asylberechtigte. Kurden werden in Deutschland vorwiegend als Türken, Araber, und Iraner definiert, obwohl sie privat an der Pflege kurdischer Traditionen und Sprache festhalten.
Oft werden Kurden in den deutschen Medien mit Unterdrückung, Verfolgung oder Vernichtung und anderen Meldungen in Zusammenhang gebracht. Dabei geht es meistens um Themen wie Krieg, Demonstrationen, Ehrenmord oder PKK-Verbot.
Ein ethisch motiviertes Handeln in den Medienberichten über Kurden ist somit kaum zu erkennen.
Minderheiten wurden in der deutschen Geschichte in der Regel immer dann zur Kenntnis genommen, wenn befürchtet wurde, dass sie zu einem Problem werden könnten. Auch die Wahrnehmung kurdischer Migranten steht in dieser Tradition. Von der bundesdeutschen Öffentlichkeit werden sie vor allem als Störfaktor empfunden. Vorherrschend ist die Sichtweise, ein Konflikt zwischen Kurden und Türken sei in die Bundesrepublik „importiert“ worden. Die kurdische Frage, wie sie sich in der Bundesrepublik stellt, ist aber kein Konfliktimport. Aus politisch-ideologischen Gründen verweigert die Politik die Anerkennung der Tatsache, dass die Bundesrepublik ein Einwanderungsland ist und zollt deswegen der offiziellen Kulturideologie der Herkunftsländer weit mehr Anerkennung, als dem nationalen bzw. ethnischen Selbstverständnis der Zugewanderten. Aus außenpolitischen Machtinteressen nimmt die Bundesrepublik Rücksicht auf die Forderungen der offiziellen türkischen Politik. Demgegenüber hatte die deutsche Regierung nie Probleme, Maßnahmen zu treffen, die im Widerspruch zur offiziellen Politik des früheren Jugoslawiens standen, wie die frühzeitige Anerkennung kroatischer Institutionen zeigt. Im Gegensatz zu anderen Minderheiten, die in der deutschen Geschichte immer wieder für außenpolitische Interessen funktionalisiert wurden, steht die kurdische Minderheit deutschen, politischen Interessen aber im Weg.
1. Einführung in die kurdische Geschichte
Die Herkunft der Kurden liegt im vorgeschichtlichen Dunkeln, weil die meisten Informationen über die Kurden vor dem Mittelalter, genauer; vor der Annahme des Islams und der damit einsetzenden Erwähnung in muslimischen Quellen, bruchstückhaft und umstritten sind. Vermutlich sind die Vorfahren der Kurden um die Wende vom zweiten zum ersten Jahrhundert v. Chr. im Zuge von Einwanderungswellen indogermanischer Arier nach West-Iran gekommen (vgl. Strohmeier/Yalcin-Heckmann 2000, 25f). Diese Region, Mesopotamien, war die Wiege der menschlichen Zivilisation. In unterem Teil lebten u.a die Babylonier, Assyrern, Sumerer, Akader. In oberen Teil Kartuner, Meder, Urartäer und andere Völker. Von den Zivilisationen dieser Völker sind viele Fragmente zurückgeblieben. Aber von den damaligen Völkern leben heute nur noch wenige darunter Kurden, Armenier und eine kleine Minderheit von Assyrer (vgl. Demirkol 1997, 9).
1.1 Ethnogenese
Es gibt keinem der Länder, in denen Kurden leben, verlässliche Schätzungen über ihre Zahl. Hierfür gibt es eine Reihe von Gründen. Einer ist der jeweiligen Regierungspolitik zu suchen: Die betroffenen Regierungen spezifizieren die verschiedenen linguistischem und religiösen Gruppen innerhalb ihrer Grenzen aus Gründen der nationalen Integration gewöhnlich nicht oder sind, wenn sie es tun, sehr zurückhaltend mit der Veröffentlichung der Ergebnisse. Ein anderer Grund ist, dass es vom politischen und sozialen Kontext abhängt, ob sich eine Person als Kurde bezeichnet oder nicht (vgl. Bruinessen 1997, 186).
Unter den Kurden finden wir einen Kern, dessen ethnische Identität unzweideutig kurdisch ist und der umgeben ist von einer fließenden Masse mit verschiedenen Graden von „Kurdischheit“, Menschen, die außer kurdisch auch noch etwas anderes sind und die ihre kurdische Identität betonen können oder auch nicht (vgl. Bruinessen 1997, 187). Nach Erhard gelten diejenigen als Kurden, die sich zum ersten als solche identifizieren und die zum zweiten von anderen Volksgruppen und Kurden als Angehörige des kurdischen Volkes anerkannt werden. Über diese Zugehörigkeit aufgrund der eigenen Identifikation und der Anerkennung von außen hinaus, gibt es einige weitere identitätsstiftende Merkmale, welche jedoch nicht auf alle Kurden angewendet werden können. Hierzu gehören Sprache, Religion, Abstammung und auch das verbreitete Zusammengehörigkeitsgefühl (vgl. Dogan u.a. 2008, 7).
Die Kurden sind nicht Türken und Araber. Der Narrativ, Kurden als Türken darzustellen, lässt sich auf die rigide kemalistische Praxis zurückführen. Kurden stellen neben Arabern und Türken eines der größten Völker im Nahen Osten. Mit Blick auf die Geschichte dieses alten Volks ist zu bemerken, dass sich Kurden in ihrer Geschichte immer im Einflussbereich verschiedener, sich abwechselnder Großreiche befanden. Typischerweise ist jedoch nicht ganz klar, ab wann man von den Kurden sprechen kann. Assyrische und sumerische Schriften aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. belegen die Existenz eines „Qurti“-Volks, das im nördlichen Zagros-Gebirge (im heutigen Iran) gelebt haben soll (vgl. Yildiz 1992, 5). Auf den beiden sumerischen Steinschwellen wird das Land „Kardaka“, das nordöstlich von Mesopotamien liegen soll (vgl. Senol 1992, 28).
Das Wort Kurde wurde schon in der Antike von Xenophon verwendet. Aber über ihre Herkunft gibt es wenige Informationen. Es wird angenommen, dass die Kurden von Meder oder Skythen abstammen (vgl. Demirkol 1997, 9). Der griechische Historiker Xenophon berichtet in seinem wohlbekannten Werk „Anabasis“ über die Vorfälle der griechischen Soldaten, nördlich von Mesopotamien beim „Rückzug der Zehntausend“ in den Jahren 401-400 v. Chr., mit einer Volksgruppe namens „Karduch“ (vgl. Senol 1992, 28). Die Mythologie von Newroz wurde vor dieser Zeit überliefert. Das kurdische Newroz-Fest lässt sich auf das Jahr 612 v. Chr. zurückverfolgen, dem gleichen Jahr in dem das Medische Reich errichtet wurde: „Nach einer alten kurdischen Legende befreite der Schmied Kawa am 21 März 612 v. Chr. die Völker des Mittleren Ostens aus der Tyrannei des Fürsten Dahak. Seitdem wird der 21. März […] als Symbol für Befreiung, Widerstand und Freiheit gefeiert. Dieser Tag wird Newroz genannt und heißt ‚ neuer Tag“ (Yildiz 1994, 6).
Die Kurden sind eines der ältesten Völker der Erde. Dennoch sind sie, bei einer Gesamtpopulation von geschätzten 30 - 40 Millionen Menschen bis heute das zahlenmäßig größte Volk der Erde ohne eigenen Staat. Die Bezeichnung Kurdistan findet zum ersten Mal nach der Auflösung des Groß- Seldschukenreiches gegen Ende des 11. Jahrhunderts Erwähnung (vgl. Dogan u.a. 2008, 6). Zum ersten Mal stießen die Kurden mit den Türken zusammen. Die Seldschuken drangen aus Zentralasien nach Anatolien vor. Mit der siegreichen Schlacht von Manziker im Jahr 1071 gegen das byzantinische Reich wurden die kurdischen Gebiete dem Seldschukenreich einverleibt (vgl. Yildiz 1994, 7). Unter dem langjährigen Herrscher Sultan Sanschar (1118-1157) entstand im Staat Chorsan (Ost-Persien) eine Provinz mit dem Namen Kurdistan, was soviel bedeutete wie Land der Kurden. Im Osmanischen Reich gab es gleichfalls eine Provinz mit Namen Kurdistan (vgl. Strohmeier/Yalcin-Heckmann 2000, 20). Im heutigen Sprachgebrauch wird der Begriff Kurdistan offiziell nur noch für die Provinz Sanandaj im Iran verwendet (vgl. Dogan u.a. 2008, 6).
1.2 Geographische Lage
Eine allgemein akzeptierte geographische Definition Kurdistans gibt es nicht. Das ist nicht überraschend, weil mit dem Begriff ganz verschiedene Vorstellungen verbunden werden. Kurdische Nationalisten verwenden ihn mit Nachdruck, während die Staaten, auf deren Territorien Kurdistan liegt, ihn leugnen oder ignorieren. Kurdistan ist auf der einen Seite (z.B. in der Türkei) ein verpöntes zuweilen auch verbotenes Wort, auf der anderen Seite ein politischer Kampfbegriff, der das Ziel eines beträchtlichen Teils der Kurden benennt (vgl. Strohmeier/Yalcin-Heckmann 2000, 20).
Es gibt heute kein exaktes geographisches Territorium Kurdistan und es ist auch nicht fixiert, und so lässt sich Kurdistan auch nicht genau in festgelegten Grenzen definieren. Je nachdem, auf welches internationale Abkommen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts man sich bezieht, können die kurdischen Gebiete ganz unterschiedliche Ausmaße annehmen. Die Kurden selbst sind sozusagen ein Volk ohne einen Staat. Die meisten Kurden leben in einem zusammenhängenden Siedlungsgebiet, das weite Teile der Türkei, des Iran, des Irak und Syrien umfasst. Weder existierende noch antizipierte Nationalstaaten weisen ethnische Homogenität auf (vgl. Amman 2001, 64).
In der Literatur tauchte die Bezeichnung „Kurdistan“ erstmals im elften Jahrhundert auf. Geographisch gesehen ist Kurdistan eine ausgedehnte Gebirgslandschaft in Vorderasien und wird heute auf sechs verschiedene Staaten verteilt, nämlich Irak, Iran, Aserbaidschan, Armenien, Türkei und Syrien. Eine von allen Völkern der Region akzeptierte einheitliche Karte Kurdistan gibt es nicht (vgl. Ibrahim 1983, 109). Die gesamte Fläche Kurdistans beträgt über 500.000 qkm, davon liegen in Ost-Kurdistan 175.000 qkm, in Süd-Kurdistan 75.000 qkm, in Süd-West-Kurdistan 15.000 qkm und in Nord-West Kurdistan 235.000 qkm (vgl. Kizilhan 1995, 17).
Abbildung 1: Kurdische Siedlungsgebiete (Quelle: NAVEND - Zentrum für Kurdische Studien e.V., Bonn, 2013a)
Im Norden bilden Erzurum, Kars und der Urmiye See die Grenze von Kurdistans; die östliche Grenze verläuft vom Urmiye See aus entlang den Zagros-Ketten bis zum Persischen Golf; „im Süden verläuft die Grenze vom Persischen Golf bis hin zum westlichen Teil der Zagros-Ketten, vorbei am alten Babylon und an Bagdad, weiter östlich des Tigris und dann stromaufwärts auch westlich von diesem. Dann folgt das von Suleymania, Mossul und Kirkuk umschlossene Gebiet und in einer westwärts gerichteten Linie der nordöstliche Teil Syriens von Aleppo bis Iskenderum; westlich von Iskenderum verläuft dann die Grenze über Maras, Malatya, Sivas, Erzincan und Dersim bis nach Erzurum. Das ist das Land, auf dem die Kurden gelebt haben und leben (vgl. Kizilhan 1995, 17f).
1.3 Geschichtlicher Überblick
Im Altertum kämpften die Kurden gegen alle Könige Assyriens. Sie schlossen sich später den Chaldäern an, eroberten mit ihnen 612 v. Chr. Ninive und gründeten das Medische Reich. Im Jahr 550 v. Chr. wurde das Medische Reich durch Achämeniden zerstört. Danach begann die Zeit der verschiedenen Herrschaften über Kurdistan (vgl. Kizilhan 1995, 19).
Mit dem Aufbruch des Islams nach Norden versuchten die Araber im Jahr 637 erst die Kurden zu unterwerfen und zu islamisieren. Dass die Kurden gegen Araber einen großen Widerstand leisteten, konnten die Araber erst im 8. Jahrhundert sie zwangsislamisieren (vgl. Demirkol 1997, 9). Bis zu diesem Zeitpunkt waren fast alle Kurden von ihrer Religion her Angehörige Zarathustras, der iranischer, kurdischer Prophet und der 600 v. Chr. lebte (vgl. Kizilhan 1995, 19).
Im 11 Jahrhundert mussten sich die Kurden gegen die Byzantiner und die Seldschuken wehren, da Byzantiner nach Osten drängten und die Seldschuken von Zentralasien nach Westen marschierten (vgl. Kizilhan 1995, 20). Nach dem Sieg der Seldschuken gegen Byzantiner im Jahr 1071 geriet Kurdistan nach und nach unter die Herrschaft der Seldschuken. Im 13. und 14. Jahrhundert herrschten die Mongolen in Kurdistan. Dann kamen die türkischen Stämme (Akkoyunlu und Karakoyunlu) aus Mittelasien nach Anatolien. Ihre Herrschaft dauerte bis zum Überfall der Osmanen im Jahre 1514 (vgl. Demirkol, 1997, 9).
Im späten Mittelalter konnten die Kurden unter wechselnden Dynastien ihre Eigenständigkeit wahren. Sie hatten innerhalb des osmanischen Reiches zahlreiche Fürstentümer und erlebten in dieser Zeit eine bedeutende Blütezeit. Bis Ende des 17. Jahrhunderts wurde diese Zeit von Kurden als kurdische Renaissance in materieller und kultureller Hinsicht bezeichnet (vgl. Kizilhan 1995, 20).
Im Jahr 1689 wurde Kurdistan erstmals mit dem Vertrag von Qasr-i Shirin, der einen jahrhundertlangen Frieden in der Region zufolge hatte, zwischen dem persischen und dem osmanischen Reich aufgeteilt (vgl. Özdemir 2006, 29). Diese Frieden Vertrag wurde von Kurden die „Erste kurdische Teilung“ genant (vgl. Deschner 2003, 11). Dies war auch zugleich die erste große Teilung des kurdischen Volkes als Sunniten und Schiiten, deren Überwindung immer noch ein großes Problem darstellt. Der schiitische und alevitische Glaube wird hier gleichgesetzt und wird in ihre Unterschiede hier nicht eingegangen (vgl. Demirkol 1997, 10). „Die verschiedenen Fürstentümer verhandelten mit den Türken und Persern und konnten so ihre Selbständigkeit bewahren, mussten aber als Gegenleistung Soldaten für die Heere dieser Großmächte bereithalten. In dieser Zeit fällt der Höhepunkt der kurdischen Literatur und Kultur“ (Kizilhan 1995, 20).
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts begann die Neidergang des Osmanischen Reiches und verlor seinen Einfluss über die kurdische Region. Vom Jahr 1876 an häuften sich die kurdischen Revolten gegen das osmanischen Reich (1879-80, 1886-89, 1923) Dieser Aufstände wurden von den Osmanen grausam unterdrückt (vgl. Kizilhan 1995, 21). Nachdem französische Revolution entwickelt sich eine panislamische bzw. pantürkische Bewegungen im Osmanischen Reich. Auch die Kurden entdeckten ihre ethnische Identität und somit ihr Nationalbewusstsein. Nach dem 1. Weltkrieg legten die Alliierten im Vertrag von Sèvres im Jahr 1920 die Aufsplitterung des geschlagenen Osmanischen Reichs fest und stellten den Kurden eine autonome Region mit Potential zum Staat in Aussicht. Unter der Führung Mustafa Kemals erwirkte die türkische Nationalbewegung durch den Unabhängigkeitskrieg einen neuen Vertrag. den Vertrag von Lausanne. der im Jahr 1923 unterzeichnet wurde Dieser Vertrag sprach große Teile des geplanten Kurdistans der kommenden Republik Türkei zu und wurde die Gründung eines kurdischen Staates nicht mehr vorgesehen (vgl. McDowall 1996, 137f). „Der Lausanner Vertrag berücksichtigte die ethnischen, wirtschaftlichen und historischen Gegebenheiten nicht. Er teilte das kurdische Volk in vier Teile auf“ (Kizilhan 1995, 21).
Die vereinbarten Vorgaben im Vertrag von Lausanne wurden durch den türkischen Nationalstaat nicht eingehalten. Die Kurden wurden Bergtürken genant und ihre distinkte kulturelle Existenz geleugnet. Die Ortsnamen, in dem die Kurden Leben wurden in ihrem Gebiet türkisiert (vgl. Ammann 2001, 79). Viele Kurden setzten sich gegen nationalistische Politik Mustafa Kemals wider und übten Aufstände (1925, 1929, 1937). Reaktionen der türkischen Regierung waren extrem repressiv und wurde im Laufe der Jahre die kurdische Sprache und Kultur gänzlich verboten und führten sie auch Zwangsumsiedlungen durch (vgl. Özdemir 2006, 73). Als bewiesen gilt zudem, dass im Rahmen dieser Assimilationsbestrebungen der türkischen Regierung der Gebrauch kurdischer Sprachen verboten und die Umsiedlung (auf Grundlage des Deportationsgesetzes vom 14. Juni 1930) von Teilen der kurdischen Bevölkerung in den Westen der Türkei angeordnet wurde. Im Anschluss an die Niederschlagung der lokalen Aufstände herrschte von 1938 bis 1960 in den kurdischen Provinzen der Türkei nahezu ununterbrochen Ausnahmezustand (Brieden 1996, 52).
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Irak vom Osmanischen Reich abgespalten und bis 1932 stand unter britischer Verwaltung. Die Idee eines kurdischen Staates wurde aus strategischen Gründen abgelehnt (vgl. McDowall 1996, 168). Ähnlich wie auch Mustafa Kemal verfolgte der Iran unter Reza Schah zu dieser Zeit die Politik einer ,,Iranisierung" der Bevölkerung und zielte auch im Namen einer Zentralisierung des Staates auf die Auflösung der Stammesstrukturen ab. So waren die Kurden im größten Teil ihres Siedlungsgebietes (mit Ausnahme des syrischen) massiver Unterdrückung ausgesetzt und ein kurdischer Staat lag in weiter Ferne. Im Jahre 1946 jedoch wurde unter dem Schutz der Sowjets in Mahabad (kurdische Stadt im Westiran) die gleichnamige kurdische Republik ins Leben gerufen. Die Existenz des ersten und bisher auch einzigen kurdischen Staats war allerdings nicht von langer Dauer, da die sowjetische Besatzungsmacht auf Druck der Amerikaner wieder abzog und die Region vom Iran nach nur elf Monaten zurückerobert werden konnte (vgl. McDowall 1996, 222f).
Es ist zu sehen, dass das gesamte 19. Jahrhundert von kurdischen Aufständen geprägt war. Diese Aufstände erfolgten bereits ein kurdisch-nationalistisches Motiv und wurden oft blutig niedergeschlagen. Die bis heute erhaltene Vierteilung Kurdistans wurde im Vertrag von Lausanne festgelegt, der zwischen den Alliierten und den Türken unter Ausschluss kurdischer Vertreter am 27.07.1923 geschlossen wurde (vgl. Özdemir 2006, 73). Seit dem Inkrafttreten dieses Vertrages sind Kurden auf dem Papier, also in ihren Pässen und allen anderen offiziellen Dokumenten Türken, Syrer, Iraker oder Iraner (vgl. Kizilhan 1995, 20f).
Über die Staatsgrenzen, die sich durch das kurdische Gebiet ziehen, schreibt Deschner (2003, 14): „Die Grenzen, die Kurdistan teilen, sind weder natürliche, wirtschaftliche noch kulturelle Grenzen. Es sind künstliche Grenzen, die gegen den Willen des kurdischen Volkes nach den Interessen der Teilungsmächte und eines von den Westmächten definierten, Gleichgewichts‘ gezogen wurden. Sie haben ganze Landschaften, ja Städte und Dörfer, ganze Stämme und sogar Sippen und Familien voneinander getrennt.“
1.4 Die Kurdische Sprache
Die Sprache ist die wichtigste kurdische Identifikation. Dieser Umstand bleibt unberührt von der Tatsache, dass nicht alle, die Kurden sind, auch die kurdische Sprache beherrschen. Kurdisch wird den westiranischen Sprachen zugerechnet, die zur indoeuropäischen Sprachfamilie gehören (vgl. Ammann 2001, 69). Die Kurden sehen ihre kulturellen Wurzeln in den iranischen und indischen Hochkulturen der vergangenen Jahrtausende. Es gibt heute keine standardisierte einheitliche kurdische Sprache. Die kurdische Sprache unterteilt sich in mehrere Dialekte und Mundarten, die stark voneinander abweichen und daher wechselseitig nur schwer verständlich sind und ist nirgendwo Hauptsprache des jeweiligen Nationalstaates. Zu den Dialekten zählt man für gewöhnlich Kurmandschi, Sorani, Zazaki und Gorani. Diese Differenzierungen und die fehlende politische Einheit unter den Kurden haben dazu beitragen, dass die Kommunikation unter ihnen beeinträchtigt ist (Strohmeier/Yalcin-Heckmann 2000, 31; Kizilhan 1995, 19).