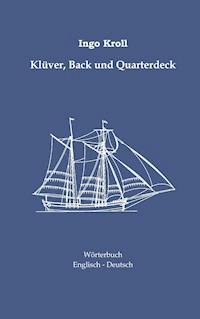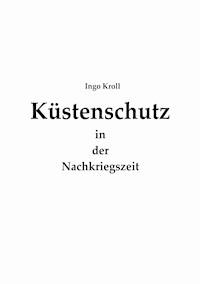
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1971 verstaatlichte als das Land Schleswig- Holstein die Landesschutzdeiche. Den Schutz vor den Sturmfluten der Nordsee übernahm von nun an „der Staat“, die anonyme Bürokratie. Den Menschen an der Westküste Schleswig- Holsteins, die über Jahrhunderte hinweg den Schutz selbst gestaltet und als ihn ihr ureigenstes Recht betrachtet hatten, wurde diese Aufgabe genommen. Warum aber fanden sich die Betroffenen mit der Schmälerung ihrer Rechte so klaglos ab? Dieser Frage geht der Autor nach. Er skizziert dazu zunächst die organisatorische und finanzielle Entwicklung des Deichwesens der schleswig- holsteinischen Nordseeküste bis zum Jahr 1971. Dann zeichnet er den Prozeß der Verstaatlichung der Landesschutzdeiche 1970/71 in den politischen Gremien nach. Insbesondere versucht er dabei die Motive der Politiker in der Landesregierung und im Landtag sowie die Haltung der Verbandsfunktionäre und der Bevölkerung zu den Absichten des Gesetzgebers aufzuzeigen. Außerdem werden die Gerüchte, welche im Zusammenhang mit der Verstaatlichung der Deich aufkamen, auf ihre Plausibilität geprüft und bewertet. Die Arbeit beschreibt die politische Lösung einer Frage, die man heute völlig anders beantworten würde. Die damalige Entscheidung ist deshalb auch bezeichnend für den Zeitgeist zu Beginn der 70er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
… de Floth, de keem un wöhl en Graff …
Danksagung
Allen Mitarbeitern in Behörden und Verbänden, in Archiven und Bibliotheken, die mich bei meinen Recherchen unterstützten, danke ich ganz herzlich. Ich habe bei allen Dienststellen immer ein offenes Ohr für mein Anliegen gefunden und wichtige Anregungen und Hinweise erhalten.
Besonderer Dank gilt meinen Gesprächspartnern. Von ihnen bekam ich nicht allein wichtige Informationen, sondern auch eine Reihe nutzbringender Unterlagen sowie wertvolle Ratschläge zur Weiterarbeit.
Ich danke auch all jenen, die sich der Mühe unterzogen, die Arbeit zu lesen und die dabei halfen, Fehler zu korrigieren.
Ohne die Hilfsbereitschaft und die Mithilfe jedes einzelnen wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen.
Ganz besonders jedoch danke ich meiner Frau, die meine Arbeit mit viel Geduld und Verständnis begleitet hat.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Ziel der Arbeit
Zur Sprachregelung in dieser Arbeit:
Quellenkritik
Organisation des Küstenschutzes bis 1945
Von den Anfängen bis zur Wasserverbandverordnung (WVVO)
Die Wasserverbandsgesetzgebung von 1937
Die Neustrukturierung der Verbände bis zum Kriegsende
Der Küstenschutz nach 1945
Die Wassergesetzgebung
Die Wassergesetzgebung des Bundes
Die Reform der Wasserverbandsgesetzgebung
Das Landeswassergesetz
Neuaufbau und Konsolidierung
Organisation
Neuaufbau 1945 – 1962
Die Nachkriegssturmfluten und ihre Folgen
Der Generalplan „Küstenschutz“ 1963
Entwässerungsmaßnahmen 1945 - 1973
Finanzierung
Aufbringung der Mittel
Finanzierung des Generalplans Küstenschutz
Haushaltsführung der Verbände
Rahmenbedingungen
Überwindung der Not und Wiederaufbau
Strukturwandel
Zwischenbilanz
Die 2. Änderung des Wassergesetzes 1970/71
Allgemeines
Das parlamentarische Verfahren
Die Verbände
Die Öffentlichkeit
Wertungen
Regierung und Parlament
Verbände und Öffentlichkeit
Gerüchte
Wahlbeeinflussung
Entmachtung der Deichgrafen
Fazit
Zwischenbilanz
Nach der Verabschiedung des 2.ÄndG-LWG
Zusammenfassung
Anhang
Quellen und Darstellungen
Ungedruckte Quellen
Gedruckte Quellen
Verzeichnis der Fachausdrücke
Texte und Tabellen
Zeittafel Küstenschutz
Der „Spade- Landbrief“ von 1559
Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Zeittafel der parlamentarischen Behandlung des 2.ÄndG-LWG
Die Marschenbauämter an der Westküste Schleswig-Holsteins
Anzahl der Wasser-, Boden- und Zweckverbände 1954
Die Deich- und Hauptsielverbände
an der Westküste Schleswig-Holsteins
Deich- und Sielverbände Nordfriesland, Eiderstedts und Dithmarschens
Deiche an der Westküste Schleswig-Holsteins
Namen und Bedeichungsjahre der Köge
Haushaltsblätter
Preise, Löhne und Monatseinkommen 1949 1972
Organigramme und Graphiken
Index
Endnoten
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Die Deich- und Hauptsielverbände 1942
Tabelle 2 Die Deich- und Hauptsielverbände sowie Deichverbände 1945
Tabelle 3 Schäden an Küstenschutzanlagen 1945
Tabelle 4 Beispiele für die Einnahmen und Ausgaben ausgewählter DHSV 1946/1947
Tabelle 5 Übersicht über die Geldmittel für die Arbeiten des Marschenbauamts Husum 1949/1950
Tabelle 6 Herkunft der Mittel
Tabelle 7 Verteilung der Mittel auf die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen
Tabelle 8 Bundes- und Landesmittel für den Küstenschutz 1948 - 1971
Tabelle 9 Vermögen und Schulden ausgewählter DHSV’e zwischen 1950 und 1970
Tabelle 10 Vermögen und Schulden ausgewählter DHSV’e zwischen 1971 und 1973
Tabelle 11 Vermögen und Schulden des DHSV Norder dithmarschen am Schluß des Rechnungsjahres 1970
Tabelle 12 Einnahmen und Ausgaben ausgewählter DHSV’e zwischen 1950 und 1973
Tabelle 13 Erwerbsbevölkerung nach Wirtschaftssektoren in Schleswig-Holstein 1950 und 1970
Tabelle 14 Erwerbsbevölkerung nach Wirtschaftssektoren in den Westküstenkreisen 1950 und 1970
Tabelle 15 Landwirtschaftliche Betriebe in Schleswig-Holstein 1949 und 1971
Tabelle 16 Landwirtschaftliche Betriebe in Nordfriesland 1949 und 1971
Tabelle 17 Landwirtschaftliche Betriebe in Dithmarschen 1949 und 1971
Tabelle 18 Bruttoinlandsprodukt in Schleswig-Holstein, Nordfriesland und Dithmarschen 1961 und 1970 nach zusammengefaßten Wirtschaftsbereichen
Tabelle 19 Urlaubsreisen von Bürgern der Bundesrepublik Deutschland 1950 - 1972
Tabelle 20 Übernachtungen in Schleswig-Holstein, Nordfriesland und Dithmarschen 1950, 1960 und 1971 nach ausgewählten Bereichen/Orten
Tabelle 21 Besitz im Haushalt
Tabelle 22 Die wichtigste Änderungen zum Deichrecht mit der 2. Änderung des LWG
Tabelle 23 Beiträge für Hochwasserschutz und Entwässerung 1960 - 1972
Tabelle 24 Betriebssteuern bäuerlicher Betriebe 1962 - 1973
Tabelle 25 Zuständigkeiten bei Deichbau, Deicherhaltung und Gewässerunterunterhaltung vor und nach 1971
Tabelle 26 Deichlänge und Deichbesitz an der Westküste Schleswig-Holsteins 1963 und 1977
Tabelle 27 Haushaltsblätter des DHSV Norderdithmarschen 1941 bis 1973
Tabelle 28 Haushaltsblätter des DHSV Südwesthörn-Bongsiel 958 - 1973
Tabelle 29 Haushaltsblätter des DSV Mittelberg/Föhr 1960 - 1973
Tabelle 30 Preise und Löhne 1949 - 1972
Tabelle 31 Netto- Monatseinkommen 1951 - 1972
Verzeichnis der Graphiken
Graphik 1 Schema der Beitragsverteilung
Graphik 2 Schema: Einnahmen der Verbände
Graphik 3 Schema: Ausgaben der Verbände
Graphik 4 Vermögen und Schulden DHSV Norder dithmarschen 1947 - 1970
Graphik 5 Schulden ausgewählter DHSV’e zwischen 1950 und 1973
Graphik 6 Schema der Verbandsfinanzierung
Graphik 7 Finanzmittel der Verbände
Graphik 8 Wahlergebnisse Westküste - Kiel 1967 -1976 im Vergleich
Graphik 9 Direktmandate bei den Wahlen in Schleswig-Holstein 1965 -1976
Graphik 10 Deich- und Hauptsielverbände an der Westküste Schleswig-Holsteins vor Inkrafttreten der WVVO
Graphik 11 Deich- und Hauptsielverbände an der Westküste Schleswig-Holsteins nach Inkrafttreten der WVVO
Graphik 12 Deich- und Hauptsielverbände an der Westküste Schleswig-Holsteins nach Inkrafttreten der WVVO
Graphik 13 Deich- und Hauptsielverbände an der Westküste Schleswig-Holsteins heute
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Alt- Nordstrand vor 1634 und der Küstenverlauf am Ende des 19. Jahrhunderts
Abb. 2 Titelblatt. Allgemeines Deichreglement 1803
Abb. 3 Deichschau 1949 auf Eiderstedt
Abb. 4 Bestimmung der „Maßgebenden Sturmflutwasserstände“
Abb. 5 Maßgebende Sturmflutwasserstände an der Westküste bis 1963
Verzeichnis der Organigramme
Organigramm 1 Deich-, Wasserbau- und Wasserwirtschaftsverwaltung 1921 - 1935
Organigramm 2 Deich-, Wasserbau- und Wasserwirtschaftsverwaltung 1936 - 1939
Organigramm 3 Deich-, Wasserbau- und Wasserwirtschaftsverwaltung 1939 - 1945
Organigramm 4 Deich-, Wasserbau- und Wasserwirtschaftsverwaltung 1945 - 1976
Organigramm 5 Organisationsplan des schleswigholsteinischen Landesamtes für Wasserwirtschaft 1966
Organigramm 6 Organisationsplan Wasserwirtschafts verwaltung des Landes Schleswig-Holstein 1966
Verzeichnis der Abkürzungen
ABM..................Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
1.ÄndG-LWG .. Gesetz zur 1. Änderung des Landeswassergesetzes
2.ÄndG-LWG .. Gesetz zur 2. Änderung des Landeswassergesetzes
ADR ..................Allgemeines Deich-Reglement
ALR...................Amt für ländliche Räume
ALW..................Amt für Land- und Wasserwirtschaft
AusfBest ...........Ausführungsbestimmung(en)
BGB ...................Bürgerliches Gesetzbuch
BHE...................Bund der Heimatvetriebenen und Entrechteten
BMELF..............Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
BMVt.................Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigte
BVerfG..............Bundesverfassungsgericht
BVerwG............Bundesverwaltungsgericht
DB......................Deichband
DGO..................Deutsche Gemeindeordnung
DHSV................Deich- und Hauptsielverband
Drs.....................Drucksache
DSV ...................Deich- und Sielverband
DV .....................Deichverband
DVO ..................Durchführungsverordnung
GG .....................Grundgesetz
GgemA .............Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“
Kdr ....................Kommandeur
LF ......................Landfläche
LV der LkV ......Landesverband der Landeskulturverbände
LWG.................Wassergesetz des Landes Schleswig-Holstein (Landeswassergesetz)
LwRMBl ...........Ministerialblatt für Landwirtschaft, Reichsministerialblatt der Landwirtschaftlichen Verwaltung
MBA..................Marschenbauamt
MELF ................Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Schleswig-Holstein
MRLLT .............Ministerium für ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein
MThw ...............Mittleres Tidehochwasser
NN (+/-) ............Normal Null
SHL ...................Schleswig-Holsteinischer Landtag
SpLR .................Spadelandrecht
SV ......................Sielverband
Vfg.....................Verfügung
VO .....................Verordnung
WAF..................Wertschaffende Arbeitslosenfürsorge
WG13 ................Preußisches Wassergesetz von 1913
WHG.................Wasserhaushaltsgesetz
WVG .................Wasser-Verband-Gesetz
WVVO ..............Wasserverbandverordnung
WWA................Wasserwirtschaftsamt
Vorwort zum Taschenbuch
Der Text des Taschenbuches ist der Nachdruck der 2006 im TECTUM-Verlag, Marburg erschienenen Dissertation. Es wird hier also der Zustand 2004/2005 dokumentiert.
Folgende Änderungen wurden in dieser Ausgabe vorgenommen:
– Das Büchlein ist auf DIN A5 verkleinert.
– Die Schriftgröße ist dementsprechend angepaßt.
– Im Index wurde 1 Begriff hinzugefügt.
– Eine Tabelle wurde hinzugefügt
– Offensichtliche Fehler wurden korrigiert.
– Fußnoten wurden in Endnoten umgewandelt (Lesbarkeit!)
– Tabellen wurden geändert
– Tabellen, Graphiken, Abbildungen und Absätze wurden umgestellt.
– Die Schriftgröße in den sog. „Haushaltsblättern“ ist gegenüber dem übrigen Text verkleinert.
Im Taschenbuch werden auch die Seiten in Farbe dargeboten, die 2006 nur schwarz/weiß abgedruckt wurden.
Kiel, im Herbst 2015
Einleitung
In Rungholt auf Nordstrand wohnten weiland
reiche Leute; sie bauten große Deiche und
wenn sie einmal darauf standen, sprachen sie:
„Trutz nu, blanke Hans!“
So beginnt die Sage über den Untergang der Stadt Rungholt. 1 Der Stadt haben der Reichtum ihrer Bewohner und ihre großen Deiche nichts genutzt. Das Meer war stärker, die Flut holte sich die Stadt. So berichtet die Überlieferung vom uralten Kampf der Küstenbewohner mit dem Meer, der stets den Keim des Unwägbaren in sich trägt - und den das Meer sich bis heute bewahrt hat.
Der Kampf mit der Flut zwang die Bewohner der Marschen bereits in frühester Zeit, sich zusammenzuschließen. So entstanden die Deichgenossenschaften, freiwillige Verbindungen, Notgemeinschaften der Küstenbewohner. Trotz der vielfältigen Versuche der Obrigkeit, Einfluß auf die Gemeinschaften zu gewinnen, blieb das genossenschaftliche Prinzip über die Jahrhunderte hinweg im Kern unangetastet. Erst im 20. Jahrhundert änderte sich dies grundlegend. Zunächst kamen 1937 die Verbände völlig unter staatliche Aufsicht, und dann überführte 1971 die Schleswig-Holsteinische Landesregierung die Landesschutzdeiche komplett in das Eigentum der öffentlichen Hand. Die Deichverbände, und damit die Betroffenen, wurden aus der Verantwortung für den Deichbau und die Deichunterhaltung der Landesschutzdeiche entlassen. Damit wurde das Genossenschaftsprinzip beim Deichwesen im Kern beseitigt.
Ziel der Arbeit
Das Hauptanliegen dieser Arbeit ist es, zu klären, warum das Land die Landesschutzdeiche komplett in Besitz nahm und warum es dem Gesetzgeber des Landes Schleswig-Holstein im Jahre 1971 gelang, in kürzester Zeit und ohne größere Konflikte mit den Betroffenen deren jahrhundertealte genossenschaftlichen Rechte zurückzudrängen und durch das neue staatliche Recht zu ersetzen. Dazu wird speziell der Frage nachzugehen sein, welche Motive die Handelnden hatten, um diese Änderung einzuleiten und durchzuführen, und aus welchen Motiven heraus die Betroffenen diese Änderungen ohne größeren Protest hinnahmen.
Meine Untersuchungen begrenze ich dabei auf die Bereiche Nordfriesland, Eiderstedt und Dithmarschen, weil dies Gebiet fast in seiner gesamten Ausdehnung nur im Schutz der Deiche bewohnbar ist. Die dort lebenden Menschen waren schon seit je her im Wortsinne „auf Gedeih und Verderb“ auf einen wirksamen Küstenschutz angewiesen und hatten eine besondere emotionale Bindung zu „ihren Deichen“ entwickelt. Jede Veränderung im Küstenschutz wirkt dort direkt auf die Menschen und die Landschaft ein und ist in ihrer Auswirkung am unmittelbarsten zu beobachten und nachzuvollziehen.
Der Aufbau der Arbeit entspricht der Fragestellung. Zunächst wird die Entwicklung des Deichrechts in den Marschlanden Schleswig-Holsteins bis zur Wassergesetzgebung von 1937 skizziert. Da die Wassergesetzgebung von 1937 und ihre Folgen für die Deich- und Sielverbände außerordentlich einschneidend waren, ist es unerläßlich, diesen Teil ausführlicher zu behandeln. In der Folge werden dann die Verhältnisse im Küstenschutz an der Westküste Schleswig-Holsteins bis zur Änderung des Wassergesetzes 1971 dargestellt. Die Darstellung ist so angelegt, daß zunächst die gesetzgeberischen und planerischen Aktivitäten der Regierung und des Parlaments beschrieben werden. Sodann wird dargelegt, wie die Verbände und die Wasserwirtschaftsverwaltung nach dem Kriege ihre Aufgaben erfüllten.
Dabei wird auf das Problem der Finanzierung der Küstenschutzmaßnahmen und der Verteilung der finanziellen Lasten ausführlicher eingegangen. Aufgrund der Komplexität der Materie werden die finanziellen Neuordnungen sowie die direkten Folgen aus der 2. Änderung LWG in diesem Abschnitt mit behandelt werden. Der zeitliche Schwerpunkt des Kapitels liegt dennoch auf dem Zeitraum zwischen dem Jahr 1937 (Erlaß der WVVO) und dem Jahr 1971 (2. Änderung LWG).
In einem kurzen Abriß werden dann die „Rahmenbedingungen“ behandelt, innerhalb derer die Wasserwirtschaftsverwaltung und die Verbände nach 1945 arbeiteten. Das waren einmal die politische Entwicklung im Lande, die Bewältigung des Flüchtlingsproblems sowie die Bevölkerungsentwicklung und der Tourismus an der Westküste. Gleichfalls wird die wirtschaftliche Umgestaltung des Landes, hier vor allem der Strukturwandel in der Landwirtschaft, in der Untersuchung Berücksichtigung finden müssen. Selbstverständlich werden die „Rahmenbedingungen“ nur insoweit betrachtet, als sie Einfluß auf die Konzepte des Küstenschutzes bzw. die Arbeiten im Küstenschutz ausübten. Eine weitergehende Untersuchung all dieser Fragen würde den Rahmen der Arbeit sprengen.
Anschließend wird die 2. Änderung des Wassergesetzes erörtert. Zunächst werden die Behandlung des Gesetzentwurfes im Parlament sowie die Reaktionen der Verbände und der Öffentlichkeit auf die Pläne der Regierung geschildert. Anknüpfend daran werden die unterschiedlichen Argumente, welche Initiatoren und Betroffene bei der Vorlage dieses Gesetzes vorbrachten, um die Verstaatlichung der Deiche zu begründen bzw. die Übernahmen zu verhindern, dargelegt, geprüft und bewertet. Daneben soll auch versucht werden, die Motive der Handelnden und der Betroffenen für ihr jeweiliges Handeln herauszuarbeiten und zu bewerten.
Zur Sprachregelung in dieser Arbeit:
der Begriff „Küstenschutz“ schließt immer sowohl den Hochwasserschutz als auch die Entwässerung ein. Beide Bereiche waren zwar nicht ständig organisatorisch zusammengefaßt bzw. aufeinander abgestimmt, aber sie waren und sind weiterhin für den Schutz der Marschlande untrennbar miteinander verbunden.
der Begriff „Verbände“ oder „die Verbände“ bezeichnet die Deich- und Hauptsielverbände bzw. die Deich- und Sielverbände. Andere Verbände, wie z.B. der Bauernverband, sind mit vollem Namen angegeben.
In dieser Arbeit wird die Übernahme der Landesschutzdeiche durch das Land mit dem zweiten „Gesetz zur Änderung des Wassergesetzes des Landes Schleswig-Holstein“ (2. ÄndG-LWG) als Verstaatlichung bezeichnet, sofern nicht Texte aus dem Gesetz oder Redebeiträge zitiert werden.
Die Verstaatlichung der Landesschutzdeiche wird im § 58a, welcher mit dem 2. ÄndG-LWG in das Wassergesetz des Landes (LWG) eingefügt werden sollte und später auch eingefügt wurde, zwar als „Unterhaltung von Landesschutzdeichen durch das Land“ bezeichnet, doch im Ergebnis war es eine Verstaatlichung. Denn im gleichen Paragraphen wird auch festgelegt, daß das „ ... Eigentum der Wasser- und Bodenverbände an den Landesschutzdeichen auf das Land ... “ übergeht. 2
Die Initiatoren und Mitwirkenden an der Gesetzesänderung im Parlament, in der Regierung und in der Verwaltung verwahrten sich freilich vehement gegen die Bezeichnung „Verstaatlichung“, das ändert aber nichts an den Fakten.
Quellenkritik
Eine Untersuchung über den Küstenschutz in der Nachkriegszeit müßte eigentlich schnell und problemlos zu bewältigen sein. Quellen und Zeitzeugen sollten reichlich vorhanden sein, zumal für eine Reihe derzeit lebender Personen der Zeitraum ja noch erlebte Zeit ist. Die Informationen müßten nur so sprudeln. So sollte man meinen! Aber weit gefehlt. Die Quellenlage ist vielfach kritisch. So sind die wichtigen Zeitzeugen leider schon verstorben, Akten nur bedingt verfügbar und Darstellungen sowie Periodika bis auf wenige Ausnahmen für Untersuchungen in dieser Arbeit wertlos.
Die Aktenlage in den Archiven des Landes, der Mittelbehörden und der Verbände ist bis etwa 1965 hinreichend, für die Zeit danach werden die Bestände geringer. Die Tätigkeit der Verbände und der Wasserwirtschaftsbehörden läßt sich mittels der vorhandenen Dokumente einigermaßen nachvollziehen.
Die Finanzierung der Verbände ist durch einen fast geschlossenen Bestand an Prüfungsunterlagen des „Landesverbandes der Kulturverbände“ für die gesamte Zeit nach dem 2. Weltkrieg hinlänglich zu belegen. Der Bestand im Landesarchiv ist zwar noch ungeordnet, aber auswertbar. Nur für den DHSV Norderdithmarschen ist der Bestand weitgehend vollständig, für die anderen Verbände an der Westküste sind die Unterlagen leider lückenhaft.
Der auswertbare Aktenbestand des Landwirtschaftsministeriums im Landesarchiv ist gleichfalls lückenhaft. Dort vorhandenes Aktenmaterial aus der Zeit um 1970 ist ungeordnet und daher z.Zt. nicht benutzbar. Die Änderung des Wassergesetzes von 1971 kann folglich anhand der Ministerialakten noch nicht überprüft werden. Deswegen wurden zur Darstellung der Vorgänge bei der Änderung des Wassergesetzes von 1971 die Parlamentsprotokolle, die Aktenbestände aus den Mittelbehörden und den Verbänden, Aussagen von Zeitzeugen sowie Zeitungsberichte ausgewertet. Die zusätzlich ausgewerteten Protokolle der Kabinettssitzungen erbrachten keine Erkenntnisse, die über diejenigen hinausgingen, welche aus den anderen Unterlagen gewonnen wurden.
Mittels der Landtags- und Ausschußprotokolle sollte eigentlich eine einigermaßen befriedigende und sachliche Analyse möglich sein. Denn bei einem so tiefgreifenden Einschnitt in die Rechte der Verbände, wie sie die Verstaatlichung der Landesschutzdeiche darstellte, erwartet man eigentlich, daß die Maßnahmen bereits im Vorfeld sorgfältig mit den Betroffenen abgestimmt worden waren. Doch dies war offensichtlich nicht der Fall. Zudem gewinnt man beim Studium der Landtags- und Ausschußprotokolle das Empfinden, daß die von Seiten der Abgeordneten (und zwar aller Fraktionen!) vorgebrachten Argumente nur bereits festgelegte und nicht mehr zu ändernde Tatsachen beschreiben. Die Aussagen und Überlegungen in diesen Papieren vermitteln die Annahme, daß eine Scheindiskussion geführt wurde, um bestimmten Formalien zu genügen. Überdies entsteht das Gefühl, daß man die Bedenken, die Vertreter der betroffenen Verbände vortrugen, kurz angebunden „abbügelte“, um rasch zur Diskussion anderer Themen übergehen zu können. Ein ernsthaftes Nachdenken darüber, eine Alternative zum vollständigen Übergang der Deiche in Landesbesitz zu finden, wie sie z.B. das niedersächsische Deichgesetz bietet, 3 fand anscheinend gar nicht erst statt. Nach dem Studium der Protokolle bleibt der schale Eindruck, daß es für die Parlamentarier nur eine Lösung der Problematik gab, nämlich die ihrige. Es bleibt vor allem der Verdacht, daß die in den Diskussionen angeführten Begründungen für eine Verstaatlichung der Deiche nur vorgeschoben waren. Diese Situation eröffnet viel Raum für Spekulationen über die eigentlichen Beweggründe. Von den befragten Zeitzeugen wurden denn auch Spekulationen geäußert, deren Aussagen sich deutlich von den offiziellen Begründungen unterscheiden. Die dabei vorgebrachten Argumente weichen in einigen Aspekten weit von denjenigen ab, welche in den parlamentarischen Beratungen angeführt wurden. Aus den Parlamentsprotokollen erfährt man daher auch nur „eine“ Sichtweise. Gleiches gilt allerdings auch für die Aussagen der befragten Zeitzeugen. Auch hier ist es so, daß man nur „eine Wahrheit“ erfährt, die ja „ihre Wahrheit“ ist, und somit von deren jeweiliger Position in einer Hierarchie und dem damit möglichen Kenntnisstand abhängig ist. Darüber hinaus ist „die“ Wahrheit naturgemäß auch von der Interessenlage des jeweils Befragten abhängig. Ein Verbandsfunktionär beurteilt häufig die Dinge anders als der Politiker oder der Beamte.
Darstellungen zum Thema „Küstenschutz“ und „Deichbau“ gibt es zahlreiche. Dabei muß man allerdings scharf zwischen Werken über die Zeit vor dem 2. Weltkrieg und über die Zeit nach 1945 trennen. Die Ereignisse vor dem 2. Weltkrieg sind eingehend dokumentiert.
Die wichtigste Darstellung dazu ist das Standardwerk von Müller/Fischer. Das mehrbändige Werk reicht zwar in einigen Passagen noch bis in die frühen 50er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein, der Schwerpunkt liegt jedoch eindeutig in der Zeit vor 1939.
In neuester Zeit sind eine Reihe von Büchern über den Deichbau und den Küstenschutz an der Westküste Schleswig-Holsteins erschienen. Viele dieser Werke, wie z.B. Stadelmanns „Meer-Deiche-Land“, gehen allerdings kaum über den Status von „Coffee-table-books“ hinaus. Sie sind gut für Touristen, ansonsten sind sie unbrauchbar.
Zum Verständnis der Entstehung und Durchführung der „Wasserverbandverordnung“ (WVVO) vor dem Kriege ist die Dissertation von Moseberg wichtig und lesenswert. Die Auswirkungen der WVVO für den Bereich Eiderstedt bis in die erste Nachkriegszeit schildert Gerd Jöns in seinem Werk von 1951.
Die Entwicklung des Deichrechts und der Organisation des Küstenschutzes von den Anfängen bis heute beschreiben Kramer/Rohde. Der Inhalt ihres Buches ist jedoch sehr gedrängt, es ist nur ein Überblick. Goldbeck beschränkt sich in seiner Arbeit auf die Darstellung der organisatorischen Entwicklung des Küstenschutzes in Ostfriesland. Schleswig-Holstein erwähnt er nur am Rande.
Zwei recht übersichtliche Arbeiten über die Organisation der Küstenschutz- und Wasserwirtschaftsbehörden sind die unveröffentlichten Manuskripte von Scherenberg und Kollmann. Beide Arbeiten, in den 90er Jahren verfaßt, sind klar und informativ, ohne allerdings auf Hintergründe einzugehen.
Die vom Land Schleswig-Holstein veröffentlichten Hefte „Wasserwirtschaft zwischen Nord- und Ostsee“ beschreiben die Entwicklung der Wasserwirtschaft und des Küstenschutzes im Lande nach 1945 ausgezeichnet. Neben dem Küstenschutz und dem Deichbau werden auch die Wassergewinnung und Abwasserbeseitigung sowie die Finanzierung behandelt. Die einzelnen Abschnitte ergeben, trotz ihrer Kürze, einen fundierten Überblick.
Regionale Aspekte beim Küstenschutz werden in Abhandlungen über die Geschichte einzelner Köge und Verbände behandelt. Vor allem in den Koogsgeschichten überwiegen die Schilderungen aus der Zeit vor dem Kriege bzw. direkt nach 1945. Aussagen zur neuesten Geschichte sowie Hintergrundinformationen sind in diesen Büchern kaum zu finden. Nur die Chronik des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen macht hier eine Ausnahme. Sie gibt neben einem anschaulichen Überblick über die Tätigkeit der Deich- und Sielverbände in Dithmarschen bis in die neueste Zeit auch noch wertvolle Hintergrundinformationen.
Eine andere, für diese Arbeit wichtige Gruppe von Büchern sind die kommentierten Gesetzesausgaben zum Wasser-, Verbands- und Bodenrecht sowie zur Bodenverbandsordnung. Die Veröffentlichungen von Bochalli, Nauke/Arnholt, Linckelmann und Tönnesmann enthalten neben den Gesetzestexten z.T. sehr ausführliche Darstellungen über die gesamte organisatorische Entwicklung der Wasserwirtschaft bis zum jeweiligen Erscheinungsjahr.
Zeitungen und Zeitschriften erbrachten nur unzulängliche Resultate. Allein die Tageszeitungen der Westküste erwiesen sich als einigermaßen ergiebig, wobei in bezug auf die Änderung des Wassergesetzes 1971 allerdings das von besonderem Interesse ist, was nicht geschrieben wurde. Denn bis auf einen, übrigens recht bissigen, Kommentar erschienen nur wenige kurze Notizen über die Angelegenheit.
Fachzeitschriften sind von höchst unterschiedlichem Informationswert. Die Zeitschrift „Wasser und Boden“ enthält mehrere Aufsätze zu Organisations- und Rechtsfragen in der Wasserwirtschaft und im Küstenschutz. Wenig gewinnbringend war hingegen die Auswertung der Zeitschrift „Küste“. Diese Publikation befaßt sich im wesentlichen mit technischen Problemen der Wasserwirtschaft. Über die Organisation(en) im/des Küstenschutz(es) wird wenig berichtet. Nützlich waren lediglich die beiden Aufsätze von M. Petersen über die „Grundlagen zur Bemessung der Schleswig-Holsteinische Landesschutzdeiche“ und von C. Hundt über „Maßgebende Sturmfluthöhen für das Deichbestick an der Schleswig-Holsteinischen Westküste“. Die dort veröffentlichen Erkenntnisse zeitigten nämlich nachhaltige Auswirkungen auf den gesamten Deichbau.
Die Auswertung des „Bauernblatt für Schleswig-Holstein“ war eine einzige Enttäuschung. Es stand eigentlich zu erwarten, daß ein solches landwirtschaftliches Fachblatt dem Thema Küstenschutz, und speziell dessen Finanzierung, einen breiteren Raum in seiner Berichterstattung einräumen würde. Denn rund ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes ist ja direkt oder indirekt vom Küstenschutz und den Entwässerungsmaßnahmen abhängig - und das Thema „Wasserlast“ war immer Stoff für viele Diskussionen. Doch erstaunlicherweise befaßte sich die Redaktion der Zeitschrift zwischen 1948 und 1972 so gut wie nie mit dem Thema. Küstenschutz und die damit zusammenhängenden Probleme fanden für die Leser dieses Blattes eigentlich nicht statt.
Bei der engen Verflechtung des Bauernverbandes mit der damaligen Regierungspartei war das aber wohl auch nicht nötig. Dessen Funktionäre besetzten immer wieder einflußreiche Positionen im Parlament und in der Regierung. Das Wirken des Verbandes und sein Einfluß auf die Politik des Landes, und damit indirekt auch auf den Küstenschutz, in den Nachkriegsjahren ist in dem Buch Es begann im grünen Kreml 4 deutlich dargestellt. Das Thema „Küstenschutz“ wird in diesem Buch nur in einigen ganz kurzen Passagen gestreift. Dabei handelt es sich im wesentlichen um Angaben darüber, inwieweit die Landwirtschaft an der Westküste Zuschüsse zu den „Wasserlasten“ erhalten hat.
Dies Buch wurde von einem „Insider“ geschrieben. Es macht geradezu eindringlich bewußt, daß wissenschaftliche Untersuchungen über die Verbände im Lande fehlen. Die Rolle der Verbände in der Gesellschaft, ihr Selbstverständnis, ihre personelle Zusammensetzung und ihre Verflechtungen untereinander und mit den politischen Gremien sowie ihr innerer Wandel im Zuge der gesellschaftlicher Veränderungen nach 1945 müßten eingehend wissenschaftlich untersucht werden.
Organisation des Küstenschutzes bis 1945
Von den Anfängen bis zur Wasserverbandverordnung (WVVO)
Küstenschutz war seit Beginn der Siedlung des Menschen in den flutgefährdeten Gebieten Anliegen und Aufgabe aller Bewohner.
Abb. 1 Alt- Nordstrand vor 1634 und der Küstenverlauf am Ende des 19. Jahrhunderts
Quelle: Petersen/Rohde 1991, S. 48
Als Einzelindividuen waren sie nicht in der Lage, Leben und Land vor den Fluten zu schützen. Nur in der Gemeinschaft konnten die notwendigen Maßnahmen durchgeführt werden. Das erforderte Regeln, welche dem Einzelnen Pflichten beim Bau und der Unterhaltung der Deiche zuwiesen und ihn so in das Schutzsystem der Gemeinschaft einbanden. Diese Regeln wurden zunächst durch Beschlüsse der Deichcommünen erstellt, später durch Verordnungen der Obrigkeit ergänzt oder ersetzt. 5
Die ersten schriftlichen Hinweise auf das Vorhandensein von Deichen sind bei Saxo Grammaticus, die ältesten Quellen des Deichrechts im Sachsenspiegel und im Schwabenspiegel zu finden. 6 Der Rasteder Sachsenspiegel von 1336 zeigt zudem die erste bildliche Darstellung eines Deiches. 7
Die ältesten schriftlich überlieferten landesherrlichen Bestimmungen, in denen u.a. auch Deichrechte geregelt wurden, stammen aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Dazu zählen neben der sog. „Siebenharden- Beliebung“ von 1426 entsprechende Vorschriften im Dithmarscher Landrecht von 1447, im Eiderstedter Landrecht von 1591 und im Nordstrander Landrecht von 1572. 8
Unberührt von obrigkeitlichen und fremdrechtlichen Einflüssen sowie von staatlicher Gesetzgebung war das sog. Spadelandrecht (SpLR). 9 Es war überliefertes Gewohnheitsrecht und galt nur in den Marschgebieten der Westküste. Das SpLR selbst war kein eigenes Gesetzeswerk. Es war lediglich der Oberbegriff für das gesamte Deich- und Sielrecht der Marschlande. 10 Die 1557 unter dem Begriff „Spadelandrecht“ 11 kodifizierte Deich- und Sielordnung für die Insel Nordstrand führt deshalb von der Benennung her in die Irre. Die dort niedergelegten Regelungen gab es in ähnlicher Form für andere Gebiete schon früher.
Die Nordstrander Ordnung ist aber „ ... die erste nachweisbare Kodifikation des althergebrachten Deich- und Sielrechts ... “.12 Seit Jahrhunderten mündlich und teilweise schriftlich tradierte Rechtsnormen werden hier zum ersten Mal zusammengefaßt und in eine verbindliche Form gebracht. Die Nordstrander Niederschrift weist aber auch eindeutig darauf hin, daß seit der Mitte des 16. Jahrhunderts der Einfluß der Landesherrschaft auf das Deichwesen zunimmt, denn die Kodifizierung erfolgte auf Befehl des Landesherrn. 13 Prinzipiell blieben aber die alten Gewohnheitsrechte unangetastet. Die grundsätzlichen Normen des SpLR beeinflussen sogar noch die heutige Deichgesetzgebung. 14
Abb. 2 Titelblatt. Allgemeines Deichreglement 1803
Quelle: Petersen/Rohde 1991 S. 148
Vom SpLR ist der Begriff des sog. „Spatenrechts“ 15 ausdrücklich zu unterscheiden. Beim „Spatenrecht“ handelt es sich um ein „ ... deichrechtlic hes Institut ... “, um ein Symbol für die „ ... Dereliction des Landes und des dazu gehörenden Deiches ... “. 16 Nach dieser Rechtsnorm konnte also jeder, der nicht mehr gewillt oder in der Lage war, seiner Verpflichtung bei Deichbau und/oder der Deichpflege nachzukommen, durch das Setzen des Spatens sein Land aufgeben. („De nich will dieken, mut wiken“). 17 Im Gegenzug vermochte jeder sich durch das Ziehen des Spatens das Land und die darauf ruhenden Rechte anzueignen. Das Recht des „Spatensetzens“ konnte jedoch auch von den Deichrichtern als Strafmaßnahme gegen diejenigen angewandt werden, die ihren Verpflichtungen beim Deichbau bzw. bei der Deichunterhaltung nicht oder nur unzureichend nachkamen. 18 Das „Spatenrecht“ entschied somit allein über den Besitz oder die Aufgabe von Land, nicht jedoch über andere Bereiche des Deichrechts. 19
Mit dem Ausbau der Landesherrschaft im 16. Jahrhundert wuchs die staatliche Aufsicht über das Deichwesen. Im 16. Jahrhundert wurden Bedeichungen noch „ ... von Landschaften, Harden, Kirchspielen oder Bauerschaften ... “ 20 ausgeführt, aber sie erfolgten bereits auf Weisung und unter Oberaufsicht der Landesherren. Seit Beginn des 17. Jahrhunderts beanspruchte der Landesherr „...das Vorland und den Anwachs als Regal der Krone... “. 21 Bedeichungen wurden jetzt entweder auf Rechnung der Landesherren selbst oder mittels Oktrois bzw. Konzessionen durch Privatpersonen durchgeführt. Nun entfiel die Eigenleistung der Marschbevölkerung, für sie trat eine meist landfremde Unternehmerschaft ein. 22
Mit der wachsenden Einflußnahme der Landesherren wuchs auch die Bürokratie. Die Aufsicht über den Deichbau wurde durch herrschaftliche Beamte übernommen, und dazu kam eine wachsende Zahl von Verordnungen für das Deichwesen. 23 Zu den im Bereiche des alten Spadelandrechts erlassenen besonderen Deichordnungen mit ergänzenden Vorschriften für einzelne Köge und Landschaften gehörten: 24
für Eiderstedt:
die Deichordnung aus dem Jahre 1582,
der Lande Eyderstädt, Everschop und Utholm confirmirte Teich- Ordnung vom 14. 11. 1595,
die Resolution, daß das Vorufer oder Land, was außerhalb Deich-Landes bleibt und demnächst anwächst, gleich dem Strohm auch in Eyderstädt als ein Regale anzusehen sey, vom 6. 1612,
der Teichverteilungs- Receß von 1617,
die Verordnung wegen des Deichwesens vom 22. 6. 1630,
das Regulativ wegen Abhaltung der Deichlasten in der Landschaft Eyderstedt vom 26. 5. 1767,
das Regulativ wegen der Concurrenz zu den Deichkosten in der Landschaft Eyderstedt vom 28. 7. 5. 1793, mit der Erklärung hierzu vom 19. 5. 1795,
für den Marschenbereich des Amtes Tondern:
die Deichordnung im Amts Tundern vom 14. 5. 1619,
das Reglement unter den Deich- und Koge- Bedienten des Amtes Tundern sowohl an der Rüttebüllisch- als Maaßbüllischen Wasserlösung, vom 1. 5. 1703,
für Nordstrand:
die Verordnung, wie es in dero Landt Nordstrandt mit reparirung der Teiche soll gehalten werden, vom 31. 5. 1625,
der herzogl. Erlaß über die Regelung der Abgaben bei Eindeichungen neuen Landes vom 20. 8. 1624,
der herzogl. Erlaß vom 8. 12. 1632, der in Nr. 9 die Zahlung des Landgeldes bei Ausdeichungen regelte,
für die Landschaft Stapelholm und Umgebung:
die Deich- Ordnung für das Land Stapelholm vom 21. 5. 1625,
die Sorckerkoges Deichordnung vom 28. 3. 1702,
für Pellworm:
die Pellwormsche Deich- Ordnung vom 5. 3. 1711,
die Resolution wegen Reparation der Deiche auf Pellworm von 20. 6. 1738,
das Reglement, wornach die Communion- Beteichung auf der Landschaft Pellworm einzuführen und festzusetzen, vom 10. 9. 1772 - eingeführt im Januar 1773,
die Verfügung vom 1. 3. 1788, wonach die Communion- Bedeichung auf Pellworm wieder aufgehoben wird,
für das Herzogtum Holstein
Teich- Ordnung für Süderdithmarschen vom 18. 5. 1643,
der Verordnung zur besseren Conservation der alten und neuen Teiche vom 4. 2. 1723,
Reglement in den Marschdistrikten des Klosters Itzehoe und der adligen Güter Heiligenstedten aus dem Jahre 1781,
Anordnungen für einzelne Marschen: z. B. die Amts- Verfügung, welchergestalt die Teiche in der Wilster- Marsch zu reparieren, vom 29. 7. 1674 und die Verordnung für die Cremper-Marsch, wegen der Grund- Brüche und Noth- Hülfe, so dabey von den Interessenten zu leisten, vom 18. 9. 1727.
In dieser Zergliederung der Rechtsvorschriften für die einzelnen Landschaften spiegelte sich die politische Zersplitterung der Herzogtümer. Doch nach dem Nordischen Krieg (1700-1721) änderte sich die politische Lage in Schleswig-Holstein. Bis 1773 gelang es, die Herzogtümer Schleswig und Holstein in den dänischen Gesamtstaat zu integrieren. Damit waren auch die Vorbedingungen für eine Vereinheitlichung im Deichwesen geschaffen, die dann 1803 mit dem „Allgemeinen Deichreglement“ (ADR) verwirklicht werden konnte. 25
Mit der Einführung des ADR wurden sämtliche Marschen Schleswig-Holsteins unter die Aufsicht von drei sachverständigen, beamteten Deichinspektoren gestellt. Ohne deren Zustimmung durften keine wesentlichen Veränderungen an den Deichen, den Uferwerken, den Schleusen etc. vorgenommen werden. Alle Marschen wurden zu Distrikten, den Deichbänden, zusammengefaßt. Der nördliche Distrikt umfaßte Nordfriesland mit den Inseln und Halligen zwischen Hoyer und Husum, der mittlere Distrikt Eiderstedt, Stapelholm und Norderdithmarschen und der südliche Distrikt Süderdithmarschen und die Elbmarschen. Das ADR regelte außerdem die Beitragspflicht zu außerordentlichen und ordentlichen Deichkosten und verpflichtete die Bewohner hinter den Deichen zu gegenseitigen Hilfeleistungen. Die Deichpflicht war untrennbar an das „belastete Land“ 26 gebunden. Bei dem Verkauf deichpflichtiger Ländereien ging die Deichlast auf den Käufer über. Für die Wasserlösung, d. h. die Entwässerung, die zwar grundsätzlich in der Zuständigkeit der Deichkommünen blieb, erhielten etliche Gebiete Sonderregelungen. So bildete man z. B. in einigen Dithmarscher Landesteilen selbständige Entwässerungskommünen, in Stapelholm hingegen blieben die Regelungen, wie sie vor Inkrafttreten des ADR bestanden hatten, weitgehend unberührt. 27
1866 nahm Preußen die Herzogtümer Schleswig und Holstein in Besitz und verband beide zu einer Provinz. Dabei wurde ausdrücklich geregelt, daß an den für das Deichwesen zuständigen Verbänden nichts geändert werden sollte. Das alte Gewohnheitsrecht im Deich- und Sielwesen blieb erhalten. Das wurde auch in den folgenden Gesetzen nicht angetastet. Das Preußische Wassergesetz von 1872 nahm sogar ausdrücklich diejenigen Marschgebiete aus dem Geltungsbereich des Gesetzes aus, in denen noch altes dänisches Recht, das ADR, gültig war. Die gleiche Regelung war auch in den Wassergesetzen von 1905 und 1913 verankert. Der Staat kümmerte sich im wesentlichen um Aufgabenbereiche, die durch das ADR nicht geregelt waren. Dazu gehörten z.B. der Schutz von Halligen und Inseln, die Sicherung besonders gefährdeter Deichstrecken durch den Bau von Steindecken, die Verbauung von Prielen und die planmäßige Ausführung von Landgewinnungsarbeiten. 28 Diese staatlichen Landgewinnungsarbeiten machten eine Regelung des Anwachsrechts an bestimmten Küstenabschnitten notwendig, da dort Deichverbände bzw. Interessengemeinschaften Vorrechte besaßen. So wurden vertragliche Vereinbarungen getroffen, in denen dem Staat das Anwachsrecht übertragen wurde. 29 Die Vorlandarbeiten führten zu Landgewinnen, die vorwiegend in Dithmarschen die Anlage von Sommerkögen ermöglichte. In anderen Gebieten blieben die Außendeiche jedoch direkt der See ausgesetzt. Dadurch ergaben sich für die betroffenen Bereiche unterschiedliche Belastungen bei der Deichunterhaltung. 30 Während bei den durch Vorland oder Sommerköge geschützten Seedeichen eine geringere Unterhaltung notwendig war, erforderten die schar liegenden Deiche 31 ständige hohe Unterhaltkosten. So verschärften sich die Ungleichheiten zwischen den Deichverbänden. Aufgrund der bestehenden gesetzlichen und organisatorischen Verhältnisse konnten die Belastungen aber nicht ausgeglichen werden.
Die Kostenentwicklung bewirkte auch, daß in den 1920er Jahren die Eindeichung neuer Köge durch Genossenschaften oder Privatleute endgültig beendet wurde. Mit der Schließung des Deiches vor dem Sönke-Nissen-Koog im Jahre 1925 war die Zeit für private Erschließung von Neuland vor den Küsten Schleswig-Holsteins für immer vorbei. 32
Entwässerung und Deichbau waren in den Rechtssystemen Spadelandrecht und ADR noch als Einheit gesichert gewesen. Die neuere Gesetzgebung hatte diesem Zusammenhang aber nicht mehr Rechnung getragen. Die Entwicklung war so verlaufen, daß mittlerweile eine einheitliche Planung bei Deichbau und Entwässerung nur noch unzureichend durchzuführen war. 33 Sowohl bei den Verbänden als auch im staatlichen Bereich war eine Zersplitterung der Zuständigkeiten für die Durchführung wasserwirtschaftlicher Aufgaben eingetreten. Zu Beginn der 1930er Jahre waren z.B. allein im Eidergebiet etwa 120 Verbände für die Regelung der Ent- und Bewässerung zuständig. 34 In den Marschdistrikten mit ihren zahlreichen Deich- und Sielverbänden bestanden entsprechende unklare Strukturen.
Um die mittlerweile unübersichtliche und ineffiziente Organisation der Verbände zu straffen, wurde 1930 der Marschenverband als „freie Arbeitsgemeinschaft der Deichverbände an der Schleswig-Holsteinischen Westküste“ gegründet. Der Zusammenschluß erfolgte, weil man erkannt hatte, daß nur bei einer stärkeren Zusammenarbeit die Deich- und Wasserlösungsverbände ihre Aufgaben in Zukunft sinnvoll wahrnehmen konnten. 35 Dazu legte der Marschenverband zwei Denkschriften vor. Während die erste Denkschrift sich in der Hauptsache mit der Landgewinnung und Arbeitsbeschaffung befaßte, 36 ging die zweite Denkschrift in ihrer Zielsetzung weit darüber hinaus. In ihr wurden Vorschläge zur Verbesserung der Verbandsarbeit, zur Verbesserung der Landeskulturverwaltung, zur Arbeitsbeschaffung und „ … zur Förderung einer einheitlichen und die ganze Marsch umfassenden Arbeit in Küstenschutz, Binnenentwässerung und Anlandung … “ gemacht. 37 Diese zweite Denkschrift enthielt u.a. detaillierte Vorschläge zur Deichverkürzung an der Westküste. 38 Die Entwürfe entstanden allerdings zu einer Zeit, in der sie aus finanziellen und politischen Gründen nicht umsetzbar waren. 39
Der Unübersichtlichkeit und dem Durcheinander bei den Verbänden stand eine gleichermaßen unübersichtliche und verworrene staatliche Organisation gegenüber. 40 So waren zuständig für den/die: 41
Küstenschutz: die preußischen Wasserbauämter (Husum, Tönning, Glücksstadt) Die Dienststellenleiter nahmen als staatliche Deichinspektoren die technische Aufsicht wahr. Für die verwaltungsmäßige Aufsicht war der Landrat als Oberdeichgraf zuständig.
Landgewinnung: die Domänenrent- und -bauämter Husum und Meldorf.
Meliorationsarbeiten: die Kulturbauämter Schleswig und Neumünster. Außerdem für die Planung und Durchführung von Entwässerungsarbeiten die Kreiswiesenbauämter.
Umlegungs- und Siedlungsvorhaben: die preußischen Kulturämter.
Die verwaltungsmäßige Zersplitterung setzte sich in der Mittelinstanz fort. Auch hier herrschte eine unklare Zuordnung der Zuständigkeiten. So waren zuständig für: 42
die Wasser- und Kulturbauämter der Regierungspräsident,
die Landgewinnung und den fiskalischen Besitz die Regierung, 43
das Siedlungs- und Umlegungswesen das Landeskulturamt.
1933 änderte sich die Lage. Das NS-Regime trat mit der Absicht an, Deutschland auch auf dem Gebiet der Ernährung autark zu machen. Dafür unternahm die Reichsregierung alle Anstrengungen. „Landgewinnung“, und damit Eindeichung, erhielt politisch und ideologisch Priorität.
Im Bereich der Wasserwirtschaftsverwaltung begann unter dieser Prämisse im gleichen Jahr eine völlige Neuordnung der Strukturen. Am 25. Juli 1933 wurden mit dem „Gesetz zur Änderung von Gesetzen über Wasser- und Bodenkultur- Angelegenheiten“ die Vorschriften des preußischen Wassergesetzes auch für die Schleswig-Holsteinischen Marschen bindend. 44 In den 1937 gegründeten Marschenbauämtern (MBÄ) Husum, Heide und Itzehoe faßte man die bislang in unterschiedlichen preußischen Behörden angesiedelten Aufgaben des Wasser- und Kulturbaus sowie der Domänenverwaltung zusammen. Sie erhielten als Aufgaben Küstenschutz, Landgewinnung und Kulturbau zugewiesen. Das MBA Husum war für Nordfriesland mit den Einzugsgebieten der nordfriesischen Ströme, für das davorliegende Watt und die Inseln, das MBA Heide für die Marschen und das Watt vor Eiderstedt bis Brunsbüttelkoog und das MBA Itzehoe für die Elbmarschen mit den Flüssen Stör, Pinnau und Krückau zuständig. Parallel zur Einrichtung der MBÄ entstanden die Wasserwirtschaftsämter Schleswig und Lübeck.
Die bereits 1934 neugegründeten Forschungsstellen Husum und Büsum wurden den Marschenbauämtern Husum und Heide angegliedert. Fachlich unterstanden sie direkt dem Oberpräsidenten der Provinz Schleswig-Holstein. Die wissenschaftliche Erforschung der Vorgänge im Wattenmeer hatte in den 1920er Jahren langsam begonnen. Nun trug man der wachsenden Bedeutung dieser Forschung mit der Einrichtung der Forschungsstellen Rechnung. Sie sollten die zuvor nur empirisch gewonnenen Kenntnisse im Küstenschutz und der Landgewinnung auf eine wissenschaftliche Basis stellen und so dazu beitragen, die hydrographischen Vorgänge vor den Deichen besser zu verstehen. Außerdem sollten sie im Rahmen eines großangelegten Forschungsprogramms wissenschaftliche Grundlagen zum Schutz der Küsten und zur Landgewinnung, für den Hochwasserschutz, die Vorflutverbesserung in der Marsch und die landeskulturellen Arbeiten auf neugewonnenen und bedeichten Flächen erarbeiten. 45 Dazu diente der 1935 genehmigte „10-Jahresplan über Planung und Forschung im Gebiet der Schleswig-Holsteinischen Westküste“. 46 Im Jahre 1940 wurde der 10-Jahresplan mit der „Generalplanung des Küstenschutzes und der Landgewinnung im nordfriesischen Wattenmeer“ fortgeschrieben. Die Planung enthielt „ ... Vorschläge für ausführbare Baumaßnahmen, die unter Berücksichtigung der bis dahin erarbeiteten Forschungsergebnisse möglich und erforderlich erscheinen ... “. 47 Die durchgeführten Forschungsarbeiten brachten wichtige Erkenntnisse über den natürlichen Zusammenhang zwischen Küstenschutz, Vorlandgewinnung und Wasserregelung. Zudem wurde festgestellt, daß viele Deiche nur unzureichenden Schutz boten und deshalb unbedingt verstärkt werden mußten. Der 2. Weltkrieg unterbrach jedoch alle Untersuchungen und Vorhaben. Erst nach 1945 wurden die Forschungsarbeiten wieder aufgenommen und bis heute weitergeführt. 48
Neben der Umgestaltung der Verwaltungsstrukturen für den Küstenschutz erfolgte die Umgestaltung der Wasserwirtschaftsverwaltung. 1937 erließ der „Reichs- und Preußische Minister für Ernährung und Landwirtschaft“ einen Grundsatzerlaß zur Errichtung einer „Wasserwirtschaftsstelle“ beim Oberpräsidenten der Provinz Schleswig-Holstein in Kiel. Diese sollte die notwendigen Vorarbeiten leisten, um die Wasserwirtschaft so umzugestalten, daß das gesamte Wasser so zweckmäßig wie möglich genutzt werden konnte. Gleichzeitig wurden die Aufgaben der heutigen Wasser- und Schiffahrtsbehörden aus dem Bereich der Wasserwirtschaft ausgegliedert. 49
1933 begannen auch die ersten Maßnahmen zur Bereinigung der Verhältnisse im Verbandswesen. Vor einer allgemeinen Neuorganisation des Deich- und Sielverbandwesens wurde am 10. Oktober 1933 durch einen Erlaß des preußischen Landwirtschaftsministeriums der Eiderverband gegründet. Damit sollte die Trägerschaft für die geplante Eiderabdämmung sichergestellt werden. Der Eiderverband erhielt vorläufig als einzige Aufgabe den Hochwasserschutz zugewiesen. Mitglieder wurden alle bestehenden Deich- und Wasserlösungsverbände sowie die Besitzer von verbandsfreien Grundstücken, die bislang im Eidergebiet für den Hochwasserschutz zuständig gewesen waren. 50 Zur Durchführung der Maßnahme griff man auf die Vorschriften des ADR von 1803 zurück, denn das preußische Wassergesetz von 1913 war für die angestrebte schnelle Lösung nicht brauchbar. Anfang 1934 erließ der Regierungspräsident in Schleswig die Verbandssatzung und berief die Verbandsorgane. Danach konnte der Verband seine Tätigkeit aufnehmen. 51 Nach einer Satzungsänderung vom Jahre 1937 übernahm der Eiderverband neben dem Hochwasserschutz die Aufgabe der Entwässerung. 52 Das Verbandsgebiet erweiterte man über die Gebiete der in der Satzung festgelegten Grenzhöhenlinie unterhalb von NN+2,5m hinaus auf Flächen, welche „ ... ausgesprochene Niederungseigenschaften und besondere Entwässerungsverhältnisse aufwiesen ... “. 53 Am 25. August 1937 erließ der schleswig-holsteinische Regierungspräsident noch die „Sondersatzung für die Aufgabengebiete des Eiderverbandes“, um Mängel im bestehenden Verbandsrecht zu beseitigen. Nach dem Erlaß der WVVO gingen dann alle bisherigen Verbände des Eidergebietes im Eiderverband auf. 54
Die endgültige Neuordnung erhielt das Verbandswesen mit dem „Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasser-Verband-Gesetz, WVG)“ und der „Ersten Wasserverbandverordnung (WVVO)“ aus dem Jahre 1937. Damit war die Anpassung des Verbandswesens an die Erfordernisse der Zeit erfolgt. Die beiden Bestimmungen bildeten den gesetzgeberischen Abschluß der organisatorischen Neustrukturierung des Küstenschutzes und der Wasserwirtschaft vor dem Kriege.
Die Wasserverbandsgesetzgebung von 1937
Mit dem „Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasser-Verband-Gesetz, WVG)“ und der „Ersten Verordnung über Wasser- und Bodenverbände (Erste Wasserverbandverordnung, WVVO)“ beseitigte der Staat den Wildwuchs im Wasserverbandswesen. Die Neuordnung betraf alle Institutionen des Reiches, die zuständig waren für
Ent- und Bewässerung,
Unterhaltung von Wasserläufen,
Ausbau von Gewässern,
Beseitigung von Abwässern,
Deichschutz,
Bodenumwandlung sowie
Grundwasserbewirtschaftung. 55
Damit beseitigte man die Zersplitterung der bestehenden Verbandsarten und die bislang geltenden landesrechtlichen Regelungen. Für alle Verbände galt von nun an ohne Rücksicht auf ihre Tätigkeit und landwirtschaftliche Lage, das gleiche Recht. Es gab nur noch „Wasser- und Bodenverbände“. Bislang gültige Bestimmungen, z.B. Regelungen aus dem preußischen Wassergesetz von 1913 (WG 13), die in den Rahmen der Neuordnung paßten, wurden z.T. wörtlich übernommen. Für die Bildung von Oberverbänden griff man sogar auf das Vorbild des ADR zurück. Dazu schreibt Kümmel:
„ ... was irgend an Nützlichem und Brauchbarem in früheren oder ältesten Rechtsquellen zu finden war, ist hineingearbeitet worden, der neuen Auffassung vom Staat, von der Volksgemeinschaft und von den Eigentumspflichten wird Rechnung getragen. ... “. 56
Damit war der gesetzliche Rahmen geschaffen, um auch in den Marschgebieten, an der Eider und in den Elbmarschen wieder klare Verbandsstrukturen zu ermöglichen. Durch die staatliche Vorgabe einer Mustersatzung 57 gelangte man zudem zu einer Rechtsvereinheitlichung. Hochwasserschutz und die Entwässerung fanden wieder unter einem Dach zusammen. Die neuentwickelten Verbandsstrukturen bewährten sich, auch über das Ende des „Dritten Reiches“ hinaus. Sie blieben im wesentlichen bis heute bestehen. 58
Das WVG und die WVVO wurden 1937 erlassen und traten am 1. Januar 1938 in Kraft. Ziel des WVG war es, die Wasser- und Bodenverhältnisse zu verbessern, um die Selbstversorgung zu erhöhen. 59 Des weiteren sollten die verworrenen Zustände des Verbandswesens beseitigt und der Einfluß des Staates sowie der Partei auf die Verbände verstärkt werden.
Die politisch motivierte und so durchaus gewollte Stoßrichtung verbarg man keinesfalls. Im § 1 WVG heißt es denn auch deutlich:
„ ... Um die Wasser- und Bodenverhältnisse als Grundlage der Selbstversorgung des deutschen Volkes zu verbessern [ ... ] wird der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft ermächtigt, [ ... ] das Recht der Wasser- und Bodenverbände, insbesondere ihre Selbstverwaltung, ihre Ordnungs- und Polizeigewalt [ ... ] die Umgestaltung bestehender und die Gründung neuer Verbände durch Verordnung nach den Grundsätzen des nationalsozialistischen Staates neu zu gestalten. ... “. 60
Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft erließ aufgrund dieser Ermächtigung die WVVO. Sie regelte das Recht der Wasser- und Bodenverbände neu. Mit dem Inkrafttreten des WVG und der WVVO war das gesamte alte Verbandsrecht aufgehoben, alle bisherigen einschlägigen gesetzlichen Regelungen verloren ihre Gültigkeit. Das Satzungsrecht der Einzelverbände und das Nebeneinander von Deich- und Sielverbänden sowie sonstiger Interessengemeinschaften waren damit beseitigt. Die bisherigen Verbände, Deichbände und all ihre Unterverbände mußten aufgelöst werden. An ihre Stelle traten neu zu gründende Deich- und Hauptsielverbände. 61
Die WVVO sah jedoch gewisse Übergangsregelungen vor. So blieben die alten Satzungen so lange in Kraft, bis eine neue, der WVVO entsprechende Satzung vorlag. Allerdings verloren unabhängig davon all die Bestimmungen der alten Satzungen sofort ihre Wirkung, die den Vorschriften der WVVO entgegenstanden. 62 Denn mit der WVVO wollte man „ ... ein neues, einheitliches und den Erfordernissen des Staates entsprechendes Reichsrecht schaffen ... “. 63
Ganz bewußt beseitigte man zunächst das alte Verbandsrecht. Die Verbände wurden so gezwungen, sich Satzungen nach dem neuen Recht zu geben. Dadurch sollte vermieden werden, daß man „ ... die neuen Vorschriften an die alten Satzungen heran„flickte“ ... “. 64