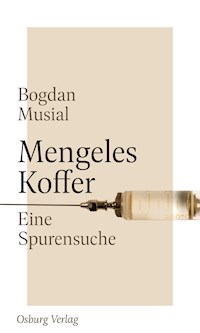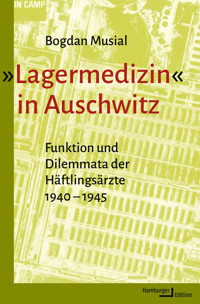
40,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hamburger Edition HIS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieser Ort werde die Hölle auf Erden sein, erklärte im Juni 1940 ein SS-Angehöriger Häftlingen, die beim Bau des Lagerzauns eingesetzt waren. Nach 1945 ist Auschwitz zum Synonym für die unvorstellbaren Grauen des Holocaust geworden. Unter den Häftlingen waren alle Berufsgruppen vertreten, auch Ärztinnen und Ärzte. Wer eine Beschäftigung im Krankenbau fand, steigerte seine Überlebenschancen deutlich, konnte aber auch sein medizinisches Wissen einsetzen, um anderen zu helfen. Als Auschwitz 1942 zum Vernichtungskomplex ausgebaut wurde, ging die Behandlung der kranken Insassen praktisch in die Hände der Häftlingsärzte über, auch wenn SS-Mediziner die Aufsicht ausübten. Die Kooperation reichte oft tief und stürzte die Häftlingsärztinnen und -ärzte in Dilemmata: Einerseits konnten sie helfen, andererseits waren sie durch Befehle gezwungen, tödliche Entscheidungen mitzutragen. Der deutsch-polnische Historiker Bogdan Musial beleuchtet erstmals umfassend die Rolle der Häftlingsärzte und rekonstruiert so auch die Geschichte von Auschwitz von den Anfängen bis zur Evakuierung im Januar 1945: Er beschreibt den Häftlingskosmos, die Arbeitseinsätze, die Selektionen, das Erproben von Mordmethoden, »medizinische Experimente« und die Vernichtung. Musials monumentale Studie ist ein herausragender Beitrag zur Forschung über Auschwitz und den Holocaust insgesamt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1056
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Bogdan Musial
»Lagermedizin«in Auschwitz
Funktion und Dilemmata
der Häftlingsärzte
1940 – 1945
Unter Mitwirkung von Oliver Musial
Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung
Mittelweg 36
20148 Hamburg
www.hamburger-edition.de
© der E-Book-Ausgabe 2024 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-430-5
© der deutschen Ausgabe 2024 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-394-0
Umschlaggestaltung: Lisa Neuhalfen, Berlin
Umschlagabbildung: Auschwitz, Luftaufnahme der alliierten Luftaufklärung,
13. September 1944. © picture-alliance / akg-images | akg-images
Inhalt
Einleitung
KL Auschwitz: Intentionen, Aufbau und Funktionsweise
Von Anfang an: Vernichtungsstätte
Der Häftlingskosmos
»Gesundheitswesen« unter tödlichen Bedingungen
Der Aufbau des Häftlingskrankenbaus im KL Auschwitz
Tod durch Hunger
Erprobung von Mordmethoden im Krankenbau: die »Aktion 14f13«
Der Vernichtungskomplex Auschwitz
1942/43: Umbrüche
Häftlingskrankenbau Auschwitz-Stammlager 1942 – 1945
Das Arbeits- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau
Das Nebenlager Buna/ Arbeitslager Monowitz
Die Nebenlager
Mörderische Medizin: Häftlingsärzte unter Zugzwang
Selektionen
Seuchenbekämpfung
Medizinische »Experimente« und »Versuchsreihen«
Epilog: Schicksale, Aufklärung und Ahndung
Anhang
Bildteil
Kurzbiografien (Auswahl)
Archive und Literatur
Zum Autor
Einleitung
»In einer abnormalen Situation ist eine abnormale Reaktion eben das normale Verhalten«, schreibt Viktor E. Frankl in seinem im Jahre 1946 erschienenen Standardwerk … trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager.1 Dr. Frankl, ein angesehener Neurologe und Psychiater aus Wien, war selbst als Häftling in vier verschiedenen Konzentrationslagern, darunter im Oktober 1944 zwei Wochen in Auschwitz. Und das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz war kein Ort, in dem normale Zustände herrschten. Ganz im Gegenteil. Dieses Lager werde die Hölle auf Erden sein, erklärte im Juni 1940 ein SS-Angehöriger Häftlingen, die beim Bau des Lagerzauns eingesetzt waren.2
Der jüdische Arzt Dr. Otto Wolken, der Anfang 1943 nach Auschwitz deportiert worden war und dort bis zur Befreiung interniert blieb, stammte ebenfalls aus Wien. Nur knapp überlebte er die ersten Monate in Auschwitz-Birkenau und wurde danach als Häftlingsarzt im Krankenbau beschäftigt.3 Zwar garantierte diese Stelle das Überleben in Auschwitz keineswegs, sie steigerte jedoch die Chancen darauf erheblich. Eines Tages, so Wolken im Jahre 1970, verlangte der SS-Lagerarzt Dr. Erwin von Helmersen, »dass ich ihm eine Liste der arbeitsunfähigen Häftlinge vorlege«. Wolken ging zu Recht davon aus, dass die von ihm zu selektierenden »arbeitsunfähigen Häftlinge« anschließend vergast werden sollten. Befehlsverweigerung kam nicht infrage, daher beschloss Wolken, den Befehl indirekt zu sabotieren:
Meine Erwägungen gingen dahin, nur diejenigen Häftlinge auf die Liste zu setzen, bei denen es sicher war, dass sie auf Grund ihrer Erkrankung in kürzester Zeit mit dem Tode rechnen mussten. Es handelte sich dabei um Häftlinge, deren körperlicher Abbau so weit fortgeschritten war, dass eine Wiederherstellung vollkommen ausgeschlossen sein musste. Es handelte sich dabei um eine Anzahl von 30 Häftlingen. […] Als ich diese Liste dem Dr. Helmersen vorlegte, beschimpfte er mich und erklärte, dass es sich hier um Sabotage handle. Er drohte mir an, dass ich dafür ins Strafkommando käme[,] und gab mir 2 Ohrfeigen. Dr. Helmersen nahm dann in dem genannten Lagerabschnitt selbst eine Selektion vor, bei der er über 300 Häftlinge auswählte […]. Von meinen Häftlingskameraden, worunter sich Häftlingsärzte, Pfleger und Blockälteste befanden, wurden mir daraufhin Vorwürfe gemacht mit dem Argument, dass ich den Dr. Helmersen zufriedengestellt hätte, wenn ich etwa 100 Häftlinge namhaft gemacht hätte, während er jetzt ein Mehrfaches selektiert hat.
Der Versetzung ins Strafkommando, die für ihn den sicheren Tod bedeutet hätte, entkam Dr. Wolken, »weil Dr. Helmersen am nächsten Tag zur Fallschirmtruppe versetzt worden ist«.4 Dieses Beispiel veranschaulicht eines der moralisch-ethischen Dilemmata, mit denen Häftlingsärzte im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz alltäglich konfrontiert waren: im vorliegenden Fall, »etwa 100 Häftlinge« persönlich auszuwählen und sie zu opfern, um sich selbst zu schützen und zugleich etwa 200 andere Insassen, zumindest vorübergehend, vor dem sicheren Tod zu bewahren.
Wie wichtig und zugleich prekär die Stellung der Häftlingsärzte im Lagersystem war, erkannte auch Robert Jay Lifton, der im Jahre 1986 sein Standardwerk über die Ärzte im Dritten Reich veröffentlichte,5 bei seinen Recherchen. In einem Brief an Raul Hilberg, den Nestor der Holocaustforschung, schrieb Lifton am 4. Januar 1977: »There is one other dimension to the work I am contemplating that I neglected to mention to you – namely, the experience of inmate-physicians in the camps, including their struggle to maintain elements of genuine healing and their conflicts around compliance or even collaboration with Nazi physicians.«6
Die Geschichte dieser Häftlingsärzte und ihre Rolle im »Gesundheitswesen« des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz erstmals umfassend zu beleuchten, ist das Ziel der vorliegenden Darstellung. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich über das gesamte Bestehen des Lagers, von seiner Einrichtung im Juni 1940 bis zur – mit Todesmärschen verbundenen – Räumung im Januar 1945. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den historischen Hintergrund gelegt, mithin die Umstände, unter denen die Ärztinnen und Ärzte handelten und handeln mussten.
Die Gesamtzahl der Häftlingsärzte und -ärztinnen im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz einschließlich der Nebenlager geht in die Hunderte. Die genaue Größenordnung ist heute jedoch kaum zu ermitteln. Es fehlen Unterlagen dazu, und die Fluktuation war sehr hoch. Viele von ihnen starben an Krankheiten, allen voran an Fleckfieber, zahlreiche wurden erschossen, andere in andere KL verlegt, einige wenige polnische Häftlingsärzte sogar freigelassen.
Eines ist aber sicher: Wer eine Beschäftigung im Krankenbau ergattern konnte, steigerte seine Überlebenschancen enorm. Gewöhnliche Häftlinge starben großenteils binnen weniger Monate an Entkräftung, Hunger und Krankheiten. Häftlingsärzte und -pfleger gehörten hingegen zu der sogenannten Lagerprominenz. Vom Tod durch Hunger und Entkräftung blieben sie faktisch verschont.
1942, als Auschwitz zum Vernichtungskomplex ausgebaut wurde, ging die medizinische Behandlung der kranken Häftlinge praktisch in die Hände der Häftlingsärzte über; die SS-Lagerärzte übten zwar die Aufsicht aus, verließen sich aber immer mehr auf die Häftlingsärzte. Dies setzte deren Zusammenarbeit mit der Lager-SS im Allgemeinen und den SS-Ärzten im Besonderen voraus. Die Kooperation reichte oft tief, erzwungen durch direkte Befehle und Anweisungen, aber auch durch die im Lager herrschenden Verhältnisse. So wirkten Häftlingsärzte an den »medizinischen« Experimenten der SS-Ärzte mit, sie führten nicht selten auf Befehl Vorselektionen bzw. Selektionen von »arbeitsunfähigen« Häftlingen in den Krankenbauen durch. In der Regel mussten sie dabei zumindest assistieren. Bisweilen ließ der Umgang der Häftlingsärzte und -pfleger mit Kranken deutlich zu wünschen übrig.
Aus diesen Gründen sahen sich einige ehemalige Häftlingsärzte nach 1945 mit Vorwürfen und überdies mit staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und Gerichtsverfahren konfrontiert. Einzelne von ihnen erlangten eine negative Berühmtheit, die teilweise die der eigentlichen SS-Täter überschattete, wobei der historische Hintergrund ihrer Lagertätigkeiten ausgeblendet und/oder entstellt, teils sogar vorsätzlich gefälscht wurde. Manch falsche Beschuldigung fand Eingang in Publikationen, selbst in solche mit wissenschaftlichem Anspruch.
Den Lageralltag der Häftlingsärzte bestimmte der Kampf um das eigene Überleben und somit auch um die eigene Beschäftigung im Krankenbau. Erst wenn diese – nach den in Auschwitz geltenden Maßstäben – halbwegs gesichert war, konnten sich Häftlingsärzte und -pfleger um kranke Insassen kümmern, sofern dies überhaupt möglich war. In den meisten Fällen waren sie hilflos. Nur einem Teil der Kranken ließ sich angesichts der äußerst knappen Ressourcen an Medikamenten, Verbandszeug oder medizinischen Instrumenten überhaupt helfen. Nichtsdestoweniger schafften Häftlingsärzte es dank teilweise unkonventioneller Behandlungsmethoden (»Lagermedizin«) sowie durch »Taktieren« und »Lavieren«, vielen kranken Insassen tatsächlich das Dasein zu erleichtern. Oft genug setzten sie dabei nicht nur ihre »privilegierte« Stellung aufs Spiel, sondern auch ihr Leben.
Im Lagerwiderstand spielten Häftlingsärzte ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie bestand in erster Linie darin, unter Todesgefahr Informationen, Unterlagen und Beweise über die in Auschwitz begangenen Massenverbrechen zu sammeln und diese an die Außenwelt weiterzuleiten. Dank dieser Aktivitäten war die westliche Welt bereits im Winter 1942/43 über die Geschehnisse in Auschwitz relativ gut informiert. Es kam außerdem vor, dass Häftlingsärzte und -pfleger besonders brutale Kapos und gefährliche Lagerspitzel, die im Krankenbau als Kranke stationär behandelt wurden, liquidierten.
Wegen ihrer Position im Lager gewannen Häftlingsärzte weitreichende Einblicke in die dort herrschenden Verhältnisse und aufgrund ihrer Profession hatten sie Erfahrung in der Erstattung und Abfassung von Berichten. Nicht wenige von ihnen forschten zudem wissenschaftlich, vor der Inhaftierung und nach der Befreiung, manchmal auch im Lager im Auftrag der SS-Lagerärzte. Ehemalige Häftlingsärzte traten nach der Befreiung als Zeugen und Gutachter in Ermittlungs- und Gerichtsverfahren gegen Auschwitztäter auf. Es sind großenteils ihre Zeugnisse, die es ermöglichten, die im Lagerkomplex herrschenden Zustände und die dort begangenen Massenverbrechen relativ gut zu rekonstruieren, obwohl die Täter alles unternommen hatten, um Spuren und Beweise zu beseitigen.
Zu Forschungsstand und Literatur
Zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz erschienen nach 1945 unzählige Monografien, Sammelbände, Sachbücher, Memoiren, Romane, Erzählungen, Gedichte, Aufsätze und Artikel. Ebenso zahlreich wurden Dokumentar- und Spielfilme produziert und ausgestrahlt. Jedes Jahr kommen neue hinzu. Die Thematik der Häftlingsärzte wird darin zwar immer wieder aufgegriffen, jedoch in der Regel am Rande. Die Ausnahme stellen einige wissenschaftliche Aufsätze und Abhandlungen7 sowie Erinnerungen ehemaliger Häftlingsärztinnen und -ärzte dar. Eine nur ihnen gewidmete Monografie steht bislang aus. Diese Lücke möchte ich mit der vorliegenden Arbeit füllen.
In der Literatur zum Thema lassen sich generell zudem zwei Forschungsstränge unterscheiden, der polnische und der westliche. Die westliche neuere Forschung beschränkt sich zeitlich auf die Jahre 1943 bis 1945 und konzentriert sich weitgehend auf die jüdischen Häftlingsärztinnen und -ärzte (von denen nur die wenigsten das Jahr 1942 überlebten),8 während die polnischen Publikationen eher auf die polnischen – und zwar seit Errichtung des Lagers im Juni 1940 bis zu seiner Räumung im Januar 1945 – eingehen. Letztere wurden meistens von ehemaligen polnischen Häftlingsärztinnen und -ärzten auf Grundlage eigener Erfahrungen und Erinnerungen sowie der in Polen zugänglichen Quellen verfasst.9 Dazu zählen unter anderem die zweifellos wichtigsten Gerichtsverfahren gegen Auschwitztäter wie etwa Rudolf Höß; diese fanden nach 1945 in Polen statt.
Westliche Forscher greifen auf diese Bestände selten zurück. Der eingangs erwähnte Lifton widmete den Häftlingsärzten in Auschwitz drei Kapitel seines Buches, wobei er seine Ausführungen auf Interviews mit ehemaligen Häftlingsärzten und Häftlingen sowie westliche Erinnerungsliteratur stützte. Der australische Autor Ross Halpin behandelt in seinem 2018 erschienenen Buch Jewish Doctors and the Holocaust10 anhand einiger Beispiele die letzten zwei Jahre des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz auf der Basis englischsprachiger Erinnerungs- und Fachliteratur. Leider ist der wissenschaftliche Umgang des Autors mit diesen Zeugnissen zumindest teilweise kritikwürdig. Es entstand eine Publikation, die einzelne Häftlingsärztinnen und -ärzte unkritisch idealisiert.11 Lifton und Halpin sind keine Ausnahmen. Zumeist werden Quellen und Publikationen genutzt, die im Westen zugänglich sind. Quellen aus den polnischen Archiven, darunter zeitgenössische, bleiben weitgehend unbeachtet, sofern sie nicht in englischer bzw. deutscher Übersetzung vorliegen.12
Im Gegensatz zur Fach- ist die Erinnerungsliteratur zum Thema in Ost wie West relativ umfangreich. Unmittelbar nach der Befreiung begannen viele Auschwitzüberlebende, so auch Häftlingsärztinnen und -ärzte, ihre Erlebnisse aufzuschreiben, um Zeugnis über das Leid, die unvorstellbaren Qualen und den industrialisierten Massenmord abzulegen. Ein Großteil dieser Zeugnisse wurde, sofern publiziert, inzwischen ins Englische und auch Deutsche übersetzt, während andere nur in den Ursprungssprachen zugänglich sind, beispielsweise Polnisch oder Französisch. Diese Quellengattung spielt in der folgenden Arbeit eine herausragende Rolle.
Dr. Mikloš Nyiszli, ein jüdischer Gerichtsmediziner aus Nagyvárad/Oradea (damals Ungarn, heute Rumänien), musste nach seiner Verschleppung nach Auschwitz im Mai 1944 für den SS-Arzt Josef Mengele in Auschwitz-Birkenau als Häftlingsarzt und Pathologe arbeiten. Auf dessen Befehl sezierte Nyiszli unter anderem Leichen von Menschen, darunter Kinder, die für »wissenschaftliche« Zwecke ermordet worden waren. Nyiszli überlebte Auschwitz und verfasste nach seiner Rückkehr einen Bericht über das Gesehene und Erlebte, den er im März 1946 fertigstellte und mit einer Erklärung einleitete:
Ich, der unterzeichnende Dr. Miklós Nyiszli, bin Arzt und ehemaliger Häftling des Konzentrationslagers Auschwitz; ich war beschäftigt im Krematorium und an den Scheiterhaufen, wo das Feuer Millionen Körper von Vätern, Müttern und Kindern verzehrte. Ich erkläre als unmittelbarer Zeuge, daß ich meinen Bericht über diese finsterste Zeit der Menschheitsgeschichte nach der Wirklichkeit, ohne Übertreibungen und ohne zu beschönigen, niedergeschrieben habe. […] Mit meiner Arbeit erstrebe ich keinerlei literarischen Erfolg, denn ich bin Arzt und kein Schriftsteller.13
Nyiszlis Bericht erschien 1946 zunächst auf Ungarisch und wurde später in viele Sprachen übersetzt. Heute gehört er gerade wegen seiner Nüchternheit und Sachlichkeit zu den erschütterndsten Zeugnissen eines Auschwitzüberlebenden.
Im selben Jahr wie Nyiszli veröffentlichte Olga Lengyel – ebenfalls in ungarischer Sprache – ein Buch über ihre Erlebnisse als jüdische Häftlingspflegerin in Auschwitz-Birkenau. Ein Jahr später folgte mit Five Chimneys die englische Übersetzung.14 1948 erschienen unter dem Titel Prisoners of Fear Erinnerungen von Dr. Ella Lingens-Reiner. Lingens, eine österreichische Juristin und Ärztin, wurde im Februar 1943 nach Auschwitz deportiert und als Häftlingsärztin in Auschwitz-Birkenau eingesetzt.15 Diesen Veröffentlichungen folgten weitere, auch in anderen Sprachen.16
Hinzu kommen Memoiren ehemaliger polnischer Häftlingsärzte, darunter Stanisław Jagielski, Alfred Fiderkiewcz, Czesław Jaworski oder Władysław Fejkiel.17 Fejkiel verfasste außerdem eine medizinisch-wissenschaftliche Abhandlung über Fleckfieber in Auschwitz, ausgehend von Beobachtungen und Notizen, die er noch als leitender Häftlingsarzt gemacht hatte.18 Diese Publikationen zählen zu jenen, die in der westlichen Forschung bis heute kaum oder gar nicht beachtet werden.
Wie Erinnerungen und Memoiren generell haben die hier erwähnten Überlieferungen subjektiven Charakter und dürfen nur mit Umsicht als Quelle herangezogen werden. Manche weisen selbstdarstellerische und apologetische Züge auf, andere wiederum zeichnen sich durch Nüchternheit und Sachlichkeit, einzelne auch durch spezifischen »Auschwitz-Humor« aus. Gleichwohl spielen sie in der folgenden Darstellung neben den Primärquellen eine sehr wichtige Rolle.
Die vorliegende Monografie berücksichtigt beide der hier skizzierten Forschungsstränge und stützt sich auf die in Ost wie West heute zugänglichen und relevanten Quellen. Selbstverständlich werden dabei auch kontroverse Fragen erörtert, etwa das nicht selten angespannte Verhältnis zwischen polnischen und jüdischen Häftlingsärzten, das in der polnischen Fach- und Erinnerungsliteratur am Rande bzw. überhaupt nicht behandelt und in den jüdischen Zeugnissen oft genug herausgestellt wird.
Zur Quellenlage
Der Bestand an zeitgenössischen Quellen zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz ist begrenzt, da die Täter in großem Stil Unterlagen vernichteten, um die Spuren ihrer Verbrechen zu beseitigen. Das gilt insbesondere für zeitgenössisches Material zum »Gesundheitswesen« in Auschwitz, erst recht zu den ersten zwei Jahren des Häftlingskrankenbaus im KL Auschwitz. Nichtsdestoweniger lassen sich dessen Entstehungsgeschichte und Funktionsweise in den Jahren 1940 bis 1942 dank der Aussagen und Berichte von Überlebenden rekonstruieren. Von den polnischen Häftlingen, die zwischen Juni 1940 und Ende 1941 ins Lager Auschwitz eingeliefert worden waren, überlebten allerdings nur einige wenige und von den jüdischen gar keine. Darüber hinaus ging es der kleinen Gruppe der Überlebenden später oft genug vergleichsweise besser, sodass sie die ersten Jahre schnell vergessen hatten, schrieb Władysław Fejkiel, der zu dieser Gruppe gehörte.19 Die wenigen erhaltenen Quellen befinden sich überwiegend im Archiv der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau (APMO), sei es im Original, sei es in Kopie. Vor diesem Hintergrund kommt Unterlagen der Nachkriegsermittlungen und -gerichtsverfahren gegen Täter und ihre tatsächlichen und vermeintlichen Helfershelfer in Auschwitz in der folgenden Darstellung eine besondere Rolle zu.
In den Monaten Februar und März 1945 ermittelten in Auschwitz Militärstaatsanwälte der I. Ukrainischen Front der Roten Armee. Sie stellten dabei zahlreiche Beweise und Artefakte sicher, vernahmen über 200 Auschwitzüberlebende als Zeugen, darunter ehemalige Häftlingsärzte. Diese Zeugnisse, obwohl oft knapp gehalten, sind – nicht nur wegen ihrer zeitlichen Nähe zu den geschilderten Geschehnissen – relevant. Sie werden im Staatsarchiv der Russischen Föderation (GARF) in Moskau aufbewahrt.
Als ergiebig stellten sich außerdem die kaum erschlossenen Unterlagen der polnischen Kommission für die Untersuchung der deutsch-hitlerschen Verbrechen in Auschwitz (Komisja dla Badania Zbrodni Niemiecko-Hitlerowskich w Oświęcimiu) heraus. Die Kommission wurde im März 1945 gegründet und arbeitete für mehrere Monate. Sie sicherte ebenfalls Dokumente, die auf dem Gelände des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz nach der Befreiung gefunden worden waren, und befragte zahlreiche Auschwitzüberlebende, darunter wiederum Häftlingsärzte. Es entstanden zeitnahe Befragungsprotokolle, die teilweise mehrere Hundert Seiten umfassen. Diese Unterlagen befinden sich im Archiv des Instituts des Nationalen Gedenkens (IPN) in Warschau.
Bedeutsam für die vorliegende Untersuchung sind ferner Ermittlungsunterlagen der Kieler Staatsanwaltschaft gegen Dr. Carl Clauberg, der in Auschwitz »medizinische« Experimente an Hunderten von jüdischen Häftlingsfrauen durchführte. Clauberg starb im August 1957 in der Untersuchungshaft. Von ähnlicher Relevanz sind die Akten zu Ermittlungen gegen den flüchtigen SS-Arzt Josef Mengele, die parallel – aber unabhängig voneinander – von der Frankfurter Staatsanwaltschaft und der polnischen Hauptkommission zur Untersuchung der deutschen Verbrechen in Polen geführt wurden, sowie die Ermittlungsunterlagen der Frankfurter Staatsanwaltschaft im Fall des Arztes Horst Schumann, der in Auschwitz groß angelegte Sterilisierungsexperimente mit Röntgenstrahlen unternahm. Als besonders wertvoll für die vorliegende Arbeit erwiesen sich Ermittlungsakten im Fall Stefan Buthner (ehemals Stefan Budziaszek) der Frankfurter wie auch der polnischen Staatsanwaltschaft. Budziaszek war von Juni 1943 bis zur sogenannten Evakuierung des Lagers leitender Häftlingsarzt in Auschwitz-Monowitz. Beide Ermittlungsverfahren wurden eingestellt.
Insgesamt stellten sich jedoch westdeutsche Ermittlungs- und Gerichtsverfahren für diese Untersuchung als weniger ergiebig heraus als ursprünglich erhofft. Dies hängt mit der Spezifik der westdeutschen Strafverfolgung von NS-Tätern zusammen, mit der sich die Bundesrepublik sehr schwertat. Darauf wird im Epilog noch eingegangen.
Weniger wohlwollend verliefen Gerichtsverfahren gegen NS-Täter in der ehemaligen DDR. Allerdings gab es auch hier nur elf rechtskräftige Gerichtsurteile gegen ehemalige Auschwitztäter, darunter Dr. Horst Fischer, einen ehemaligen SS-Lagerarzt in Auschwitz. Fischer wurde im Jahre 1966 in Ost-Berlin zum Tode verurteilt.20 Er war geständig und auch die Beweislage war erdrückend, wovon die historische Forschung heute profitiert.
Die wichtigsten Quellen zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz – und somit auch der Häftlingsärzte – befinden sich in polnischen Archiven, insbesondere im Archiv der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau sowie im Hauptarchiv und den Regionalarchiven des Instituts des Nationalen Gedenkens. Dies hängt einerseits mit den Aktivitäten der 1947 eingerichteten Auschwitz-Gedenkstätte zusammen, andererseits mit der im März 1945 gegründeten Hauptkommission zur Untersuchung der deutschen Verbrechen in Polen, deren Nachfolgeorganisation das Institut des Nationalen Gedenkens ist.
Die Gedenkstätte Auschwitz sammelt und bewahrt nicht nur zeitgenössische Quellen (im Original und in Kopie) und Artefakte zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Ihre Mitarbeiter befragten ab 1947 außerdem Tausende von Auschwitzüberlebenden und fertigten davon Protokolle an, sie sammelten und sammeln weiterhin einschlägige Zeugnisse über das oben Beschriebene hinaus.21 Sie werten diese Überlieferungen wissenschaftlich aus, verfassen Gutachten für Gerichtsverfahren und veröffentlichen Fachpublikationen wie beispielsweise das in jahrzehntelanger Arbeit entstandene, voluminöse Nachschlagewerk Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939 – 1945 von Danuta Czech, das für die Auschwitzforschung unverzichtbar ist.
Im Gegensatz zu der bundesrepublikanischen ging die polnische Nachkriegsjustiz entschlossen sowohl gegen Auschwitztäter als auch gegen deren Helfershelfer unter den Häftlingen vor, sofern sie ihrer habhaft wurde. Bis 1950 lieferten die alliierten Besatzungsbehörden 1817 mutmaßliche Kriegsverbrecher an Polen aus, darunter einige Hundert, die in Auschwitz eingesetzt waren. Unter ihnen befanden sich der Kommandant Rudolf Höß und sein Nachfolger Arthur Liebehenschel, drei SS-Lagerärzte und ein SS-Lagerzahnarzt.22
Nach neuesten Recherchen sind über 9686 SS-Angehörige (darunter mindestens 200 SS-Aufseherinnen) im KL Auschwitz samt seinen Nebenlagern tätig gewesen. Von ihnen standen 673, darunter 21 Frauen, als Angeklagte vor polnischen Gerichten.23 Dies verdeutlicht den Stellenwert der polnischen Archive für die Erforschung der Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Besonders ergiebig sind die Unterlagen des Ermittlungs- und Gerichtsverfahrens gegen Rudolf Höß (vom 11. bis 29. März 1947 in Warschau), der zum Tode verurteilt wurde, sowie das Verfahren gegen 40 ehemalige Angehörige der Lagermannschaft. Dieser Prozess fand vom 24. November bis zum 16. Dezember 1947 in Krakau statt.24
Hinzu kommen zahlreiche Ermittlungs- und Gerichtsverfahren gegen ehemalige Auschwitzhäftlinge, auch gegen ehemalige Häftlingsärzte und -pfleger. In der westlichen Forschung wurden diese Quellen bislang kaum rezipiert. In der vorliegenden Darstellung spielen sie – wie die unveröffentlichten Augenzeugenberichte und Erinnerungen ehemaliger Auschwitzhäftlinge, darunter Häftlingsärztinnen und -ärzte, die sich zumeist im Archiv der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau befinden – eine zentrale Rolle.
Zum Umgang mit den Quellen
Forschungen und Publikationen zur Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz stützen sich weitgehend auf Nachkriegsberichte und -zeugnisse sowie auf Erinnerungen von Überlebenden. Sie spiegeln naturgemäß die Sicht Einzelner wider. Sie werden dadurch nicht falsch, aber man muss solche Zeugnisse mit Bedacht auswerten. Oft genug lässt jedoch der Umgang mit ihnen einiges zu wünschen übrig. So werden Berichte und Aussagen von Augenzeugen unverifiziert als Tatsachen wiedergegeben oder der historische Hintergrund wird außer Acht gelassen bzw. entstellt dargestellt.
»Ursprünglich nahm man an«, so die Psychologin Anna Abraham, »das Gedächtnis liefere eine getreue Abbildung der vergangenen Wirklichkeit. Aber heute wissen wir, dass unsere Erinnerungen keinesfalls solide sind. Vielmehr sind sie wie gestrickt. Und die Vorstellungskraft strickt mit: Dinge werden ausgelassen, Dinge werden dazugedichtet, verschönert, aufgebauscht. Die Neurowissenschaft zeigt, dass das Gedächtnis und die Vorstellungskraft nicht nur eng miteinander verwoben sind – sondern sich häufig überlappen.«25 Ferner ist sich die empirische Forschung einig, dass die Erinnerung infolge von traumatischen Erlebnissen leidet. »Unter großer Belastung ist die menschliche Wahrnehmung mangelhaft, weil Stress die Aufmerksamkeit einschränkt.«26 Die in Auschwitz herrschenden Verhältnisse waren höchst traumatisierend – und das schlägt sich folglich auch in den Erinnerungen der Überlebenden nieder.
»Die Skepsis gegenüber Augenzeugenberichten ist vermutlich so alt wie die Menschheitsgeschichte«, führt der Psychologe Edgar Erdfelder in einem Beitrag zum Thema aus. »Der griechische Geschichtsschreiber Thukydides (460 – 396 v. Chr.) [beklagte] widersprüchliche Darstellungen historischer Ereignisse durch mehrere Augenzeugen – ein ihm wohlbekannter Sachverhalt, den er auf Voreingenommenheit und Gedächtnislücken zurückführte. […] Doch nicht nur in der Philosophie und den Geschichtswissenschaften, auch in den Kriminal- und Rechtswissenschaften ist eine skeptische Haltung gegenüber Zeugenaussagen seit alters nachweisbar.«27 Trotzdem lässt sich auf Augenzeugenberichte als Beweismittel vor Gericht ebenso wenig verzichten wie in der Geschichtsforschung, also auch bei der Erforschung der Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz.
Nicht selten basieren einzelne Elemente in den Berichten ehemaliger Auschwitzhäftlinge auf Hörensagen. In solchen Fällen sind sie oft unpräzise und geben mitunter – in gutem Glauben – verzerrende oder gar falsche Darstellungen wieder. Es kommt aber auch vor, dass manche intendiert falsch berichten, zumindest teilweise. Den Hintergrund liefern dabei – wohl in den meisten Fällen – persönliche Animositäten und Konflikte, aber auch Vorurteile oder gar Verleumdungskampagnen.
Das Buch Der SS-Staat von Eugen Kogon enthielt in den ersten Auflagen scharfe Beschuldigungen gegen den Häftlingsarzt im KL Auschwitz-Monowitz Stefan Budziaszek. Kogon stützte sich auf die schriftliche Aussage von Stefan Heymann, einem ehemaligen kommunistischen Häftling, der nach Kriegsende für den sowjetischen Nachrichtendienst arbeitete und in der DDR als SED-Propagandist und von 1950 an als Diplomat Karriere machte.28 Budziaszek intervenierte daraufhin bei Kogon, genauso wie zahlreiche andere ehemalige Auschwitzhäftlinge, die sich für den Häftlingsarzt einsetzten. Kogon stellte in einer Erklärung vom 24. April 1951 fest:
Aus der dokumentierten Unterredung mit Herrn Dr. Stefan Budziaszek ergibt sich für mich Folgendes: (a) Offensichtlich ist Stefan Heymann, der ein sehr aktiver Kommunist war und ist, aus politischen Motiven seiner Partei gegen Herrn Dr. Budziaszek in Aktion getreten. Der Anlass waren persönliche Differenzen, die zwischen Stefan Heymann und Herrn Dr. Budziaszek in Monowitz nach einer vorübergehenden Zeit guter Zusammenarbeit sich ergeben hatten. Derlei Situationen und ihr Missbrauch sind mir leider aus meiner eigenen Lagererfahrung nur allzu gut bekannt.29
Auch Neid spielte bei solchen falschen Beschuldigungen eine Rolle. Insbesondere Funktionshäftlinge, so der bereits zitierte Dr. Otto Wolken im April 1945, sahen sich »vielfach« mit dem Umstand konfrontiert, dass »Häftlinge, die keine Funktionsposten im Lager hatten, aus Neid bestimmte Vorwürfe erfanden bzw. übertrieben darstellten«.30
Andere wiederum taten genau das Gegenteil. Die deutsche Jüdin Dr. Lucie Adelsberger, Häftlingsärztin in Auschwitz-Birkenau, hatte unmittelbar nach der Befreiung ihre Erinnerungen niedergeschrieben. Veröffentlich wurden sie erst 1956 unter dem Titel Auschwitz: Ein Tatsachenbericht. Das ursprüngliche Manuskript war etwa dreißig Seiten länger gewesen. Adelsberger »hat diese für den Druck herausgenommen, weil sie offenbar Namen enthielten, mit denen sie zu diesem Zeitpunkt nicht in eine solche Diskussion involviert sein wollte«.31 Andere wiederum milderten frühere, kritische Darstellungen einiger Personen ab oder wandelten sie gar vom Negativen ins Positive um.32
Ein anderes Phänomen ist der sogenannte »hyperhistorical complex of the survivors«. In Tausenden von Berichten und Erinnerungen jüdischer Überlebender wird an die Ermordung der Juden in Europa erinnert. Diese Quellen gehören ohne Zweifel zu den wichtigsten Zeugnissen des Holocaust, in der westlichen Narration über den Holocaust spielen sie die Schlüsselrolle. Der Umgang mit ihnen ist jedoch wie mit jeder historischen Überlieferung nicht unproblematisch. Dr. Samuel Gringauz, ein Holocaust-Überlebender, wies bereits im Jahre 1950 auf eine spezifische Problematik im Umgang mit diesen Zeugnissen hin:
The difficulties in studying the great Jewish catastrophe are manifold. […] Last but not least, there is what perhaps may be termed, the hyperhistorical complex of the survivors. Never before was the event so deeply sensed by its participants as being part of an epoch-shaping history in the making, never before was a personal experience felt to be so historically relevant. […] The result of this hyperhistorical complex has been that the brief post-war years have seen a flood of »historical materials« – rather »contrived« than »collected« – so that today one of the most delicate aspects of research is the evaluation of the so-called »research material«.33
Im Jahre 1952 fand in Israel ein Gerichtsverfahren gegen Raya Hanes statt, die im Frauenlager Auschwitz-Birkenau jüdische Blockälteste gewesen war und nach Zeugenaussagen für zahlreiche Misshandlungen verantwortlich. Trotzdem wurde sie von Richter Zeev Zeltner freigesprochen.
As in other trials, the judge wrote that some of the witnesses expressed deep animosity toward the defendant. […] After so many years of torment, the judge wrote, this animosity was understandable, »but hatred blinds one … and one must treat this testimony very cautiously«. From their vantage points the prosecution witnesses viewed Hanes as wicked and cruel and thus as fulfilling the demonic Nazi program. But, so Zeltner concluded, many of the witnesses suffered from »a general psychosis« – in the spirit of 1950s psychology, he attributed a mental pathology to the witnesses. […] These witnesses, the judge seemed to be saying, had only a limited grasp of the position in which Hanes hand found herself.34
Trotz all dieser hier angeführten Bedenken etablierte sich inzwischen der sogenannte affirmative Umgang mit Überlieferungen, die von Holocaustüberlebenden stammen. Den Quellen wird dabei, begründet in der Haltung gegenüber den Überlebenden, ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit unterstellt, ein Zugang, der Quellenkritik zu unterlaufen droht.35
Abgesehen davon, dass ein affirmativer Umgang mit Überlieferungen – gleichgültig welcher Provenienz – gegen die Grundregeln nicht nur der historischen Forschung verstößt, lockt diese Haltung Hochstapler, Betrüger und Fälscher geradezu an. Sie missbrauchen dieses gesellschaftliche Klima, um sich als Überlebende des Holocaust bzw. als deren Nachkommen (somit indirekte Holocaustopfer) auszugeben. Die Motive dafür sind zahlreich und decken ein breites Spektrum von materiellen bis hin zu psychischen Gewinnen ab. Manche dieser erfundenen Erinnerungen sind sogar als Buch oder Film in die öffentliche Erinnerung eingegangen.
Die affirmative Haltung schützt diese Hochstapler vor kritischen Fragen und Zweiflern und erleichtert oder ermöglicht gar erst ihre Betrügereien, die dann doch, manchmal erst nach Jahren, aufgedeckt werden. Aber dann ist der Schaden oft schon angerichtet: ideell, materiell und vor allem an der historischen Wahrheit.36 Das vorliegende Buchprojekt ist in gewisser Weise das Nebenprodukt eines solchen Fälschungsversuchs, den der Autor in dem 2019 erschienenen Buch Mengeles Koffer detailliert dargestellt hat.37
Zum Aufbau des Buches
Polnische Publikationen sind eher polnisch orientiert, die der jüdischstämmigen Autoren hingegen eher ›judeozentrisch‹. In diesem Buch wird versucht, die beiden Narrationsstränge zusammenzuführen. Polnische Häftlingsärzte hatten eine andere Perspektive und Lagererfahrung als jüdische. Viele von ihnen waren schon ab 1940 in Auschwitz und wurden erst nach und nach im Lagerhospital beschäftigt, allerdings zunächst als Häftlingspfleger, da Häftlingsärzte bis Ende 1941 nicht erlaubt waren. Die ersten jüdischen Häftlinge, die von Beruf Mediziner waren, durften erst im April/Mai 1942 im Häftlingskrankenbau (HKB) tätig werden, anfangs ebenfalls lediglich als Häftlingspfleger. Von ihnen überlebten aber nur einige wenige, die Zeugnis darüber ablegen konnten. Im Herbst 1942 änderte sich die Lage erneut: Von nun an wurden in den Krankenbauen immer mehr jüdische Ärzte unter den Häftlingen, und zwar auch formal, als Häftlingsärzte beschäftigt. Von ihnen überlebte ein Großteil das Lager und war in der Lage, die Geschehnisse aus eigenem Blickwinkel darzustellen.
Die folgende Darstellung ist chronologisch und sachlich in vier Teile gegliedert. Dreh- und Angelpunkt sind die Zeugnisse der Zeitzeugen, deren Biografien sich im Laufe der Untersuchung entfalten. Zu denjenigen Häftlingsärztinnen und Häftlingsärzten, die für diese Studie die größte Rolle spielen, finden sich im Anhang Kurzbiografien.
Die Entstehungsgeschichte des Konzentrationslagers Auschwitz und die Lebensbedingungen, mit denen die Häftlinge sich konfrontiert sahen, stehen im Zentrum des ersten Teils. Auschwitz, so wird deutlich werden, unterschied sich von Beginn an von anderen Lagern im deutschen Machtbereich. Eingerichtet als Konzentrationslager für zunächst polnische Häftlinge, erwies es sich für die Angehörigen der polnischen Führungseliten, die gezielt hierhin gebracht wurden, als regelrechte Vernichtungsstätte. Sie sollten nach dem Willen der SS das Lager nicht lebend verlassen. Neben dem SS-Lagerpersonal spielte dabei das Kaposystem mit seinen Auswüchsen eine fatale Rolle. Diese mörderischen Ziele bestimmten den Alltag der Häftlinge, die in Reaktion darauf unterschiedliche Überlebensstrategien entwickelten. Der hier geschilderte Lagerkosmos bildet den historischen Hintergrund für alles Weitere.
Der zweite Teil dreht sich um den Aufbau des »Gesundheitswesens« im KL Auschwitz und seine Besonderheiten in der Zeit vom Juni 1940 bis zum Frühjahr 1942. Das Ziel der pseudomedizinischen Versorgung war, wie sich schnell zeigte, der Tod. Im Krankenrevier für die Lagerinsassen, das mit steigender Häftlings- und Krankenzahl zu einem Häftlingskrankenbau (HKB) mit mehreren Blocks ausgebaut wurde, fehlte es an allem, das Sagen hatten unter der Aufsicht der SS-Lagerärzte deutsche Funktionshäftlinge ohne medizinische Fachkenntnisse. Gelegentlich ließen einige SS-Lagerärzte (aus pragmatischen Gründen) jedoch vereinzelt Ärzte unter den Häftlingen, die sich allerdings als Handwerker ausgeben mussten, im Krankenbau arbeiten.
Deren Möglichkeiten, jenen zu helfen, denen die Aufnahme in den Krankenbau gelungen war, waren allerdings äußerst begrenzt. Nachgezeichnet wird hier unter anderem die »Lagermedizin«, die sie unter den gegebenen Umständen zu entwickeln suchten. Gegen eine der – neben dem Lagerterror und Erschießungen – Haupttodesursachen im Lager, den Hunger, konnten sie allerdings kaum etwas ausrichten. Außerdem begannen SS-Lagerärzte 1941, im Krankenbau dank ihres unbeschränkten Zugriffs auf die Häftlinge verschiedene Tötungsmethoden zu erproben und weiterzuentwickeln. Im Rahmen der sogenannten Aktion 14f13, der systematischen Ermordung »nicht arbeitsfähiger« Häftlinge, testeten sie vor allem die Injektion giftiger Substanzen und den Einsatz von Zyklon B.
Das Jahr 1942 markiert Wendepunkte in Funktion und Intention des Konzentrationslagers Auschwitz, die sich auch auf das dort gehandhabte »Gesundheitswesen« auswirkten. Auschwitz wurde zum Vernichtungskomplex ausgebaut – durch Arbeit im ursprünglichen KL Auschwitz (Stammlager), in den neu errichteten Lagern Buna/Monowitz und den zahlreichen Nebenlagern, durch industriell perfektionierte Massentötung der europäischen Juden im Lager Auschwitz-Birkenau. Die unterschiedlichen Ziele der jeweiligen Lager wirkten sich auch auf den Ausbau und die Gestaltung der medizinischen Versorgung aus. Dies ist das Thema des dritten Teils, der die Entwicklungen in den jeweiligen Lagern bis zur Räumung des Lagers im Januar 1945 schildert.
In all diesen Lagern wurden ab 1942 nach und nach zunächst polnische, dann auch jüdische Ärzte unter den Häftlingen in den Krankenbauten eingesetzt, die bis zum Herbst 1943 den Einfluss der deutschen Funktionshäftlinge zurückdrängen konnten. Dies kam der Versorgung der kranken Häftlinge zugute, stellte die Häftlingsärzte aber auch vor Dilemmata. Denn in ihrer Funktion mussten sie sich auch zu den mörderischen Anforderungen der SS-Lagerärzte verhalten: wenn es um die erzwungene Mitwirkung an Selektionen in den Krankenbauten, an tödlichen Maßnahmen der »Seuchenbekämpfung« sowie an medizinischen »Experimenten« und »Versuchsreihen« ging. Diese Fragen zählen zu den größten Tabus, wenn es um die Tätigkeit der Häftlingsärzte in Auschwitz geht. Wie belastet (und belastend) die damit einhergehenden Entscheidungen sind, haben in jüngster Zeit die öffentlichen Diskussionen um ärztliche Triage im Zuge der weltweiten Coronapandemie in Erinnerung gerufen. Die Häftlingsärztinnen und -ärzte handelten unter ungleich schwierigeren Bedingungen. Wie sie mit diesen Zwangslagen umgingen, damit befasst sich der vierte Teil.
Der Epilog ist der Nachkriegsgeschichte gewidmet – den Schicksalen einiger Häftlingsärztinnen und -ärzte nach ihrer Befreiung sowie dem Kampf um Aufklärung und juristische Verfolgung der deutschen Auschwitztäter, den sie nach ihrer Befreiung aufnahmen.
Das Literaturverzeichnis enthält nur die Literatur, die in der Darstellung direkt zitiert oder erwähnt wird. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die in dieser Studie zitierten und verwendeten Vernehmungsprotokolle, Zeugnisse und Augenzeugenberichte sind bis auf wenige Ausnahmen in der jeweiligen Landessprache der Archive, in denen sie aufbewahrt werden, verfasst. Wo dies nicht der Fall ist, wird dies gesondert vermerkt. Übersetzungen aus dem Französischen wurden von Stefanie Markert aus Halle an der Saale besorgt. Russische und polnische Quellen hat der Verfasser sinngemäß übersetzt und wiedergegeben. Für eventuelle Übersetzungsfehler ist allein der Verfasser verantwortlich.
Angeklagte wie Rudolf Höß und andere haben in polnischer Haft Berichte und Erklärungen auf Deutsch abgegeben. Wo dies aus dem Dokumententitel hervorgeht, ist die Originalsprache nicht eigens angegeben.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Frau Andrea Böltken aus Berlin für das Lektorat bedanken, für ihre kritischen Rückfragen, für ihre Formulierungs- und auch Kürzungsvorschläge, die das ursprüngliche Manuskript lesefreundlicher gemacht haben. Dieses Buch konnte nur aufgrund der Unterstützung der »Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur« entstehen, wofür ich Jan Philipp Reemtsma, dem Vorstand der Stiftung, persönlichen Dank schulde.
1Viktor E. Frankl, … trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager, mit einem Vorwort von Hans Weigel, 9. Aufl., München 2005, S. 40.
2Häftlingspersonalbogen Dr. Viktor Frankl, Dachau: Arolsen Archives, 1.1.6.2/10054057/I TS Digital Archive; Danuta Czech, Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939 – 1945, 2. Aufl., Reinbek bei Hamburg 2008, S. 36.
3Bericht/Anhörung Dr. Otto Wolken vom 17.4.1945 (deutsch, Abschrift): AIPN, GK 196/88, Bl. 131–303, hier Bl. 172–190.
4Zeugenvernehmung Dr. Otto Wolken vom 29.9.1970: Fritz Bauer Institut, 4 Js 798/64, Bd.5, Bl. 888–890, hier Bl. 888v–889v.
5Robert Jay Lifton, The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide, New York 1986. Hier wird im Weiteren die deutsche Ausgabe Ärzte im Dritten Reich, Stuttgart 1988, verwendet.
6Zitiert nach Sari J. Siegel, »Treating an Auschwitz Prisoner-Physician: The Case of Dr. Maximilian Samuel«, in: Holocaust and Genocide Studies 28 (2014) 3, S. 450–481, hier S. 451.
7Danuta Czech, »Die Rolle des Häftlingskrankenbaulagers im KL Auschwitz II«, in: Hefte von Auschwitz 15 (1975), S. 5–112; Antoni Makowski, »Organisation, Entwicklung und Tätigkeit des Häftlings-Krankenbaus in Monowitz (KL Auschwitz III)«, in: Hefte von Auschwitz 15 (1975), S. 113–181; Tadeusz Paczuła, »Organisation und Verwaltung des ersten Häftlingskrankenbaus in Auschwitz«, in: Die Auschwitz-Hefte, hg. vom Hamburger Institut für Sozialforschung, Hamburg 1994, Bd.1, S. 159–165; Kazimierz Hałgas, »Die Arbeit im ›Revier‹ für sowjetische Kriegsgefangene in Auschwitz. Ein Bericht«, in: ebenda, S. 167–172; Irena Białówna, »Aus der Geschichte des Reviers im Frauenlager in Birkenau«, in: ebenda, S. 173–184; Tadeusz Szymański/Danuta Szymańska/Tadeusz Śnieszko, »Das ›Spital‹ im Zigeuner-Familienlager in Auschwitz-Birkenau«, in: ebenda, S. 199–208; Władysław Fejkiel, Więźniarski szpital wKL Auschwitz, Oświęcim 1994; Irena Strzelecka, »Die Häftlingsspitäler (›Häftlingskrankenbau‹) im KL Auschwitz«, in: Auschwitz 1940 – 1945. Studien zur Geschichte desKonzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, hg. von Wacław Długoborski und Franciszek Piper, 5 Bde., Oświęcim 1999, Bd.2: Die Häftlinge: Existenzbedingungen, Arbeit und Tod, S. 353–421; Ruth Jolanda Weinberger, Fertility Experiments in Auschwitz-Birkenau. The Perpetrators and Their Victims, Saarbrücken 2009; Maria Ciesielska, Szpital obozowy dla kobiet w KL Auschwitz-Birkenau (1942 – 1945), Warszawa 2015. Darüber hinaus erschienen in den Jahren 1958 bis 1991 zahlreiche Berichte ehemaliger Häftlingsärztinnen und -ärzte, die in der polnischen Ausgabe der Hefte von Auschwitz (Przegląd Lekarski – Oświęcim) veröffentlicht wurden. Zu erwähnen ist außerdem der Band De l’Université aux Camps de Concentration. Temoignages Strasbourgeois, Strasbourg 1989 [1945] mit Berichten der Häftlingsärzte Marc Klein (S. 429–455), Robert Levy (S. 457–466) und Robert Waitz (S. 467–499).
8Vgl. u. a. Claude Romney, »Ethical Problems Encountered by Auschwitz Prisoner Doctors«, in: Remembering for the Future: The Holocaust in an Age of Genocide, hg. von John K. Roth und Elisabeth Maxwell, New York 2001, Bd.1, S. 319–334; Astrid Ley, »Kollaboration mit der SS zum Wohle von Patienten? Das Dilemma der Häftlingsärzte in Konzentrationslagern«, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 61 (2013) 2, S. 123–139; Michael A. Grodin (Hg.), Jewish Medical Resistance in the Holocaust, New York/Oxford 2014; Hans-Joachim Lang, Die Frauen von Block 10. Medizinische Versuchein Auschwitz, Hamburg 2011; Ross Halpin, The Essence of Survival: How Jewish DoctorsSurvived Auschwitz, Darlinghurst, N.S.W., 2014; ders., Jewish Doctors and the Holocaust:The Anatomy of Survival in Auschwitz, Berlin/Jerusalem 2018; Siegel, »Treating an Auschwitz Prisoner-Physician«.
9Siehe die bereits erwähnte Zeitschrift Przegląd Lekarski – Oświęcim mit zahlreichen Artikeln, Erinnerungen und Beiträgen ehemaliger, nicht nur polnischer Häftlingsärztinnen und -ärzte. Eine Auswahl dieser Texte wurde 1994 in deutscher Übersetzung unter dem Titel Die Auschwitz-Hefte vom Hamburger Institut für Sozialforschung herausgegeben. Auch einige ausgewählte Hefte erschienen in deutscher Sprache. Zurzeit werden diese historisch-wissenschaftlich und auch nicht selten medizinisch-historisch wertvollen Beiträge vom Polnischen ins Englische übersetzt.
10Halpin, Jewish Doctors.
11Das gilt beispielsweise für die ehemalige Häftlingsärztin Dr. Alina Brewda, die Halpin allein anhand ihrer Selbstzeugnisse aus dem Jahre 1966 schildert (ebenda, S. 91–97). Es gibt jedoch genug Quellen, die dieses Bild zumindest teilweise korrigieren. Mehr dazu siehe unten. Auch das im April 2022 erschienene Sachbuch LesMédecins d’Auschwitz des französischen Autors und Arztes Bruno Halioua fußt ausschließlich auf den im Westen erschienenen Memoiren- und Fachpublikationen; eigene Archivrecherchen hat Halioua nicht angestellt. Ferner befasst sich der Autor in seiner Abhandlung nur mit dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II).
12Als wichtige Ausnahme ist Ewa K. Bacon zu nennen. In Saving Lives in Auschwitz. ThePrisoners’ Hospital in Buna-Monowitz, West Lafayette, IN, 2017, beschreibt Bacon die Geschichte ihres Vaters Stefan Budziaszek, der von Juni 1943 bis zur Räumung des Lagers der leitende Häftlingsarzt (HKB-Älteste) in Auschwitz-Monowitz war. Sie berücksichtigt in ihrer Untersuchung nicht nur unveröffentlichte Berichte ihres Vaters, sondern auch Darstellungen anderer Auschwitzhäftlinge, die in Polen veröffentlicht worden sind, sowie die einschlägige polnische Forschungsliteratur.
13Mikloš Nyiszli, Im Jenseits der Menschlichkeit. Ein Gerichtsmediziner in Auschwitz, 3., um ein Nachwort erw. Aufl., Berlin 2011, S. 7.
14Olga Lengyel, Five Chimneys: The Story of Auschwitz, Chicago 1947.
15Ella Lingens-Reiner, Prisoners of Fear, London 1948. Im Jahre 2003 erschien die deutsche Ausgabe: Ella Lingens, Gefangene der Angst. Ein Leben im Zeichen des Widerstandes, hg. und mit einem Vorwort versehen von Peter Michael Lingens.
16Vgl. u. a. A Jewish Doctor in Auschwitz: The Testimony of Sima Vaisman, mit einem Vorwort von Serge Klarsfeld und einem Nachwort von Diane von Furstenberg, Hoboken, NJ, 2005 (aufgeschrieben wenige Tage nach der Befreiung des KL Auschwitz); Lucie Adelsberger, Auschwitz: Ein Tatsachenbericht. Das Vermächtnis der Opfer für uns Juden undfür alle Menschen, 2., verb. Aufl., hg. von Eduard Seidler, Bonn 2005. Adelsberger war Häftlingsärztin in Auschwitz-Birkenau. Marco Nahon, Birkenau: The Camp of Death, Tuscaloosa, AL, 1989. Nahon verfasste seinen Bericht unmittelbar nach der Befreiung in französischer Sprache. André-Abraham-David Lettich, Trente-quatre moisdans les Camps de Concentration. Témoignage sur les crimes »scientifiques« commis par lesmédecins allemands, Tours 1946; Gisella Perl, Ich war eine Ärztin in Auschwitz, Wiesbaden 2020 (das englische Original erschien 1948); R.J. Minney, I Shall Fear no Evil. The Storyof Dr Alina Brewda, London 1966; Adélaïde Hautval, Medizin gegen die Menschlichkeit.Die Weigerung einer nach Auschwitz deportierten Ärztin, an medizinischen Experimenten teilzunehmen, Berlin 2008; Eddy de Wind, Ich blieb in Auschwitz. Aufzeichnungen eines Überlebenden 1943 – 45, München 2020 (Übersetzung aus dem Niederländischen).
17Stanisław Jagielski, Sclavus Saltans, Wspomnienia lekarza obozowego, Warszawa 1946; Alfred Fiderkiewicz, Brzezinki. Wspomnienia z obozu, 2. Aufl., Warszawa 1956; Czesław Wincenty Jaworski, Apel Skazanych: Wspomnienia z Oświęcimia (Oświęcim, Brno, Monowice), Warszawa 1962; Władysław Fejkiel, »Medycyna za drutami«, in: Pamiętniki lekarzy, hg. von Kazimierz Bidakowski undTadeusz Wójcik, Warszawa 1964, S. 404–546. Hinzu kommen Veröffentlichungen in der Zeitschrift Przegląd Lekarski – Oświęcim.
18Władysław Fejkiel, »Dur wysypkowy w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu w latach 1941 – 1944«, in: Rozprawy Wydziału Nauk Medycznych 3 (1958), Bd.3, S. 5–50.
19Fejkiel, »Medycyna za drutami«, S. 439.
20Vgl. Henry Leide, Auschwitz und Staatssicherheit. Strafverfolgung, Propaganda und Geheimhaltung in der DDR, Berlin 2019. Zur Zahl der Gerichtsurteile siehe S. 71.
21Als Übersicht über die Bestände im Archiv der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau vgl. u. a. Czech, Kalendarium, S. 7–13; vgl. auch den Beitrag »Auschwitz-Birkenau. Vergangenheit und Gegenwart« auf der Website der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, https://tinyurl.com/fma2eyzr [Zugriff: 7.5.2021].
22Bogdan Musial, »NS-Kriegsverbrecher vor polnischen Gerichten«, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 47 (1999) 1, S. 25–56; vgl. auch den Beitrag »Procesy esesmanów z załogi KL Auschwitz« auf der Website der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, https://tinyurl.com/mryevct9 [Zugriff: 26.12.2020].
23Vgl. die editorische Vorbemerkung zur Datenbank »SS-Mannschaft KL Auschwitz«, die Dr. habil. Aleksander Lasik in Zusammenarbeit mit dem Institut für Nationales Gedenken erstellte. Sie ist einzusehen auf der Website truthaboutcamps.eu; zur editorischen Vorbemerkung siehe https://tinyurl.com/4tfyse3v [Zugriff: 26.12.2020]; Łukasz Gramza, »Verfolgung der Täter der im Vernichtungslager KL Auschwitz-Birkenau begangenen Verbrechen«, in: truthaboutcamps.eu, hier https://tinyurl.com/y39u4h4s [Zugriff: 13.12.2022]; »Procesy«. Die früheren Schätzungen gingen von insgesamt etwa 8000 SS-Angehörigen und etwa 200 SS-Aufseherinnen in Auschwitz aus. Vgl. Der Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963 – 1965). Kommentierte Quellenedition, hg. von Raphael Gross und Werner Renz, 2 Bde., Frankfurt a. M./New York 2013, hier Bd.1, S. 10.
24Im Krakauer Auschwitzverfahren wurden 23 Angeklagte zum Tode verurteilt, sechs erhielten lebenslängliche, sieben 15-jährige und drei drei- bis fünfjährige Gefängnisstrafen. Ein Angeklagter, der ehemalige SS-Arzt Hans Münch, wurde freigesprochen. Vgl. Urteil des Obersten Nationalen Tribunals (Najwyższy Trybunał Narodowy) vom 22.12.1947: AIPN, GK 196/168, Bl. 1–54, hier Bl. 51–54.
25Interview mit Anna Abraham, »Es gibt kein langweiliges Leben – nur einen Mangel an Vorstellungskraft«, in: Psychologie heute 47 (2020) 12, S. 36–40, hier S. 38, https://tinyurl.com/24w6n7c4 [Zugriff: 13.12.2022]. Siehe auch dies. (Hg.), The CambridgeHandbook of the Imagination, Cambridge u. a. 2020.
26Elizabeth F. Loftus/James M. Doyle, Eyewitness Testimony: Civil and Criminal, Charlottesville 1997, S. 21–31 (Zitat S. 29).
27Edgar Erdfelder, »Das Gedächtnis des Augenzeugen. Aktuelle Hypothesen und Befunde zur Genese fehlerhafter Aussagen«, in: Report Psychologie 28 (2003) 7/8, S. 434–445, hier S. 435. Dabei sind »nichtintendierte Falschaussagen (Irrtümer)« von »intendierten Falschaussagen (Lügen)« zu unterscheiden.
28Zu den biographischen Angaben siehe den Beitrag »Heymann, Stefan (14.3.1896 – 4.5.1967)« aus dem Handbuch Wer war wer in der DDR, zitiert nach https://tinyurl.com/2p8h3yyx [Zugriff: 22.12.2020].
29Erklärung Dr. Eugen Kogon vom 24.4.1951, notariell beglaubigte Kopie: Fritz Bauer Institut, Ermittlungsakten im Fall Stefan Buthner, 4 Js 798/64, Bd.1, Bl. 14 f.
30Am 17. April 1945 fand eine Sitzung der Auschwitz-Kommission statt, in der das Verhalten von Juliusz Genszer als ehemaliger Auschwitzhäftling diskutiert wurde. Genszer sollte als Blockältester im Block 18 in Auschwitz-Birkenau andere Häftlinge misshandelt haben. Dr. Alfred Fiderkiewicz, ein ehemaliger Häftlingsarzt im Nachbarblock, nahm Genszer in Schutz. Auch der oben angeführte Dr. Wolken konnte nichts Nachteiliges über Genszer sagen und traf die zitierte Aussage über den Neid, der zu »großer Vorsicht« gemahne. Fiderkiewicz »bestätigte voll diese letzten Ausführungen von Dr. Wolken«, heißt es im Sitzungsprotokoll der Kommission für die Untersuchung der deutsch-hitlerschen Verbrechen in Auschwitz am 17.4.1945: AIPN, GK 69/2, Bl. 1–4.
31Adelsberger, Auschwitz, S. 143. Adelsberger erwähnt Häftlingsärzte in ihrem Text nicht namentlich.
32Beispielsweise der niederländische Jude Eddy de Wind, ein Häftlingsarzt im Stammlager Auschwitz. In seinen Memoiren stellt er die Person von Dr. Max Samuel neutral dar. Vgl. Wind, Ich blieb in Auschwitz, S. 46–48. In einem Bericht, den de Wind unmittelbar nach der Befreiung durch die Rote Armee verfasst hatte, beschreibt er Samuel hingegen durchaus kritisch; dieser habe Frauen in der Versuchsstation »mit großem Eifer« operiert. Vgl. Bericht Eduard de Wind über gynäkologische Experimente im KL Auschwitz, o.D. [Februar/Anfang März 1945]: GARF, f. 7021, op. 108, d. 50, Bl. 1–6, hier Bl. 2; handschriftliches Original in niederländischer Sprache: ebenda, d. 46, Bl. 13–19.
33Samuel Gringauz, »Some Methodological Problems in the Study of the Ghetto«, in: Jewish Social Studies: A Quarterly Journal Devoted to the Historical Aspects of the Jewish Life 12 (1950) 1, S. 65–72, hier S. 65 f.
34Dan Porat, Bitter Reckoning. Israel Tries Holocaust Survivors as Nazi Collaborators, Cambridge, MA, 2019, S. 121 f.
35Vgl. Peter Novick, Nach dem Holocaust. Der Umgang mit dem Massenmord, Stuttgart/München 2001, S. 95: »In den letzten Jahren ist ›Überlebender des Holocaust‹ ein Ehrentitel geworden, der nicht nur Mitgefühl, sondern Bewunderung und sogar Ehrfurcht erregt. Überlebende werden aufgrund ihres Leidens als beispielhaft für ihre Tapferkeit, ihre Stärke und ihre Weisheit angesehen und meist auch so beschrieben.«
36Vgl. u. a. Bogdan Musial, Mengeles Koffer. Eine Spurensuche, Hamburg 2019. Zu Beispielen und Motiven siehe S. 145–163.
37So hatte sich eine gewisse Magdolna Kaiser spätestens seit den 1990er Jahren als Enkelin eines ungarischen Juden und Häftlingsarztes aus Auschwitz ausgegeben, der mit dem berüchtigten SS-Arzt Josef Mengele bei dessen Experimenten zusammengearbeitet habe. Kaiser fälschte u. a. Tagebuchnotizen, Aufzeichnungen und Memoiren des erfundenen Großvaters aus dessen angeblicher Haftzeit in Auschwitz mit dem Ziel, diese als authentisches historisches Dokument veröffentlichen zu lassen. Diese Veröffentlichung sollte dann u. a. die Vorlage für eine Dokumentation und einen Spielfilm liefern.
KL Auschwitz: Intentionen, Aufbau und Funktionsweise
Von Anfang an: Vernichtungsstätte
Das Konzentrationslager Auschwitz ist nach 1945 zum Synonym für den Holocaust geworden. Hier wurden etwa eine Million Juden aus verschiedenen europäischen Ländern ermordet: aus Polen in den Vorkriegsgrenzen, Ungarn, Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Griechenland, der Tschechoslowakei, Belgien, Frankreich, Rumänien, Jugoslawien, Italien und Norwegen. In den anderen Todeslagern (Belzec, Sobibor, Treblinka und Kulmhof) wurden in erster Linie polnische Juden umgebracht; Überlebende, die hätten Zeugnis ablegen können, gab es kaum. Darüber hinaus wurden die dortigen Massentötungseinrichtungen noch vor der Befreiung vernichtet und jegliche Spuren beseitigt.
In Auschwitz-Birkenau gelang das der Lagermannschaft nicht mehr im gleichen Umfang. Zwar wurden die Vernichtungsanlagen gesprengt, die Ruinen blieben aber stehen. Ferner überlebten die Hölle von Auschwitz Abertausende von jüdischen und nichtjüdischen Häftlingen, die nach der Befreiung über ihr Leid berichten konnten und dies auch taten. Diese Zeugnisse prägen heute die Narration über Auschwitz im Besonderen und über den Holocaust im Allgemeinen. In diesem Umstand ist auch die besondere Stellung von Auschwitz in der Holocaust-Erinnerung und -Forschung begründet.
Bevor jedoch das KL Auschwitz zum größten Vernichtungslager für europäische Juden ausgebaut wurde, hatte es als Internierungs- und Mordstätte für polnische Führungseliten fungiert. Die Genese und Errichtung des KL Auschwitz hängen nämlich in erster Linie mit der deutschen »Polenpolitik« zusammen.
Das KL Auschwitz unterschied sich von Anfang an von den übrigen deutschen Konzentrationslagern, die ab 1933 errichtet worden waren. Hier wurden zunächst politische Gegner, Kriminelle, »Asoziale« und deutsche Juden, nach der Zerschlagung der »Rest-Tschechei« im März 1939 auch tschechische und ab September 1939 polnische Häftlinge in großer Zahl interniert. Das KL Auschwitz entstand hingegen formal als Internierungseinrichtung für ausschließlich polnische Häftlinge. In Wirklichkeit sollte es als Vernichtungsstätte für Polens Elite dienen. Für diese These mangelt es zwar täterseits an eindeutigen zeitgenössischen Quellen, es gibt aber starke Indizien dafür und vor allem die Geschehnisse im KL Auschwitz selbst legen, wie sich zeigen wird, beredt Zeugnis davon ab.
Adolf Hitler persönlich tat am 2. Oktober 1940 im kleinen Kreis kund: »Noch einmal müsse der Führer betonen, dass es für die Polen nur einen Herrn geben dürfe und das sei der Deutsche, zwei Herren nebeneinander könne es nicht geben und dürfe es nicht geben, daher seien alle Vertreter der polnischen Intelligenz umzubringen. Dies klinge hart, aber es sei nun einmal das Lebensgesetz.«1 Unter »Intelligenz« verstanden Hitler und seine Vertrauten die Gesamtheit der polnischen Eliten – gesellschaftlich, kulturell, religiös, militärisch und politisch –, die den Bestand des Staates und der Nation sicherten.
Am 30. Mai 1940 hatte bereits Generalgouverneur Dr. jur. Hans Frank seinen deutschen Beamten in einer Polizeisitzung die Grundlinien der deutschen Polenpolitik in jenen besetzten polnischen Gebieten erläutert, die als »Generalgouvernement« seiner Herrschaft unterstanden. Frank bezog sich hierbei ausdrücklich auf Hitler: »Der Führer […] drückte sich so aus: Was wir jetzt an Führungsschicht in Polen festgestellt haben, das ist zu liquidieren, was wieder nachwächst, ist von uns sicherzustellen und in einem entsprechenden Zeitraum wieder wegzuschaffen.«2 Ähnlich äußerte sich Hitler wiederholt, wobei diese Äußerungen stets als Befehle bzw. Anordnungen zu verstehen sind.3 Heinrich Himmler, der als Reichsführer der SS und Deutschen Polizei zusammen mit seinen Männern in erster Linie für die Umsetzung der Befehle zur Vernichtung der polnischen Intelligenz verantwortlich war,4 berief sich ebenfalls immer wieder auf Absprachen mit Hitler. Am 13. März 1940 beispielsweise soll er vor Zuhörern aus der höheren Generalität des Heeres in einem Vortrag in Koblenz ausdrücklich betont haben: »In diesem Gremium der höchsten Offiziere des Heeres kann ich es wohl offen aussprechen: Ich tue nichts, was der Führer nicht weiß.«5 Er bezog sich dabei auf das Vorgehen der SS und Polizei im besetzten Polen, das heißt auf die dort begangenen Massenverbrechen.
Die massive antipolnische Propaganda der Zwischenkriegszeit erleichterte und legitimierte diese Art der Polenpolitik. Ihren Ursprung hatte sie in den antipolnischen Vorurteilen und Ressentiments, die in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert vorherrschten und staatlicherseits gezielt gefördert wurden. Die NS-Propaganda vermengte diese Vorurteile mit der nationalsozialistischen Rassenlehre von »Untermenschen« und »Herrenrasse«, wobei die Frage, wie Polen darin einzuordnen seien, durchaus umstritten war. Hans Friedrich Günther, der führende deutsche »Rassengelehrte« dieser Zeit, den Hitler gerne las und den NSDAP-Mitgliedern empfahl, propagierte noch im Jahre 1934 die deutsch-polnische »Rassengemeinschaft«. Er argumentierte, dass die Konzeption der »nordischen Rasse« Deutsche und Polen verbinden und nicht trennen solle.6 Selbst Hans Frank erklärte noch am 30. Mai 1940: »Wir sehen also einen absolut germanischen Rassekern in diesem Volkstum, und diesen Rassenkern zu entwickeln, zu pflegen und zu fördern, wird auf weite Sicht die Möglichkeit geben, diesen Raum des Generalgouvernements dem Deutschtum zuzuführen.«7
Anders als die Polenpolitik, die vor allem die Vernichtung der Führungseliten anstrebte, zielte die nationalsozialistische Politik gegenüber den Juden auf deren restlose Entfernung zumindest aus dem deutschen Machtbereich. Dem rassischen Antisemitismus, dem Hitler und seine Gefolgsleute anhingen, galten Juden ausnahmslos als Krankheitserreger, die jede »Volksgemeinschaft« zersetzten und daher eliminiert werden müssten. Bis zum Frühjahr 1941 ging man davon aus, dies nach dem siegreichen Krieg durch Vertreibung und Deportationen zu erreichen. Zuvor sollte die jüdische Bevölkerung – zumindest im besetzten Polen – unter anderem durch Aushungern in Ghettos dezimiert werden. Das änderte sich im Sommer 1941: Im Osten gingen die deutschen Besatzer zum systematischen Massenmord an Juden über.8
Betrachtet man die Entwicklungen im KL Auschwitz, fallen die Ähnlichkeiten, aber auch die Unterschiede zwischen der deutschen Juden- und Polenpolitik deutlich ins Auge. Die systematische Vernichtung der polnischen Führungseliten setzten die deutschen Besatzer schon während des Überfalls auf Polen in Gang. Die insgesamt sieben Einsatzgruppen, die sich aus Angehörigen von Sicherheitsdienst (SD), Sicherheits- und Ordnungspolizei rekrutierten, hatten die Aufgabe, alle »deutschfeindlichen Elemente« zu bekämpfen. Dem Terror der Einsatzgruppen fielen bis Ende 1939 etwa 50 000 Polen zum Opfer, die meisten in den westlichen Gebieten. Die Juden als ethnische Gruppe waren im Herbst 1939 im Allgemeinen nicht das erklärte Ziel dieser systematischen Erschießungen; sie galten nicht als Führungselite des polnischen Staates, es sei denn, es handelte sich um polonisierte Juden. Gleichwohl wurden damals Juden ermordet, jedoch meistens bei pogromartigen Ausschreitungen oder bei den sogenannten Vergeltungsaktionen. Schätzungen zufolge fielen in ganz Polen bis zur Jahreswende 1939/40 etwa 7000 Juden der deutschen Gewaltherrschaft zum Opfer.9
Im Frühjahr 1940 setzten die deutschen Besatzer eine zweite groß angelegte Terrorwelle gegen die polnischen Führungsschichten in Gang. In den ehemals polnischen Westgebieten (Wartheland) waren davon etwa 5000 Personen betroffen, von denen die meisten in Konzentrationslagern umkamen. Im Generalgouvernement führten SS und Polizei zu diesem Zeitpunkt die »Außerordentliche Befriedungsaktion« (AB-Aktion) durch. In deren Rahmen ermordete die Sicherheitspolizei etwa 4000 Menschen, größtenteils Angehörige der Intelligenz sowie Menschen, die als »asozial« eingestuft worden waren. Ferner ordnete Himmler die Einweisung von 20 000 Polen in Konzentrationslager an.10 Von März bis Ende 1940 wurden allein in das KL Dachau 13 337 polnische Männer eingeliefert, darunter Hunderte polnische Priester. Im Frauenlager Ravensbrück waren im April 1940 unter den Neuankömmlingen zu 70 Prozent Polinnen.11
Genese des KL Auschwitz und Ausbaustufen
In diesem Frühjahr fiel die Entscheidung, für polnische Gefangene ein gesondertes Konzentrationslager einzurichten. Überlegungen dazu gab es bereits seit Dezember 1939, als Ort bot sich aus deutscher Sicht die polnische Stadt Oświęcim – nun in Auschwitz umbenannt – an. Dort befanden sich ehemalige polnische Artilleriekasernen, außerdem verfügte die Stadt über günstige Eisenbahnanbindungen. Seit Jahresanfang 1940 fanden mehrere Ortsbesichtigungen statt und bis April nahm der Plan konkrete Formen an: In Auschwitz sollte ein »Quarantänedurchgangslager« für polnische Gefangene entstehen als Ausgangspunkt für deren Weiterleitung in die im Reich liegenden Konzentrationslager. Die Kapazität wurde mit 10 000 Häftlingen veranschlagt.12
Am 27. April 1940 erteilte Heinrich Himmler, als Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei auch für die KL zuständig, Richard Glücks, dem Inspekteur der Konzentrationslager, den Befehl, in Auschwitz ein Lager aufzubauen. Zwei Tage später ernannte Glücks Hauptsturmbannführer Rudolf Höß zu dessen Kommandanten. Nur einen Tag später, am 30. April, traf dieser mit mehreren SS-Männern in Auschwitz ein. Am 4. Mai wurde Höß offiziell zum Kommandanten des KL Auschwitz ernannt.13 In den hier erwähnten Befehlen ist keine Rede mehr von einem Quarantänedurchgangslager.14
Höß konnte zum Zeitpunkt seiner Ernennung auf langjährige Lagererfahrungen zurückblicken. Geboren 1901 in Baden-Baden, hatte Höß sich 1919 dem Freikorps Roßbach angeschlossen und an Kämpfen unter anderem im Baltikum und in Oberschlesien teilgenommen. 1922 war er der NSDAP beigetreten, zwei Jahre später wegen Beteiligung an einem politischen Mord (Fememord) zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt worden; allerdings kam er nach nur vier Jahren aufgrund einer Amnestie frei. Noch vor der nationalsozialistischen Machtübernahme lernte er Heinrich Himmler kennen, der Höß sehr schätzte. 1933 trat Höß der SS, 1934 dem Totenkopfverband bei. Die SS-Totenkopfverbände waren für die Bewachung der Konzentrationslager zuständig und hier machte Höß nun Karriere. Die ersten vier Jahre diente er im KL Dachau, zunächst als Block-, ab 1936 als Rapportführer. Im August 1938 wechselte er als Adjutant des Lagerkommandanten in das KL Sachsenhausen, wo er im November 1939 zum Schutzhaftlagerführer im Rang eines SS-Hauptsturmführers aufstieg. Höß, ab 1929 verheiratet, hatte insgesamt fünf Kinder; das jüngste sollte im Jahre 1943 in Auschwitz zur Welt kommen. Zu diesem Zeitpunkt liefen dort die Vernichtungsanlagen, in denen unter seiner Aufsicht auch Zigtausende jüdische Kinder vergast wurden, Tag und Nacht.15
Im Mai 1940 machten sich der frisch ernannte Kommandant des KL Auschwitz und seine Männer mit Eifer und Elan daran, die verwahrlosten Kasernen in ein Konzentrationslager für 10 000 Häftlinge um- und ausbauen zu lassen. Der deutsche Bürgermeister von Auschwitz stellte Höß unter anderem 300 jüdische Männer für Aufräumarbeiten auf dem Gelände und in der Umgebung des künftigen Lagers zur Verfügung. Am 29. Mai trafen vierzig Häftlinge aus dem KL Dachau unter Bewachung eines SS-Unterscharführers namens Beck in Auschwitz ein. Es handelte sich um einen deutschen Kapo und 39 junge polnische Häftlinge, die beim Bau des Lagerzauns aus Stacheldraht eingesetzt wurden. Zwei Wochen später schickte man sie nach Dachau zurück. Die polnischen Häftlinge wollten jedoch lieber in Auschwitz bleiben, weil sie hier auf die Unterstützung der örtlichen polnischen Bevölkerung hofften. »Daraufhin erklärte ihnen SS-Unterscharführer Beck, sie hätten keinen Grund zum Bedauern, denn dieses Lager werde die Hölle auf Erden sein.«16
Der erste Gefangenentransport mit 728 Männern und Jugendlichen – darunter mindestens zwölf Juden – aus dem Gefängnis in Tarnów erreichte Auschwitz am 14. Juni 1940, obwohl das KL noch nicht fertiggestellt war und die Neuankömmlinge in dem benachbarten Gebäude des ehemaligen Tabakmonopols provisorisch untergebracht werden mussten. Die »Zugänge«, so der offizielle Begriff, wurden mit Schlägen, Fußtritten und Gebrüll empfangen, ihrer persönlichen Sachen beraubt, geschoren, gebadet und desinfiziert, anschließend registriert und mit Nummern gekennzeichnet. Nach dieser Prozedur erlebten sie ihren ersten Lagerappell. Der Schutzhaftlagerführer, SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch, empfing die Häftlinge mit folgender Ansprache: »Ihr seid hier nicht in ein Sanatorium gekommen, sondern in ein deutsches Konzentrationslager, aus dem es keinen anderen Ausgang gibt, als durch den Schornstein des Krematoriums. Wenn das jemandem nicht gefällt, kann er ab sofort in den Draht gehen. Wenn in einem Transport Juden sind, dann haben sie kein Recht, länger zu leben als zwei Wochen, die Priester einen Monat und die übrigen drei Monate.«17 Diese Drohungen waren keine leeren Worte, wie sich bald herausstellen sollte.
Die Ausbesserungs- und Aufbauarbeiten auf dem Gelände des KL Auschwitz wurden nun weitgehend mit eigenen Kräften, das heißt unter Einsatz »eigener« Lagerinsassen, fortgesetzt. Anfang Juli verlegte man die meisten Häftlinge in die ersten instand gesetzten Kasernengebäude. Die Unterkünfte lagen in den Blocks 1 bis 3, das rudimentäre Krankenrevier mit Personal und kranken Insassen zog wenige Tage später in Block 16. Die halbwegs fertigen Blöcke 14 und 15 waren als Quarantäneblöcke für die Neuzugänge vorgesehen. Ende des Jahres wurden sie dem Häftlingskrankenbau eingegliedert.18
Gleichzeitig wurden die übrigen Kasernengebäude ausgebessert und nach den Bedürfnissen des KL aus- und umgebaut. Nach und nach bezog die Lagerleitung einzelne Gebäude als Blöcke in das KL ein: die Blöcke 4, 5 und 6 sowie Block 13, in dem der Lagerarrest und die im August eingerichtete Strafkompanie untergebracht wurden. Der alte Munitionsbunker wurde zum Krematorium I für verstorbene Häftlinge umgebaut. Bald kamen auch neue Gebäude und Blöcke hinzu. Ende 1940 wurden die Holzpfosten im Lagerzaun durch solche aus Beton ersetzt. Zu diesem Zeitpunkt begann die Lagerführung mit der Aufstockung der ursprünglich eingeschossigen Blockgebäude um ein Stockwerk und der Errichtung von neuen Blocks innerhalb des Lagergeländes.
Spätestens Ende 1940 gab es Pläne, in Auschwitz ein weiteres Lager mit der Bezeichnung Auschwitz II zu errichten. Die Arbeiten daran wurden jedoch erst im Herbst 1941 in Angriff genommen, während die Ausbauarbeiten im KL Auschwitz I im Frühjahr 1941 fortgesetzt wurden. Am 1. März 1941 erteilte Himmler dem Lagerkommandanten den Befehl, »das Lager für die Zahl von etwa 30 000 Häftlingen« zu vergrößern. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Häftlingszahl etwa 8000. Im Mai 1941 begann man mit dem Bau von acht neuen Blöcken, die bis Sommer 1942 fertiggestellt waren. Wegen der insgesamt zweijährigen umfassenden Um-, Aus- und Neubauarbeiten ließ die Lagerführung die Blocks im Sommer 1941 neu nummerieren.19
Die Errichtung des Konzentrationslagers Auschwitz mit seinen Nebenlagern, dessen erstes (Auschwitz II) seit Oktober 1941 in Birkenau (Brzezinka) gebaut wurde, hatte für das Schicksal der örtlichen jüdischen und polnischen Bevölkerung dramatische Folgen. Zunächst wurden die Bewohner, die in unmittelbarer Nähe des Lagers lebten, vertrieben (»ausgesiedelt«), teils zur Zwangsarbeit ins Reich verschleppt. Anfang Juli 1940 mussten weitere Bewohner weichen, damit SS-Angehörige mit ihren Familien die Häuser übernehmen konnten. So entstand bis Ende 1940 um das Lager die SS-Siedlung.
Am 6. Juli 1940 entwich mit Tadeusz Wiejowski der erste Häftling aus dem KL Auschwitz. Die deutschen Ermittlungen ergaben, dass polnische Zivilisten dem Flüchtigen geholfen hatten. Der Lagerkommandant reagierte umgehend und forderte schärfste Strafmaßnahmen. In einem Schreiben vom 12. Juli an den Inspekteur der Konzentrationslager Glücks führte Höß aus: »Die umwohnende Bevölkerung ist fanatisch polnisch und […] bereit zu jedem Vorgehen gegen die verhaßten SS-Männer. Auch hat jeder Häftling, dem es gelingt zu entweichen, sofort jede Hilfe[,] wenn er das nächste polnische Gehöft erreicht hat.«20
Einige Tage später, am 18. Juli, besichtigte der Höhere SS- und Polizeiführer in Breslau, SS-Gruppenführer Erich von dem Bach-Zelewski, das Lager. Anschließend befahl er die sofortige Erschießung der Zivilisten, die verdächtigt wurden, dem Flüchtigen geholfen zu haben. Ferner ordnete von dem Bach-Zelewski »eine Räumungsaktion zur Säuberung der gesamten Lagerumgebung im Umkreis von fünf Kilometern […] von allen verdächtigen und arbeitsscheuen Elementen« an.21 So entstand die Idee einer Sperrzone im Umkreis des KL Auschwitz.
Im Februar 1941 begannen die deutschen Besatzer, aus der Stadt Auschwitz und ihrer Umgebung die jüdischen Einwohner und aus den in der Nähe des Lagers befindlichen Dörfern Pławy, Babice, Broszkowice, Brzezinka (Birkenau), Budy, Harmęże und Rajsko die polnischen Bewohner zu vertreiben. Insgesamt wurde ein Gebiet von 40 Quadratkilometern von Polen und Juden »gesäubert«; hier richtete man das Interessengebiet des KL Auschwitz ein. Die Häuser und Wirtschaftsgebäude der »ausgesiedelten« polnischen Bewohner wurden durch Häftlingsarbeitskommandos entweder abgebrochen oder für die Zwecke des Lagers umgebaut: In Rajsko entstanden eine Pflanzenzuchtstation und 1943 die Hygienisch-Bakteriologische Untersuchungsstelle der Waffen-SS Süd-Ost (im Jahre 1944 umbenannt in Hygiene-Institut der SS und Polizei Auschwitz), in Harmęże eine Geflügelzucht, in Budy, Pławy, Babice und Brzezinka verschiedene landwirtschaftliche und Produktionsbetriebe.22
Obwohl die Einrichtung der Sperrzone um das KL Auschwitz ursprünglich die Flucht von Lagerinsassen unterbinden sollte, waren laut Rudolf Höß die Fluchtzahlen im KL Auschwitz die höchsten im deutschen Lagersystem. Während eines Besuches am 17. und 18. Juli 1942 rügte Himmler während des abschließenden Abendessens den Lagerkommandanten Höß nach dessen eigenen Angaben: »›Die Fluchtzahlen von Auschwitz sind ungewöhnlich hoch und im KL noch nie dagewesen. Jedes Mittel‹ – er wiederholte – ›jedes Mittel ist mir recht, das Sie anwenden, um vorzubeugen und Fluchten zu verhindern! Die Fluchtseuche von Auschwitz muß verschwinden!‹«23
Das KL Auschwitz entwickelte sich ab dem Herbst 1941 zu einem weit verzweigten Lagersystem. Als Erstes begann man im Oktober 1941 in Birkenau mit dem Aufbau eines Kriegsgefangenenlagers (KGL). Im Frühjahr 1942, das KGL war noch nicht fertiggestellt, wurde es umgewidmet: in ein Arbeits- und vor allem Vernichtungslager für die europäischen Juden. Hier entstanden 1942/43 die Vernichtungsanlagen, der gesamte Lagerkomplex Auschwitz-Birkenau wurde bis zum Sommer 1944 sukzessive (nach Lagerabschnitten) immer weiter ausgebaut.