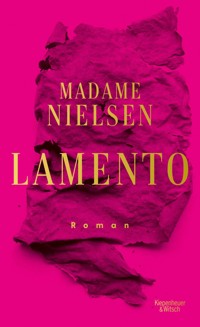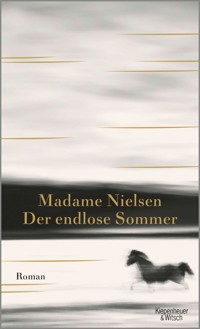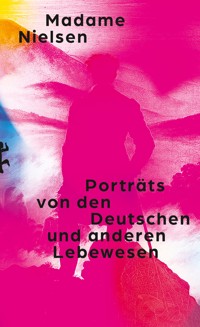
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Angekommen in der herrschaftlichen Wohnung am Stuttgarter Platz in Berlin und flugs eingetreten in die fremde Sprache, macht sich die große Wandlerin der Gegenwartsliteratur Madame Nielsen auf, das »Deutsche« zu suchen. Dabei trifft sie auf den wahrhaften Wutbürger, steigt mit dem Hausphilosophen der AfD hinab zu den Geistern der Vergangenheit und unterhält sich mit der letzten wirklichen Diva über Leben und Tod – nicht um sie vorzuführen oder um sich ihnen anzuverwandeln, sondern um sich, getrieben von einer inneren Unersättlichkeit, der Welt und ihren Verhärtungen schonungslos und offen auszusetzen. Denn anstatt es sich in starren Identitäten, Ideen und Kategorien einzurichten, gilt es, das Eigene, das »Deutsche«, das Denken beständig zu erkunden, weniger als eine unumstößliche Notwendigkeit, sondern vielmehr als allumfassende Möglichkeit. Ohne jegliche Scheu, dafür mit sprachlichem Witz und großer Leichtigkeit malt Madame Nielsen ihre Porträts von den Deutschen und schafft so eine verführende, unterhaltsame Lektüre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Porträts von den Deutschen und anderen Lebewesen
Madame Nielsen
Porträts von den Deutschen undanderen Lebewesen
Eine Gemäldegalerie
Inhalt
Ein Vorwort
Selbstporträt im konvexen Spiegel des 20. Jahrhunderts
Tiefe Mathematik
Deutsche Zeitgeister
Auf der Weltbühne oder Tragödien und Komödien in der Ukraine
Nackt wie ein dampfendes Skelett
Der deutsche Wutbürger
Das Urteil
Der Tod meines Vaters
Schattenbilder
Nach dem Menschen
Appendix Die Privatbibliothek des deutsch-europäischen Intellektuellen des späten 20. Jahrhunderts
Ein Vorwort
Als ich im Juni 2019 mit dem Zug aus dem Norden in Berlin einrollte, um hier für ein ganzes Jahr als DAAD-Stipendiatin zu wohnen, zu wandern, zu weinen und zu schreiben, nahm ich mir vor, innerhalb diesen Jahres oder diesen neuen Lebens eine Reihe von Versuchen in der deutsche Sprache, die nicht die Sprache meiner Mutter ist, mir aber trotzdem sehr lieb und nicht ganz fremd und mich schön irritierend, zu unternehmen und dazu auch noch zu versuchen, die Deutschen dazu zu verführen, einige von diesen Essais zu veröffentlichen.
Von diesen und jenen und dazu noch drei, die ursprünglich auf Dänisch verfasst wurden, habe ich hier zehn zusammengestellt, die alle, und alle auf sehr verschiedene Arten und Weisen, »Porträts von den Deutschen und anderen Lebewesen« sind, unter denen sich auch eine Reiher befindet, die letzten Endes heiser auffliegt.
Ich bin diejenige, die durch meine mehr oder wenig heiklen, peinlichen oder zweideutigen Begegnungen mit oder Verhältnissen zu den einzelnen alle zum Hervortreten bringt und in der Schrift schamlos ausstellt. Und so kann ich Sie, liebe Leser-und-innen, dazu einladen, mit mir jetzt durch meine persönliche Gemäldegalerie zu wandern.
Madame Nielsen
Selbstporträt im konvexen Spiegel des 20. Jahrhunderts
Am frühen Nachmittag des 24. Juni 2019 kam ich mit dem Zug aus Kopenhagen über Hamburg nach Berlin und zog in einer große Hochparterrewohnung – vier Zimmer en suite, große Küche und Bad – am Stuttgarter Platz in Charlottenburg ein und begann ein neues Leben. Als wer? Als die, die ich bin, selbstverständlich, als Lou Camille Nielsen, Madame Nielsen genannt. Und gleichzeitig begann ich das Leben eines anderen. Das hatte ich schon einmal getan: Vom 11. September 2001 bis zum 11. September 2002, genau ein Jahr, lebte ich das Leben des Professor Dr. Dr. Dr. der Semiotik Per Aage Brandt in seiner kleinen Vierzimmerwohnung hinter dem Hauptbahnhof in Kopenhagen. Damals trat ich ohne eigene Sachen oder sonstige Bagagen als nacktes körperliches Dasein – Leib, Seele und Sprache – über die Türschwelle in den neuen Lebensweltraum ein. Ein ganzes Jahr lebte ich in seinen Räumen, saß auf seinen Möbeln, schlief in seinem Bett, träumte seine Träume, trug seine Kleider, atmete sein Luft und verrichtete seine Notdurft, erledigte seine Korrespondenzen und gab bei der dänischen Parlamentswahl 2002 sogar seine Stimme ab. Per Aage Brandt hatte mich damals, als ich die Treppe emporgestiegen war, lebhaft an der Tür begrüßt und mir die Schlüssel übergeben, ich hatte seine Hand geschüttelt und seinen Körper gespürt, ihn gesehen, wie er sich an mir vorbei die Treppe hinunterbewegte, und das ganze folgende Jahr, umgeben von vielen sehr persönlichen Sachen dieses anderen, gelebt.
Diesmal begrüßte mich niemand, als ich an dem windigen, aber sehr warmen frühen Nachmittag im Juni 2019 mit meinem kleinen Rollkoffer, vollgestopft mit Kleidern, Büchern, Notizheften, Bleistiften und Toilettensachen über die Türschwelle in die Wohnung am Stuttgarter Platz trat. Niemand war da, nur Möbel, aber keine wahrhaft persönlichen Sachen, keine Fotografien, keine Briefe, keine Handschrift, keine besonderen Nippsachen oder Souvenirs, sogar Essgeschirr, Besteck, Handtücher und Bettwäsche waren so anonym wie möglich: von IKEA. Das einzig Persönliche waren die Adresse: Stuttgarter Platz 22, die wenigstens die Sozialklassezugehörigkeit von diesem unbekannten anderen, dessen Leben ich jetzt ein ganzes Jahr lang leben sollte, angab, und einige traditionelle afrikanische Skulpturen, Plakate und Malereien, die einen gewissen ästhetischen Geschmack andeuteten. Und dann waren da noch die Bücher: eine Bibliothek, vollgepackt mit mehreren Tausend Bücher, auf Deutsch, aber auch auf Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Englisch. Und schließlich, oder als Erstes: der Familienname des anderen, der ich jetzt war, der auf dem Klingelschild am Hauseingang und auf dem Blechpostkasten stand: »Hillen«.
»Ich bin Hillen«, dachte ich, als wäre ich die Hauptperson in der revidierten Ausgabe von Max Frischs Roman Stiller. Doch anstatt die Geschichte meines Lebens zu erzählen, wandte ich mich dem Inhalt meiner Bibliothek und den drei Malereien zu, die wie ein Triptychon in dem langen Flur hingen, um mich zu porträtieren und in die europäische Geschichte einzumalen.
Das Gewicht der Tausenden von Büchern, die die Wände in meiner Bibliothek von dem Parkettboden bis zur Stuckdecke bedecken, ist bestimmt eine Tonne, meine Bibliothek ist buchstapellich des white man's burden, die Last der Europäer nach der Aufklärung und der europäischen Kolonisierung des Rests der Welt. Der Europäer, der ich bin, ist ein Bildungsmensch, ein von Büchern, Schrift und Sprache erbauter Bürger oder errichtetes Gebäude. Und ich: Was für ein Bildungsgebäude bin ich? Schau: Ganz unten auf dem westlichen Regal der Bibliothek, als Fundament meines Gebäudes und Geists, stehen Marx & Engels gesammelte Werke in 39 staubblauen, von der Zeit und dessen Licht verbleichten Leinenbände mit zwei »Ergänzungsbänden« und einem »Sachregister« mit 3410 Stichwörtern. Auf dem untersten Regal der gegenüberstehenden östlichen Wand befinden sich Lenins gesammelte Werke in 40 dunkelweinroten Lederbänden. Auf den Regalbrettern darüber: Das Kapital, El Capital und Le Capital in jeweils drei Bänden, mehrere Hunderte Bücher mit Kommentaren zu, Theorien über und Auseinandersetzungen mit dem Marxismus und dazu noch Biografien über Marx und Lenin, die gesammelten Werke und Schriften von Mao Zedong, Rosa Luxemburg, Che Guevara, Ernst Bloch und Sigmund Freud, Bücher von Fidel Castro, Feuerbach, Kropotkin, Lukacs, Adorno, Horkheimer, Habermas, Marcuse, Althusser, Gramsci, Bourdieu und zahllosen anderen, weniger bekannten politischen Theoretikern, allesamt – von Agnes Heller und ein paar anderen ausgenommen – weiße europäische Männer, blasse Bildungsbürger, Aufklärungszeitgeister.
Ach, denke ich, wie ich hier stehe und mich in dem Spiegel der mehr als zweitausend Bücher sehe, dann bin ich doch kein besonderer, nur – um mit Pierre Bourdieu dort auf dem fünften Regal von unten zu sprechen – ein Zeichen meiner Zeit, ein Zeitgeist wie jeder anderer: der typische europäische Linksintellektuelle der sogenannten 68er-Generation, dessen young white man's burden und Schicksal es gewesen ist, nicht wie die Schüler in der Sowjetunion nur die gesammelten Werken Lenins und Marx zu studieren oder wie die chinesischen Studenten der Kulturrevolution nur Maos Gedichte, Reden und Schriften zu singen oder wie die Jugendlichen in der DDR nur Marx & Engels und Rosa Luxemburg oder wie die jungen Revolutionäre in Zentral- und Südamerika nur Ches und Fidels und Frantz Fanons gesammelten Reden zu lesen, sondern die gesamten gesammelten Werke von Marx, Engels, Lenin, Mao, Luxemburg, Castro, Che, Fanon usw. usf. zu studieren und zu kommentieren und zu memorieren. Ach!
Als 68er muss ich, denke ich hier vor dem Spiegel der Bücher stehend, Ende der Vierziger geboren sein, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Freitod von Adolf Hitler, der, fällt mir plötzlich auf, nirgendwo zu erblicken ist: In keinem der Tausenden Bücher ist eine Spur vom Führer oder überhaupt von der Vergangenheit, von Hitler, dem Nazismus, dem Dritten Reich, dem Holocaust, der Auslöschung von mehr als sechs Millionen Juden oder überhaupt etwas von der deutschen Geschichte. Keine Spur von Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater und den gesamten »deutschen Väter«, diesen alten Nazisten und all den Millionen und Abermillionen, die nur schwiegen und weiterarbeiteten. Als wäre ich gar kein Deutscher, nur Europäer. Als gäbe es für mich keine Vergangenheit, nur Zukunft: die Revolution. Aber was für eine Revolution? Hier ist keine Spur von RAF, Meinhof und Baader oder von den Roten Brigaden, von Sendero Luminoso und der PLO. Ich bin also augenscheinlich kein Linksradikaler, nur ein bürgerlicher Revolutionär gewesen und, ich stehe ja hier in meiner hochbürgerlichen alten Wohnung in Berlin-Charlottenburg, bin es auch geblieben. O Mann! Wieso Mann? Weil kein einziges Buch über die Frauenbewegung zu sehen ist, die ja genau gleichzeitig wie die 68er-Bewegung die ganze westliche Welt durchzog und bewegte. Nichts.
Dafür aber gibt es, denke ich hier vor dem Spiegel meiner Bibliothek stehend, dafür gibt es als Überbau zu meiner Basis aus europäischen politischen Denkern und revolutionären Führern in den oberen Regalen Hunderte und Aberhunderte von Büchern zur Befreiung und bevorstehenden Revolutionierung der ehemaligen europäischen Kolonien in Zentral- und Südamerika und – in meinem, wenn nicht persönlichen, dann, denke ich, allmählich doch spezifischeren Fall – Afrika: Handbuch der Dritten Welt in 8 Bänden; Leo Gabriel, Aufstand der Kultur; Lateinamerika in 6 Bänden; Eduardo Galeano, Die offenen Adern Lateinamerikas; Sven Lindqvist, Land and Power in South America; Imperialismo, Capitalismo Monopolista; Salvador Allende, Chiles Weg zum Sozialismus; El Salvador. Ein Land im Kampf um seine Befreiung; Harrison, Hunger und Armut; Michael Brown, The Economics of Imperialism; Hampe, Die ökonomische Imperialismustheorie; Eppler, Wenig Zeit für die Dritte Welt; Leo Frobenius, Kulturgeschichte Afrikas; René Dumont, L'Afrique Noir est mal partie, Arghiri Emmanuel, L'échange inégal; Die Arbeiterklasse in Afrika usw. usf.
Als hätte ich, denke ich hier vor dem Spiegel stehend, statt in die Vergangenheitsbewältigung und die deutscheuropäische Geschichte des 20. Jahrhunderts mich in die Zukunft und die Revolutionierung der Welt außerhalb Europas gestürzt und mich damit auch vor den wütenden Frauen geflüchtet. Wenn nicht bewusst, dann habe ich – um mit Freud, dessen gesammelten Werke in elf rosaroten Bänder dort unten in der Basis stehen, zu sprechen – die sogenannte Dritte Welt immerhin unbewusst als eine von europäischen Kolonisatoren und von Imperialismus verschmutzte Tabula Rasa gedacht, wo ich als Deutscher und Europäer ein ganz neues Leben in einer neuen Welt anfangen konnte.
Aber wie?, denke ich hier vor dem Spiegel stehend: Was ist aus mir geworden, nun da ich als voll ausgebildetes Gebäude mit Basis und Überbau dastehe? Wie habe ich diese Tausenden von Theorien, die meinem Geist zum Bersten füllten, denn in körperlicher Praxis umgesetzt und realisiert?
Ich setze mich in Bewegung, öffne die weißen Flügeltüren und gehe hinaus in den Flur.
An den Wänden hängen drei Gemälde. Wie ein Triptychon!, denke ich. Alle drei Flügel von dem gleichen Maler gemalt, sein Name »A. M. BAN« unten rechts auf jedes der drei Bilder gepinselt, in den Jahren »98« und »99«, also den letzten beiden Jahren des 20. Jahrhunderts. Ach, denke ich, wenn das hier ein weiterer Teil des Porträts von mir und meinem Leben ist, dann sehe ich mich hier nicht mehr nur im trügerischen Spiegel der Schrift, nein, hier bin ich wahrhaft bildlich dargestellt, in der großen, christlich-europäischen Maltradition, nicht von einem mitgebrachten europäischen Hofmaler, nein, von einem der Einheimischen! Ein Triptychon auf billiger Leinwand, auf armen Rahmen gespannt, in klaren, unzweideutig frohleuchtenden Farben und in dem »naiven«, »unschuldigen«, »folkloristischen« und also »typisch« afrikanischen Stil, denke ich, keine »echte«, also abendländische Kunst, sondern einfache Volkskunst, die aber längst nicht mehr »authentisch« und »ursprünglich« ist, sondern die aufgeklärte europäische Kunst kindlich unbeholfen nachzuahmen trachtet; genau wie »wir« es uns vorstellen.
Fangen wir beim linken Flügel an: Ein kleines Dorf weit draußen, ein verwüstetes, dauertrockenes Land, wo die einfachen weißgetünchten und mit Wellenblech gedeckten Hütten auf der staubig braunen Erde stehen, ringsum keinerlei Straße, weder aus Asphalt noch Pflasterstein noch Fliesen, nur Staub und die paar kleinen dürren Bäumen; und weit im Hintergrund, wie im Traum oder in ferner Erinnerung, die grünen, hügeligen Berge. Den Vordergrund bildet der Dorfplatz, wie immer unter dem einen großen Baum, der in diesem Fall aber nicht der große mythologische Baobab, sondern nur ein dünner palmenähnlicher ist, unter dem nicht der traditionelle Dorfrat aus alten Kat kauenden Männer sich versammelt hat und wo auch nicht mehr, wie nach der Ankunft der ersten weißen Mannes, die Dorfbewohner tagelang herumlungern oder in Hängematten ihr Leben wegschlafen, aber ebenso wenig aneinandergekettete Sklaven, nein, vielmehr fleißig-lächelnde Menschen befreit arbeiten, mit nackten Händen natürlich, wie die Handwerker, die die afrikanischen Menschen zu sein geboren scheinen, nur die primitivsten europäischen Werkzeuge liegen hier und dort auf der nackten Erde herum verstreut: Schraubenzieher, Zange, Hammer usw., doch nirgends Möbel, nicht mal einen Hockern haben sie, die also immer noch glücklich Armen, die da knien, hocken oder sitzen, barfuß, auf dem Boden, gekleidet nicht in ihre »authentischen« Stammeskostüme, ganz im Gegenteil: Endlich sind sie von primitiven und unterdrückenden Traditionen und Stammeszugehörigkeiten befreit und zeitlos gekleidet in von europäischen Jungen abgenutzte Hosen, T-Shirts und kurzärmliche Hemden, die wahrscheinlich seinerzeit von ihren zur Fabrikarbeit befreiten Brüdern in Bangladesch und Pakistan mit den nackten Händen und Füßen angefertigt und gefärbt wurden. Alle sind sie Männer, keine einzige Frau, nur ein paar Jungs, es gibt augenscheinlich keine Ausbildung hier im Dorf, es geht direkt ab in die Produktion! Von was? Wie bekannt, sind der afrikanische Kontinent und dessen Einwohner dazu auserwählt oder verdammt, die kaputten Sachen, Maschinen, Chemikalien usw. nicht nur aus Europa und den U. S. A., sondern auch aus China und dem Rest der Welt wiederzuverwerten. In diesem kleinen Dorf setzen die jungen Männer brauchbare Teile von einfachen gelben, blauen, grünen Mopeds zusammen. Und damit sind sie glücklich. Fast alle lächeln sie vor sich hin, friedlich, keine Spur von antikolonialistischem Panafrikanismus, Bürgerkrieg, von Milizen oder den üblichen afrikanischen Diktatoren, nicht mal ein Bürgermeister, Dorfrat oder Häuptling ist zu erblicken, hier scheinen alle gleich und gleichwertig zu sein, niemand ist den anderen über- oder untergeordnet, dies ist die realisierte kommunistische Utopie, von der ich in all den Jahren zuvor während meiner Studien der Tausenden und Abertausenden von Büchern in meinem Basis- und Überbauregal geträumt habe. Nicht mal der dunkle Schatten eines weißen Mannes wirft sich über die Gesichter der jungen Männer oder in den Staub dazwischen. Es ist ideal. Fast zu ideal: Denn wo bin ich in dieser Zukunft? Habe ich oder hat man mich denn ganz in den Staub gemacht, exit weißer ghost?
Nur mit der Ruhe, denke ich, mal sehen: Die beiden anderen Flügel des Triptychons sind Stadtbilder. Auf dem rechten Flügel leuchtet ein Porträt des Alltags in einer kleinen Stadt: Im Zentrum die Hauptstraße, umgeben von zwei- und dreistöckigen Häusern im europäischen Stil, keine Kolonialpaläste, sondern einfache Kastenhäuser mit den im Süden üblichen Söller und unten drin kleine Läden zur Straße hin, keine Supermärkte, sondern traditionelle Handwerkstätten und Einzelräume, vollgestopft mit Stoff und Waren. Wie jede afrikanische Stadt ist auch diese eine Buntheit von Leben, hier ein gelbes Taxi, dort und dort zwei von den bekannten afrikanischen Minibussen, die wie immer fast bersten vor schwarzen Körpern und unter dem Gewicht der gezurrten Bagagen und Kleiderbündeln zusammenbrechen, und in der Seitenstraße ein alter Lkw mit einer orangenen Plane über die prallvolle Pritsche gespannt. Hier in der Stadt herrscht noch eine letzte Spur von der klassischen, vom weißen Europäer eingeführten Hierarchie: Im goldenen Schnitt steht der Verkehrspolizist in seiner hellblauen, ein bisschen pyjamahaften Uniform mit Mütze und weißen Handschuhen, eine Signalpfeife im Mund, und dirigiert den Verkehr, der neben den erwähnten Fahrzeugen auch von einem Moped, einem Fahrrad und zahllosen Fußgängern bewegt wird. Im Vordergrund die Hauptszene: der Markt, keine Mall oder auch nur Markthalle, sondern der traditionelle afrikanische Markt unter offenem Himmel. Frohe Frauen und schwarze Mädchen in bunten Gewändern – eine mit einem winzig kleinen, glücklich schlafenden Buben in einem grünen Tuch um die Lenden gespannt – haben allerlei afrikanisches Obst, Gemüse und Wunder aus dem Umland zu Fuß in die Stadt getragen, auf riesigen Bambustellern, in Körben, wie immer in Afrika auf dem Kopf balancierend, und verkaufen das alles jetzt einander und den Stadtfrauen, die ihnen nicht überstehen, sondern ihnen wie Schwestern liebevoll zulächeln. Wir sehen gelbe Zitronen, kleine lila Fische sehen wir, weiße Zuckerhütchen, gelben Käse und Maisbrot, lange Weizenbrote, bunte Stoffe, Eier; ein Stadtbube in blauer Hose mit schwarzem Gürtel, blauem Hemd und muslimischem Käppchen auf dem Kopf verkauft eine Schachtel Zigaretten an einen erwachsenen Büroangestellten, einen richtigen Herrn in grauer Hose, gelbem, offen stehendem Hemd und in schwarzen Herrenschuhen, und von hinten schiebt ein junger Mann einen von den typisch afrikanischen Zweiradwagen vor sich durch die Menge, und, ach, da vorne rechts ist ein grünes Auto schon wieder zusammengebrochen, die Passagiere sitzen immer noch drinnen und warten, während ein barfüßiger Mann mit aufgekrempelten Hemdärmeln und Schirmmütze sich tief in den Motor unter der aufgeschlagenen Motorhaube beugt und operiert. Auch hier ist kein weißer Mann zu erblicken, meinen Schatten aber sieht man: Die Zigaretten sind europäisch, die Ladenschilder sind auf Englisch und Französisch und werben für europäische und amerikanische Produkte: Marlboro Filter, Nescafé, Crown, Commercant Import – Export und sogar Centre Commercial steht über der Öffnung eines der kleinen Läden. Dieser rechte Flügel ist also nicht nur ein Porträt der afrikanischen Kleinstadt mit ihrem Marktplatz, sondern auch ein Bild der kolonialistisch-imperialistischkapitalistischen Marktökonomie. Ach, ja, denke ich und seufze sogar leise vor mich hin, hier alleine vor dem Triptychon in diesem finsteren Flur stehend, ach, ja, der Weg zu meiner erträumten Utopie ist dann doch immer noch weit.
Bis jetzt habe ich nur die Zeichen von mir auf diesem verdammten lichtüberfluteten Kontinent gesehen, aber, denke ich hier im finsteren Flur stehend, es wäre ja auch enttäuschend, ja geradezu abwertend, falls ich irgendwo in die Menge auf einem der beiden Flügel hineingepinselt wäre. Auch Christ, der wahre Erlöser, wird ja immer nur im Zentrum dargestellt. Und so nehme ich nun den letzten Schritt und komme vor der Haupttafel zu stehen. Hier im Zentrum dieses noch nicht ganz »post«-kolonialen Triptychons offenbart sich die Hauptszene und damit vielleicht nicht nur mein Ich, sondern auch der große erlösende Zusammenhang, das postkoloniale Utopia, das eine Umkehrung und Revolution und Überwindung der europäisch-christlichen Vorstellung von Afrika als »Heart of Darkness«, Armut, Hunger und primitiver Gewalt sein muss.
Szene ist die Hauptstadt des bisher namenlosen afrikanischen Landes: Im Hintergrund streckt sich die Stadt fast renaissancehaft hinaus zu den paradiesisch immergrünen und noch nicht und hoffentlich nie entwaldeten oder erodierten Hügeln und Bergen, die ganze Stadt wie für immer ohne weißen Wolkenkratzer, kein einziger Phallus von Gehry, Lloyd-Wright, Kolhaas oder Bjarke Ingels, fast nur ein- und zweistöckige Häuser und Wellblechbaracken, im Himmel nur weiche weiße Wolken, keine Spur von Flugzeugen, auch keine Teerstraßen, überall nur die staubrottrockene Erde, auch hier die gelben Autos mit Gepäckbündeln auf den Dächern, schwer beladen, Barfußgänger und einzelne Fahrräder, ein Lkw mit von winkenden Arbeitern überquellender Pritsche biegt in eine Seitenstraße ab, und ganz vorne, als Ausnahme vom alltäglichen Leben, das Wunder: die Menge, die Masse, nein, denke ich plötzlich, das Volk!
Aber ruhig, denke ich hier vor dem Altarbild in dem finsteren Flur stehend, ganz ruhig wollen wir uns zur