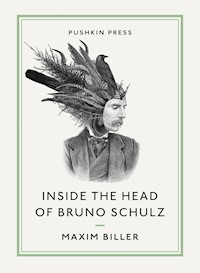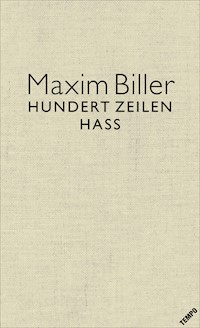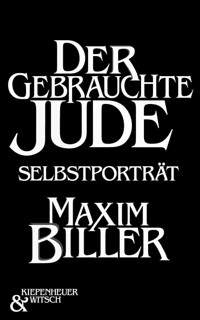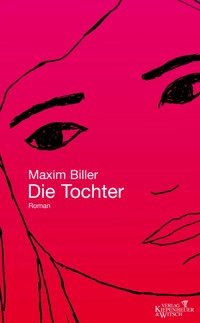9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Buch ist ein Kaleidoskop unserer Epoche, die 16 Erzählungen ergeben einen Roman dieses Jahrhunderts aus vielen einzelnen Stimmen – und aus Geschichten, wie sie vor allem jüngere Schriftsteller in Deutschland schon lange nicht mehr erzählen: eine Kindheit in einem russischen Dorf 1941, ein verbissenes Liebesduell im Prag der Nachkriegszeit, eine literarische Detektivgeschichte im München unserer Tage oder ein unlösbares Vater-Tochter-Drama in New York, das im neuen Deutscland von Solingen und Mölln endet. Ein mitreißendes Buch über traurige Überlebende, komische Lebenskünstler, verwirrte Wissenschaftler, abgefallene Kommunisten, freche Mädchen, verlogene Schriftsteller, melancholische Mütter und monströse Verbrecher, das auf immer neue Weise um das ewig gleiche Thema kreist: Wie hat das Grauen der Vergangenheit die Menschen der Gegenwart im Griff, und wie kann man darüber erzählen, ohne zu versteinern oder zu vergessen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Maxim Biller
Land der Väter und Verräter
Erzählungen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Maxim Biller
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Maxim Biller
Maxim Biller, geboren 1960 in Prag, lebt seit 1970 in Deutschland. Von ihm sind bisher u. a. erschienen: der Roman »Die Tochter«, die Erzählbände »Wenn ich einmal reich und tot bin«, »Land der Väter und Verräter« und »Bernsteintage«. Er hat die beiden Essaybände »Die Tempojahre« und »Deutschbuch« veröffentlicht sowie das Kinderbuch »Adas größter Wunsch«. Sein Roman »Esra« wurde gerichtlich verboten und ist deshalb zurzeit nicht lieferbar. Sein letztes Theaterstück »Menschen in falschen Zusammenhängen« wurde am Berliner Maxim Gorki Theater uraufgeführt. Er schreibt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die Kolumnen »Moralische Geschichten«, die auch als Buch erschienen sind. Sein im Jahr 2007 erschienener Erzählband »Liebe heute« wurde unter dem Titel »Love Today« 2008 in den USA veröffentlicht.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Das Buch ist ein Kaleidoskop unserer Epoche, die 16 Erzählungen ergeben einen Roman dieses Jahrhunderts aus vielen einzelnen Stimmen – und aus Geschichten, wie sie vor allem jüngere Schriftsteller in Deutschland schon lange nicht mehr erzählen:
eine Kindheit in einem russischen Dorf 1941, ein verbissenes Liebesduell im Prag der Nachkriegszeit, eine literarische Detektivgeschichte im München unserer Tage oder ein unlösbares Vater-Tochter-Drama in New York, das im neuen Deutschland von Solingen und Mölln endet. Ein mitreißendes Buch über traurige Überlebende, komische Lebenskünstler, verwirrte Wissenschaftler, abgefallene Kommunisten, freche Mädchen, verlogene Schriftsteller, melancholische Mütter und monströse Verbrecher, das auf immer neue Weise um das ewig gleiche Thema kreist:
Wie hat das Grauen der Vergangenheit die Menschen der Gegenwart im Griff, und wie kann man darüber erzählen, ohne zu versteinern oder zu vergessen?
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 1994, 2012, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Lo Breier
Covermotiv: © Maxim Biller
ISBN978-3-462-30597-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Figuren und Handlungen
Ein trauriger Sohn für Pollok
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Land der Väter und Verräter
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Wie Cramer anständig wurde
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Die Marx-Brothers in Deutschland
Warum starb Aurora?
Efim flieht in den Wald
Eine kleine Familiengeschichte
Efims Wahrheit
Meyers Wahrheit
Finkelsteins Finger
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Hana wartet schon
Mannheimeriana
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Polanski, Polanski
Der perfekte Roman
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Aus Dresden ein Brief
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Lurie damals und heute
Erinnerung, schweig
1. Kapitel
2. Kapitel
Eine Liebe im Vorkrieg
Ich bin's, George
Der Anfang der Geschichte
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Meiner Schwester Jelena
Gib einer Sache einen Namen, und sie wird geschehen
Sämtliche Figuren und Handlungen sind frei erfunden. Alle Ähnlichkeiten mit Lebenden und Verstorbenen sind deshalb rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Ein trauriger Sohn für Pollok
1.
Milan Holub hatte das Leben meines Vaters zerstört, und als mir eines Tages ein Verlag sein neues Buch zur Beurteilung schickte, beschloß ich, Rache zu nehmen. Seit ich denken konnte, war ich mit Holubs Namen vertraut, zu Hause wurde über ihn so oft wie über einen Verwandten und so wütend wie über Hitler gesprochen. Darum verband ich von früh an mit ihm, den ich nie getroffen hatte, nur Abscheu und Haß. Er war mein ganz persönlicher Haman und Titus, eine Figur, so groß und allgegenwärtig wie aus einem Geschichtsbuch, und hätte mich je einer gefragt, warum Vater und Mutter und auch ich niemals miteinander glücklich wurden, hätte ich mit meiner Antwort keine Sekunde gezögert. Milan Holub, hätte ich gesagt, Milan Holub, der Philosoph und Schriftsteller, war es, an dem Vater als junger Mann zerbrach. Alles andere, was danach in seinem Leben geschah, war nur noch der dunkle, langanhaltende Epilog zu jener Szene, die sich damals, 1949, in der tschechoslowakischen Botschaft in Moskau abgespielt hatte, als Holub – so wurde es bei uns erzählt – seinen besten Freund, meinen Vater, mit ein paar schnellen, beiläufigen Sätzen um die Zukunft brachte.
Die Szene in der Botschaft habe ich mir von klein auf ganz genau vorgestellt, immer und immer wieder: Ich sah Holub an einem übergroßen, schwarzen Schreibtisch, auf dem kein Blatt Papier, kein Schreibzeug, keine einzige Akte lag. Ich sah einen langen Schatten, der ihn und den Tisch von hinten überzog, so daß einzig die Gestalt meines Vaters von einem schwachen, gräulichen Tageslicht bedeckt war. Ich sah Holub auf einem hohen schwarzen Stuhl, dessen Rückenlehne fast bis zur Decke reichte, ich sah einen Hocker, auf dem mein Vater seine Zeit absaß, und dann sah ich auch, wie Holub plötzlich mit dem Handrücken eine Staubspur von der Tischplatte wischte und das vernichtende Verdikt über seinen Freund sprach. Doch obwohl ich Holubs Foto von ungezählten Buchumschlägen und Zeitungsseiten kannte, obwohl ich mit seinem festen, selbstbewußten mährischen Bauerngesicht genau vertraut war, dachte ich es mir in all den Jahren ganz anders, als eine wabernde, fast durchsichtige Maske, deren Züge ständig wechselten, und so erschien mir der Schriftsteller mal als Feliks Dserschinskij, mal als Reinhard Heydrich, und ab und zu einfach nur als ein wuchtiger, braungefleckter Rottweilerhund.
Holub war, wie Vater auch, Aktivist der ersten Stunde gewesen. Er zog mit der aufgewühlten Menge durch die Straßen Prags, im Putschfebruar 1948, er feierte bei den Maiumzügen tanzend und klatschend den neuen sozialistischen Menschen, er besang in seinen Teplitzer Elegien Stalin und Gottwald, er war Dichter und Volkserzieher und Politkommissar – und tauchte dann, kein halbes Menschenleben später, in zweiter Reihe hinter Forman, Mňačko und Kohout, als einer der Kulturhelden des Prager Frühlings wieder auf, kein Kommunist mehr, aber noch immer von den Freiheitsideen der Linken beseelt. Und nun erst, so schilderte er es selbst in Ich, Böhmen und die Welt, in seiner Autobiographie, deren tschechisches Manuskript ausgerechnet ich zur Begutachtung bekommen hatte – nun erst kamen die besten Jahre seines Lebens, »diese drei, vier herrlichen und befreienden Jahre«, in denen einer wie er erleben durfte, daß das, was ein Intellektueller sich ausdenkt und erträumt, manchmal eben doch bei den einfachen Menschen Sehnsüchte zu wecken vermag. Als dann die Russen einmarschierten, konnte und wollte er deshalb nicht wieder kehrt machen, und so wurde die Charta 77 zu seiner neuen Partei. Er unterschrieb Petitionen, er verfaßte Briefe an Gustav Husák, er schlug sich mit den Männern vom Innenministerium herum und mit den Fragen unwissender westlicher Journalisten, die ihn zu dieser Zeit regelmäßig in seiner Wohnung am Moldauufer, vor diesem schmalen Panoramafenster mit Hradschinblick filmten und fotografierten. Doch schließlich wurde der Druck zu groß, die Geheimpolizisten drehten ihm den Strom ab, das Wasser, sie lasen seine Post und kappten seine Telefonleitungen. Sie saßen Tag und Nacht in ihren kleinen Autos vor seinem Haus, und als eines Abends Holubs Dackel Pepa mit durchgeschnittenem Hals im Türrahmen hing, beschloß der Schriftsteller, das Land zu verlassen.
Es war ein sehr stiller, ergreifender Ton, den Holub in Ich, Böhmen und die Welt wählte, um zu schildern, wie er den toten Dackel entdeckte, »an die Tür genagelt und blutüberströmt wie Jesus«, und wie er ausgerechnet in diesem Moment plötzlich begriff, daß alles umsonst war und daß die Tränen, die er um seinen Dackel vergoß, zugleich die Tränen des Abschieds von der Heimat und somit von seiner ganzen Geschichte waren. »Das Leben, glaube ich, ist eine große Sau«, lautete der letzte Satz des Pepa-Kapitels, ein Satz, den ich nicht mehr vergessen konnte. Aber ich vergaß ebensowenig, daß einer wie Holub immer schon viel zu gewandt und klug gewesen war, um länger als nötig sentimental zu sein, zu egoistisch, um sich vom eigenen Leid ergreifen und zerbrechen zu lassen, so wie Vater es getan hatte.
Im Westen, in seinem dritten Leben, kam Holub schnell wieder auf die Beine, schon bald bezog er am Münchener Prinzregentenplatz eine prachtvolle Wohnung, noch geräumiger und aufwendiger eingerichtet als die in Prag, und so sah man ihn von nun an auf Fotos nicht mehr vor dem düsteren, dunklen Hradschin stehen, er hatte jetzt den Silberturm der Hypo-Bank im Rücken. Er stand da, die Arme über der Brust gekreuzt, den Blick herausfordernd in die Kamera gerichtet, und alles war so, als sei er immer schon auf dieser Terrasse, in dieser Stadt, in diesem Land gewesen, als sei er genau hier, über den Dächern Münchens, auf dem richtigen Fleck.
Ja, es lief wirklich gut für den Philosophen und Schriftsteller Milan Holub, es lief für ihn, um genau zu sein, tausendmal besser als für meine Familie, denn das Exil schien ihn, im Gegensatz zu uns, nur zu befeuern. Seine Bücher kamen in schneller Folge neu heraus, man sah ihn im Fernsehen, seine Essays wurden ins Deutsche übersetzt und erschienen in kleinen, aber angesehenen Literaturzeitschriften, und der Ruf, der seiner angekündigten und immer wieder verschobenen autobiographischen Abrechnung mit dem kommunistischen Jahrhundert voranging, war zwar alles andere als weltumspannend, hallte aber dennoch durch manch eine Rezension eines anderen posthistorischen Buchs. Es schien auf eine beinah unverdächtige Weise nichts dabei zu sein, wie schnell sich Milan Holub in der Fremde zurechtfand, Aufträge, Ehrungen und Freunde flossen ihm ganz automatisch zu, und der Respekt, der ihm entgegengebracht wurde, hatte nicht einmal etwas Verlogenes. Er war »der glücklichste Emigrant aller Zeiten, Thomas Mann und Imelda Marcos vielleicht ausgenommen« – so hatte es Holub selbst in Ich, Böhmen und die Welt formuliert, in seiner autobiographischen Abrechnung mit dem kommunistischen Jahrhundert, die eines Tages dann doch noch fertig geworden war und die ich nun also, als einer der ersten, in meinen Händen hielt.
Das Buch war mir natürlich egal gewesen, es ging mir um etwas ganz anderes, doch die scheinbar aufrichtige, selbstironische Haltung, mit der Holub sein Leben erzählte, zog sogar mich anfangs in ihren Bann. Erst beim zweiten Lesen bemerkte ich erleichtert, daß an dieser Attitüde nichts stimmte, daß Holubs Ehrlichkeit bloß Täuschung war, eine rhetorische Waffe, mit der er jeder möglichen Kritik die Spitze nahm. Einwänden, die gegen ihn, gegen sein früheres Denken und Wirken hätten aufkommen können, begegnete er von vornherein, indem er sie selbst einfach aussprach, und das wurde immer wieder besonders da deutlich, wo er laut, demonstrativ, fast selbstzerstörerisch zugab, einst ein verbrecherischer, pubertärer Dummkopf gewesen zu sein, in jener dunklen Zeit, als er seine »Poeme für Stalin, Gottwald und all die andern Massenmörder« verfaßte. Nein, die Teplitzer Elegien verschwieg Milan Holub nicht, und auch sonst berichtete er von all seinen Vergehen und Irrtümern, die bekannt waren. Was aber 1949 in Moskau, in der dunkelroten Botschaftsvilla an der Malaja Nikitzkaja, zwischen ihm und Vater vorgefallen war, das erwähnte er nicht.
Damals studierten die beiden gemeinsam an der Historischen Fakultät der Lomonossow-Universität. Sie schliefen im Studentenwohnheim in einem Zimmer, sie spielten im Sommer zusammen Fußball und im Winter Eishockey, sie machten denselben Mädchen den Hof, sie lasen dieselben Bücher – manchmal sogar gleichzeitig, indem sie sich kapitelweise abwechselten –, sie belegten dieselben Kurse und verehrten dieselben Professoren, und die kameradschaftliche Konkurrenz, die zwischen ihnen herrschte, war immer nur Ansporn für sie, aber niemals ein Grund für Haß und Intrige. So, jedenfalls, hatte es Vater empfunden, vielleicht sogar zu Recht, doch eines Tages machte er den Fehler, mit Holub, dem Goj, über Stalins Haß auf die Juden zu sprechen. Politik war bis dahin zwischen den beiden kein Thema gewesen, obwohl – oder vielleicht gerade weil – Holub, das Wunderkind, damals kein einfacher Student war, sondern zugleich auch dritter und mit Abstand jüngster Kulturattaché an der Prager Botschaft in Moskau. Es war ein seltsames Gespräch, das sie in der Institutskantine über den großen Stalin führten, Vater redete anfangs ganz leise, während Holub schwieg und schwitzte und mit den Fingern auf die Tischkante klopfte, und als Vater die Stimme hob, plötzlich alle Vorsicht vergessend, stand sein bester Freund stumm auf und lief hinaus. Schon am nächsten Tag schrieb Holub seinen Bericht, und so kam Vater vors Studententribunal, Holub ließ ihn in einem kleinen Schauprozeß von den Kommilitonen aburteilen, er sorgte dafür, daß Vater von der Universität relegiert und aus dem Komsomol ausgeschlossen wurde. Als für Vater schon alles verloren zu sein schien, wurde er von Holub in die Botschaft bestellt. Es sollte die letzte Begegnung der beiden Freunde werden, es gab keinen Streit, aber auch keine Versöhnung, Vater gab sich Mühe, er redete von Reue, er murmelte zaghaft von den Gefahren des Kosmopolitismus, denen er erlegen war, er versprach Besserung und eine umfangreiche Selbstkritik. Holub schwieg auch jetzt wieder, er schwitzte und klopfte mit den Fingern auf die Tischplatte, und bevor er ohne Gruß hinausging, sagte er doch noch etwas, er nannte Vater einen Verräter und Abtrünnigen, den man in Zukunft sehr genau in den Augen behalten werde, und nachdem er Vater die Ausweisungspapiere überreicht hatte, erklärte er, er sei ab nun nicht mehr sein Freund. Wie ein Rottweiler sah er dabei vielleicht nicht aus, aber wie Feliks Dserschinskij bestimmt.
2.
»Eine unangenehme Sache, Herr Holub, ich weiß«, sagte ich. Wir hatten uns bei ihm verabredet, in seiner riesigen Dachwohnung am Prinzregentenplatz, von der aus man heute Aussicht auf die ganze Stadt hatte, auf das halbe bayerische Land dahinter und die blauen Felsen der Alpen dazu. Wir saßen im Arbeitszimmer, in tiefen, braunen Schriftsteller-Ledersesseln, es gab Cognac und Zigaretten, durch die offene Terrassentür wehte die heiße, nach Abgasen riechende Sommerluft herein, und auf Holubs leerem, aufgeräumten Schreibtisch, den ich zu Anfang kaum eine Sekunde aus den Augen ließ, lag das von mir abgelehnte Manuskript von Ich, Böhmen und die Welt, das er bestimmt nur deshalb dort hingelegt hatte, um mich während unseres Treffens daran zu erinnern, was für ein Schurke ich war.
Holubs Arbeitszimmer befand sich am Ende eines langen Flurs, der am Wohnungseingang sehr weit und großzügig geschnitten war, sich nach einigen Schritten aber stark verjüngte. Dann kamen ein paar Stufen, man bog um die Ecke, der Weg wand und schlängelte sich erneut, bis man endgültig nicht mehr wußte, wo man war. Überhaupt ging hier alles durcheinander, mal kam man sich wie in einem Penthouse vor und dann wieder wie in einer Burg, dunkle, verliesartige Mansardenräume wechselten sich mit riesigen Hallen ab, deren überraschend hohe Wände unter einem terracota-farbenen, venezianischen Verputz lagen. Es gab bunte Popart-Sessel und schwere Biedermeiersofas, überall hingen Bilder und Zeichnungen, in jedem Winkel standen Skulpturen und mit frischen Blumen gefüllte Vasen. Im Arbeitszimmer, in einer alten Juweliervitrine, waren mehrere gerahmte Fotografien ausgestellt, die Milan Holub in den entscheidenden Phasen seines Lebens zeigten, man sah ihn – immer etwas aufgeregt, immer ein wenig unterwürfig – im Gespräch mit Pavel Kohout und Emil Zátopek, mit Dubček, Yves Montand und Jorge Semprun, und auf einem der Bilder saß Holub mit Philip Roth und Kundera im Carnegie’s Deli und aß Pastrami.
Der Milan Holub, der mich in seinem Kabinett empfing, hatte natürlich keinerlei Ähnlichkeit mit dem Gespenst aus meinen Botschaftsphantasien – aber mit dem umtriebigen, kraftstrotzenden Literatur-Impressario aus der Fotosammlung auch nicht. Sein Blick war matt, seine Stimme stumpf, und die gelbe Haut, die sein erstaunlich kleines Bauerngesicht – ein richtiges Zwetschgengesicht! – überspannte, kam mir wie die Haut eines Greises vor, der sich allmählich in ein Kind zurückzuverwandeln beginnt. Statt mich zu beschimpfen oder zu beleidigen, saß Holub nun tonlos und unsicher da, seine Mimik war starr, seine Gesten und Bewegungen schienen übervorsichtig und ängstlich, und je länger ich ihn betrachtete, desto mehr fand ich, daß er kein ebenbürtiger Gegner für mich war. Allein seine großen, mit Pigmentflecken übersäten Hände schienen noch voller Leben zu sein, er knetete sie ständig, er verkantete die Finger und ließ immer wieder seine Gelenke knacken. Manchmal fuhr er sich ganz plötzlich durch das noch volle, halblang geschnittene weiße Haar, und wenn er dann den Blick hob, entdeckte ich in seinen Augen, zumindest für diesen kurzen Moment, die Anmutung von Überlegenheit und Kraft.
»Wie lange haben Sie an Ihrem Buch gearbeitet?« sagte ich.
»Fünf Jahre«, erwiderte er.
»Das tut mir leid.«
»Es war eine gute Zeit. Vielleicht meine beste.«
»Vielleicht Ihre beste?«
»Sie sind, entschuldigen Sie, womöglich zu jung, um das zu verstehen. Jste přece skoro ještě dítě.«
Wir sprachen Deutsch miteinander, das Holub inzwischen offenbar ganz gut beherrschte, ab und zu streute er jedoch ein tschechisches Wort, einen tschechischen Satz ein, so als wolle er prüfen, ob ich seine Muttersprache auch wirklich verstand.
»Rozumíte?« sagte er.
»Ano a ne.«
»No nevadí. In Ordnung«, fuhr er leise, zurückhaltend fort, und ich überlegte, ob der Ton, den er nun anschlug, ernst oder möglicherweise doch ironisch war. »Jedenfalls freue ich mich auf die nächsten fünf Jahre, die bestimmt genauso gut werden oder vielleicht sogar noch besser. Ich freue mich auf diese fünf Jahre, in denen ich alles neu schreiben will. Oder muß. Nicht wahr?«
Er hat die Kröte tatsächlich geschluckt, dachte ich, und im nächsten Augenblick fragte ich mich aber, was Holubs Trick war, ich fragte mich, in welche Falle er mich lockte, denn es konnte doch einfach nicht sein, daß mein Plan derart perfekt aufgegangen war. Als mich vier Wochen zuvor sein aufgeregter Verleger angerufen hatte, mit der Bitte, ich möge so schnell wie möglich das tschechische, noch nicht übersetzte Manuskript der endlich fertiggestellten Holub-Memoiren lesen und beurteilen, war ich mir meiner Sache sicherer gewesen als jetzt. Ich hatte sofort – noch während des Gesprächs, noch während ich mich darüber freute, daß ich endlich wieder einen Auftrag bekam – siegesgewiß beschlossen, dem Schriftsteller auf eine sehr dialektische, sehr historische Art eine Lehre zu erteilen, und so schrieb ich dann später in meinem Gutachten, Milan Holubs tausendseitige Autobiographie Ich, Böhmen und die Welt sei vollkommen mißlungen, gleichwohl sie ästhetisch und inhaltlich das Potential zu einem der wichtigsten Werke der europäischen Nachkriegsliteratur habe, weshalb es mir, wie ich zum Schluß von falschem Holubianer-Pathos getränkt erklärte, immens wichtig scheine, dieses Buch durch eine Revision, durch ein komplettes Umschreiben zu retten, damit es eines Tages den ihm gebührenden Rang einnehmen könne. Das war natürlich völliger Unsinn gewesen, ich fand Holubs Autobiographie weder groß noch mißlungen, sie war ein ganz gewöhnliches verlogenes Buch wie Tausende anderer auch, am besten noch in jenen Passagen, wo er – wie zum Beispiel im Pepa-Kapitel – besonders raffiniert und heuchlerisch zu Werke ging. Daß sich der Verlag trotzdem von meiner Beurteilung blenden ließ, daß der verzweifelte Holub mich nun zu sich gebeten hatte – das alles schien der beste Beweis dafür zu sein, daß ich alles richtig gemacht hatte. Aber was war der Trick?
»Ich will die Wahrheit wissen«, sagte Holub plötzlich. Er erhob sich aus dem Sessel, das heißt, er preßte die Hände und die Unterarme gegen die Seitenlehnen, worauf sich sein Körper quälend langsam nach oben zu schieben begann. Holub drohte mehrmals zurückzurutschen, und als er endlich sicher stand, lächelte er zufrieden, um sich, gegen die Vitrine mit den Fotos gelehnt, eine Weile von der Anstrengung auszuruhen. Schließlich ging er langsam zum Schreibtisch vor, er nahm sein Manuskript in beide Hände, und bevor er wieder in den Sessel versank, knallte er den hohen Stapel rüde auf den Glastisch zwischen uns. »Die Wahrheit bitte«, sagte er. »Was habe ich falsch gemacht?«
Nichts weiter, dachte ich, Sie haben nur meinen Vater vernichtet. Aber ich sagte: »Sie haben ein großes Buch verschenkt!«
»Und wie?«
»Sie haben groß gedacht – und klein geschrieben.«
»Mein Gott …«
»Ihre Erinnerungen hätten der Roman einer Epoche werden können …«
»Aber?«
»Die Perspektive stimmt nicht«, log ich. »Sie sind zu nah an sich selbst dran, zu weit weg von den großen Ereignissen. Sie reflektieren zu viel und zu hermetisch, sie erzählen zu wenig, und wer nicht dabei war, wer nicht wie Sie vierzig Jahre Kommunismus und Verzweiflung in der Tschechoslowakei erlebt hat, macht als Leser nicht mit, geschweige denn, daß er die metaphorische Kraft Ihrer Ideen und Erfahrungen begreift.«
Ich faselte und faselte, aber Holub hörte mir ernsthaft zu, er machte sich sogar Notizen, während ich sprach, der Füller – von seinen langen braunen Fingern geführt – flog in einem rasenden Tempo übers Papier, und als ich fertig war, sah er auf und sagte unsicher: »Und Sie waren dabei…«
»Ist das eine Frage?« erwiderte ich.
»Ja.«
»Nein, ich war eben nicht dabei, nicht als Erwachsener jedenfalls. Trotzdem kann ich mich an so vieles erinnern, an Dinge, die Sie nicht erzählen wollen.«
»Welche Dinge denn?«
»Dinge, von denen ich zu Hause hörte«, sagte ich herausfordernd. »Oder die ich selbst erlebt habe!«
»Ich verstehe wirklich nicht, was Sie meinen.«
Ich zögerte. Schließlich sagte ich: »Ich meine … zum Beispiel … den Tag, als Ludvík Svoboda zum Präsidenten gewählt wurde. Wir spielten in unserer Straße Fußball, während die Erwachsenen vor den Fernsehern saßen, und plötzlich rauschte aus allen Fenstern ein donnernder Applaus, er rauschte durchs ganze Land, und ich wußte, daß die Guten gesiegt hatten. Dieser herrliche Sommertag kommt bei Ihnen gar nicht vor, Herr Holub – statt dessen beschreiben Sie minutiös jede einzelne Sitzung des Schriftstellerverbands oder ermüden den Leser mit seitenlangen Analysen des Treffens von Dubček und Breschnew im Zug an der russischen Grenze …«
»Wollen Sie mir etwa sagen, was ich zu schreiben habe?« unterbrach mich Holub. Plötzlich war er wieder da, sein halbernster, halbironischer Tonfall von vorhin, den ich nicht einzuordnen wußte.
»Ich habe nur gesagt«, gab ich trotzig zurück, »was Sie nicht geschrieben haben!«
»Sie sind …«, setzte er an, aber dann ging ihm plötzlich die Luft aus. Er begann zu husten, und der Husten schüttelte für einen unangenehm langen Augenblick seinen alten, papierleichten Körper. »Sie sind … Entschuldigen Sie … Sie sind, scheint mir, ein kluger junger Mann, und ich habe das, was Sie mir vorwerfen, beim Schreiben natürlich selbst oft gedacht. Nejsem přece úplně senilní,« Er zog ein benutztes Papiertaschentuch aus seiner Jacke und hielt es sich über den Mund. Er hustete erneut, aber nicht mehr so stark, seine Rede war jetzt gut zu verstehen und sein Ton wieder ganz eindeutig. »Ich hätte wohl besser auf mein inneres Kontrollsystem achten sollen«, sagte er, »aber manchmal reißt die eigene Begeisterung einen einfach mit fort, Herr Pollok.« Er hatte meinen Namen langsam und betont ausgesprochen, und nun blickte er mich aus seinem winzigen Zwetschgengesicht heraus scharf an, er tupfte sich mit dem Taschentuch über die Mundwinkel und die Lippen, und als wäre er aus einem langen Schlaf erwacht, sagte er auf einmal ganz fest: »Wenn Sie über damals so viel wissen – was wissen Sie dann über mich?«
Ich preßte die Hände gegen das riesige Cognacglas, ich blickte an Holub vorbei und sah durch das hohe Terrassenfenster in den tiefen Fönhimmel. Ich wollte jetzt nicht antworten, ich hatte keine Lust mehr, immer und er wieder über ihn nachdenken zu müssen, ich wollte lieber an Vater denken, an meinen Vater, an diesen schweigsamen, sturen Mann, der, seit ich mich erinnern konnte, niemals von sich gesprochen hatte, weshalb er mir, solange er bei uns war, immer wie dieser ältere Herr aus einem russischen Roman vorkam, der in einer kommunalen Gemeinschaftswohnung am Ende eines langen Flurs sein eigenes Leben lebt. Nein, Vater selbst hat mir natürlich nie von seinem unrühmlichen Moskauer Ende erzählt, und er hat sich ebenfalls darüber ausgeschwiegen, wie es weitergegangen war – wie er also gleich am Tag nach seinem Rauswurf nach Prag zurückmußte, wo ihn bereits der Marschbefehl zum politischen Strafbataillon der Armee erwartete. Die nächsten fünf Jahre verbrachte er dann in den Urangruben von Jáchymov, im Westen Böhmens, und dort hatte er eine ähnlich sinnvolle und erschöpfende Tätigkeit zu verrichten gehabt wie die Heloten von Sparta oder die Gespenster von Birkenau. Ich weiß nicht, ob er damals noch Hoffnung besaß, ich habe nie erfahren, ob er im Arbeitslager – vielleicht während er gerade das giftige Urangestein aufs Förderband schaufelte oder in zehn Metern Tiefe Sprengladungen anbrachte – davon träumte, eines Tages an die Universität zurückgehen zu dürfen, um doch noch ein berühmter Historiker zu werden, so wie er es sich einst gewünscht hatte. Wahrscheinlich wußte er ganz genau, daß alles aus war, und möglicherweise, doch das glaube ich nicht wirklich, wußte er da auch schon, daß später ein rühmloser Filmschreiber aus ihm werden würde, fast immer ohne Arbeit, dafür aber ständig voller großer Pläne, ein Tagträumer und Künstlerdarsteller, der außer sich selbst keinen andern je wichtig genommen hat – sonst hätte er doch wohl mit Mama und mir in diesen drei Jahrzehnten mehr als fünf Sätze gewechselt.
Ich weiß, ich übertreibe schon wieder, aber ich weiß auch, daß Vater wirklich etwas von diesem großen Schweiger vom andern Ende des Flurs gehabt hat, und so war es dann immer Mama gewesen, die in München, wenn wir ab und zu samstags oder sonntags beim Mittagessen zusammensaßen, ins Erzählen kam, so herausfordernd und bestimmt, als wolle sie dafür sorgen, daß ich, ihr einziger Sohn, der seit unserer Flucht aus Prag keinen Verwandten mehr gesehen hatte, statt dessen aber die sich häufenden Zerwürfnisse zwischen ihr und Vater um so intensiver mitbekam, daß ich also niemals vergaß, daß wir, allen Launen des Schicksals zum Trotz, eine Familie waren und nicht bloß ein zufällig zusammengewürfeltes Trio. Mama erzählte bei diesen beschwörenden Küchensitzungen, die in Wahrheit ohnehin nichts mehr retten konnten, ein ums andere Mal Vaters Moskauer Passion, und sie erzählte oft auch von der Nacht, als sie ihn, Jahre später, im Prager Filmklub kennengelernt hatte, wo er sie wagemutig vor einer wild betrunkenen Männermeute in Sicherheit brachte, um ihr hinterher, das erste und einzige Mal, seine Geschichte anzuvertrauen. Vater unterbrach Mamas Erzählungen jedesmal, aber nie energisch genug, er erklärte mit einem kalten Klang in der leisen Stimme: »Ich will darüber nicht sprechen!«, doch dann, als Mutter fertig war, als sie den rituell wiederkehrenden Schlußsatz »Und darum wurde dein Vater so eigentümlich und stark« ausgesprochen hatte, sagte er – als eine Art Refrain, Klage und Tusch – ganz mild: »Milan hat sich bei mir bis heute nicht einmal entschuldigt!«
Holubs Entschuldigung – um sie also, so kam es mir immer vor, wenn in unserer Küche die Rede auf Moskau und Jáchymov kam, war es Vater in all den Jahren viel mehr gegangen als um das ihm angetane Unrecht. Und so merkwürdig und falsch mir das schien, ich konnte es mir dennoch erklären: Mein Vater pflegt, wie jeder gute Jude, das Beleidigtsein als eine besonders kostbare Tugend, und wer, wie er, auf jüdische Art beleidigt ist, der will seinen Beleidiger nicht wirklich hassen, vergessen, ignorieren, der will nur eins: daß das Böse rückgängig gemacht, daß es durch eine Entschuldigung wieder ausgelöscht wird. Vielleicht hat diese bescheidene, geduldige Haltung damit zu tun, daß die überpragmatischen Juden immer nur den einen einzigen Wunsch haben, die Erde möge sich bloß weiterdrehen, damit sich der Rest dann schon irgendwie findet. Vielleicht rührt sie auch daher, daß sie den Antisemitismus als eine derart absurde, abstrakte Kategorie betrachten, daß ihnen allein Worte als trostreich erscheinen. Vielleicht aber, um wieder auf Vater selbst zurückzukommen, war es vor allem so, daß er irgendwann begriffen hatte, daß er damals selbst der gleiche wutentbrannte Menschheitserretter mit Parteibuch gewesen war wie Holub, sein bester Freund, weshalb er bei einer andern Gelegenheit nicht anders gehandelt hätte.
3.
»Was wissen Sie über mich, Herr Pollok?« wiederholte Holub seine Frage, doch ich antwortete nicht, ich dachte an meinen Vater, den ich so lange nicht mehr gesehen hatte, den ich noch liebe, aber nicht mehr mag, weil er uns im siebten Jahr der Emigration verließ, sieben Jahre nach unserer gemeinsamen Flucht aus Prag, den ich einfach vergessen will, weil er wegging, um mit einer Deutschen in einem deutschen Vorort eine deutsche Familie zu gründen und einen deutschen Sohn zu zeugen, meinen Halbbruder David, den ich nicht kenne, den ich niemals gesehen habe und niemals sehen will.
»Ist Ihnen nicht gut, junger Mann?« sagte Holub, und ich glaube, er lächelte.
Ich sah in seine dunkelblauen, fast violetten Augen, mir fiel auf, wie nah sie beieinanderstanden, und ich entdeckte nun auch, daß der messerscharfe Nasenflügel, der sich zwischen ihnen erhob, mit winzigen Narben und braunen Flecken übersät war. Ich schüttelte den Kopf, dann schob ich meinen Oberkörper, mit dem ich in der Zwischenzeit ganz tief in den Sessel hineingerutscht war, ein Stück nach oben, ich stützte mich mit beiden Ellbogen an den Seitenlehnen ab, bemüht, eine anständige Sitzposition zu erlangen, und das sah bestimmt genauso hilflos aus wie vorhin bei ihm, dem Greis. »Es ist alles in Ordnung«, sagte ich erschöpft, ich warf ihm einen ausdruckslosen Blick zu und schwieg wieder.
»Erzählen Sie mir doch etwas von sich«, sagte der Schriftsteller. »Ich habe vom Verlag gehört, Sie schreiben auch.«
»Ja.«
»Ist denn schon etwas erschienen?«
»Nein.«
»Ihr Deutsch ist aber sehr gut.«
»Meine Freunde in Israel sagen, ich klinge wie ein Wehrmachts-Offizier.«
»Die müssen es natürlich wissen.«
»Wir hätten damals nach Amerika gehen sollen.«
»Dort hätten Sie es auch nicht leichter gehabt.«
»Vielleicht ja doch.«
»Machen Sie sich nichts daraus«, sagte Holub. »Am Ende gewinnt man immer. Das wichtigste sind Freunde und Familie.«
»Ja.«
»Sind Sie verheiratet?«
Ich bewegte leicht den Kopf, so leicht, daß ich selbst nicht genau wußte, ob ich ihn geschüttelt oder ob ich genickt hatte.
»Kinder?«
»Nein.«
»Ich habe auch keine Kinder.« Er überlegte eine Weile, und dann sagte er vorsichtig: »Kinder behindern einen beim Schreiben nur. Miluju děti, ale musím být sám.«
Hatte er das wirklich gesagt? Meine Wut war plötzlich unermeßlich. »Ach wissen Sie, Herr Holub«, fuhr ich ihn an, und ich spürte, wie meine Kräfte nun in Sekundenschnelle wiederkehrten, »den Roman haben Sie schließlich ganz allein nicht hingekriegt.«
Er zuckte zusammen, sagte aber: »Das stimmt.«
»Na ja – immerhin wissen wir, woran es lag.«
»Ich weiß es nicht.«
»Sie waren von der ersten Seite an der Favorit, Herr Holub, darüber haben wir doch gerade gesprochen. Sie waren eingebildet wie ein großer Boer oder Tennisspieler, Sie fühlten sich zu sicher, und diese Überheblichkeit hat dazu geführt, daß Sie einfach nicht mehr gewinnen konnten.«
»Ja, könnte sein.«
»Sie haben geschrieben, wie Sie gelebt haben – zu selbstgewiß.«
Holub zögerte mit einer Antwort, und ich überlegte, ob er mich jetzt gleich hinauswerfen würde. »Woher wollen Sie das wissen?« sagte er dann.
»Als Schriftsteller weiß man alles über die andern.«
»Das leuchtet mir ein, junger Mann.«
»Es leuchtet Ihnen ein?«
»Ja.«
»Und leuchtet Ihnen auch ein«, sagte ich laut, »wie schrecklich dumm und opportunistisch es von Ihnen ist, mir das alles zu glauben? Und wie typisch das für Sie ist, Sie Arschloch?«
Er schwieg, und während er schwieg, fragte ich mich, ob ich gerade der glücklichste Mensch der Welt war, und als ich dann sah, daß seine Beine zitterten, als ich sah, wie er plötzlich ganz abwesend seine jugendlichen Hände zu drücken und pressen begann, um sie kurz darauf aus nächster Nähe zu mustern und schließlich unter seine zitternden Oberschenkel zu schieben, da wußte ich, ich war es tatsächlich: der glücklichste Mensch der Welt.
»Herrgott, Pollok«, stieß Holub aus, und obwohl er versuchte, mich anzuschreien, brachte er nur ein fades, albernes Krächzen zustande, »jetzt sagen Sie mir endlich, was Sie über mich wissen!«
»Daß Sie ein Verräter sind«, erwiderte ich mild und kühl, »ein widerlicher Verräter. Und daß Sie verlogenes gojisches Schwein meinen Vater und Ihren besten Freund an Ihr mieses gojisches Kreuz genagelt haben.«
»Ihren Vater, Pollok?«
»Meinen Vater. Aber was spielt es für eine Rolle, wer er für mich ist. Nennen wir ihn einfach nur Itzig, Sie verfluchter alter Stalinist, Sie mährischer Bauern- und Hurensohn!«
»Den Namen«, sagte Holub, und seine hohe alte Stimme klang nun wieder klar, die Knie zitterten nicht mehr, und die Hände lagen plötzlich ganz ruhig auf seinem Schoß. »Ich will den Namen Ihres Vaters wissen.«
»Sie haben ihn vergessen?«
»Den Namen!«
»Wie wäre es mit… Pepa?«
»So hieß mein Hund.«
»Immerhin hatten Sie in Ihrem Geschwür von Buch, in Ihrer Metastase von Memoiren für seine Geschichte eine Menge Platz gehabt.«
»Den Namen!«
»Pavel Pollok«, sagte ich schließlich, und eine heiße Welle schoß durch meine Wirbelsäule bis hoch hinauf zum Gehirn. »Pavel heißt mein Vater, und Sie haben ihn fertiggemacht.«
»Pavel Pollok?«
»Ja.«
»Pavel, mein Pavlíček?«
»Er kommt in Ihrem Buch gar nicht vor…«
»Mein Freund und Feind, mein Kamerad und Ankläger?«
Ich nickte.
»Der stolzeste Jude Osteuropas?« rief Holub laut und höhnisch aus, er lachte so heftig, daß er wieder zu husten begann, und die Mischung aus Röcheln und Kichern, dieses scharfe, ständig brechende Geräusch, das seiner Kehle entstieg, während sich sein schmaler, leichter Körper schüttelte, war mir so unangenehm, daß ich kurz dachte, ich müßte mir die Ohren zuhalten. »Ja, ich erinnere mich an ihn«, sagte Holub ruhig, nachdem er sich wieder gefangen hatte. Er fuhr sich durch die weiße Beethovenmähne, er strich selbstgefällig über seine rotglänzenden Greisenwangen und ließ die Hände dann langsam auf das Manuskript von Ich, Böhmen und die Welt sinken, das nun vor ihm auf dem niedrigen Glastisch lag. Nachdem er mit den Fingern an der oberen Kante des Manuskripts wie an einem Stoß Karten entlanggefahren war, spielte er eine Weile mit dem Gummiband, das den Stapel zusammenhielt, er zog es mehrmals hoch und ließ es wieder zurückschnellen, und endlich riß er es mit einer plötzlichen, für ihn viel zu heftigen Bewegung durch. »Ich soll meinen Pavlíček hier einfach nicht erwähnt haben?« sagte er. »Že jsem prej na něho fakt zapomněl?« Und dann begann er in seinem Manuskript zu blättern, sein Blick raste über die Seiten, es schien, als suche er darin tatsächlich nach dem Namen meines Vaters, er arbeitete sich wütend durch den Stapel, ohne aufzuschauen, ohne mit mir zu sprechen, er lupfte ein Blatt, warf einen flüchtigen Blick darauf, zerknüllte es, schob es vom Tisch, griff nach dem nächsten, kontrollierte und zerriß es und hatte längst wieder ein neues in der Hand. Das alles ging sehr schnell, unwahrscheinlich schnell, Holub hatte sich dabei aus seinem Sessel hochgekämpft, er beugte sich mühsam über den Glastisch, er murmelte abwechselnd auf deutsch und auf tschechisch »Pavel, wo bist du? Pavlíčku, kde jsi?«, er lachte und setzte für einen Augenblick eine besonnene Miene auf. Dann wieder verzog er zornig das gelbe Gesicht, und während immer mehr zerknüllte Seiten seines Romans den Boden um mich herum bedeckten, während der Stapel vor Holub immer niedriger wurde, bis er schließlich ganz verschwand, während sich Holubs Arbeitszimmer also allmählich in eine Art Gummizelle verwandelte, überlegte ich, ob ich tatsächlich noch immer der glücklichste Mensch der Welt war.
»Also nein«, sagte Holub, »Sie haben wirklich recht, ich kann Ihren Vater hier einfach nicht finden.« Er redete auf einmal so übertrieben langsam und monoton, als habe er mich die ganze Zeit mit seiner Verrücktennummer nur auf den Arm nehmen wollen, und plötzlich sah er mir tief in die Augen, und er sagte ernst und abgeklärt: »Sie hätten nicht mit mir anfangen sollen, Herr Pollok. Sie wären besser zu Hause geblieben.« Und dann sagte er noch etwas, aber das hörte ich nicht mehr, ich betrachtete ihn wie einen Fisch im Aquarium, ich sah seine dunklen Augen, ich sah die schmale Nase, ich sah die weißen Krümel in seinen Mundwinkeln, und es war alles nur noch ein Rauschen und Summen.
4.
Meine Eltern haben sich im Prager Filmklub bei der Premiere von Ján Kadárs erstem Film kennengelernt, bei einer Party, die nach einem eher ruhigen, langweiligen Beginn erst ganz spät in eine Art Orgie umschlug – Orgie deshalb, weil irgendwann doch noch alle Männer unter den Tischen lagen, während die Frauen, die jungen Frauen, darauf tanzten. Schließlich begannen sich die Mädchen auch noch auszuziehen, die Männer kamen schnell wieder zur Besinnung, sie standen im Kreis um sie herum, sie johlten und klatschten, und die größte Aufmerksamkeit zog dieses schmale, schwarzhaarige Ding mit den großen Brüsten und dem klugen Lächeln auf sich, das sich so wild und selbstvergessen bewegte wie ein kleines Kind, das endlich einmal mit den Erwachsenen tanzen darf. Als die Kindfrau dann langsam ihren Büstenhalter öffnete, als die Träger bereits von ihren Schultern gerutscht waren und sie, von den Zuschauern bejubelt, den BH nur noch mit den Händen über ihren Brüsten hielt, erhob sich wie in Trance ein letzter Betrunkener aus seinem Alkoholschlaf, ein kleiner, zarter Junge mit oliv-farbenem, ernsten Zigeunergesicht, er stand auf, wankte auf die kleine Tänzerin zu, zerrte sie vom Tisch herunter und trug sie, als wären sie Braut und Bräutigam, aus dem Filmklub hinaus.
In dieser Nacht, so hat es Mutter später immer erzählt, wurde ich gezeugt, gleich in dieser ersten Nacht also, in der sich meine Eltern ineinander verliebten, in der sie zum ersten Mal miteinander schliefen, in der sie sich von der selbstsüchtigen Freude über das plötzlich gefundene Glück so sehr fortreißen ließen, daß keiner von ihnen beiden darüber nachdachte, wer der andere überhaupt war. Diese Nacht bedeutete den Beginn einer langen Kette von Verleumdungen und Mißverständnissen, und vielleicht wäre später wirklich alles ganz anders gekommen, hätten sich Vater und Mutter in jenen gottverdammten zwölf Stunden nicht wie Königskinder gefühlt, wenn sie kurz innegehalten und sich gefragt hätten, ob Wunder denn tatsächlich möglich sind. Es blieb, natürlich, von diesem ersten Hochgefühl zunächst noch einiges übrig, der Haß und das Schweigen fraßen sich nur langsam zwischen sie, und es gibt eine Menge Fotos aus den frühen Jahren, auf denen meine Eltern wie ein aufgekratztes Nouvelle-Vague–Pärchen aussehen, wobei ich mich vor allem an ein Bild erinnere, das sie in einem Café in Marienbad zeigt, ein Bild, das man ziemlich lange ansehen muß, bis man sich wirklich sicher ist, daß die beiden da nicht Jean-Luc Godard und Anna Karina aus Paris sind, sondern Pavel und Lula Pollok aus Prag. Vater hat millimeterkurze Haare, er ist unrasiert, er blinzelt über den oberen Rand einer schweren schwarzen Sonnenbrille in die Kamera, während Mutter, eine Perle in ihrem weißen, engen Kleid mit dem üppigen Spät-Fünfziger-Dekolleté, ihn von der Seite ernst und verliebt anblickt.
Es gab bestimmt mehr als diesen einen goldenen Augenblick in der Ehe meiner Eltern, zumindest solange wir in der Tschechoslowakei lebten – alles war leicht, fast unernst, Mutter schrieb noch nicht, sie war eine junge Schauspielerin mit kleinen Rollen und einer großen Zukunft, während Vater ohne Säuernis um seinen Durchbruch kämpfte. Hatte er nach seiner Entlassung aus der Armee zuerst mit Skripts für öde Wissenschaftssendungen des staatlichen Rundfunks Geld verdienen müssen, schien es plötzlich nurmehr eine Frage der Zeit zu sein, wann er, als einer aus der jungen Prager Filmclique, sein erstes Drehbuch für einen abendfüllenden Film schreiben würde. Ein paar Monate lang zog Vater mit seinen neuen Freunden Nacht für Nacht um die Häuser, sie gingen ins Theater Na zábradlí, sie aßen beim einzigen Chinesen der Stadt und betranken sich hinterher im Bystrica, und eines Abends kam er dann endlich mit Miloš Forman ins Gespräch. Der Film, den sie zusammen machten – bis heute Vaters einzige wichtige Arbeit –, wurde in Karlsbad mit dem Großen Preis ausgezeichnet, und zur Feier fuhren meine Eltern, ohne mich, das erste Mal in ihrem Leben nach Frankreich.
An die Prager Jahre – die besten, die meine Eltern miteinander gehabt hatten – kann ich mich selbst natürlich wenig erinnern, aber ich weiß noch, wie ich damals schon, als Kind, über bestimmte Blicke, Gesten und Bemerkungen erschrak, und ich weiß auch, wie ich mir dann jedesmal vorstellte, Vater und Mutter könnten gar nichts dafür und seien nur für einen kurzen Moment von bösen Geistern besessen. Heute vermag ich nicht genau zu sagen, in wem es mehr gespukt hatte, wer von den beiden stärker unter seinen Leidenschaften gelitten hat. Vater, sein Leben lang verbittert über den Parteiausschluß, wütend über das geraubte Studium, entkräftet von den fünf Jahren in Jáchymov, war zwar in jener Zeit nicht weniger einsilbig und egoistisch als sonst, doch die Aufbruchstimmung, die das Land plötzlich erfaßt hatte, riß ihn wie alle andern kurz mit. Die kollektive Fortsetzung des Sozialismus mit menschlichen Mitteln war eine große, nationale Angelegenheit, niemand wurde ausgeschlossen, weder ein Opfer wie er noch ein Bösewicht wie Milan Holub, alle Tschechen und Slowaken empfanden ein paar Monate, Jahre lang eine fast zärtliche Gemeinsamkeit, und so gesehen war der Prager Frühling für Vater eine ganz gute Kur gegen seine Einsamkeit. Erst nach dem russischen Einmarsch begriff er, als einer von vielen, wie banal die Illusion gewesen war, in der er gelebt hatte. Wenn man so will, war für ihn die Okkupation die Wiederholung dessen gewesen, was ihm selbst schon einmal ganz persönlich angetan worden war, damals, 1949, in Moskau. Das alte Trauma kehrte zurück, das Schweigen und der Groll, doch diesmal war niemand mehr da, der ihm hätte helfen können, denn Mutter hatte nun ihre eigenen Probleme und Gespenster. Daß sie in Barrandov und an den Prager Theatern keine Arbeit mehr bekam, war das eine. Daß sie Gedichte zu schreiben begann, das andere. Plötzlich hatte sich ihre Zärtlichkeit, ihre Wärme in etwas Neues verwandelt, sie war mal manisch gut gelaunt, mal tief frustriert, ihre Stimmungen überkamen sie wie Naturkatastrophen, und das Tragische war, daß sie jedesmal so radikal von ihr Besitz ergriffen, daß Mama dann tagelang wie eine Schlafwandlerin durchs Leben ging. Die Depressionen trieben sie an den Patience-Tisch oder zu ihren Gedichten, die Euphorien aber hinaus auf die Straße, zu Freunden oder in Lokale, wo sie manchmal vier, fünf Stunden lang ganz allein eine Gesellschaft unterhielt, plappernd und lachend und grimassierend. Wollte sie einen ihrer Gute-Laune-Anfälle zu Hause ausleben, drehte sie das Radio laut auf, sie tanzte allein im Wohnzimmer oder redete, wenn keine passende Musik kam, Vater und manchmal sogar auch mich einfach nieder, allein mit sich selbst, ohne Sinn oder Gehör für den andern.
Am liebsten tanzte Mama zu dieser wüsten slowakischen Volksmusik, in der sich Zimbal, Geige und das Seufzen des Sängers immer wahre Wehmutsschlachten liefern, und als wir dann später nach München kamen, als wir in die Wohnung am Petuelring einzogen, kaufte sie, noch bevor wir ein einziges Möbelstück besaßen, einen Plattenspieler, sie holte aus ihrem Koffer ein paar alte Supraphon-Platten heraus, legte eine auf und begann selbstverliebt, selbstvergessen zu tanzen, sie schnippte mit den Fingern, sie rief »Juchej!« und »Joj!«, sie war aufgelöst vor Glück, und ich weiß wirklich nicht, ob Vater sie in diesem Augenblick genauso entzückend und liebenswürdig fand wie damals im Filmklub … So also begann das erste Kapitel der Emigration, im Frühling 1970, und es endete sieben Jahre später, irgendwann an einem späten Nachmittag, als die Möbelpacker Vaters Sachen aus der Wohnung hinaustrugen. Vater war ein paar Wochen vorher ausgezogen, während der Ferien, als ich in England einen Sprachkurs machte, und nun stand ich in seinem leeren Arbeitszimmer, und an der Stelle, wo früher der Schreibtisch gewesen war, senkten sich ein paar staubige Spätsommerstrahlen schräg in den Raum und tanzten über dem zerkratzten Parkett.
Nein, die Polloks haben im Exil wahrlich keine gute Figur gemacht – wir waren in der Fremde einander noch fremder geworden, die Familienwohnung war nicht mehr der Ort aller Gemeinsamkeit, sondern allein der neutrale Boden, wohin sich jeder zurückzog, um darüber nachzusinnen, wie gräßlich es dort draußen, in diesem Deutschland der Deutschen, war. Statt miteinander zu reden, statt zu streiten, statt sich wütend die Meinung zu sagen, lebten wir – von Vater angesteckt – in München zusehends stummer und unaufmerksamer nebeneinander. Wie sehr habe ich mir später gewünscht, Mutter hätte Vater ein einziges Mal für seine wehleidige Zurückgezogenheit lauthals beschimpft! Und wie sehr hätte ich es geliebt, wenn Vater ihr wiederum wutschnaubend ihre tyrannischen Stimmungen vorgehalten hätte! In Wahrheit aber kümmerte sich jeder um sich selbst, ich saß tagelang in meinem Zimmer, las Thomas Mann und hörte das Köln-Konzert von Keith Jarrett, Vater büffelte Deutsch, arbeitete manchmal beim BR als Aufnahmeleiter und träumte von seinem nächsten Forman-Film, und Mutter, die im Westen Theater und Kino endgültig aufgegeben hatte, verlegte sich darauf, in kleinen Emigrantenzeitschriften ihre Gedichte zu veröffentlichen und melodramatische Briefe an wildfremde Menschen zu schreiben, an Antonín Liehm in Paris oder an Škvorecký in Toronto etwa, die sie anflehte, ihr bei der Suche nach einem ausländischen Verlag unbedingt zu helfen, sie würde sich sonst etwas antun.
An Milan Holub wandte sich Mutter, nachdem auch er aus Prag ausgereist war, natürlich nicht, das war das mindeste, was sie für Vater, für den Herrn vom andern Ende des Flurs, tun konnte, und überhaupt – so dachte ich oft – war die Sache mit Holub in der Emigration das einzige Glied, das uns noch verband. Wenn wir, was am Ende immer seltener geschah, in unserer Küche zusammensaßen und über ihn sprachen, war sofort alles andere vergessen, wir vertieften uns jedesmal von neuem in Vaters Holub-Geschichte wie religiöse Juden an Pessach in die Haggada, und obwohl Mutter die Moskauer Geschehnisse nüchtern, fast ohne Kommentar, erzählte, kam es mir trotzdem so vor, daß sie und Vater davon überzeugt waren, es wäre für sie beide alles soviel leichter gewesen, hätte sich diese Tragödie in der tschechoslowakischen Botschaft niemals abgespielt, denn dann wäre Vater wohl ein ganz anderer geworden und er hätte sie und mich ganz anders geliebt. Daß Vater am Ende unserer Küchengespräche immer so traurig von Holubs ausgebliebener Entschuldigung sprach, war für mich jedenfalls Beweis genug, daß er dem Schriftsteller tatsächlich für alles, was in seinem Leben passiert war, die Schuld gab, und so mußte ich dann dabei oft an jenen Satz denken, mit dem die Juden seit über dreitausend Jahren ihre Geschichte beschwören, an diese so ambivalente Formel, die ihnen als Testament und Prophezeiung gilt. »Wir waren Sklaven in Ägypten«, sagen sie, und nichts anderes sagte Vater auf seine Art auch, wenn er zum hundertsten Mal erklärte, Holub habe sich bei ihm nicht einmal entschuldigt.
Wie mächtig und einigend kann die Kraft der Geschichte wohl sein? Unser gemeinsamer Haß gegen Milan Holub war jedenfalls nicht stark genug, eines Tages gab Vater mir und Mutter dann doch noch den Laufpaß, er nahm seine Kleider, Möbel und Bücher mit, er ließ uns die Familienfotos und seine Lebensversicherung, er zog ans andere Ende der Stadt zu seiner neuen Frau, die genauso still war wie er, er zog weit weg von uns in den hellen, reichen Süden Münchens, und nun saß er also in Solln, in dieser weißen Wirtschaftwundervilla an seinem Schreibtisch und mühte sich dort mit seinen Drehbüchern ab, die keiner verfilmen wollte. Jedesmal, wenn ich seitdem an ihn denken mußte, wütend über seinen Verrat und voller Bewunderung für die Kraft, mit der er sich Deutsch beigebracht hatte, um bei aller Aussichtslosigkeit weiterschreiben zu können, jedesmal, wenn ich vor meinem inneren Auge diesen kleinen, dunklen Mann sah, wie er verbissen auf den Bildschirm seines Computers starrt, immer noch derselbe Egoist und Don Quichotte wie früher, erinnerte ich mich daran, wie ich früher einmal, um ihn endlich aus der Reserve zu locken, furchtbar grob und eingebildet zu ihm sagte: »Mama und ich sind ein Fleisch und Blut – aber du bleibst für sie auf immer ein Fremder.« Worauf er ein für ihn vollkommen ungewohntes Lächeln auf seine Lippen zauberte und mir sanft über die Stirn strich.
5.
»Sie sind schuld«, sagte ich zu Holub, »Sie allein.« Das Rauschen und Summen ließ langsam wieder nach, und ich fühlte mich so kräftig und ausgeruht, als hätte ich zehn Stunden geschlafen. »Sie sind schuld«, wiederholte ich, »ja, Sie sind schuld.« Ich liebte diesen Satz, ich war schrecklich froh, daß ich ihn endlich gefunden und ausgesprochen hatte, und dann – als sei nun alles zu Ende, das Drama vorbei – beugte ich mich vor und begann, aus Höflichkeit und ohne mir etwas dabei zu denken, die verstreuten Manuskriptblätter vom Boden aufzusammeln.
»Lassen Sie das«, sagte Holub, »fassen Sie bloß nichts an!« Seine Stimme hatte an Kraft gewonnen, sein Blick war scharf und genau, und auch sein schmächtiger Körper hatte mit einem Mal alles Senile verloren. Der Alte stand, die kleine, harte Brust steif vorgestreckt, hinter seinem Schreibtisch, er zog eine Schublade auf und nahm einen grauen Plastikordner heraus. »Jetzt lassen Sie das doch endlich«, sagte er, »dort unten werden Sie Ihren Vater nicht finden.« Aber ich achtete nicht auf ihn, und erst nachdem sich Holub wieder in seinen Sessel gesetzt hatte, begann ich – noch immer auf dem Boden herumkriechend – mir seiner Worte bewußt zu werden, und plötzlich ließ ich alle Blätter wieder fallen, ich nahm ebenfalls Platz, Holub füllte unsere Gläser mit Cognac auf, er schob mit der Handkante die Zigarettenschachtel zu mir herüber, schließlich öffnete er den Ordner und sagte: »Hier haben wir unseren Pavlíček, Herr Pollok, hier ist das Jüdlein-Kapitel, an dem ich so lange schrieb und das ich dann doch nicht in mein Buch aufgenommen habe, und wenn Sie noch einmal Arschloch zu mir sagen, dann schmeiße ich Sie raus.«
»Arschloch«, sagte ich, »Arschloch, Arschloch, Arschloch.« Ich stand auf und ging zur Tür.
»Ich weiß«, rief mir Holub hinterher, »daß Sie sowieso bleiben werden.«
Ich drehte mich nach ihm um, wir schauten uns an, und während sich unsere Blicke kreuzten, machte ich ein paar langsame, tastende Schritte zurück, es zog mich durch den ganzen Raum, an Holub vorbei, und an der offenen Balkontür blieb ich dann stehen. Jetzt erst löste ich von Holub den Blick, ich sah hinaus, ich sah über die Stadt zu den blauen Hügeln der Alpen, sie schimmerten in der heißen italienischen Luft, ich roch Sand und Oleander und Meer, und ich dachte, wenn das hier endlich vorbei ist, nehme ich meine Badesachen und setze mich in Terracina an den Strand.
»Ich bin schuld?« sagte Holub.
»Ja.«
»Woran? Sagen Sie es! Oder schweigen Sie lieber ganz, es wäre ohnehin am besten für Sie.«
Was sollte ich bloß tun? Sollte ich erklären, wegen Ihnen, Holub, lebt Vater nicht mehr bei uns, wegen Ihnen ist Mutter absonderlich geworden, und aus mir haben Sie einen apathischen, jähzornigen Trauerkloß gemacht?
»Sie sind«, begann ich schließlich, »Sie sind … schuld daran, daß wir Prag überhaupt verlassen mußten … Ja, ganz genau. Denn Typen wie Sie haben dem Land gleich zweimal Unglück gebracht. Sie und die andern waren zuerst so dumm, unter Gottwald Stalinismus mit Kommunismus zu verwechseln, und zwanzig Jahre später waren Sie noch viel dümmer, als Sie mit Dubček eine sozialistische Demokratie errichten wollten, viel zu naiv, um zu verstehen, daß Zar Breschnew so was niemals zulassen würde … Ich hasse Idealisten«, fuhr ich ihn an, und ein herrliches Triumphgefühl stieg kurz in mir auf.
»Warum gehen Sie nicht einfach wieder zurück?«, sagte er ungerührt. »Es hat sich doch alles zum Guten gewendet.«
»Zu spät.«
»Sie haben sich in Deutschland prächtig eingelebt, nicht wahr?«
»Ja, ganz genau«, log ich. »Und außerdem – wenn ich daran denke, daß schon wieder dieselbe Clique wie ’48 und ’68 in der Burg sitzt, wird mir nur übel.«
»Ihnen wird übel?«
»Ja, verdammt. Es sind schließlich Leute wie Sie, die jetzt auch noch die Republik spalten!«
Holub drehte den Kopf zur Seite, und dann sagte er, ohne
mich anzusehen, streng und vorwurfsvoll: »Sie reden so, als hätte ich Ihr ganzes Leben vernichtet und –«
»Nicht mein Leben«, unterbrach ich ihn erschrocken, »aber das meines Vaters.«
Er sah mich jäh wieder an. »Jetzt sagen Sie endlich, was Sie wissen!« rief er. »Tak už to řekněte!«
Ich atmete durch, einmal, zweimal, aber ich blieb stumm, Holub schwieg auch, und so schwiegen wir beide, und plötzlich sagte ich ganz leise: »Sie haben Papa in Moskau verraten …«
Nein, er zuckte nicht zusammen. Er schnaubte nicht vor Wut, und er sprang mir auch nicht an die Kehle. Er nickte einfach nur, er nickte und nickte, und dabei schürzte er nachdenklich die Lippen.
»Sie haben meinen Vater auf dem Gewissen«, sagte ich, »und er hat sich von Ihrem Verrat nie mehr erholt. Das Leben ist seitdem für ihn nur noch ein Traum – und die Menschen Traumfiguren, durch die man einfach hindurchgreifen kann. Er glaubt niemandem mehr, nur sich selbst, im Beruf und auch sonst, und hätte er nicht nach dem Lager meine Mutter kennengelernt, dann wäre nicht einmal dieser stumme Phantast aus ihm geworden, sondern einfach nur ein abgewrackter Versager.« Ich wußte genau, daß ich über Dinge redete, die ich noch nie mit jemandem besprochen hatte, es war völlig verrückt und ganz logisch zugleich, daß ausgerechnet Milan Holub mein Zuhörer war. »Sie haben sich«, sagte ich plötzlich selbstbewußt, »bei Vater noch nicht mal entschuldigt!«
Holub hörte auf zu nicken. »Wann, sagten Sie, hat Ihr Vater Ihre Mutter kennengelernt?«
»Wieso wollen Sie das so genau wissen?«
»Antworten Sie!«
»Ende der fünfziger Jahre, glaube ich. Aber das spielt doch gar keine Rolle.«
»Und wo?«
»In Prag natürlich«, sagte ich, und dann fügte ich, eher gnädig und geduldig als zornig, hinzu: »Jetzt lassen Sie mich doch damit in Ruhe. Sie sind ein Schuft, das wissen Sie, und Sie kommen in die Hölle.«
»Kommen Juden auch in die Hölle?«
»Nur wenn sie sich mit den falschen Gojim einlassen.«
»Jasně. Sonst nicht?«
»Niemals, Herr Holub. Die Erde ist für uns bereits fürchterlich genug. Da hat Gott später mit uns ein Einsehen.«
Er bewegte den Kopf, als würde er etwas ganz genau abwägen, dann sagte er: »Möchten Sie sich nicht wieder setzen?«
»Nein.«
»Sicher nicht?«
»Was soll denn das?« fuhr ich ihn an, ich machte einen ängstlichen Schritt auf die Terrasse hinaus, ich sog den Wind ein, der in kühlen und heißen Stößen abwechselnd um mein Gesicht strich, ich dachte wieder an den langen Strand von Terracina, ich dachte an junge Frauen mit dunklen Hüften, an Eisverkäufer und deutsche Touristen, und ich dachte auch an die rauhen, breiten Steine, auf die man im Seichten tritt, bevor man ins Meer rausschwimmt.
»Ihre Eltern, Pollok, haben Sie angelogen«, sagte er. »Ihre Eltern kennen sich, seit sie Kinder waren, und sie überlebten gemeinsam den Krieg. Ich habe« – er stutzte für einen Moment – »ich habe, falls es Sie interessiert, darüber alles in meinem Jüdlein-Kapitel geschrieben, und natürlich habe ich darin auch erwähnt, daß die beiden einen Freund hatten, der Milan hieß, ein einfacher mährischer Bauernjunge, aber bestimmt kein Hurensohn.«
»Doch! Ein Hurensohn!« stieß ich aus, und Holubs kleines altes Gesicht zog sich zusammen, die Stirn, die Wangen und das Kinn waren mit unzähligen Falten übersät, aber plötzlich straffte sich die Haut wieder, er lächelte und sagte: »Wollen Sie meine Geschichte hören oder nicht?« Und jetzt nickte ich, worauf er den Kopf senkte, er blätterte in seinem Ordner eine Seite um, doch dann legte er ihn wieder weg und sah mich traurig an.
6.
Zuerst erzählte Holub von dem Bauernhof seines Vaters in der Nähe von Ostrau. Er sprach von tiefen, endlosen Wäldern, in denen ein Kind allein vor Angst verging, mit anderen zusammen aber glücklich und aufgeregt war über so viel Düsternis und Abgeschiedenheit. Er beschrieb mir den Geruch von gemähtem Gras, der sich im Altweibersommer über den Feldern erhob, er redete über das teuflische Rot der Mohnblumen und über den süßlichen Geschmack der Weizenkörner, die man aus den Ähren herauspulte und ganz langsam zerkaute. Er sprach von Schlachtfesten und dampfenden Innereien, von klugen Schweinen und verwöhnten Katzen, von Kühen, Ziegen und einem alten Schäferhund, und dann aber, übergangslos, redete er vom Krieg, den man in der Einöde von Lanovo lange Zeit nicht gespürt hatte, weil man von ihm einfach nichts wissen wollte, so lange, bis Holubs Vater eines Tages zwei fremde Kinder aus der Stadt mitbrachte, einen halbwüchsigen, hübschen Jungen, dessen olivfarbenes Gesicht mit Flaum übersät war, und ein aufgedrehtes, unentwegt kicherndes und plapperndes Mädchen mit blauschwarzen Haaren und dem Ansatz einer Brust. Der Junge hieß Chaim Pollok, das Mädchen Zelda Rubinstein, sie nannten sich Pavel und Lula, er stammte aus Brno, sie aus Prag, und bei der katholischen Untergrund-Organisation, die sie gerettet hatte, wußte niemand, was mit ihren Eltern geschehen war.
Das Mädchen und der Sohn des Bauern verliebten sich gleich am ersten Morgen ineinander – sie stand hinter ihm am Brunnen, als er sich wusch, und dann wusch sie sich und er sah ihr zu. Obwohl Milan älter war als Lula, war er sich seiner Zuneigung am Anfang genausowenig bewußt wie sie. Dem stillen, zornigen Pavel fiel jedoch schnell auf, wie aufmerksam die beiden miteinander sprachen, wie erschrocken sie sich immer ansahen, und Milan und Lula begriffen erst im nachhinein den Ernst und die Niederträchtigkeit der Bemerkungen, die er ab und zu in ihrer Gegenwart aus heiterem Himmel machte. »Wer so viel lacht, wird daran noch ersticken«, murmelte Pavel einmal am Weiher von Lanovo still vor sich hin, während Milan und Lula einen ganzen Nachmittag lang kreischend und johlend versuchten, sich gegenseitig ins Wasser zu stoßen. Er lag am Ufer, das Gesicht hinter einem seiner Jirásek-Bücher versteckt, und als sie dann schließlich direkt vor ihm auftauchten, sich über ihn beugten und wild die nassen Köpfe schüttelten, um ihn vollzuspritzen, wurde er richtig wütend. »Eines Tages werdet Ihr daran ersticken«, sagte er laut und böse, ohne sie anzuschauen, und dann fügte er hinzu: »Glück macht dumm.« Doch Milan und Lula nahmen Pavels Anfälle nie allzu ernst, sie wußten nicht, warum er in Wahrheit so bitter war, sie dachten, er meine, die Zeit sei eben nicht danach, ein ausgelassener, fröhlicher Jugendlicher zu sein, aber sie schämten sich trotzdem ihrer Fröhlichkeit nicht, und obwohl sie darüber nicht sprachen, war beiden klar, daß man mit Pavel Geduld haben mußte.
Pavel liebte Lula auch, doch im Gegensatz zu Milan wußte er es. Er wollte um sie kämpfen, aber er hatte keine Ahnung wie, und obwohl er noch nie ein Mädchen geküßt, geschweige denn überall gestreichelt hatte, dachte er ständig daran, wie es wäre mit Lula zu schlafen, und manchmal, wenn sie wieder einmal mit Milan allein durch die Wälder zog, kroch Pavel in ihren Unterschlupf unter dem Austragshof zurück, er zog sich nackt aus, legte sich in Lulas Bett, mit dem Bauch nach unten, und während er ihr Kissen zärtelte und küßte, als wäre es ihr Gesicht, rieb er seinen Körper so lange an der Matratze, bis es ihm kam. Irgendwann begann sich Lula über die Flecken in ihrem Bett zu wundern, sie fragte sich, ob nicht vielleicht die Katzen in ihrer Abwesenheit darin spielten und hineinmachten, und so schlich sie eines nachmittags, als Milan mit seinem Vater in die Stadt gefahren war, an ihr »Nazischreckversteck«, wie sie es nannte, leise heran, sie kam lautlos die kleine Leiter hinunter, und als sie dieses Kratzen und Keuchen und Matratzenknirschen hörte, war sie sich sicher, sie habe die verfluchten Viecher endlich erwischt. Da aber sah sie schon Pavels nackte Schultern, sie sah seinen schmalen braunen Rücken, sie sah seinen weißen Po, und weil sie so leise gewesen war, machte er immer weiter und weiter, er zuckte mit den Armen, er wand den Oberkörper, sein kleiner Hintern ging in schnellen, abgehackten Bewegungen auf und ab, und schließlich winselte der Junge, er seufzte auf, als hätte er sich verschluckt, seine Glieder vibrierten sekundenlang wie nach einem Stromschlag, und danach wurde er ganz still. Von diesem Moment an liebte Lula auch Pavel, aber sie liebte ihn anders als den Sohn des Bauern, nicht so naiv und platonisch, nicht so unbewußt, sie wollte Pavlíček haben, sie wollte ihn einmal genau dann in den Armen halten, wenn ihn dieser Stromschlag traf, und so kletterte sie, ohne ein Wort zu sagen, wieder still hinauf. Dachte sie später daran, wie schön Pavel an jenem Nachmittag in ihrem Bett gebebt hatte, war sie genauso glücklich und aufgekratzt, wie man es in ihrem Alter sonst immer ist, wenn man mit jemandem das erste Mal geschlafen hat, ohne daß es eine Enttäuschung war.