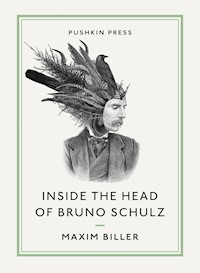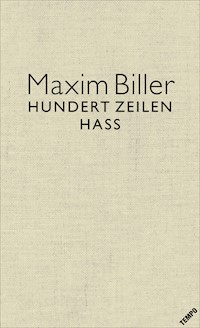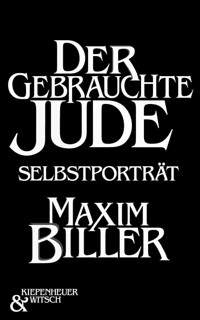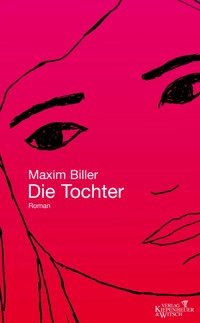12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Welt der russisch-jüdischen Familie aus Hamburg, um die es in Maxim Billers neuem Roman »Mama Odessa« geht, ist voller Geheimnisse, Verrat und Literatur. Wir lesen aber auch ein kluges, schönes und wahrhaftiges Buch über einen Sohn und eine Mutter, beide Schriftsteller, die sich lieben, wegen des Schreibens immer wieder verraten – und einander trotzdem nie verlieren. Mit beeindruckender Leichtigkeit spannt Maxim Biller einen Bogen vom Odessa des Zweiten Weltkriegs über die spätstalinistische Zeit bis in die Gegenwart. Alles hängt bei der Familie Grinbaum miteinander zusammen: das Nazi-Massaker an den Juden von Odessa 1941, dem der Großvater wie durch ein Wunder entkommt, ein KGB-Giftanschlag, der dem Vater des Erzählers gilt und die Ehefrau trifft, die zionistischen Träumereien des Vaters, der am Ende mit seiner Familie im Hamburger Grindelviertel strandet, wo nichts mehr an die jüdische Vergangenheit des Stadtteils erinnert – und wo er aufhört seine Frau zu lieben, um sie wegen einer Deutschen zu verlassen. Dennoch scheint ständig ein schönes, helles Licht durch die Zeilen dieses oft tieftraurigen, außergewöhnlichen Buchs. »Mama Odessa« ist ein literarisches Meisterstück von größter Präzision und poetischer Kraft, wie es auf Deutsch nur selten gelingt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Maxim Biller
Mama Odessa
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Maxim Biller
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Maxim Biller
Maxim Biller, geboren 1960 in Prag, lebt seit 1970 in Deutschland. Von ihm sind bisher u.a. erschienen: der Roman »Die Tochter«, die Erzählbände »Sieben Versuche zu lieben«, »Land der Väter und Verräter« und »Bernsteintage«. Seinen Liebesroman »Esra« lobte die FAS als »kompromisslos modernes, in der Zeitgenossenschaft seiner Sprache radikales Buch«. Billers Bücher wurden in neunzehn Sprachen übersetzt. Bereits nach seinem Erstling »Wenn ich einmal reich und tot bin« (1990) wurde er von der Kritik mit Heinrich Böll, Wolfgang Koeppen und Philip Roth verglichen. Zuletzt erschienen sein Memoir »Der gebrauchte Jude« (2009), die Novelle »Im Kopf von Bruno Schulz« (2013) sowie der Roman »Biografie« (2016), den die SZ sein »Opus Magnum« nannte. Sein Bestseller »Sechs Koffer« stand auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2018. Über den Roman »Der falsche Gruß« (2021) schrieb die NZZ: »Das ist große Kunst.«
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Mit beeindruckender Leichtigkeit spannt Maxim Biller einen Bogen vom Odessa des Zweiten Weltkriegs über die spätstalinistische Zeit bis in die Gegenwart. Alles hängt bei der Familie Grinbaum miteinander zusammen: das Nazi-Massaker an den Juden von Odessa 1941, dem der Großvater wie durch ein Wunder entkommt, ein KGB-Giftanschlag, der dem Vater des Erzählers gilt und die Ehefrau trifft, die zionistischen Träumereien des Vaters, der am Ende mit seiner Familie im Hamburger Grindelviertel strandet, wo nichts mehr an die jüdische Vergangenheit des Stadtteils erinnert – und wo er aufhört seine Frau zu lieben, um sie wegen einer Deutschen zu verlassen. Dennoch scheint ständig ein schönes, helles Licht durch die Zeilen dieses oft tieftraurigen, außergewöhnlichen Buchs.
»Mama Odessa« ist ein literarisches Meisterstück von größter Präzision und poetischer Kraft, wie es auf Deutsch nur selten gelingt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2023, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung Covergestaltung und -motiv: Walter Schönauer
Alle Rechte vorbehalten
ISBN978-3-462-31152-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Vom selben Autor
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Wenn ich einmal reich und tot bin
Die Tempojahre
Land der Väter und Verräter
Harlem Holocaust
Die Tochter
Kühltransport
Deutschbuch
Esra
Bernsteintage
Moralische Geschichten
Menschen in falschen Zusammenhängen
Liebe heute
Der gebrauchte Jude
Kanalratten
Im Kopf von Bruno Schulz
Biografie
Hundert Zeilen Hass
Sechs Koffer
Literatur und Politik
Sieben Versuche zu lieben
Wer nichts glaubt, schreibt
Der falsche Gruß
»Nur wer tragisch endet, ist wirklich ein Poet.«
Wladimir Wyssozki
1.
Im Mai 1987 – ich war erst sechsundzwanzig Jahre alt – schrieb mir meine Mutter auf einer alten russischen Schreibmaschine einen Brief, den sie nie abschickte. Es ging gleich damit los, wie faul sie gerade sei, wie sehr sie sich mal wieder dafür schämte, dass sie tagelang auf der riesigen roten Rolf-Benz-Couch im Wohnzimmer herumlag, die sie noch mit meinem Vater gekauft hatte, und pausenlos ihre langen, dünnen Kim-Zigaretten rauchte. Wie sie in der Küche Patiencen legte und noch mehr rauchte. Oder wie sie rauchend am Fenster im Wohnzimmer stand und die jungen, gerade sprießenden Blätter an den eben noch kahlen schwarzen Ästen der Linden vor unserem Haus in der Bieberstraße anguckte.
Danach kamen ein paar kurze, böse Gedanken über die Menschen im Westen, die immer so tun mussten, als ob sie sehr beschäftigt wären. So wie ihre »nervige« Nachbarin aus dem Erdgeschoss – »Ich kann mir ihren idiotischen Adligennamen bis heute nicht merken!« –, die ihr neulich erzählt habe, wie schlecht sie sich fühlte, wenn sie einen Tag lang nichts anderes machte, als Krimis zu lesen. Und dann überfiel sie mich, der diesen Brief erst dreißig Jahre später, erst nach ihrem scheußlichen, einsamen Tod lesen sollte, mit ihrer Wut und ihrer Traurigkeit, von der ich nie etwas gewusst habe. Oder vielleicht doch? Es ging um ihren Vater, meinen Großvater, der Mitte der siebziger Jahre in Odessa verhaftet wurde, weil er mit zwei Freunden eine geheime Ausstellung antisowjetischer Kunst im Keller der Kunstakademie organisiert hatte, im Gefängnis einen Herzinfarkt kriegte, später zu Hause noch einen, dann noch einen, und dann war es vorbei.
»Bis heute quält mich mein schlechtes Gewissen, synok, und so wird es bis zum Ende meines Lebens sein, dass ich nicht zu Papa vor seinem Tod nach Odessa geflogen bin, dass ich nicht bei ihm war und ihn nicht begraben habe«, schrieb mir meine Mutter. »Hätte ich gewusst, dass diese schrecklichen Gefühle ein Leben lang wiederkommen werden, wäre ich damals natürlich zu ihm gefahren und hätte ihm den Handrücken gestreichelt, so wie er es früher immer bei mir machte, wenn ich keine Lust mehr auf nichts hatte.«
Dazu muss man wissen, dass wir – meine Mutter, mein Vater und ich – lange vor den meisten anderen Juden Anfang der siebziger Jahre die Sowjetunion verlassen hatten. Mein Vater hatte mit seinen langatmigen Studien über die Geschichte des russischen Zionismus, die nur im Samisdat erschienen, und mit seinem völlig ernst gemeinten Plan, uns mit einem entführten Aeroflot-Flugzeug aus Odessa nach Tel Aviv rauszufliegen, schon immer zu den eifrigsten Refuseniks aus der Gruppe um den neuen Moses Nathan Scharanskij gehört. Das war das eine. Das andere war, dass keiner von uns dreien nach unserer von Henry Kissinger persönlich ausgehandelten Ausreise 1971 jemals wieder einen Fuß auf sowjetischen Boden setzen durfte. »Wen die ewigen Kommissare noch einmal zu fassen kriegten, den würden sie nie wieder gehen lassen«, sagte mein Vater oft.
Und trotzdem wäre meine Mutter zurückgefahren?, fragte ich mich immer wieder beim Lesen des Briefs, der so lange adressiert und frankiert in einer der Schubladen ihres Arbeitszimmersekretärs herumgelegen hatte. War ich ihr so egal? Wäre es ihr wirklich wichtiger gewesen, noch einmal ihrem sterbenden Vater in die verlöschenden Augen gesehen zu haben, statt ein ganzes, vor mir liegendes Leben lang in meine Augen zu schauen? »Übrigens«, hatte sie mit der Hand unter den maschinengeschriebenen Brief gekritzelt, »überlege ich schon lange, ob ich dieses scheußliche riesige Möbelstück, auf dem ich hier gerade liege und dir schreibe, endlich wegwerfen und mir etwas schönes Neues fürs Wohnzimmer kaufen soll. Ich bin sicher, dein Vater hat hier immer mit seiner deutschen Nutte gelegen, wenn ich nicht da war.«
Konnte es sein, dachte ich plötzlich, dass ich inzwischen auch so ein verwirrter, trauriger Erwachsener war wie meine Eltern? Denn jetzt war ich es, der in Hamburg, in der Bieberstraße, auf dem fünfzig Jahre alten roten, noch immer ziemlich festen und fast wie neu strahlenden Sofa saß und die typischen Katschmorian-Gefühle hatte, wie meine Mutter das nannte, auch aus eigener Erfahrung. Was sie damit meinte? Mein schöner, fröhlicher armenischer Großvater hieß Katschmorian – Jaakow Gaikowitsch –, und obwohl er es sich nach Mamas Worten nie anmerken ließ, dachte er genauso oft an Selbstmord wie andere Leute an Liebe und Essen. Oder vielleicht sogar noch öfter.
2.
Das erste Mal las mir meine Mutter eine von ihren Erzählungen am Telefon vor – sie war in Hamburg, ich schon ein paar Jahre in München. Ich hatte gerade meine erste richtige Erwachsenenwohnung gefunden, zwei Zimmer unterm Dach, im Winter zu kalt, im Sommer zu heiß, aber wenigstens keine furchteinflößenden WG-Fremden mehr, mit denen ich das Badezimmer, die Küche und alle möglichen Stimmungen und Katastrophen teilen musste. An einem hellen Sommervormittag stand ich dort am Fenster, guckte auf den riesigen schwarzen Block des Nordbads mit der noch leeren, im Morgentau schimmernden Wiese davor und hielt das Telefon zwischen Kopf und Schulter, weil ich gleichzeitig versuchte, einen kleinen Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber von der Glasscheibe zu kratzen, den ich bei der Wohnungsübergabe nicht bemerkt hatte.
»Wie geht es dir, mein Junge?«, hatte meine Mutter freundlich gesagt, als ich – noch im Pyjama – ein paar Minuten vorher schlecht gelaunt abgenommen hatte. Danach fiel sie sich selbst ungewöhnlich hart und unfreundlich ins Wort. »Aber bitte erzähl mir jetzt nicht wieder von deinen Problemen und deinen Mädchen! Du weißt, dass ich dann tagelang nur noch über dich nachdenke und mir Sorgen mache.«
Ich machte stumm ein genervtes Gesicht wie ein Sechzehnjähriger.
»Na gut«, sagte sie, »was ist los?«
»Nichts«, sagte ich, »gar nichts. Ich bin einfach zu spät, ich müsste schon längst arbeiten.«
»Das war toll, was du über Cynthia Ozick geschrieben hast, ich hab mir gleich fünf oder sechs Spiegel-Hefte gekauft und sie an die ganzen dummen Weiber bei uns im Haus verteilt. Sollen sie vor Neid platzen!«
»Was soll das, Mama? Ich bin nicht mehr acht. Du musst nicht mit mir angeben.«
»Ja, leider.«
»Weißt du noch, wie ich in Odessa wie alle anderen Kinder in meiner Klasse für den Frauentag fotografiert wurde?«
»Ich hab die Karte noch irgendwo.«
»Sie haben das Foto von jedem von uns in eine Zeichnung von einem Blumenstrauß reingeklebt. Und darüber stand in so einer blöden geschwungenen Schrift: Internationaler Tag der Frau 1968 und Herzlichen Glückwunsch, Mama!«
»Du hast auf dem Bild so böse geguckt, als wärst du sauer auf mich, dass ich dich überhaupt geboren habe.«
»Aber nein, Mama.«
»Bist du sicher?«, sagte meine Mutter mit ihrem schönen, schrecklichen, explosionsartigen Lachen. Und dann fragte sie mich, ob ich Lust hätte, mir eine Geschichte anzuhören, die sie gestern im Wartezimmer von Dr. Felosof, unserem alten Hausarzt, schnell runtergeschrieben hatte.
»Sie heißt Der Kompass«, sagte sie, »und ich musste beim Schreiben ein paar Mal fast weinen.«
3.
Sie lagen in Karagul, siebzig Kilometer westlich des Kirgisischen Gebirges, in ihren Betten und hörten im Radio, dass Hitler wie ein Hund in Berlin umgekommen war und viele Soldaten bald wieder nach Hause kommen würden. Dann hörten sie im Radio auch noch Salutschüsse, die direkt vom Roten Platz kamen, und gleichzeitig das Klappern von Pferdehufen im Hof. Ela wusste sofort, dass es Papa war. Er war auf einem riesigen jungen Schimmel in den Krieg gezogen, und als sie aus dem Fenster schaute, erkannte sie gleich seine hohe, schmale Gestalt auf dem Rücken des Pferdes. Aber dann fiel ihr auf, dass der Schimmel nur noch Haut und Knochen war und weiß wie ein Greis. Das machte sie sehr traurig.
Am Abend – nachdem Papa gebadet und sich mit Mamulja für zwei Stunden in der Küche eingeschlossen hatte, wo die Schlafcouch der Erwachsenen stand – packte er die Geschenke aus, die er ihnen aus Deutschland mitgebracht hatte. Mamulja bekam eine goldene Herrenuhr von Omega oder Doxa, das wusste Ela später nicht mehr, weil sie sie schon bald auf dem Schwarzmarkt von Karagul verkaufen mussten, sehr viel feine, weiße Unterwäsche, einen Fleischwolf, der noch ganz neu war und glänzte, eine ganze Garnitur Silberbesteck mit Suppenkelle und Tortenheber, und eine kleine Holzkiste, die bis zum Rand voll war mit papierdünnen, hellen Schokoladenplättchen. Ela bekam nur einen alten Kompass aus Silber, der überall dunkel angelaufen war und sich viel zu glatt und abgegriffen anfühlte. Natürlich war sie mit ihrem Geschenk nicht zufrieden. Sie hatte gehofft, dass Papa ihr Spielzeuge, Farbstifte und ein ähnliches kurzes blaues Kleid aus Seide mitbringen würde, wie sie es einmal auf einem alten deutschen oder holländischen Bild in Odessa im Museum gesehen hatte.
Als Papa bemerkte, wie unzufrieden Ela war, sagte er zu ihr: »Komm auf meinen Schoß, Ela-Dschan, ich verrate dir, warum dieser Kompass mehr wert ist als hundert Dosen Kaviar und dreitausend Schokoladentorten.« Obwohl sie zuerst trotzig auf ihrem Küchenstuhl sitzen blieb, erzählte er ihr dann trotzdem, wie er kurz vor Berlin alle seine Kameraden und sogar sein Pferd verloren hatte. Sie waren nachts in einen Wald gekommen, wo sie ein paar Stunden schlafen wollten. Als er aufwachte, war er allein. Der Wald war sehr groß, und obwohl Papa sich sonst in jeder fremden Stadt und Landschaft gut zurecht fand, fand er nicht mehr hinaus. Er war drei oder vier Tage in dem Wald, aber es kam ihm so vor, als wären es noch viel mehr Nächte gewesen. Er wollte schon aufgeben und einfach liegen bleiben, als eines Morgens – er hatte in einem tiefen, feuchten Erdloch übernachtet – plötzlich ein schlafender deutscher Soldat neben ihm lag. Er hatte ein eingefallenes, fast weißes Gesicht, eine zerrissene Uniform und riesige weiße, lustige Ohren. Papa wollte ihn gerade mit den bloßen Händen erwürgen, als der Deutsche die Augen öffnete und sagte: »Bitte nicht, ich will nicht sterben! Darum verstecke ich mich doch hier, so lange, bis der Krieg aus ist.« Dann fragte er Papa, ob er sich auch vor dem Krieg versteckte. Als Papa sagte, dass er sich verirrt hatte und zu seinen Kameraden und seinem Pferd zurück wollte, um mit ihnen Berlin zu erobern, lächelte der Deutsche glücklich. Er zog aus seinem alten, grünen Armeerucksack den Kompass, den Papa eben Ela geschenkt hatte. »Hier«, sagte er zu Papa, »den brauche ich nicht mehr. Aber dir hilft er, hier rauszukommen. Danke, dass ihr für uns euer Leben riskiert! Kommt bitte nie vom richtigen Weg ab.«
Ela, die inzwischen auf Papas Schoß saß, lächelte und sah ihn erwartungsvoll an. »Wenn du so alt sein wirst wie ich«, sagte Papa, »und dich plötzlich nicht mehr im Leben zurechtfindest, musst du nur auf diesen Kompass schauen, und alles wird gut.« Da schüttelte die kleine Ela traurig den Kopf, als wüsste sie, dass ihr später im Leben Papas Kompass nur selten helfen würde.
4.
Den Kompass aus der Geschichte meiner Mutter gab es wirklich – er gehörte erst einem Wehrmachtssoldaten, dann meinem Großvater, dann meiner Mutter. Später schenkte sie ihn mir, aber ich kann ihn seit Jahren nicht wiederfinden. Die kleine Ela war natürlich sie selbst, die in Wahrheit sehr russisch Aljona und manchmal auch Aljonuschka hieß. Und es gab auch den herrlichen großen Schimmel, auf dem mein Großvater im Krieg war. Das hatte sie mir oft erzählt, und bestimmt war auch sonst in der Geschichte nichts erfunden, denn erfinden konnte meine Mutter beim Schreiben nie – nur ab und zu dabei etwas verschweigen. Zum Beispiel ihre seltenen, dafür umso wüsteren Wutanfälle, wenn sie es gar nicht mehr schaffte, etwas Unangenehmes zu ignorieren, oder die vielen Geliebten ihres leichtsinnigen und melancholischen Vaters, des schönen Jaakow Gaikowitsch Katschmorian. Oder auch ihr merkwürdiges Verhältnis zu Lassik Stein, einem der ältesten Freunde meines Vaters, wegen dem wir nicht in Tel Aviv oder Beerschewa gelandet waren, sondern in Hamburg.
Lassik Stein – Slawist, Journalist und Autor von angeblich mehr als tausend Aphorismen – war klein, dick und sehr gebildet. Wann immer wir ihn in unseren ersten Jahren in Hamburg in seiner großen, hellen Eckwohnung im Abendrothsweg in Eppendorf besuchten, saß er in einem blauen Trainingsanzug in der Küche und aß den Borschtsch oder die dicke grüne Gemüsesuppe, die er für sich gekocht hatte. Wir aßen meistens mit, und wenn wir fertig waren und die weiße Tischdecke mit Dutzenden dunkelroter oder grüner Flecken übersät war, zogen wir ins viel größere Eck- und Wohnzimmer um, wo ich auf Lassiks Farbfernseher ohne Ton Fußball und Raumschiff Enterprise gucken durfte.
Die Erwachsenen unterhielten sich währenddessen über Lassiks großes Lebensthema: das Massaker vom Tolbuchinplatz in Odessa, das »kleine Babi Jar«, wie Lassik es nannte, und über seinen Kampf für ein Denkmal, auf dem alle Namen der fünfundzwanzigtausend toten Juden stehen sollten, die dort von den Deutschen und Rumänen in einer einzigen Nacht wie Zunder angesteckt wurden. Und es ging jedes Mal auch um die fünf Jahre Lager, die Lassik zur Strafe für seinen Mut von den Kommunisten bekommen hatte. Zu Hause fragte ich meine Eltern, ob Lassik auch schon davor so viel gegessen hatte und so dick war. Während meine Mutter stumm, aber lächelnd wegsah, sagte mein Vater: »Lassik hat gesehen, wie diese Tiere das Fleisch der anderen Häftlinge aßen, die vor ihren Augen erfroren waren. Damals wäre er lieber verhungert.«
Dass Lassik auch immer sehr großen Appetit auf Frauen hatte, wusste ich natürlich – obwohl ich noch auf dem langen Sprung vom Kind zum Erwachsenen war –, das wusste fast jeder russische Emigrant zwischen Hamburg, Brighton Beach und Haifa. Und dass er es trotz seines riesigen Bauchs, seiner knapp 160 Zentimeter Körpergröße – oder waren es noch weniger? – und seines meist fettig glänzenden, alten Engelsgesichts immer wieder schaffte, mehrere Freundinnen gleichzeitig zu haben, war in unserer Küche oft ein Thema, bei dem wir viel lachten. Als meine Mutter eines Tages sagte, sie würde nicht mehr zu Lassik mitkommen, weil er sie bei unserem letzten Besuch heimlich gefragt hatte, ob sie sich mit ihm auf eine »kleine Mesalliance« einlassen wollte, wie er es nannte, lachte mein Vater besonders laut. Danach ging er immer allein in den Abendrothsweg, also auch ohne mich, und kam meistens spät und sogar ein bisschen betrunken nach Hause.
In einem der Briefe, die ich später im Sekretär meiner Mutter gefunden hatte, erwähnte sie nur ein einziges Mal die Geschichte mit Lassik Stein. Hier klang die ganze Sache anders und viel interessanter. Eigentlich ging es in dem Brief um mich, denn ich hatte offenbar meiner warmen, aber fernen Mutter mal wieder etwas über eine von diesen jungen Münchener Frauen erzählt, die mich liebten und nicht wollten. »Ich habe noch mal über alles nachgedacht, was du vorhin am Telefon gesagt hast«, hatte sie mir auf Russisch geschrieben, »und ich habe dich gleich wieder angerufen. Aber dann war bei dir schon besetzt, mein Junge, wahrscheinlich hast du gerade mit einem der Mädchen gesprochen. Was ich dir jetzt schreibe, darfst du nie deinem Vater erzählen! Als ich selbst so jung war, war ich in einen Jungen an der Universität verliebt, der lange Haare hatte, Gedichte so lang wie Romane schrieb und linientreuen Professoren beim Sprechen nicht ins Gesicht sah. Aber wenn er mit mir schlafen wollte, erschrak ich, als wäre er eine wilde Bestie, die mich in tausend Stücke reißen wollte. Dann beleidigte ich ihn wie ein Straßenmädchen! Bei deinem Vater, der über etwas hundertmal nachdenkt, bevor er es tut, habe ich diese Angst nie, verstehst du. Er regt sich nie über etwas auf, er bleibt sogar ruhig, wenn ihn ein Deutscher im Supermarkt oder auf dem Ausländeramt beleidigt. Wie hätte er uns auch sonst aus Russland rausbringen sollen? Er hat ja damals sogar so getan, als hätte er nichts gehört, als ich euch von Lassiks Frechheiten erzählt habe, weil er natürlich wusste, dass Lassik auch einer von diesen Jungen mit den langen Haaren und langen Gedichten war, gegen die er früher keine Chance hatte.« Danach kamen ein paar durchgeixte Zeilen, und dann stand dort nur noch ein einziger, rätselhafter Satz: »Trotzdem wünsche ich mir heute den jungen Dichter aus der Universität zurück, jemanden wie dich oder Lassik!«
Natürlich hatte meine Mutter diesen Brief geschrieben, bevor sie die Sache mit meinem Vater und seiner neuen deutschen Freundin herausfand. Und obwohl sie ihn nie abschickte, machte mich jetzt ihr Geständnis sehr glücklich. Das war ihre Art, mir ihre Liebe zu zeigen.
5.
Mama wurde als Schriftstellerin geboren, aber sie wurde es zu spät, um wirklich eine zu werden. Schon als Kind liebte sie Bücher, so wie jeder in Russland. Sie konnte mit fünf Jahren lesen und schreiben, und angeblich erzählte sie fast jeden Tag ihren Eltern – meinen Großeltern –, dass sie später selbst auch Bücher schreiben wollte. Als die drei im August 1941 vor den Deutschen und den Rumänen aus Odessa fliehen mussten – die Menschen liefen verwirrt durch die Straßen, aus den Lautsprechern kamen Marschmusik und immer wieder Stalins berühmte Durchhalterede –, verschlossen ihre Mutter und ihr Vater die ganze Familienbibliothek in zwei großen Kisten, die mein Großvater allein zum Bahnhof trug, von wo ein paar letzte Züge nach Asien gingen. Ihre kleine Tochter Aljona sollte auch noch in der letzten Kirgisenhütte und im schmutzigsten Mongolenzelt genug zu lesen haben. In Karagul, wo sie eine schöne, einfache Zweizimmerwohnung in einer alten Militärbaracke bekamen, packten sie als Erstes die Bücherkiste aus, und Mama küsste jedes einzelne Buch, das meine Großmutter rauszog: die einunddreißig gelben Bände der Maupassant-Gesamtausgabe, die unendlich vielen dunkelgrünen Tolstoi-Bände, die dicken blauen Puschkin-Bände, das Dschungelbuch und ihren Lieblings-Katajew, den mit dem weißen Segelboot vor der Ansicht ihrer Heimatstadt Odessa auf dem Umschlag.
Was passierte aber eineinhalb Jahre später, in den großen Sommerferien? Die kleine Aljona, jetzt schon fast fünfzehn, machte in der leeren Scheune hinter ihrer Baracke eine richtige Bibliothek mit ihren eigenen Büchern und den Büchern ihrer Eltern auf. Sie hatte sich sogar eigene Ausleihkarten gebastelt und auf dem Markt von Karagul einen alten Erledigt-Stempel besorgt, der wahrscheinlich noch aus der Zarenzeit stammte. Die Kinder aus der Militärsiedlung, die in den nächsten Tagen und Wochen zu ihr kamen und sich bei ihr Bücher ausliehen, brachten sie nie zurück, natürlich nicht, und das war genau das, was sie wollte. Als ihre Mutter sie am Ende der Sommerferien fragte, was aus der Familienbibliothek geworden sei, antwortete sie streng: »Die gibt es nicht mehr. In solchen Zeiten muss man nicht lesen, es gibt Wichtigeres!« Und noch bevor die Mutter ihr eine Ohrfeige geben konnte, sagte ihr Vater: »Lass sie, es könnte sogar sein, dass sie recht hat.« Das alles weiß ich aus einer anderen von Mamas Erzählungen, sie nannte sie Das Ende der Literatur in der Stadt Karagul, aber ich hätte Die Bibliothek besser gefunden, klarer und nicht so russisch-pathetisch.
Auf dem Cover des ersten und einzigen Buchs meiner Mutter – es heißt natürlich Der Kompass – ist ein Foto von ihr aus den frühen fünfziger Jahren. Sie sieht jung, intelligent und völlig unschuldig aus. Ihre schwarzen, lockigen Haare gehen ihr bis zu den Schultern, sie lächelt und formt trotz ihrer Unschuld fast unsichtbar, aber unanständig die Lippen. Das Foto wurde in den Tagen aufgenommen, als sie in Moskau an der Lomonossow-Universität Geografie studierte. Ob sie damals wieder angefangen hatte zu lesen? Bestimmt. Dass aber eine der wenigen Geschichten, die sie in den nächsten dreißig Jahren schreiben würde, schon aus dieser Zeit stammte, glaube ich nicht, dafür war das Leben einer jungen sowjetischen Frau nach dem Krieg viel zu schwer und zu traurig. Vielleicht begann sie ja mit dem Schreiben während der ersten Tauwetter-Jahre, als die Menschen zwischen Brest und Wladiwostok wieder das Wort »morgen« lieben lernten, vielleicht träumte sie sogar kurz davon, dass eine Erzählung von ihr in Nowyj Mir erscheinen könnte, freigegeben von Chruschtschow persönlich, aber das stelle ich mir natürlich nur so vor.
In Hamburg, das weiß ich genau, schrieb sie meistens im Auto, vor dem Toom-Markt in Winterhude – bevor sie ausstieg, um wie jeden Samstag für uns drei für die ganze Woche einzukaufen und danach allein, so klein und zierlich wie sie war, die vielen Tüten in unsere Wohnung hochzuschleppen. Auf dem Rücksitz ihres roten Fiat Panda lag immer ein Block mit Briefpapier, und wenn ich ab und zu reinguckte, waren wieder ein paar Seiten mehr mit ihrer riesigen Schrift vollgeschrieben. Einmal – ich ging noch zur Schule, schlief und träumte zu viel in meinem großen dunklen Hofzimmer in der Bieberstraße und wusste nicht, was ich später selbst machen würde – fragte ich sie, was dort stand, weil ich die russische Schreibschrift nur schlecht lesen konnte.
Sie sagte: »Nichts Besonderes. Was immer mir gerade einfällt.«
»Und was fällt dir jetzt ein?«, sagte ich.
»Wie ich auf der großen Treppe in Odessa stehe, im Hafen, und aufs Meer und einen riesigen weißen Dampfer schaue, der sanft im Wasser schaukelt. Aus den Schornsteinen des Dampfers kommt eine riesige weiße Wolke heraus, unten auf der Hafenpromenade streiten sich ein paar Matrosen, und plötzlich rast ein Kinderwagen an mir vorbei die Treppe hinunter und die Mutter schreit panisch: ›Hilfe! Helft! Mein Kind! Bitte, helft mir!‹«
»Mama«, sagte ich, »das ist aus dem Panzerkreuzer Potemkin. Die Szene kenne ich.«
»Ich weiß«, sagte sie.
»Und woran hast du gerade wirklich gedacht?«
»Dass ich gern die berühmte Nina Agadschanowa gewesen wäre, die sich diese Szene ausgedacht und aufgeschrieben hat.«
»Ach so«, sagte ich, aber damals verstand ich noch nicht, wie sie das meinte.
6.
Vor ein paar Tagen war in der FAZ ein langer Artikel über die Judenverbrennung vom Tolbuchinplatz und einen deutschen Verein, der dort ein Denkmal hinstellen möchte. Ich musste sofort an Lassik Stein denken, der schon lange nicht mehr lebt, und beim Lesen wartete ich die ganze Zeit umsonst, wann endlich sein Name kommen würde. Einige Seiten weiter stand etwas über die Geschichte der sowjetischen Giftmischer, die in der Nähe von Saratow in ein paar verfallenen Hütten mit den gemeinsamen geheimen Senfgasversuchen der Roten Armee und der Reichswehr angefangen hatte. Obwohl ich Zufälle sonst völlig uninteressant finde, war es diesmal anders, denn in meiner Erinnerung gehörten beide Sachen zusammen.
Wenn meine Eltern und Lassik im Abendrothsweg nicht über seine eigenen Denkmal-Pläne für Odessa redeten, ging es nämlich oft um einen ganz bestimmten Sonntag im August 1967, der in unserer Familienmythologie eine wichtige Rolle spielte. An diesem Tag war es sehr heiß und schwül an der nördlichen Schwarzmeerküste, aber vielleicht regnete es auch, das erzählten meine Eltern jedes Mal anders, und ich selbst konnte mich sowieso nur an wenige Augenblicke in diesem Sommer erinnern. Mein Vater hatte schon im Frühling für meine Mutter und mich in Bolschoi Fontan eine kleine, weiß gestrichene Datscha gemietet, wo wir in der Woche ohne ihn zum Strand gingen, sehr viel Okroschka und Wassermelone aßen, Dutzende Schachpartien anfingen, ohne sie zu beenden, und uns fast nie stritten. Am Freitag kam er mit der Straßenbahn oder mit dem Auto aus der Stadt zu uns und blieb bis Sonntag, das wusste ich noch, und ich glaube, dass er meistens sehr schlechte Laune hatte. Als kleiner Junge dachte ich, dass er auch Ferien machen wollte, so wie wir, statt in der hochsommerlich glühenden Stadt zu hocken und sich im Institut – ein Wort, das bei uns immer sehr respektvoll ausgesprochen wurde – mit seinen unintelligenten Vorgesetzten herumzuärgern. In Lassiks Küche erfuhr ich aber zehn Jahre später, dass er deshalb so bedrückt war, weil er schon damals als Jude Ärger mit den Sicherheitsorganen – auch ein typischer Sowjetmenschen-Ausdruck – hatte. Es ging um die Gruppe, die er noch als Student gegründet hatte und die sich jeden Samstag in einem Nebenraum des ehemaligen Jiddischen Theaters in der Griechischen Straße traf.
Die Jungisraeliten, wie sie sich nannten, diskutierten viel darüber, ob sie versuchen sollten, nach Israel auszuwandern – oder ob es nicht mutiger und wichtiger wäre, dazubleiben. Sie redeten bewundernd über den stolzen Rabbi Nachman von Bratslav, der sich nicht in seiner Heimatstadt, sondern im benachbarten Uman beerdigen ließ, weil dort kurz vor seiner Geburt an drei Tagen dreißigtausend Juden von Kosaken umgebracht wurden. Sie lasen sich aufgeregt die jüdischen Gangster-Geschichten von Babel vor, die verboten waren, und berauschten sich an der List der israelischen Generäle im Sechstagekrieg. Und natürlich war immer einer dabei, der hinterher den