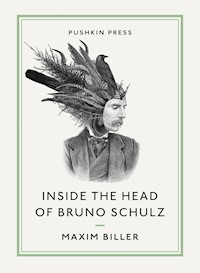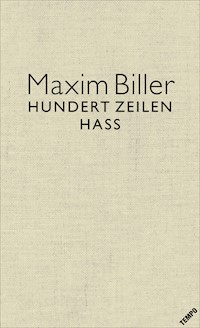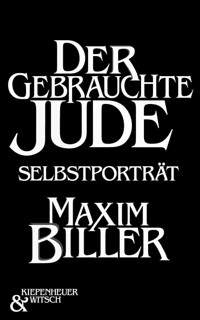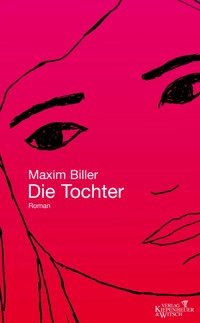9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein deutscher Philip Roth.« Michael Wise in der_ Jerusalem Post_ »Ich mag keine Gedichte, sie sind mir fremd, und ich verstehe auch nichts von bisexuellen russischen Poetessen ä la Marina Zwetajewa. Ich lebe jetzt anderswo, doch meine Eltern wohnen nach wie vor in dem alten Bürgerhaus am Hamburger Rotherbaum, wo wir 1974 auf unserem Weg von Moskau über Wien, Israel und New York schließlich untergekommen waren, zufrieden über jene lebensnotwendige Portion materieller Sicherheit, die Deutschland uns bot.« Mit beißendem Sarkasmus, Witz und oft auch liebevoller Zuneigung führt Maxim Biller die Figuren seiner Welt vor: Die Überlebenden des Holocaust, ihre Kinder und Enkel, vereinsamte Alte, verfolgungs- und größenwahnbesessene Kulturkosmopoliten, Intellektuelle und Geschäftsleute, vor allem die Jüngeren unter ihnen zwischen Aufbegehren gegen die eigenen Eltern, dem Kampf gegen aufrichtige Antisemiten und heuchlerische Philosemiten und der Suche nach der eigenen jüdischen Identität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Maxim Biller
Wenn ich einmal reich und tot bin
Erzählungen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Maxim Biller
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Maxim Biller
Maxim Biller, geboren 1960 in Prag, lebt seit 1970 in Deutschland. Von ihm sind bisher u.a. erschienen: der Roman »Die Tochter«, die Erzählbände »Wenn ich einmal reich und tot bin«, »Land der Väter und Verräter« und »Bernsteintage«. Er hat die beiden Essaybände »Die Tempojahre« und »Deutschbuch« veröffentlicht sowie das Kinderbuch »Adas größter Wunsch«. Sein Roman »Esra« wurde gerichtlich verboten und ist deshalb zurzeit nicht lieferbar. Sein letztes Theaterstück »Menschen in falschen Zusammenhängen« wurde am Berliner Maxim Gorki Theater uraufgeführt. Er schreibt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die Kolumnen »Moralische Geschichten«, die auch als Buch erschienen sind. Sein im Jahr 2007 erschienener Erzählband »Liebe heute« wurde unter dem Titel »Love Today« 2008 in den USA veröffentlicht.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Ein deutscher Philip Roth.« Michael Wise in der Jerusalem Post
»Ich mag keine Gedichte, sie sind mir fremd, und ich verstehe auch nichts von bisexuellen russischen Poetessen à la Marina Zwetajewa. Ich lebe jetzt anderswo, doch meine Eltern wohnen nach wie vor in dem alten Bürgerhaus am Hamburger Rotherbaum, wo wir 1974 auf unserem Weg von Moskau über Wien, Israel und New York schließlich untergekommen waren, zufrieden über jene lebensnotwendige Portion materieller Sicherheit, die Deutschland uns bot.«
Mit beißendem Sarkasmus, Witz und oft auch liebevoller Zuneigung führt Maxim Biller die Figuren seiner Welt vor: Die Überlebenden des Holocaust, ihre Kinder und Enkel, vereinsamte Alte, verfolgungs- und größenwahnbesessene Kulturkosmopoliten, Intellektuelle und Geschäftsleute, vor allem die Jüngeren unter ihnen zwischen Aufbegehren gegen die eigenen Eltern, dem Kampf gegen aufrichtige Antisemiten und heuchlerische Philosemiten und der Suche nach der eigenen jüdischen Identität.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 1990, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2012, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Lo Breier, Hamburg
Covermotiv: © Raissa Perlstein
ISBN978-3-462-30590-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Figuren und Handlungen
Rosen, Astern und Chinin
Horwitz erteilt Lubin eine Lektion
Meine Tage mit Frenkel
Roboter
Halt durch, Al!
Harlem Holocaust
Cilly
Im Geschäft
Ehrenburgs Decke
Gare de l’Est
Verrat
Brille, Lara und die Glocken von St. Ursula
Wenn ich einmal reich und tot bin
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Meinen Eltern
Ȇberdies, wenn ich ein Jahr
in Deutschland zubrächte, würde
ich nur an eins denken ...
Zwölf Monate lang wäre ich ein Jude und
sonst nichts. Ich kann mir nicht
leisten, dafür ein ganzes Jahr
herzugeben.«
Saul Bellow, Humboldts Vermächtnis
Sämtliche Figuren und Handlungen sind frei erfunden. Alle Ähnlichkeiten mit Lebenden und Verstorbenen sind deshalb rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Rosen, Astern und Chinin
Ich mag keine Gedichte, sie sind mir fremd, und ich verstehe auch nichts von bisexuellen russischen Poetessen ä la Marina Zwetajewa. Bei meiner Mutter jedoch liegt der Fall anders, und obwohl man mit der Behauptung vorsichtig sein sollte, sie lebe ganz allein und für sich in einer kleinen, engen Welt aus Jamben, Trochäen und Daktylen, ist doch etwas dran, denn Lyrik bedeutet ihr sehr viel.
Früher, erinnere ich mich, verschwand sie manchmal für ganze Nachmittage im Schlafzimmer, um zu lesen. Wenn sie mich dann plötzlich von dort rief, wußte ich genau, daß sie mich an ihren Versabenteuern beteiligen wollte. So stand ich in der Tür, trat von einem Fuß auf den anderen und sah sie an. Die Gardinen waren zugezogen, nur die Bettlampe gab ein gedrängtes, ockergelbes Licht ab. Meine Mutter lag am äußersten Rand des Ehebettes, im Morgenrock, zugedeckt, den Rücken von dicken Kissen hochgestützt, die Beine angewinkelt. Auf ihren Knien ruhte ein Buch von Mandelstam, das sie seit Wochen studierte. Bestimmt las sie schön, und ich hatte auch nie etwas gegen ihre russischen Gedichte – aber sie interessierten mich eben nicht. Manchmal ließ ich das ganze über mich ergehen, manchmal nicht, weshalb ich dann sofort angeödet die Schlafzimmertür von außen schloß.
Die Mandelstam-Phase ist längst vorbei. Ich lebe jetzt in München, doch meine Eltern wohnen nach wie vor in dem alten Bürgerhaus am Hamburger Rotherbaum, wo wir 1974 auf unserem Weg von Moskau über Wien, Israel und New York schließlich untergekommen waren, zufrieden über jene lebensnotwendige Portion materieller und ziviler Sicherheit, die Deutschland uns bot. Aber natürlich ist Sicherheit nicht alles, gerade wenn man sie hat, und so wurde mein Vater in seiner zweiten, westlichen Diaspora nun auch zum zweiten Mal zum Idealisten. Seit Jahren schon plant er, von meiner Mutter weder unterstützt noch gehindert, einen neuen Auszug nach Israel, der diesmal definitiv sein soll. Abmarschort: Hamburg 13, Schlüterstraße 23, Beletage. Bestimmungsziel: Jeruschalajim, jüdische Altstadt, viertes Haus rechts vom Jaffator aus gesehen, mit Blick auf Felsendom und Klagemauer. Mama hält von Israel ungefähr soviel wie ich von Poesie, und ihre gleichgültige Haltung gegenüber dem ohnehin vagen Auswanderungsvorhaben meines Vaters kommt seiner eigenen Unentschlossenheit nur entgegen. Während also die Alyah in Hamburg ein hübsches Thema-Nichtthema darstellt, überlege auch ich alle paar Monate wieder, wohin ich übersiedeln könnte. Längst sind auf meiner Liste beinahe alle westeuropäischen Hauptstädte zuzüglich New Yorks erschienen und von dort wieder verschwunden. Ich glaube, daß mein Zögern in gewisser Weise dem meines Vaters entspricht und daß also er und ich vom Kopf her noch ganz gute Juden abgeben: im Sinne unserer ständigen Sehnsucht nach einem Ortswechsel nämlich. In Wahrheit jedoch wird keiner von uns beiden jemals mehr seinen Hintern irgendwohin bewegen – eine besonders raffinierte Art von Assimilation.
Zurück zu Marina Zwetajewa. Sie ist zur Zeit Mamas große Heldin. Ich hoffe, die Verehrung bezieht sich eher auf ihre literarischen Leistungen und weniger auf die biographischen. Schließlich war Marina Zwetajewa nicht nur zeitweise lesbisch, sie hat sich 1941 im tatarischen Jelabuga auch noch erhängt. Bis Jelabuga wird meine Mutter bestimmt nie kommen. Doch natürlich hat sie Ansätze zu einer Melancholie, die zum Teil ihrem Charakter entspringt, zum Teil aber an der üblichen Russen-Wehmut geschult wurde, von der sie vierzig Jahre ihres Lebens umgeben war. Sie, die Jüdin, hat ins Ausland viel von dieser russischen Verkitschtheit mitgenommen, die sie allerdings meist gut unter Verschluß hält. Manchmal aber auch nicht. Daß dann keine blödsinnigen Jelabuga-Stimmungen über sie kommen und sie im Gegenteil diese Schwermutoffensiven halb befremdet, halb amüsiert wie aus der Ferne betrachtet, beweist, daß sie wirklich okay ist.
Vor einigen Wochen nun stieß sie auf ein Zwetajewa-Poem, das ihr sehr zu schaffen machte. Gleich beim ersten Durchlesen entpuppte sich Für Ala (von Zwetajewa für ihre Tochter geschrieben) als lyrisches Psychopharmakon: Über der zweiten Strophe heulte sich Mama derart die Augen aus, daß man sich hinterher fragte, ob es sich um einen echten Gefühlsausbruch gehandelt hatte oder um eine chemische Reaktion. Am Abend kam mein Vater vom Büro nach Hause, und nachdem er sich umgezogen hatte, setzte er sich sofort an seinen Schreibtisch, wo er, wie jeden Tag, bis zum Beginn des heute-journals weiterarbeiten wollte. Er spannte gerade das erste Blatt in seine kyrillische Übersetzermaschine ein, als Mama das Arbeitszimmer betrat und mitten im Raum anfing zu weinen. Das heißt, zunächst rezitierte sie nach einer kleinen Ankündigung ein Stück des Ala-Gedichts, und an ihrem Schlüssel-Vers heulte sie dann los. Ich weiß nicht, ob mein Vater sich über ihren Ausbruch wunderte oder was er sonst darüber dachte. Er nahm ihr, ohne ein Wort zu sagen, das Buch aus der Hand und las still für sich zu Ende. Und plötzlich sah sie, wie sein Gesicht zuckte, wie er seine Brille abnahm und auf den Tisch legte und wie er sich dann mit den Handballen die Augen zu reiben begann. Darüber war sie so erstaunt – erstens, weil er doch sonst nie weinte, und zweitens, weil es ihn offensichtlich an einer anderen Stelle erwischt hatte –, daß sie ihre Tränen vergaß, um wenig später von einem kleinen, befreienden Lachen durchgeschüttelt zu werden. Und dann lachte er auf einmal auch, und sie verstand, daß er sie hereingelegt hatte, und alles war wieder in Ordnung. Glücklicherweise nahm die Sache einen harmonischen Ausgang, was deshalb so bemerkenswert ist, weil meine Eltern nicht gerade das sind, was man ohne Einschränkung ein gutes Paar nennen möchte. Da, wo sie sich intellektuell ausgezeichnet verstehen, versagen oft ihre emotionalen Standleitungen. Außerdem sind Mamas Wechseljahre für keinen lustig, nicht für sie und nicht für meinen Vater, und es gibt Situationen, in denen Nichtigeres als ein paar merkwürdige Verszeilen genügt, um sie aus der Fassung zu bringen. So könnte man die Zwetajewa-Episode bereits an diesem Punkt zu den Akten legen, hätte mich meine Mutter nicht am folgenden Tag spätabends in München angerufen, um sie mir ausführlich zu schildern. Denn dabei fiel mir eine Geschichte ein, die vor ungefähr zwei Jahren, auch in Hamburg, passiert war.
Mama erzählte gerade von den ersten überraschenden Tränen, sie beschrieb die zweiten Tränen in der Gegenwart meines Vaters, sie vergaß auch nicht die dritten und vierten Tränen zu erwähnen, die in der Nacht und am nächsten Morgen kamen, immer dann, wenn sie diese verfluchte Strophe wiedersah, sie fragte mich kurz nach meiner Arbeit aus, um sogleich zu erklären, sie hätte nichts dagegen, es noch einmal zu probieren, sie wäre bereit, diese zwei Zeilen auch für mich zu rezitieren, was ich ihr aber verbot, weil ich keine Lust hatte, sie weinen zu hören, und weil ich es ohnehin nicht leiden kann, wenn man mir vorliest, und während wir also derart leidenschaftlich hin und her telefonierten, schürfte ich außerdem noch in meiner Erinnerung ...
Damals hatte ich in Hamburg für ein paar Monate Ferien gemacht. Ich kam direkt von der Journalistenschule und hatte bis dahin nirgends etwas veröffentlicht – außer einer Buchbesprechung in einer kleinen Zeitschrift, die von Leuten meines Alters herausgegeben wurde und ihren Autoren viel Freiheit gab. So beschloß ich, vor allem aus persönlichem Interesse, für die Zeitschrift ein Interview mit Joseph Heller zu machen, der sich zu dieser Zeit auf einer PR-Reise durch Deutschland befand, um sein neues Buch vorzustellen – den autobiographischen Bericht über die zwölf Monate, in denen er es schaffte, sich der muskellähmenden Allmacht des Guillain-Barré-Syndroms zu entwinden. Ich rief bei Hellers deutschem Verlag an und bekam sofort einen Termin. Das Gespräch verlief sehr erfreulich, bis zu dem Zeitpunkt, an dem mich die Dame von der Presseabteilung in gespielt-scherzhaftem Ton fragte, ob ich schon wüßte, in welchem Lokal ich mit Herrn Heller, dessen Appetit nach der Krankheit viel besser geworden sei, essen wollte. Ich kannte mich inzwischen mit einer Menge guter Sachen aus, aber teure Restaurants gehörten noch nicht dazu, und bevor ich in diesem Sinne antworten konnte, fügte sie bei, ich müsse Herrn Heller und seine Begleiterin einladen – das sei so üblich. Eine Begleiterin hatte er auch?! Ich weiß genau, wie in diesem Moment etwas für mich zerfiel, wie vor meinem inneren Auge aus dem großzügigen, klugen und mannhaften Autor von Catch 22 und Gut wie Gold, mit dem ich entre nous über Literatur, Sex und Judentum philosophieren wollte, auf einmal ein ekelhafter, geiziger Mauschelzwerg geworden war, ein Unsympath mit einem weibischen Zug um die Augen. Und ich weiß auch, wie ich mich am Telefon zu winden begann und meiner Verhandlungspartnerin zu erklären versuchte, daß weder ich noch die Zeitschrift über jene finanziellen Mittel verfügten, die es uns erlauben würden, einen weltberühmten Schriftsteller standesgemäß auszuführen, und wie ich schließlich in der Not auf die rettende und kostensparende Idee kam, Herrn Heller und seine Begleiterin zu uns nach Hause einzuladen ... Mama sollte Speisen kochen, die ihn an seine Kindheit, seine Jugend, ach was, die ihn an seine eigene Mutter erinnern würden ...
Und somit wäre bereits der erste Kilometerstein auf dem Erkundungsmarsch durch die Innenwelt meiner Mutter erreicht, den ich ganz beiläufig unternahm, während sie mit mir zwei Jahre später am Telefon über Marina Zwetajewa und einiges mehr sprach. Was ging in Mama damals eigentlich vor, als ich ihr mitteilte, daß am nächsten Freitag ein moderner Dichterfürst, ein amerikanischer Jude mit deutsch-russischen Vorfahren, bei uns zu Abend essen würde? Um ehrlich zu sein, kann ich das mit wirklicher Bestimmtheit gar nicht sagen, ich weiß nur, wie sehr sie es haßt, wenn mein Vater am späten Nachmittag anruft, ihr Gäste zum Abendbrot ankündigt und sie bittet, doch am besten Hering, Schtschi und Pelmeni vorzubereiten, halt irgendwas, das ihr am wenigsten Mühe mache – worauf sie oft genug, noch während er spricht, wortlos aufhängt. Ich aber war jetzt zum ersten Mal mit einer solchen Bitte an sie herangetreten, was den Vorteil hatte, daß sie sie mir unmöglich abschlagen konnte.
Der große Freitag raste heran, und während ich mir in meiner freien Zeit noch einmal Joseph Hellers Romane vornahm, hielt ich Abend für Abend mit Mama Konferenzen ab, bei denen wir besprachen, was sie für den Schriftsteller kochen würde. Es sollte auf jeden Fall etwas osteuropäisch-jüdisches sein, und im Grunde ging es bei unseren Unterredungen nur noch um Details. Wäre ein kalter polnischer Trinkborschtsch angebrachter als der warme und dicke russische? Das Huhn gekocht oder gebraten? Zum Nachtisch Leikach oder Apfelkompott oder vielleicht beides? Immer wieder tauchte bei meiner Mutter die Überlegung auf, wie es denn jetzt um Hellers Gesundheit bestellt sei. Es wäre doch möglich, sagte sie, daß seine Hände noch zittrig seien, weshalb es ihm bestimmt weniger Mühe machte, den Borschtsch zu trinken statt zu löffeln – sie wolle einen Mann wie ihn nicht in die peinliche Situation bringen, den Tisch fremder Gastgeber wie ein Tattergreis vollzukleckern. Und so gesehen sei es bestimmt auch besser, das Huhn gekocht zu servieren, das wäre auf jeden Fall bekömmlicher, gerade für einen Kranken... Irgendwann war sie dann soweit, daß sie ihm den Nachtisch verbieten wollte, denn der liege schwer auf dem Magen, und außerdem sei Süßes schlecht für die Zähne. »Ein Tee wird reichen«, erklärte sie. Zum Schluß war ich fast ein wenig überrascht, wie schnell sich meine Mutter mit dem anstrengenden Prominentenbesuch abgefunden hatte, denn ihr Interesse ging sogar soweit, daß sie sich während unserer Besprechungen immer wieder Gedanken über Hellers Freundin machte.
»Ist sie Jüdin?« fragte sie, Böses ahnend.
»Nein«, erwiderte ich.
»Eine Nichtjüdin?«
»Ja.«
»Groß?«
»Weiß ich nicht.«
»Aber du wirst doch wissen, welche Haarfarbe sie hat?«
»Keine Ahnung.«
»Und wie versteht sie sich mit seinen Eltern?« sagte sie, und ich wußte nicht, ob sie sich über mich lustig machte oder ob die Frage ernst gemeint war. Ihre Neugier konnte ich kaum befriedigen, aber zumindest erzählte ich ihr, was ich inzwischen Hellers neuem Buch entnommen hatte: Danach war seine Geliebte eine ehemalige Krankenschwester, die der Schriftsteller auf der Intensivstation kennengelernt hatte. Das fand Mama aufregend, sie entdeckte darin Menschlichkeit, gleichzeitig äußerte sie sich kritisch über die gojische Herkunft des Mädchens (wieviel schöner und treffender wäre an dieser Stelle das englische Wort gentile, das auch des öfteren bei Heller vorkommt), und sie bat mich, wenn ich selbst damit fertig sei, ihr Hellers Bücher zu leihen.
Aber dann war es plötzlich von einem Tag auf den andern vorbei mit Mamas Euphorie. Bestimmt hing es damit zusammen, daß mein Vater, der in der ganzen Einladungssache noch gar keine Rolle zugewiesen bekommen hatte, am Mittwoch geschäftlich nach Budapest fliegen mußte. Doch nicht genug, daß sie von ihm für den Freitagabend allein gelassen worden war – was für eine Hilfe konnte ich schon sein? –, hinzu kam die Angelegenheit mit Oleg Borka, einem alten Freund meines Vaters aus Moskau, der inzwischen in Zürich wohnte. Borka hatte überraschend seinen Besuch angemeldet, er wollte in Hamburg ein verlängertes Wochenende verbringen, und es machte ihm gar nichts aus, daß mein Vater erst am Samstag zurückkommen würde. Meine Mutter litt aber um so mehr unter diesem Zeitplan. Dazu muß man wissen, daß Borka – ein kleiner Mann mit Glatze, schwarzen Augen und strichdünnem Schnurrbart – ein altes Junggesellenroß war, vielleicht nicht mehr allzu viril, aber dafür noch sehr angriffslustig. Bestimmt wußte mein Vater von seinen Neigungen, aber nie hätte er angenommen, daß Borka auch schon mal, ganz unkameradschaftlich, versucht hat, meiner Mutter den Hof zu machen. Ich dagegen habe, während einer früheren Borka-Visite, eine für mich sehr seltsame Szene zwischen ihm und Mama miterlebt, oder besser gesagt, es waren ihre Stimmen, von ganz leise bis laut und erbost, die ich vom anderen Ende des langen Flurs unserer Hamburger Wohnung vernahm, und da ich dann auch noch Borkas darauffolgenden stillen Abgang von der Küche ins Wohnzimmer beobachtet hatte, war es für mich später kein Problem, Mamas schlechte Laune, die bis zum Ende seines Aufenthaltes anhielt, eindeutig zu entschlüsseln.
Kein Wunder also, daß Mama nun ihren Herzschmerzblick bekam, und wenn man zu den äußeren Faktoren auch noch die inneren, ihr Klimakterium und die bekannten Schwermutanlagen hinzuaddierte, kam man auf eine hübsche Melancholiesumme: Kilometer zwei.
Die Heller-Bücher lagen unberührt neben ihrem Bett, Mandelstam hatte wieder Konjunktur, sie verbrachte Stunde um Stunde im verdunkelten Schlafzimmer, und es ging ihr offensichtlich so schlecht, daß sie mich nicht einmal mehr rief, um mich an ihren Jamben und Daktylen teilhaben zu lassen. Wie sehr wünschte ich mir, sie würde mir vorlesen wollen. Und natürlich machte ich mir Sorgen um sie, aber ich dachte auch an ihr Versprechen, meine Gäste zu bewirten, und ich war mir überhaupt nicht sicher, ob sie es noch einhalten konnte oder wollte. An diesem Punkt der Erinnerung aber verschlägt es mich wieder, für einen Augenblick, in die Gegenwart. Es war sehr spät geworden, ich lehnte in meinem Zimmer in München an der Fensterbank, spürte die von der Heizung aufsteigende Wärme an meinen Armen und gleichzeitig den schmalen Windzug, der irgendwo durch das Holz drang. Ich blickte durch die Nacht auf die andere Straßenseite, wo das niedrige Mietshaus stand, in dem diese Teenager-Göre mit ihren Eltern wohnte, die regelmäßig abends – offensichtlich nach dem Duschen – nackt ans Fenster trat und jedesmal, wenn sie bemerkte, daß ich sie beobachtete, die Arme vor den kleinen Brüsten verschränkte und aus dem Zimmer rannte, um mir auf diese Weise, wie scheinbar verabredet, einen letzten kurzen Anblick ihres jungen und großen Hinterns zu bieten. Hier stand ich also, wartete auf ihren Auftritt, und da war wieder Mamas Stimme in meinem linken Ohr, klangvoll, alt, da war von neuem dieser eine merkwürdige Haken in unserer Telefonkonversation, den sie urplötzlich schlug, und kurz darauf begriff ich, wohin sie steuerte: Listig unternahm sie einen neuen Versuch, mir hier und jetzt Für Ala aufzuzwingen. Ich sprang sofort zurück in die Vergangenheit, ich mußte mich ganz genau erinnern, wie die Sache mit Heller, Borka, Mama und dem Hund ausgegangen war – Zwetajewas Gedicht konnte noch warten.
Borka reiste am Donnerstag an. Er war nicht, wie sonst, geflogen, er hatte den Wagen genommen, seinen gelben Mercedes-Kombi. Der Grund dafür war Borkas Hund, ein milchweißer japanischer Akita, fast so groß wie Borka selbst, mit wuchtigen Pfoten, langen, kräftigen Beinen, einem runden Rumpf und einer runden Schnauze, die wie ein behaartes Straußenei aussah. Dieser Hund, den Borka in einer Hommage an Stalin Jossif getauft hatte, fand bei Borkas Züricher Freunden keinen Zuspruch mehr, niemand war bereit gewesen, ihn für einige Tage bei sich aufzunehmen. Und weil Borka, der zu Tieren ein ähnlich passioniertes Verhältnis hatte wie zu Frauen, Jossif den Aufenthalt in einem Tierheim ersparen wollte, nahm er ihn mit. Als ich Jossif aus der Hecktür von Borkas Mercedes herausspringen sah, dachte ich, daß dieser Eisbär meiner Mutter den Rest geben würde. Aber zu meiner Überraschung blieb Mama, die sich inzwischen wieder etwas gefangen hatte, beim Anblick des riesenhaften Hundes gelassen. Borka küßte sie zur Begrüßung auf die Wangen, was sie mit einer Art Umarmung erwiderte; dann erklärte er uns, wieso er Jossif mitgebracht hatte, und da er sich dafür furchtbar entschuldigte, konnte sie gar nicht anders, als dem Hund schnell über die Ei-Schnauze zu fahren und Borka zu beruhigen. »Ich mag Hunde gern«, sagte sie. Als er darauf erwiderte, sie müsse sich vor Jossif nicht fürchten, erklärte sie kämpferisch, daß sie vor Hunden wenig Angst habe. Sofort ging ein Ruck durch den winzigen Körper des alten russischen Casanovas, im Nu waren die ihm sonst eigenen lockeren, fließenden Bewegungen wie weggezaubert, seine Hände strebten nicht mehr von ihm weg, hin zu fremden Körpern und Gegenständen, er war mit einem Mal ganz steif und ruhig, und man hatte den Eindruck, dieser Mann war für den Rest seiner Tage kein Tatscher und kein Grabscher mehr ...
Kaum bemerkte Mama selbst, daß sie Borka auf Distanz bekommen hatte, wurde sie freundlicher und offener. Was dazu führte, daß der folgende Abend, den wir zu dritt zu Hause verbrachten, zu einer regelrechten Idylle geriet. Die beiden verstanden sich gut, sie redeten viel über die Moskauer Vergangenheit, über Freunde und Feinde, meine Mutter zeigte uns alte Fotos, später gab es etwas zu essen, und dann spielten wir bis drei Uhr früh Canasta. Jossif lag träge herum, störte nicht, bellte nicht, machte nicht auf den Teppich, und als Borka zum Schluß, nachdem die Kartenpartie beendet war, sagte, er müsse mit dem Hund noch einmal raus und meine Mutter aufforderte, ihn zu begleiten, schien es ganz natürlich, daß sie nach kurzem Zögern seinen Vorschlag annahm.
Hier nun nähere ich mich einer kritischen Phase meines Mutter-Marsches, weil ich im folgenden nur einen weißen Fleck umranden kann, nicht mehr. In jener Nacht nämlich war ich, kaum hatten Mama, Borka und der Hund das Haus verlassen, schlafen gegangen. Ich weiß also nicht, ob, und wenn, was in der Nacht noch geschah, weshalb mein Verdacht nur ein sehr vager Verdacht bleiben kann, denn ich habe meine Mutter nie danach gefragt. Natürlich. Und schließlich, denke ich, hatte sie doch Borka gleich zu Beginn so wirkungsvoll ausgeschaltet...
Als ich am nächsten Morgen in die Küche kam, fand ich auf dem Eßtisch eine Nachricht von meiner Mutter: Sie wollte zur Massage, zum Friseur und im Anschluß daran einkaufen, weshalb sie erst am späten Nachmittag zurückkommen würde. Borka, der bereits beim Frühstück saß, hatte mir den Zettel zugeschoben, und nachdem ich ihn durchgelesen hatte, sagte er, er wolle später einen Hamburg-Rundgang unternehmen, weil er die Stadt trotz einiger Besuche noch gar nicht richtig kenne. Ich könnte ihn, wenn ich Lust hätte, dabei begleiten, und später würden wir zusammen Getränke, Nüsse und Trockenfrüchte für den Abend holen. Das mit dem Stadtbummel leuchtete mir noch irgendwie ein. Daß er jedoch, so penetrant eigenverantwortlich, einkaufen wollte, fand ich merkwürdig, zumal ich diese Art von Partyzeug sonst immer mit meinem Vater zu besorgen pflegte. Ich empfand Borkas Vorschlag als ungebührliche Einmischung, und obwohl mir selbst diese Überlegung ziemlich verklemmt und deutsch vorkam, konnte ich mich gegen sie nicht wehren. Im selben Moment fiel mir ein, daß an dem Joseph-Heller-Showdown, wenn man so wollte, statt meines Vaters doch ohnehin Borka teilnahm, und so gesehen wäre es angesichts seiner plötzlichen hausmännischen Fürsorge nur konsequent, wenn ich ihn als solchen auch dem Schriftsteller vorstellen würde ...
Vorher aber zeigte ich Borka noch den Stephansplatz, den Rathausmarkt, die vielen Innenstadtpassagen mit ihren italienischen Feinkostgeschäften und Boutiquen und schönen Zeitschriftenläden. Ich führte ihn zum Hafen, wir marschierten vom Baumwall bis zu den Landungsbrücken am Wasser entlang, wir steckten Münzen in die Fernrohre, mit denen man die Tanker und Dockkräne und Barkassen beobachten kann. Wir gingen in Winterhude spazieren, und wir fuhren mit der Fähre kreuz und quer über die Alster, um dann, nach einem kurzen Abstecher nach Pöseldorf, den Heimweg anzutreten. Borka hatte Jossif zu Hause gelassen, weil er uns auf dem Ausflug nur behindert hätte. Das war mir egal, ich hätte es am liebsten gesehen, wenn auch Borka nicht mitgekommen wäre. Ein absurder Gedanke, war ich doch nur Borkas wegen zum Reiseführer geworden. Diesen und anderen Blödsinn ließ ich mir zu Beginn unserer Exkursion durch den Kopf gehen, und ich entwickelte auch einige vernünftigere Gedanken, die zum Teil in negativer Emanation Borka betrafen, ansonsten aber vorwiegend um das herannahende Treffen mit Joseph Heller kreisten, weil ich nun allmählich nervös zu werden begann. Doch schon bald gelang es Borka, mich von alldem abzulenken. »Ich habe Stalin persönlich kennengelernt«, sagte er ganz unvermittelt, nachdem wir ein Geschäft mit alten Uhren in der ABC-Straße verlassen hatten. Mir blieb nur, ihn erstaunt anzusehen, worauf er begeistert fortfuhr: »Es war kurz vor seinem Tod, 1952 glaube ich. Du weißt ja, wie Jossif Wissarionowitsch war: Eines Tages rief bei mir jemand an und fragte mich, wie es mit der Arbeit im Institut voranginge. Als ich wissen wollte, wer dran sei, sagte er, sein Name sei Stalin. Das machte er gern, Leute anrufen und erschrecken. Wir plauderten eine Weile, und zum Schluß lud er mich zu sich zum Essen ein. Zwanzig Minuten später war ein Wagen da und holte mich ab.« Borka machte eine Pause. »Schau nicht so«, sagte er schließlich, »das ist die reine Wahrheit ... Während des Essens hielt sich in Stalins Nähe ein alter Schäferhund auf, dem er ab und zu ein Stückchen Fleisch hinwarf. Als der Hund ihn einmal in einem solchen Moment ansah, sagte Stalin zu mir: ›Hat der Hund nicht einen richtig menschlichen Blick?‹ Stell dir das vor! Wie konnte ein Mann wie Stalin mit all seiner Macht so etwas Dummes sagen? Ein Hund hat keinen menschlichen Blick! Ein Hund schaut wie ein Hund!«
Jetzt wußte ich also, wie Jossif zu seinem Namen gekommen war, und egal ob Borkas Geschichte stimmte oder nicht – daß und wie er sie erzählte, bedeutete mir etwas. Und so dachte ich plötzlich wieder an die Empfindsamkeiten meiner Mutter, an ihre Bücher und ihre Kindheits- und Kriegs- und Stalinismus-Anekdoten, ich dachte an meinen Vater, einen ausgewiesenen Pragmatiker, der – obwohl in der Sowjetunion von der Universität relegiert und später beruflich unter Druck gesetzt – auch im Westen nicht, anders als viele andere, zum langweiligen Kalten Krieger geworden war. Er konnte emphatisch denken und leidenschaftslos analysieren, allein das hatte er nicht nur seinen Anlagen zu verdanken, es hing ebenso mit der strengen kommunistischen Erziehung zusammen, und das erkannte er an. Auch er sprach oft von früher, erzählte Witze und mehr oder weniger reale Begebenheiten aus dem immerpolitischen russischen Alltag. Doch gleichzeitig war er trotz seiner Nüchternheit und Erinnerungskraft ein Mensch, der zuweilen in Gefühlen strandete und dann nach vorne sah, Richtung Israel. Aber das hatten wir ja bereits.
Es muß ungefähr zu dem Zeitpunkt gewesen sein, in dem ich mit Borka an der Reling der Alsterfähre stand und die im fahrigen Dunst flackernde Innenstadtsilhouette betrachtete, als meine Mutter – massiert, frisiert und mit Einkaufstüten vollbeladen wie ein Muli – von der Hartungsstraße in die Schlüterstraße einbog und langsam auf die Nummer 23 zuging. Soweit war alles noch wie es sein sollte, auch dann, als sie die Haustür aufgeschlossen und die Post aus dem Briefkasten herausgenommen hatte, um daraufhin langsam in den ersten Stock hinaufzusteigen. Drei Absätze hat die Treppe, und als sie die erste Stufe des letzten, des dritten Absatzes berührt hatte, hörte sie Jossifs Gebell zum ersten Mal. Sie wußte, daß das Borkas Hund war, und obwohl sie zunächst zusammenschreckte, beruhigte sie sich gleich wieder, weil sie davon ausging, daß Borka den Hund leicht in den Griff bekommen konnte. So läutete sie kurz und steckte dann den Schlüssel ins Schloß, in dem Glauben, daß der Hund von Borka inzwischen zur Ruhe gebracht werden würde. Der Akita machte aber weiter – das lange Alleinsein in der fremden Wohnung hatte ihn offenbar nervös gemacht.
Sein Gebell klang in ihren Ohren wie das Trompeten eines Mammuts, und dieses böse und panische Geräusch wurde von einem wütenden Schaben und Schlagen begleitet, weil Jossif mit seinen Pfoten wie ein Verrückter gegen die Tür sprang, so daß sie diese gar nicht richtig aufbekam. Aber das wollte sie vielleicht schon gar nicht mehr, denn nun hatte er sich aufgerichtet, weshalb er sie für Sekunden um einen Kopf (seinen eigenen) überragte. Dann fiel er mit dem Gewicht seines ganzen prähistorisch-grotesk großen Leibes auf die Tür, die daraufhin zuschlug und Mama einen Schlag versetzte, welcher sie um einige Schritte zurückwarf. Das alles klingt ziemlich komisch, und komisch klingt auch, wie sie noch einen letzten Versuch unternahm, in ihre Wohnung einzudringen, wie es also kurz still war, nachdem sie die Tür einen Spalt weit aufgestoßen hatte, wie im nächsten Moment, plötzlich, irgendwo unten, Jossifs Eierkopf auftauchte, weshalb sie unwillkürlich an ein Riesenreptil denken mußte. Als das Reptil dann aber kurz und laut aufknurrte, wußte sie wieder, mit wem sie es zu tun hatte, und so warf sie die Tür zu, knallte die Einkaufstüten hin, lief die Treppe hinunter, lehnte für einen Augenblick nachdenklich am Fuß des Geländers, um dann auf die Straße hinauszutreten und sich wie ein Kind oder ein Penner vor dem Sandsteinportal unter den beiden steinernen Löwenköpfen und dem kleinen Affen auf den kalten Eingangsstufen niederzulassen. Mama im Reich der Tiere, Kilometer drei.
Auf der Treppe saß sie mehr als eine Stunde, ohne zu weinen, zu klagen, zu jammern oder hysterisch zu lachen. Ihr Kopf füllte sich statt dessen mit heißem Dampf, sie hob ab, stieg über die Dächer, und von dort beobachtete sie die Stadt Hamburg und ihre winterschwarze Umgebung, den breiten Elbstrom und dahinter das Meer, sie sah nach Moskau und Leningrad, sie erblickte Stakanow-Monumente, rote Transparente, ihre Schule in der Kromsskaja, ihr Geburtshaus, sie erlebte die Stunde, in der sie zum ersten Mal mit meinem Vater schlief, sie streifte Jerusalem und den Heiligen Berg, und sie warf auch einen Blick auf den jüdischen Teil des Friedhofs in Hamburg-Ohlsdorf. Woher ich das so genau weiß? Anders kann es gar nicht gewesen sein.
Sie blieb in der Luft, bis ich kam. Als sie wieder unten war, sah ich sie mir ganz genau an. Sie war ein kleines Geschöpf, aber ihr Körper strahlte Festigkeit und Widerstandskraft aus, er mußte ein hohes spezifisches Gewicht haben. Sie saß da, und sie war kein armer Wurm, sondern ein wütender, verletzter, genervter Mensch; ja, vor allem wütend. Ich blickte in ihre grauen Augen, in ihr weißes, langes Gesicht, und da katapultierte es mich wieder zwei Jahre nach vorn, ich hielt den Telefonhörer in der Hand, und meine Widerstandskraft erlahmte, und so sagte ich schließlich: »Na gut, dann lies es mir vor«, worauf sie sofort loslegte, und alles war ganz normal, bis zu diesen zwei verfluchten Zeilen, die Zwetajewa einst voller Inbrunst an ihre Tochter Ala gerichtet hatte und die Mama offensichtlich nun mir oder sich oder wem auch immer zusprach:
»So merke dir, daß keiner paßt zu keinem,
und wirf dich dennoch jedem an den Hals.«
Schon riß Mamas Stimme ab, ich hörte sie schluchzen, und ich dachte: angekommen. Wieder also dieses russische Pathos, der Weltschmerz, und irgendwie war es schade, daß Mamas Hundewut in meiner Erinnerung mit dem Schlußakkord der Zwetajewa-Episode zusammengekommen war und deshalb alles so melancholisch geraten mußte ...
Aber nun muß ich auch noch, wieder, an meinen Vater denken, der mir seinerzeit die Kopie eines Artikels aus einer in Israel auf russisch erscheinenden Zeitschrift gab. Darin ging es um Israels Zukunft, um die wirtschaftlichen Perspektiven des Landes, seine kollektive psychologische Struktur, die innere Wehrkraft. Begeistert – und gewiß auch in pädagogischer Absicht – hatte mir Papa einen Absatz unterstrichen, in dem von Israels Bevölkerungsfluktuation die Rede war. »Es kommen viele Starke zu uns«, schloß der Verfasser. »Auch deshalb haben wir, zur Überraschung aller Antisemiten, eine der besten Armeen der Welt ... So werden die Juden langsam zum Volk Israel. Und die Schwachen verlassen das Land. Die Selektion geht weiter.« Ich hatte diese Stelle gehaßt, und das sagte ich meinem Vater auch offen ins Gesicht, worauf in eben diesem Gesicht sofort die gleichen wütenden Risse des Beleidigtseins und Trotzes erschienen, die ich auch bei Mama beobachtet hatte, als sie vor unserem Haus auf den eisigen Stufen hockte – das Kinn auf den herangezogenen Knien – und ihren kleinen Beobachtungsflug unternahm. Was er mit einer Grimasse anzeigte, hatte sie mit einer Körperhaltung ausgedrückt. (Und wie, muß ich mich fragen, signalisiere wohl ich solche Gemütslagen?)
Das Essen mit Joseph Heller und seiner rothaarigen Freundin Lucille konnte, nachdem Borka Jossif gebändigt hatte und meine Mutter wieder zu Kräften gekommen war, doch noch stattfinden. Es war ein großer Erfolg, ein würdiger Epilog, mit einer eigenen Stimmung und Zentrifugalkraft ... Es hat, natürlich, allen geschmeckt. Heller sprach mit Mama Jiddisch, Lucille unterhielt sich ausgezeichnet mit Borka, ohne daß der es auch nur einmal gewagt hätte, sie anzufassen. Zwischendurch machte ich mein Interview mit dem verehrten Schriftsteller, wobei ich allerdings merkte, daß seine großen Tage bereits vorbei waren, denn er gab mir wiederholt zu verstehen, daß es im Prinzip egal ist, was man macht, Hauptsache, man ist nicht allein dabei. Aber das gehört nicht wirklich hierher, vielmehr sollte ich erwähnen, wie ausgelassen die Stimmung an diesem Freitag abend war, wie sehr meine Mutter ihre Gastgeberrolle genoß, ohne von meinem Vater bevormundet zu sein, und wieviel sie im Gespräch mit Heller lachte.
Wir blieben bis in den Morgen hinein in der Küche, der Tisch war auseinandergezogen, es war weiß gedeckt, und sehr schnell waren überall Wein- und Limonadeflecken aufgetaucht, Kartoffeln und Reis und Brocken gefilte Fisch flogen herum, Hühnerknochen wurden auf den Boden geworfen und sofort wieder vor Jossif, der an ihnen gerne erstickt wäre, in Sicherheit gebracht. Nach dem Hauptgang saßen wir über Tee und Mamas Leikach, der auch dem geheilten Kranken prächtig bekam. Und dann nahmen wir uns schließlich doch noch Papas Wodka vor, der wie immer im Tiefkühlfach lagerte. Der Wodka floß wie weißer Honig in unsere Wassergläser, und auch Mama trank davon, und es war so ein richtiger russischer, jüdischer Küchenabend ...
Ja, und wohl deshalb muß ich jetzt, eigentlich gegen meinen Willen, an ein Gedicht von Mandelstam denken, das auch Mama kennt und das ich zum Abschluß zitieren will, weil es einfach hierher gehört:
»Ich trink auf soldatische Astern, auf alles,
für was man mich rügt:
Den prächtigen Pelz und mein Asthma,
auf Petersburg, gallig-vergnügt,
Musik von savoyischen Kiefern, Benzin
auf den Champs-Elysées,
Auf Rosen im Rolls-Royce, aufs Öl
der Pariser Gemälde-Allee.
Ich trink auf die Wellen, Biskaya, auf Sahne
aus Krügen, alpin,
Auf Hochmut von englischen Mädchen
und koloniales Chinin,
Ich trinke, doch bin ich nicht schlüssig,
was ich wohl lieber noch hab:
Den fröhlichen Asti spumante oder –
Châteauneuf-du-Pape ...«
Horwitz erteilt Lubin eine Lektion
Horwitz haßte Schnee. Er haßte auch Sonne, Regen, Nachbarn, bitteren Tee und alte Männer von der Sorte, wie er selbst einer war. Draußen stand eine feuchte, eiskalte Luft, die durch die Hausmauern in seinen welken Körper hineinfuhr, und wenn er aus dem Fenster schaute, sah er, wie vor den gelben Lichtglocken, die die Straßenlaternen umspannten, ein Schleier aus dickem, schweren Schnee hing, der nun schon seit Stunden fiel und die ganze Stadt – Bäume, Häuser, Autos, Passanten – bedeckte. Horwitz schüttelte sich angewidert, fuhr Lubin, seinem Kater, mit den Fingern durchs schwarze Fell und ließ die Jalousien herunter.
Das Zimmer lag plötzlich ganz im Dunkeln. Horwitz fluchte. Er war eben ein Idiot. Er hätte zuerst Licht machen sollen. Vielleicht sollte er, überlegte Horwitz, die Jalousien noch einmal hochziehen, zum Lichtschalter gehen und sie dann wieder herunterlassen. Nein, das war zu umständlich. Aber andererseits hatte diese Methode den Vorteil, daß er sich in dieser Finsternis nicht die Knochen brechen würde. Er zögerte. Was war er doch für ein Feigling, dachte er plötzlich, wütend auf sich selbst. Also los, alter Kacker, trieb er sich an, los.
Er drehte sich langsam herum. Mit der rechten Hand wedelte er in der Luft wie ein Blinder mit seinem Stock, mit der linken tastete er die Möbel ab. Der Sessel, ein Schritt, der zweite Sessel, zwei Schritte, das Tischchen, halber Schritt zur Seite, die Kommode. Darüber in Schulterhöhe der Lichtschalter. Horwitz streckte zögernd die Hand vor, griff nach dem Schalter. Im selben Moment wischte ihm etwas Warmes um die Beine, Horwitz erschrak fürchterlich, er zuckte zusammen, die Hand flog wie von selbst in die Höhe, stieß gegen den Schalter und riß dann ein Bild von der Wand. Glas klirrte, die Neonröhre flackerte drei-, viermal auf, und im Zimmer wurde es hell. Horwitz hörte hinter sich einen entsetzten Katzenschrei und sah den zerbrochenen Rahmen auf der Kommode. Gleichzeitig landete Lubin auf seiner Schulter und schmiegte sich mit dem Kopf an Horwitz’ Wange. »Bestie!« sagte der Alte. Er schüttelte den Kater ab und begann die Glassplitter aufzusammeln. Das Bild legte er vorsichtig zur Seite. Es war eine alte Fotografie von Lowe Gans. Sie stammte aus den fünfziger Jahren, als Horwitz und Gans noch vom DP