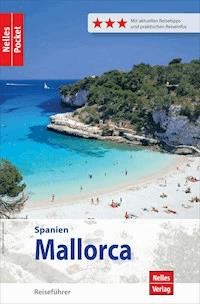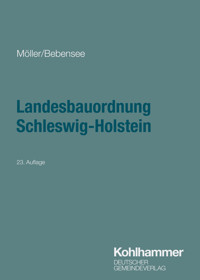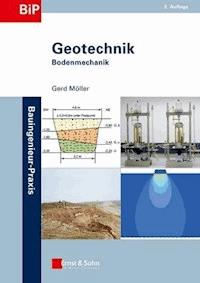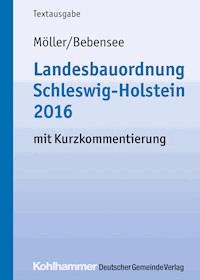
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Deutscher Gemeindeverlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Anlass für das Werk ist die Novellierung der Landesbauordnung Schleswig-Holstein. Die Novelle überträgt den Bauherren mehr Eigenverantwortung, enthält verständlichere Formulierungen und entlastet die Kommunen. Weitergehende Erleichterungen bei Baugenehmigungen, wie z. B. bei einer nachträglichen energetischen Sanierung, werden ermöglicht. Kleine Windkraftanlagen werden in bestimmten Gebieten verfahrensfrei gestellt. Traditionell ist auch dieser Textausgabe eine Kurzkommentierung beigefügt, die auf alle wesentlichen Aspekte des Bauordnungsrechts in Schleswig-Holstein eingeht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 880
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kommunale Schriften für Schleswig-Holstein
Herausgegeben vom Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag
Landesbauordnung Schleswig-Holstein 2016
mit Kurzkommentierung
Textausgabe mit einer erläuternden Einführung und Kurzkommentierung
Gerd MöllerMinisterialrat a. D.
Jens BebenseeKreisoberverwaltungsrat
Deutscher Gemeindeverlag
1. Auflage 2017
Alle Rechte vorbehalten
© Deutscher Gemeindeverlag GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN: 978-3-555-01854-6
E-Book-Formate:
pdf: 978-3-555-01855-3
epub: 978-3-555-01856-0
mobi: 978-3-555-01858-4
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Anlass für das Werk ist die anstehende Novellierung der Landesbauordnung Schleswig-Holstein. Die Novelle soll mehr Eigenverantwortung für Bauherren vorsehen, verständlichere Formulierungen enthalten und die Kommunen entlasten. Geplant sind weitergehende Erleichterungen bei Baugenehmigungen wie z.€B. bei einer nachträglichen energetischen Sanierung. Kleine Windkraftanlagen sollen in bestimmten Gebieten verfahrensfrei gestellt werden. Traditionell zu umfassenden Änderungen der Landesbauordnung ist auch dieser Textausgabe eine Kurzkommentierung beigefügt, die auf alle wesentlichen Aspekte des Bauordnungsrechts in Schleswig-Holstein eingeht.
Ministerialrat a. D. Gerd Möller, ehemals Referatsleiter im Innenministerium des Landes S.-H; Kreisoberverwaltungsrat Jens Bebensee, Fachdienstleiter Bauaufsicht beim Kreis Stormarn.
Vorwort
Von geringfügigen Änderungen abgesehen, hatte die Landesbauordnung 2009 über sieben Jahre Bestand. Aufgrund der fortentwickelten Musterbauordnung, gewonnener Erfahrungen mit den Neuregelungen der Landesbauordnung 2009 und der Herausforderungen der Energiewende erschien eine umfassende Anpassung der Landesbauordnung geboten. Zudem waren Änderungen aufgrund einer umzusetzende EU-Vorschrift in Bezug auf das Bauproduktenrecht erforderlich.
Der Novellierung der Landesbauordnung ist eine eingehende Kurzkommentierung beigefügt. Die Kurzkommentierung greift alle wesentlichen Aspekte des Gesetzes sowie der Gesetzesnovellierung auf, um so zu einer verständigen Anwendung insbesondere der neuen Regelungen im Bauwesen beizutragen.
Beigefügt ist des Weiteren die aktuelle Bauvorlagenverordnung, die insbesondere der Umsetzung der bauaufsichtlichen Verfahren und differenzierten Behandlung der bautechnischen Nachweise dient.
Im Anhang befinden sich die wesentlichen Vorschriften des aktuellen Baugesetzbuchs über die Zulässigkeit der Vorhaben und andere für das Verfahren bedeutsame Bestimmungen und die Baunutzungsverordnung in Zusammenstellung mit ihren früheren Fassungen, die für die in ihrem Geltungszeitraum aufgestellten oder geänderten Flächennutzungs- und Bebauungspläne weiter gelten. Der Übersichtlichkeit halber sind nur die früheren Regelungen unter den aktuell geltenden Text gesetzt worden, die von der geltenden Fassung abweichen.
Enthalten sind schließlich eine Einführung und ein umfassendes Stichwortverzeichnis.
Zum vorliegenden Werk wird auf Folgendes aufmerksam gemacht:
1. Aus Gründen der Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit ist in der gesamten Textfassung der Landesbauordnung die zwischenzeitlich neu für die Rechtssetzung in Schleswig-Holstein eingeführte Schreibung verwendet worden.
2. Im Anschluss an die jeweilige Gesetzesbestimmung folgt die dazugehörige Kurzkommentierung, welche die wesentlichen Erläuterungen und die einschlägige Rechtssprechung hierzu enhält.
3. Zur leichten Auffindbarkeit sowie Zuordnung der Regelungen zu betreffenden Kommentierung sind die Sätze in der Textfassung der Landesbauordnung durchnummeriert.
Kiel/Lübeck, im August 2016Gerd Möller/Jens Bebensee
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungs- und Literaturverzeichnis
AEinführung
BLandesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) mit Kurzkommentierung
Erster Teil:Allgemeine Vorschriften (§§ 1–3)
Zweiter Teil:Das Grundstück und seine Bebauung (§§ 4–9)
Dritter Teil:Bauliche Anlagen (§§ 10–52)
Abschnitt I:Gestaltung (§§ 10, 11)
Abschnitt II:Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung (§§ 12–17)
Abschnitt III:Bauprodukte, Bauarten; Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen (§§ 18–27)
Abschnitt IV:Wände, Decken, Dächer (§§ 28–33)
Abschnitt V:Rettungswege, Öffnungen, Umwehrungen (§§ 34–39)
Abschnitt VI:Technische Gebäudeausrüstung (§§ 40–47)
Abschnitt VII:Nutzungsbedingte Anforderungen (§§ 48–52)
Vierter Teil:Die am Bau Beteiligten (§§ 53–57)
Fünfter Teil:Bauaufsichtsbehörden, Verfahren (§§ 58–81)
Sechster Teil:Ordnungswidrigkeiten, Verordnungs- und Satzungsermächtigungen, Übergangs- und Schlussvorschriften (§§ 82–86)
CBauvorlagenverordnung
DBundesrechtliche Regelungen
1.Baugesetzbuch (BauGB): §§ 14–19, 22, 29–38, 201, 212a, 245b, 246, 248–249
2.Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO –)
Stichwortverzeichnis
Abkürzungs- und Literaturverzeichnis
AEinführung
1Das Bauordnungsrecht nach Ende des Ersten Weltkrieges
Nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte unter dem Eindruck der zerstörten Grenzgebiete eine rege Baugesetzgebung. Die Preußische Einheitsbauordnung von 1919 war Muster für die Bauordnungen der Städte in Schleswig-Holstein. 1931 erging die Bauordnung für das platte Land. Auf der Grundlage der Einheitsbauordnung erschien 1922 die Bau-Polizeiverordnung für die Städte und Flecken des Regierungsbezirks Schleswig und 1930 die Bau-Polizeiverordnung für das platte Land des Regierungsbezirks Schleswig. Das Wohnsiedlungsgesetz vom 22. September 1933 (RGBl. S. 659) enthielt neben bauordnungsrechtliche auch planungsrechtliche Regelungen. Auf seiner Grundlage und aufgrund der Bauregelungsverordnung vom 15. Februar 1936 (RGBl. S. 104) wiesen die Gemeinden Baugebiete aus. Die Ausweisung der Baugebiete durch Baupolizeiverordnungen erfolgte in Gestalt von Baustufen- und Bauklassenplänen. Die Baugestaltungsverordnung vom 10. November 1936 (RGBl. S. 938) enthielt baugestalterische Anforderungen. Seinerzeit sollte ein „Deutsches Baugesetzbuch“ das gesamte Baurecht einheitlich zusammenführen. Der Zweite Weltkrieg unterbrach diese Entwicklung.
2Die Neuordnung seit 1945
Aufgrund der starken Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg regelte bereits kurz nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Bildung der Länder das Aufbaugesetz vom 21. Mai 1949 (GVOBl. Schl.-H. S. 93) und die Landesbauordnung vom 1. August 1950 (GVOBl. Schl.-H. S. 225) das Baurecht in Schleswig-Holstein. Aufgrund der Überlegungen über ein einheitliches Baurecht erstattete das Bundesverfassungsgericht auf Antrag des Bundestages, des Bundesrates und der Bundesregierung das Rechtsgutachten vom 16. Juni 1954 – 1 PBvV 2/52 –, BVerfGE 3, 407.
In diesem Rechtsgutachten stellte das Bundesverfassungsgericht zur Klärung der Gesetzgebungszuständigkeiten fest, dem Bund stehe aufgrund des Artikel 74 Nr. 18 GG die konkurrierende Gesetzgebung für das Recht der städtebaulichen Planung, der Baulandumlegung, des Bodenverkehrs sowie der Erschließung zu, das „Baupolizeirecht im bisher gebräuchlichen Sinne“ sei aber Sache der Landesgesetzgebung. Nach dem Gutachten könne der Bund jedoch für Gebäude, die Wohnzwecken dienten, einzelne spezifisch das Wohnungswesen berührende baupolizeiliche Vorschriften erlassen.
Am 21. Januar 1955 schlossen der Bund und die für die Bauaufsicht zuständigen Minister der Länder daraufhin die „Bad Dürkheimer Vereinbarung“ ab. Dabei verpflichtete sich der Bund, von seiner Gesetzgebungszuständigkeit im Bauordnungsrecht keinen Gebrauch zu machen, wenn die Länder diesen Bereich „im Grundsätzlichen einheitlich“ regelten. Zugleich wurde vereinbart, eine Musterbauordnung auszuarbeiten, die als Grundlage für die Landesbauordnungen der Bundesländer dienen sollte.
Auf Grundlage dieser Vereinbarung schuf die Arbeitsgemeinschaft der für das Bauwesen zuständigen Minister der Länder – ARGEBAU – die Musterbauordnung und entwickelte sie laufend fort. Die Länder erließen auf dieser Grundlage ihre Landesbauordnungen. Damit konnte das Ziel der Vereinbarung, das Bauordnungsrecht im Wesentlichen einheitlich zu regeln, erreicht werden. Dies geschah nicht zuletzt im Interesse der am Bau Beteiligten.
Der Bund machte von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz durch Erlass des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 (BGBl. I S. 341) Gebrauch. Mit Inkrafttreten des Bundesbaugesetzes traten die planungsrechtlichen Bestimmungen der Landesbauordnung 1950 außer Kraft.
Es folgte 1971 das Städtebauförderungsgesetz, das 1976 und 1979 geändert wurde. Das Baugesetzbuch führte das Bundesbaugesetz (allgemeines Städtebaurecht) und das Städtebauförderungsgesetz (besonderes Städtebaurecht) zusammen (Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 8. Dezember 1986 – BGBl. I S. 2253 ). Es ist die erste Gesamtkodifikation des deutschen Städtebaurechts. Das Baugesetzbuch wurde laufend fortgeschrieben. Derzeit gilt das Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722).
Neben dem Baugesetzbuch ist die Baunutzungsverordnung von Bedeutung. Sie enthält Vorschriften über Art und Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche. In Anpassung an wechselnde Anforderungen an die städtebauliche Ordnung und Entwicklung der Städte und Gemeinden ist die Baunutzungsverordnung seit Inkrafttreten 1962 mehrfach geändert worden. Mittlerweile gibt es die Baunutzungsverordnung in den Fassungen BauNVO 1962, 1968, 1977, 1986 und 1990). Derzeit gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548).
3Schleswig-Holsteinische Landesbauordnung
3.1Entwicklung bis 1994
Die am 1. Juli 1968 in Kraft getretene Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 9. Februar 1967 (GVOBl. Schl.-H. S. 51) ersetzte die Landesbauordnung vom 1. August 1950 und ordnete als erste Landesbauordnung auf der Grundlage der Musterbauordnung das Bauordnungsrecht in Schleswig-Holstein grundlegend neu. Das Bauordnungsrecht dient entsprechend seiner herkömmlichen Funktion überwiegend der Gefahrenabwehr. Von großer und stetig zunehmender Bedeutung sind daneben Anforderungen sozialpolitischer Art, die Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderung und im weitesten Sinne der Umweltschutz. Außerdem dient die Landesbauordnung der Verhütung von Verunstaltungen und auch der Baugestaltung. Das Bauordnungsrecht wurde stetig fortentwickelt.
Weitere größere Gesetzesfassungen waren die Landesbauordnung i. d. F. vom 20. Juni 1975 (GVOBl. Schl.-H. S. 142), das Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung vom 28. März 1979 (GVOBl. Schl.-H. S. 260) und die Landesbauordnung vom 24. Februar 1983 (GVOBl. Schl.-H. S. 86). Bis zum Inkrafttreten der Landesbauordnung vom 24. Februar 1983 sind die Gesetzesregelungen durch Anforderungen der Baudurchführungsverordnung vom 25. April 1968 (GVOBl. Schl.-H. S. 105) sowie danach der Baudurchführungsverordnung vom 11. August 1975 (GVOBl. Schl.-H. S. 225, ber. S. 262) ergänzt worden. Nach diesem Zeitpunkt sind die entsprechenden Rechtsvorschriften der Baudurchführungsverordnung Gegenstand der Landesbauordnung geworden. Die wesentlichen Entwicklungen des Bauordnungsrechts der vergangenen zwanzig Jahren ergeben sich aus den nachfolgenden Ausführungen.
3.2Landesbauordnung 1994
Die Landesbauordnung i. d. F. vom 11. Juli 1994 (GVOBl. Schl.-H. S. 321) setzte die EG-Bauproduktenrichtlinie zur Verwirklichung des EG-Binnenmarktes auch für Bauprodukte um und hat die bauaufsichtlichen Verfahren durch Einführung einer Baufreistellung und eines vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens vereinfacht und beschleunigt.
3.3Landesbauordnung 2000
Der mit der Landesbauordnung 1994 eingeschlagene Weg, der Vereinfachung der bauaufsichtlichen Verfahren mit dem teilweisen oder vollständigen Prüfverzichten und der Klarstellung der Verantwortung der Bauherrinnen und Bauherren sowie der am Bau Beteiligten, wurde durch die Landesbauordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 10. Januar 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 47, ber. S. 213) fortentwickelt. Staatliche Stellen wurden weiter entlastet und die Verfahren beschleunigt. Dabei hatten die Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser die Aufgabe, mit Hilfe der Architekten- und Ingenieurkammer die in der Landesbauordnung klargestellte Verantwortung durch entsprechende Aus- und Fortbildung zu bewältigen.
In das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren fielen alle baulichen Anlagen im gesamten Gebiet der Gemeinde mit Ausnahme der Sonderbauten. Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren wurden im Wesentlichen nur die planungsrechtlichen Regelungen sowie Vorschriften von besonderer nachbarrechtlicher oder sozialpolitischer Bedeutung geprüft. Bei Gebäuden mittlerer Größe sowie bei anderen sicherheitstechnisch besonders bedeutsamen baulichen Anlagen sind in die Prüfung zusätzlich die Regelungen des Brandschutzes sowie die bautechnischen Nachweise eingestellt worden.
Das Baufreistellungsverfahren ist im erweiterten Umfange beibehalten worden. Die Bauherrinnen oder Bauherren sowie die Entwurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfasser mussten auch bei Vorliegen der sachlichen Voraussetzungen das Baufreistellungsverfahren nicht mehr zwingend betreiben. Sie konnten das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren wählen.
3.4Landesbauordnung 2009
Die Baugenehmigung blieb bei der Landesbauordnung vom 22. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 6) Schlusspunkt des Verfahrens. Das Baugenehmigungsverfahren bewältigte die häufig gegebenen Problemlagen einschließlich der des Bauens im Außenbereich und des Nachbarschutzes. Größtmögliche Bündelung bauaufsichtlicher Aufgaben und einheitliche Ansprechpartner blieben für die Bauherrinnen und Bauherren sowie im öffentlichen Interesse von herausragender Bedeutung.
Die Struktur der bauaufsichtlichen Verfahren war weiter vereinfacht worden. Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren blieb Regelverfahren, in das praktisch alle baulichen Anlagen im gesamten Gebiet der Gemeinde mit Ausnahme der Sonderbauten fielen. Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren wurde Bauordnungsrecht nicht mehr geprüft. Das bisherige Baufreistellungsverfahren war zu einem Genehmigungsfreistellungsverfahren fortentwickelt worden, in dem die Gemeinde eine besondere Rechtsstellung erhielt und in das deutlich mehr Vorhaben als bisher fielen. So sah die Genehmigungsfreistellung eine Art vorrangige Einschaltung der Gemeinde vor. Die Gemeinde konnte im Interesse insbesondere des Schutzes ihrer Planungshoheit das Bauvorhaben in ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren „überleiten“. Eine Fortentwicklung der Fristenregelungen ließ eine weiter gehende Beschleunigung der Verfahren erwarten. Das Baugenehmigungsverfahren nach § 67 erfasste bei Fertigung der Bauvorlagen durch umfassend bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasserinnen oder Entwurfsverfasser wie bisher nur Sonderbauten.
Die neue Gliederung der Gebäude in Gebäudeklassen ergab sich aus dem neuen Brandschutzkonzept der Musterbauordnung 2002, das von der Arbeitsgemeinschaft der für das Bauwesen zuständigen Minister der Länder – ARGEBAU – unter Einbeziehung eines Forschungsvorhabens zum Brandverhalten mehrgeschossiger Gebäude in Holzbauweise erarbeitet worden war. Es ermöglichte eine bundeseinheitliche Anwendung. Die Einteilung der Gebäudeklassen fand sich bei der unterschiedlichen Behandlung in den verschiedenen bauaufsichtlichen Verfahren wieder und war insofern auch verfahrensrechtlich beachtlich.
Prüfung und Überwachung bautechnischer Anforderungen waren – weil die bautechnischen Risiko- und Gefährdungspotentiale nicht verfahrens-, sondern vorhabenabhängig sind – eigenständig geregelt worden, wobei je nach Schwierigkeitsgrad und Gefahrenpotential zwischen den Bauvorhaben differenziert wurde. Sonderbauten nach § 51 wurden grundsätzlich weiterhin umfassend geprüft.
Die Verantwortung der am Bau Beteiligten wird weitergehend klargestellt. Im Rahmen der bautechnischen Nachweise erhielten Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit und die Prüfsachverständigen für Brandschutz eindeutige Verantwortungsbereiche, in denen diese je nach Aufgabenbereich abschließend bautechnische Nachweise und den Brandschutz verantworteten oder ggf. prüften, ohne dass es einer gesonderten Überprüfung durch die Bauaufsichtsbehörden bedarf.
3.5Landesbauordnung 2016
Das aktuelle Gesetz orientiert sich ebenfalls an der Musterbauordnung mit ihren materiell- und verfahrensrechtlichen Erleichterungen. Die Rahmenbedingungen für Maßnahmen des Klimaschutzes und zur Nutzung erneuerbarer Energien sind verbessert worden. Weitergehende Erleichterungen ergeben sich bei den Abstandflächenregelungen in bestimmten Fällen einer nachträglichen Gebäudesanierung wie die Wärmedämmung und das Anbringen von Solaranlagen. Verfahrensfreistellungen sind für Anlagen zur Energieeinsparung bzw. zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien eingeführt worden. Dazu zählen bestimmte Windenergieanlagen in Kleinsiedlungs-, Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in vergleichbaren Sondergebieten und im Außenbereich oder bestimmte Solaranlagen. Weitere Verfahrensfreistellungen ergeben sich u. a. für bestimmte Gewächshäuser für land- oder forstwirtschaftliche Betriebe sowie Betriebe des Erwerbsgartenbaus und Werbeanlagen für die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse.
Die Anforderungen an die Barrierefreiheit sind fortgeschrieben worden. Die konkreten Anforderungen an das barrierefreie Bauen ergeben sich unmittelbar aus der als Technische Baubestimmung eingeführten Norm DIN 18040; bisher bestehende Doppelregelungen sind aus der LBO gestrichen worden.
Die Gemeinden können durch Satzung örtliche Bauvorschriften über abweichende Abstandflächentiefen – Vergrößerung oder Verringerung – erlassen. Die Gemeinden haben die Möglichkeit, bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Anforderungen in Bezug auf die Bebauungsdichte zu harmonisieren. Die bisherigen Möglichkeiten, auf spezielle verkehrsbezogene Bedingungen im Gemeindegebiet reagieren zu können, sind durch eine Satzungsbefugnis über die Anzahl und Beschaffenheit der KFZ-Stellplätze sowie der Abstellanlagen für Fahrräder erweitert worden. Wegen des Inkrafttretens der Verordnung (EU) Nummer 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 S. 5) am 1. Juli 2013 sind die bauproduktenrechtlichen Regelungen angepasst worden.
Analog zur Beauftragung der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit mit der Prüfung des Standsicherheitsnachweises ist die öffentlich-rechtliche Beauftragung der Prüfsachverständigen für Brandschutz für die Prüfung des Brandschutznachweises durch die Bauaufsichtsbehörde eingeführt worden. Die Beauftragung durch die Bauaufsichtsbehörde gewährleistet die erforderliche Sorgfalt bei der Prüfung und einen engen Informationsaustausch zwischen der Bauaufsichtsbehörde und der oder dem Prüfsachverständigen für Brandschutz, z. B. im Hinblick auf Abweichungen und Änderungen. Die Beauftragung der oder des Prüfsachverständigen für Brandschutz regelt im Einzelnen die Landesverordnung über die Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure für Standsicherheit, Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure für Brandschutz sowie Prüfsachverständigen (PPVO), die entsprechend angepasst worden ist. Zur Abgrenzung der hoheitlichen Beauftragung der Prüfsachverständigen für Brandschutz zu den Prüfsachverständigen anderer Fachbereiche sind die Prüfsachverständigen für Brandschutz nunmehr Prüfingenieurinnen und Prüfingenieuren für Brandschutz.
Das Gesetz enthält neu Sonderregelungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden, die für ihre Unterbringung Erleichterungen schaffen sollen.