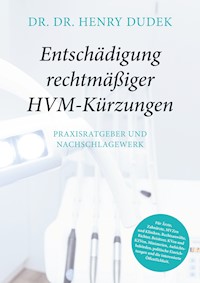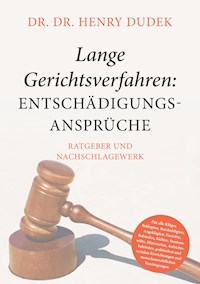
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Manche deutschen Gerichte brauchen sehr lange für ein abschließendes Urteil. Dadurch sind die Beteiligten lange Zeit psychisch belastet (dies ist die Regelvermutung) und es können ihnen auch materielle Schäden entstehen. Solche Schäden sind ausgleichspflichtig. Sie müssen durch eine Entschädigung neutralisiert werden. Es stellen sich damit etliche Fragen: Welches sind die Rechtsgrundlagen der Schadenskompensation und wie sind die Rechtsgrundlagen auszulegen? Was bedeutet "Verfahren"? Wann sind Verfahren verzögert? Was wird entschädigt und nach welchen Regeln? Wer versucht auf welche Weise und mit welchen Mitteln, diese Ansprüche zu vereiteln? Was kann man dagegen tun? In seinen Ratgebern, Nachschlagewerken zu lange dauernden Gerichtsverfahren und daraus resultierenden Entschädigungsansprüchen gibt Dr. Dr. Henry Dudek auf die dringenden Fragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der Darstellung und Kommentierung der zahlreichen in der Rechtspraxis bestehenden Mängel sowie des staatlichen Unterlaufens der Verzögerungsentschädigungen
Inhalt
Vorwort zur ersten Auflage
1.
gesetzliche Regelungen
1.1 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angeordnete Regelung einer verschuldensunabhängigen Entschädigung
1.2 Umsetzungsversuch der verschuldensunabhängigen Entschädigungsregelung
1.3 Wirksamkeit der verschuldensunabhängigen Entschädigungsregelung
1.4 verschuldensabhängige Schadensersatzregelung
1.5 Verhältnis von Entschädigungs- und Schadensersatzregelung
2.
Grenzen der Auslegung
2.1 Pflicht zu strikt EGMR-konformer Rechtsanwendung
2.2 Märchen vom Richterprivileg und verfahrensdauerabhängiger Urteilsqualität
2.3 Auslegungsregel »effektiver Rechtsschutz«
2.4 Auslegungsregel »wirksame Beschwerdemöglichkeit«
2.4.1 Regelung des Art. 13 EMRK
2.4.2 Anwendungsbefehl der EMRK
2.4.3 in Deutschland übliche Verletzung des Anwendungsbefehls
2.5 Auslegungsregeln »Verhältnismäßigkeit«, »Gleichheit« und »Vertrauensschutz«
2.5.1 unverhältnismäßige Verfahrensdauern
2.5.2 gleichheitswidrige Verfahrensdauern
2.5.3 vertrauensschutzverletzende Verfahrensdauern
3.
tatsächliche Zustände
3.1 staatliche Tendenz zum Beibehalten von Missständen
3.2 Ausklammerung der für effektiven Rechtsschutz unabdingbaren behördlichen Vorverfahren
3.3 geschäftsmäßiger Missbrauch überlanger Verfahren zur staatlichen Einnahmeerzielung
3.4 menschenrechtliches Verständnis des Rechtsschutzbedürfnisses
3.5 Ignorieren des Rechtsschutzes
3.6 staatlicher Widerstand gegen verzögerungslose Verfahren
4.
Feststellung der Verzögerung
4.1 Dauer des Gesamtverfahrens
4.2 Ein – Jahres – pro – Instanz – Grundregel
4.2.1 Verfahrensbeginn
4.2.1.1 behördliche Vorverfahren
4.2.1.2 strafrechtliche Ermittlungsverfahren, Berufsgerichtsverfahren
4.2.1.3 Ignorieren behördlicher Untätigkeit
4.2.1.4 Unterlassenes Klären von Vorfragen
4.2.2 Verfahrensende
4.2.2.1 verzögerte Urteilszustellungen
4.2.2.2 verzögerte Streitwert- und Kostenentscheidungen
4.2.2.3 verzögerte Vollstreckung
4.2.2.3.1 verzögerte Erteilung von Vollstreckungsklauseln
4.2.2.3.2 verzögerter Vollzug des Urteils
4.2.2.4 Falschangaben zum Ende der Rechtssache
4.3 Abweichungsgründe von der Ein- Jahres – Regel
4.3.1 Bedeutung der Sache für den Betroffenen
4.3.2 Komplexität des Falles
4.3.3 Verhalten des Betroffenen
4.3.4 Verhalten des Staates
4.3.4.1 gerichtliches Verhalten
4.3.4.2 behördliches Verhalten
4.3.5 Kombination der Abweichungsgründe
4.3.6 nicht maßgebliche Abweichungsgründe von der Ein – Jahres – Regel
4.3.7 Sonderfälle »möhwaldartigen-Nichts-Taugens«
5.
Entschädigung
5.1 verschuldensunabhängige Entschädigung
5.1.1 immaterielle Entschädigung
5.1.2 materielle Entschädigung
5.1.3 Entschädigung auf andere Weise
5.2 verschuldensabhängiger Schadensersatz
5.2.1 Amtspflicht zur unverzögerten Ausübung des Amtes
5.2.2 Amtspflicht zur EGMR – getreuen Rechtsanwendung
5.2.3 Amtspflicht zur Beachtung festgestellter Konventionsverletzungen
5.2.4 immaterieller Schadensersatz
5.2.5 materielle Entschädigung
5.3 Entschädigungsverzögerung
6.
Anhang
6.1 völkerrechtlicher Mindestinhalt und – umfang der innerstaatlichen Regelung des § 198 ff GVG
6.2 angemessene Verfahrensdauer pro Instanz
6.3 angemessene Gesamtverfahrensdauer: errechnet sich durch Division
6.4 Verzögerungsentschädigung
6.4.1 immaterielle Entschädigung
6.4.2 materielle Entschädigung
Vorwort zur ersten Auflage
Die als penetrant langsam empfundene Arbeit mancher Behörden und Gerichte in einigen Bundesländern – z.B. in Niedersachsen – behindert den Alltag der Bürger durch nervenaufreibende Wirkungen und der wegen des damit verbundenen Stresses verbundenen psychischen Belastungen (=immateriellen Schäden). Das wäre bei korrekter Arbeit vermeidbar gewesen. Nicht selten werden sogar materielle Schäden verursacht. Jährlich ärgern sich in Deutschland Hunderttausende über die sie durch pomadige-schläfrige Arbeit belastendenden und schädigenden unter den Behörden und Gerichten.
Manche Staatsdiener führen ihre Amtsgeschäfte so, als ob verzögerungsbedingte immaterielle und materielle Schäden als unabänderliche schicksalhafte Ereignisse von den ihnen »untergeordneten« Bürgern klaglos – quasi als »gottgegeben« – hinzunehmen seien; denn es gehört in Deutschland seit jeher zu einem eingeschliffenen rechtswidrigen Amtsverständnis, sich stets in nicht gerade rechtstaatlicher Art und Weise um Verpflichtungen gegenüber den Bürgern und Entschädigungen aller Art möglichst herumzudrücken. So ist eben das über die Hitler-Diktatur bis in die heutige Zeit weitergeschleppte ursprünglich preußische Untertanenverständnis, das den Bürgern ohne eigenes Nachdenken blinden Kadavergehorsam abfordert.
Als guter Bürger gilt auch im heutigen Deutschland immer noch, wer den Anweisungen von Jedem folgt, der die »übergeordnete« Staatsmacht durch das Tragen einer Dienstmütze oder Robe darstellt.
Bezüglich der Entschädigung für Verzögerungen hat der Europäische Gerichtshofs für Menschenrechte (»EGMR«) ein Machtwort gesprochen und Deutschland verpflichtet, solche Belastungen genau so auszugleichen, wie es der EGMR tut. Das gilt auch, wenn der verzögert bearbeitete Antrag oder die verschleppte Klage am Ende keinen Erfolg hatten; denn es kommt allein auf die Dauer der Sache an, nicht auf den Erfolg. Angemessene Bearbeitungszeiten sind ein Menschenrecht; keine Petitesse. Was »angemessen« ist, hat der EGMR deutschen Gerichten konkret vorgegeben und diese verpflichtet, das Verzögerungsrecht genauso anzuwenden wie der EGMR.
Soweit die Theorie.
Die deutsche Rechtswirklichkeit ist oft eine andere.
Die Rechtswirklichkeit bilden immer noch viele Beamte und Richter, die die Gesamtsystematik des Rechtsschutzes des EGMR gegen Verzögerungen gar nicht begreifen und nur kleine bruchstückhafte Ausschnitte aus diesem Gesamtsystem intellektuell erfassen können – so wie eine Ameise, die sich in einem großen Wald befindet, und – weil sie nur wenige Meter davon überblicken kann – glaubt, sie sehe Alles.
Zudem ist staatliches »um – Ansprüche – Herumdrücken« üblich; so wie ein Zechpreller oder Betrüger, der seine Schulden nicht bezahlen will. Von etlichen behördenwillfährigen Kommentatoren, die dem Staat »nach dem Munde reden« wird behauptet, dass Verzögerungen »nicht so schlimm« seien, besonders dann, wenn die jahrelang dauernde Klage oder Berufung (manchmal sogar wegen der Dauer) keinen Erfolg hatte.
Die Auffassung ist falsch und täuscht die Bürger. Das ist auch der Zweck, um weiterhin ungestört herumtrödeln zu können. Ebenso drücken sich etliche Landesregierungen um ihre Pflicht zur Einhaltung der allgemeinen Völkerrechtsnormen der Vereinten Nationen und der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) herum, indem sie die Menschenrechte nicht praktisch und wirksam, sondern bloß scheinbar und theoretisch anwenden.
Vorliegend werden die Möglichkeiten der Rechtswahrnehmung nach dem praktischen und wirksamen Verständnis des EGMR nebst in der Praxis zu erwartender Schwierigkeiten der oft die Verzögerungen schönredenden Behörden und Gerichte so konkret wie möglich an Beispielen aus der Praxis dargestellt. Beispiele pflegt man – damit sie eingängig sind – so auszuwählen, dass sie sich an extremen Fällen orientieren. Am extremsten und dreistesten werden die Menschenrechte m.W. in Niedersachsen (»Nds«) missachtet, und hier durch die Sozialgerichtsbarkeit (»SGb«). Darum entstammen die meisten der Beispielsfälle der niedersächsischen Sozialgerichtsbarkeit und den Kundgaben der Nds Landesregierung.
Wer Missstände und Menschenrechtsverletzungen still erduldet, tut sich, den Mitbürgern und dem Rechtsstaat keinen Gefallen. Passivität ermöglicht, den Rechtsstaat auszuhöhlen. Aktiver Einsatz gegen den Schlendrian dient dem Durchsetzen der Menschenrechte und verbessert das Sozial- und Rechtssystem. Ob ein System etwas taugt, ergibt sich nie in der Theorie, immer erst in der Realität.
Weil durch »fake – news« (siehe auch das o.g. Ameisen-Beispiel) erstaunlich viele Halb- und Unwahrheiten im Umlauf sind, sollte man sich nie kritiklos auf das verlassen, was Beamte und Richter sagen. Wie frei manche Staatsdiener von jeglicher Sachkunde sind, sieht man täglich:
Die hochbezahlte Bundesregierung verwendet jährlich ca. eine halbe Milliarde Euro Steuergelder zum Aufbessern ihres Wissens durch externe Berater. Das hat aber nicht geholfen, die seit ca. 40 Jahren den Generationenkontrakt bedrohenden Sozial- und Umweltprobleme (z.B. Dudek, Rechnungstheoretische Untersuchungen zur Sozialrechnungslegung, Diss FU Berlin 1984) zu begreifen. Erst der 2019 von der schwedischen Schülerin Greta Thunberg aufgebaute öffentliche Druck hat die Bundesregierung aufgeweckt und erstmals Nachdenken erzwungen; denn ohne öffentlichen Druck »geht Nichts«.
Vor ca. 20 Jahren ignorierte eine dem hippokratischen Eid des »nihil nocere« verpflichtete Ärztin als Niedersächsische Gesundheitsministerin (CDU) meinen Hinweis, dass die Zahl der ca. 80.000 jährlichen (bisher 1,6 Mio) Thrombosetoten zu reduzieren ist, wenn Notärzten übliche Thrombolytika mitgegeben werden.
Bei Herzinfarkten und Lungenembolien können dadurch tödliche Verstopfungen der Blutbahn mit frischen Gerinnseln rückgängig gemacht werden. Diese rescue – Lyse vor Ort kann die Zahl der Toten wegen frischer Thromben drastisch reduzieren. Weil kein öffentlicher Handlungsdruck bestand, interessierte das Thema die Ministerin nicht. Es geschah Nichts. Anders bei der Corona – Pandemie, in der es gewaltigen öffentlichen Druck gab. Obwohl wegen der Corona Pandemie in Deutschland vermutlich wesentlich weniger Menschen versterben als die jährlich evtl. zehntausende unnötig an frischen Thromben Verstorbenen, wird das Corona-Thema – wegen des öffentlichen Drucks – beachtet. Der öffentliche Druck hat bewirkt, dass die jetzt in der EU tätige frühere Ministerin sich um das Corona-Problem kümmert.
Selbst Richter bekunden verblüffend offen die menschenrechtswidrige Unverlässlichkeit des Staates. Man dürfe nicht einmal aus spezifischen Gründen des Vertrauensschutzes gegebenen staatlichen Auskünften vertrauen. So hat der Richter Möhwald am SG Hannover darstellt, ausdrücklich aus spezifischen Gründen des Vertrauensschutzes gegebenen Weisungen einer ministeriellen Aufsichtsanordnung hätte man nie vertrauen dürfen (S 35 KA 9/16 – Möhwald).
Solche Staatsdiener determinieren unser Leben – in der oft zutreffenden Gewissheit, dass die Öffentlichkeit von staatlichem Murks Nichts erfährt. Es gelten die Dummheit bezeugenden Beamtenregeln: »Nichts anrühren – das macht nur Arbeit« und: »Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus« sowie: »Ein Richter macht keine Fehler« – oder »Richter brauchen keine Belehrung zur Verfahrensgestaltung« (so: Dt Bundestag, Drs 17/3802, S 21 Sp 1) Wegen dieser Mentalität stehen allgemeines Völkerrecht, die Grundrechte (GG) und die Menschenrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) oft bloß auf dem Papier, obwohl jeder Staatsdiener die Amtspflicht hat, diese Rechte zu garantieren. Manchmal werden die Grund- und Menschenrechte sogar noch massiv behindert. Wer in Deutschland sein Grund- und Menschenrecht auf effektiven Rechtsschutz beansprucht, der muss es durchsetzen – oft mit hartem Ellenbogen. So hat sich der Verfassungsgeber die Rechtswirklichkeit gewiss nicht vorgestellt.
Solche Missstände, m.W. insbesondere im Bereich der Sozialgerichtsbarkeit (SGb), schreien nach Öffentlichkeit und deskriptiver Transparenz; denn ein Einzelner ist gegen den Staat machtlos. Nur die Öffentlichkeit kann als Kontrollinstanz des Staates etwas bewirken. Da trifft es sich gut, dass der Gesetzgeber wegen der Lehren aus der Vergangenheit jede Art von Geheimjustiz ablehnt. Er will Transparenz und damit Öffentlichkeit darüber, was sich bei Behörden und Gerichten abspielt. Der EGMR setzt ebenfalls auf eine öffentliche Kontrolle staatlicher Behörden und Gerichte: »The Court has consistently recognised that the public has a right to receive information of general interest.« (EGMR v 4.4.2009, 37374/05, § 26 – Tarsasag a Szabadsagjogokert/Ungarn) Nach dem Verständnis des EGMR erfüllt dieses Recht eine »watch-dog-Funktion«. Das Nichtöffentlichmachen von Gerichtsentscheidungen ist sogar menschenrechtswidrig. (EGMR v 17.12.2013, 20688/04, § 86 – Nikolova und Vandova/Bulgarien) Deshalb gehört zur Deskription der vorliegenden Schrift das Nennen konkreter Beispiele mit Namen. Jeder muss verantworten, was er tut und ist für sein amtliches Verhalten öffentlich rechenschaftspflichtig. Geordnete Rechtssysteme funktionieren nur, wenn rechtswidriges Verhalten bei Behörden und Gerichten nachprüfbar ist, also bloße Verallgemeinerungen und Pauschalierungen vermieden werden und die konkreten Methoden des Missbrauchs und die sie anwendenden Personen bekannt sind. Nur dann können die aufgedeckten Missstände in die behördlichen und richterlichen Karrierepläne einfließen, um unhaltbar-enthemmte Zustände nicht durch Beförderungen zu verschlimmern.
Betroffene werden gebeten, Urteile zu der vorliegenden Thematik zur Verfügung zu stellen, damit diese in weiteren Auflagen der vorliegenden Schrift berücksichtigt werden können.
Trotz der sorgfältig die Rechtsprechung (RSpr) zur Verfassung und Konvention berücksichtigenden Ausführungen wird – auch wegen nicht selten grotesker Auffassungen etlicher Gerichte – für die Ausführungen keine Garantie übernommen. Das Vorgehen muss stets mit einem Rechtsanwalt abgesprochen werden.
Personenbezogene Begriffe sind selbstverständlich geschlechtsneutral zu verstehen, also m/w/g.
Lohne (Südoldenburg), August 2020
Der Verfasser
1 gesetzliche Regelungen
Gesetze entwickeln sich nicht immer aus Sitten, Bräuchen und Gewohnheiten der Gesellschaft.
Der beste Beweis dafür sind die §§ 198 ff GVG, die gegen den in manchen Bundesländern und deren Gerichtsbarkeiten eingeschliffenen Brauch langer Gerichtsverfahren durch eine gewollte Anordnung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) zustande gekommen sind, um ebendiese eingeschliffenen menschenrechtswidrigen Angewohnheiten zum Vorteil der Bürger zu ändern. »Dies gibt Zeugnis für den …Satz, dass die Menschen niemals etwas Gutes tun, wenn sie nicht dazu gezwungen sind …« (Machiavelli, Vom Staate, 37).
Weil aber die §§ 198 ff GVG auf einer übergangslos geschaffenen Anordnung des EGMR beruhen, tun sich etliche deutschen Behörden und Gerichte schwer damit, ihr jahrzehntelang gepflegtes Verhalten zu ändern. Deutsche Gerichte müssen das Recht so anwenden, wie es der Rechtsprechung (RSpr) des EGMR entspricht; sie sind ausdrücklich vom EGMR dazu verpflichtet worden. (EGMR, U v 29.5.2010, 53126/07, § 39 – Taron/Deutschland)
Das geschieht aber fast durchgängig in Deutschland nicht. Deutschland und die deutschen Gerichte verstoßen in selten dreister Weise gegen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) in der ihnen verpflichtend vorgegebenen Auslegung durch den EGMR.
Dafür gibt es mehrere Gründe:
Etliche an verzögernde Arbeit gewohnte Staatsdiener haben immer noch nicht begriffen, dass verzögerungslose staatliche Tätigkeit ein aus dem allgemeinen Völkerrecht entspringendes Menschenrecht ist und dass nationale Gesetze niemals die Grundlage für die Nichteinhaltung des Völkerrechts oder Völkervertragsrechts sein können. (siehe auch: Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge v 23.5.1969, Art 26, Art 27) Art 26 des Wiener Übereinkommens der Vereinten Nationen drückt den auch im allgemeinen Völkerrecht und Völkervertragsrecht geltenden Grundsatz des »pacta sunt servanda« aus, wonach ein völkerrechtlicher Vertrag (hier: die EMRK) die Vertragsparteien bindet und von ihnen nach Treu und Glauben zu erfüllen ist.
Art 27 des Wiener Übereinkommens lautet: »Eine Vertragspartei kann sich nicht auf ihr innerstaatliches Recht berufen, um die Nichterfüllung eines Vertrages zu rechtfertigen.«
Gleichwohl tut eine große Zahl von Beamten und Richtern in Deutschland – fernab jeden völkerrechtlichen Gedankens und jenseits jeder völkervertraglichen Verpflichtung Deutschlands – immer noch so und sind zu Teilen vermutlich sogar davon überzeugt, dass es keine völkervertagsrechtliche Pflicht aus der EMRK, sondern ein weltweit seltenes Gnadengeschenk des deutschen Staates an seine Bürger sei, wenn er ihnen (jedenfalls auf dem Papier) zusichert, dass in fairer Weise und in angemessener Zeit über Ansprüche der Bürger oder gegen die Bürger erhobene Beschuldigungen entschieden werde, denn es bestehe ja ein »natürliches« Über/Unterordnungsverhältnis zwischen dem Staat und seinen Bürgern.
Das ist aber in einem modernen Rechtsstaat nicht so.
Die mit dem Ende der Hitler-Diktatur aufkeimende Einstellung, dass der Staat kein Selbstzweck ist, sondern seinen Bürgern zu dienen hat und es in einem modernen Rechtsaat nicht mehr die in Diktaturen übliche staatliche Aufgabe ist, Bürger durch »Überordnung« zu drangsalieren, lehnen manche Landesregierungen mehr als 75 Jahre nach dem Ende der braunen Diktatur immer noch ab. Manche Behörden dieser Bundesländer befolgen – dem braungetünchten gestrigen und heute nur noch in Diktaturen wie z.B. Nordkorea vorfindbaren Gedankengut der Überordnung des Staates über die Bürger entsprechend – nicht einmal rechtskräftige (rkr) Gerichtsentscheidungen, aufgrund welcher sie zur Leistung gegenüber Bürgern verpflichtet sind. Das ist z.B. in Niedersachsen so und wird trotz jahrelang verschleppter »Prüfung« bemerkenswerterweise weder von der Landesregierung, noch vom Nds Landtag (01317/11/18 v 2.7.2020), geschweige denn den zuständigen Abgeordneten (z.B. Axel Brammer, SPD) beanstandet. Wer wollte angesichts solcher staatlichen Vertuschung von Missständen ernsthaft von Fairness und fairen Verfahren gem. Art 6 EMRK in manchen Bundesländern sprechen?
Die Zusicherung fairer Verfahren in angemessener Zeit ist (abgesehen davon, dass sie oft nicht eingehalten wird), nach der EMRK keine besondere »Vergünstigung« Deutschlands an seine Bürger. Es ist ein mit modernem Denken nicht zu vereinbarendes verqueres Staatsverständnis, dass der Staat als »Stärkerer« mit seinen Bürgern nach freiem Belieben so verfahren könne, wie es ein normannischer Stammesfürst einst formuliert haben soll: »Es ist der Vorzug, den die Natur dem Stärkeren über den Schwächeren gegeben hat, dass dieser ihm gehorchen soll.«
Die §§ 198 GVG sind – für sich betrachtet – ein bloß aus der Systematik der menschenrechtlichen Regelungen der Art 6 und 13 EMRK herausgerissenes Fragment des allgemeinen Völkerrechtsstandards. Fragmente lassen keine auf verhältnismäßigen, gleichheits- und vertrauensschutzkonformen Prinzipien beruhendes Denken oder eine sonstige Systematik erkennen. Das ist natürlich auch bei der – wegen Nichtbeachtung des allgemeinen Völkerrechtsstandards und der EMRK- falschen Anwendung der §§ 198 ff GVG so, die ein sich auf die Anordnung des EGMR berufendes Vollzugsgesetz sind, das ohne die Berücksichtigung des dahinterstehenden allgemeinen Völkerrechtsstandards und der EMRK kaum Sinn macht und zur Falschanwendung führt.
Viele Staatsdiener wenden die §§ 198 ff GVG deshalb auch falsch, nämlich fragmentartig und ohne völkerrechtliche und menschenrechtliche Bezüge an, indem sie naiverweise – ohne jede Beachtung der Systematik des Art 6 EMRK und der umfangreichen RSpr dazu – aus den §§ 198 ff GVG einfach ihnen geeignet erscheinende Bruchstücke entnehmen, um die Überordnung des Staates über den Bürger sicherzustellen. Sie haben dabei nicht begriffen, dass die §§ 198 ff GVG so angewendet werden müssen, wie es der EGMR in seiner umfangreichen Rechtsprechung (»RSpr«) tut. Das ist aufgrund der völkerrechtlichen und menschenrechtlichen Bedeutung eine bei vielen Juristen unbekannte Selbstverständlichkeit. Außerdem hat der EGMR ausdrücklich angeordnet, dass die innerstaatlichen Gerichte die Verzögerungsrechtsprechung so anwenden müssen wie es der EGMR tut – also gar keine »Spielräume« für irgendwelche für vom case – law des EGMR abweichenden Entscheidungen bestehen. (EGMR v 29.5.2010, 53126/07, § 39 – Taron/Deutschland sowie Grabenwarter, EMRK, 118)
Schließlich haben viele Staatsdiener bis heute immer noch begriffen, dass der Anspruch auf eine unverzögerte Entscheidung über Ansprüche oder über erhobene Anklagen nicht nur einen menschenrechtlichen Anspruch aus der EMRK, sondern zugleich einen von den Vereinten Nationen niedergeschriebenen allgemeinen völkerrechtlichen Standard »billiger« Verfahrensführung verkörpert, der wegen seiner Selbstverständlichkeit eigentlich gar keiner schriftlichen Fixierung bedurft hätte.
Art 6 EMRK artikuliert also gar kein neues Recht, sondern schreibt den von den Vereinten Nationen festgestellten Standard des allgemeinen Völkerrechts nur in die Konvention hinein. Die Vereinten Nationen haben nämlich bereits 1966 im von ca. 170 Staaten ratifizierten Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPbürg), den auch Deutschland ratifiziert hat (BGBl, 1973 II, 1553), den Standard des allgemeinen Völkerrechts – u.a. auf billige Verfahren – als verbindliche Menschenrechte zusammenfassend dargestellt.
Der Anspruch auf faire Verfahren in angemessener Zeit fließt also aus den allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts und des Völkervertragsrechts, die gem. Art 25 GG über deutschem Bundesrecht stehen und Bundesrecht verdrängen.
In Teil II, Artikel 2 Absatz 2 dieses wichtigsten Menschenrechtsinstruments auf universeller Ebene verpflichtet sich jeder der dieser Völkerrechtsvereinbarung der Vereinten Nationen beigetretenen Staaten zur Einhaltung menschenrechtlicher Standards hinsichtlich seines Rechtssystems; nämlich dazu, dass Jeder, der in seinen in diesem Pakt anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, das Recht hat, eine wirksame Beschwerde einzulegen.
Diese Regelung des IPbürg entspricht Artikel 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention (»EMRK«), einem regionalen Menschenrechtssystem, das wegen der weitaus geringeren Zahl der Ratifikationsstaaten eine geringere Heterogenität aufweist und daher von größerer Effektivität ist. Wegen der Ratifizierung durch Deutschland steht die EMRK gem. Art 59 GG mindestens im Range eines deutschen Bundesgesetzes. Hinsichtlich des Art 13 EMRK ist das aber anders; denn Art 13 EMRK ist inhaltsidentisch mit dem im Internationalen Pakt der Vereinten Nationen festgeschriebenen allgemeines Völkerrecht und genießt daher m.E. als ius cogens aufgrund von Art 25 GG den Vorrang vor Bundesgesetzen. Nationale Gesetze können keine Grundlage für die Nichteinhaltung des Völkerrechts oder Völkervertragsrechts sein. (siehe auch: Art 27 des Wiener Abkommens über das Recht der Verträge vom 23.5.1969)
Das heißt, dass nicht nur die EMRK zu beachten ist und die Völkerrechtsnormen des Pakts der Vereinten Nationen »nicht so wichtig« sind oder umgekehrt. Folglich ist es deutschen Behörden und Gerichten verwehrt, der EMRK oder dem IPbürg zu widersprechen, diese Normen unbeachtet zu lassen oder sie nur am Rande zu beachten.
EMRK und IPBürg haben in jeder Verzögerungssache eine zentrale Rolle.
Hinsichtlich des Normenranges dürfte gelten: Wer Art 13 EMRK verletzt, der verletzt nicht nur das gem. Art 59 GG im Range eines Bundesgesetzes stehende europäische Völkervertragsrecht, sondern zugleich den gem. Art 25 GG über deutschem Recht stehenden allgemein anerkannten Standard des Völkerrechts.
Deutsche Behörden und Gerichte haben die Amtspflicht, neben dem im Pakt der Vereinten Nationen niedergelegten allgemein anerkannten Standard des Völkerrechts aufgrund Art 1 EMRK auch die mit dem IPbürg wesens- und inhaltsgleichen Rechte aus Art 13 EMRK zu gewährleisten. Art 13 EMRK garantiert Jedem das Recht einer wirksamen Beschwerde gegen Konventionsverletzungen.
Gem. Art 14 des Internationalen Pakts der Vereinten Nationen hat Jeder einen Anspruch darauf, dass über seine zivilrechtlichen Ansprüche und eine gegen ihn erhobene strafrechtliche Anklage in billiger Weise verhandelt wird, was eine Erledigung in angemessener Zeit einschließt.
Diese Regelung entspricht Art 6 der EMRK, wonach ebenfalls Jeder ein Recht auf ein faires Verfahren in angemessener Zeit hat, was allerdings hinsichtlich der Fairness und auch hinsichtlich der Dauer in Deutschland immer noch nicht durchgängig gewährleistet wird. Nach meinen Erfahrungen sind es oft dieselben Richter, die Verfahren unangemessen verzögern und deren Verfahren nicht fair sind.
Die Menschenrechte aus Teil II, Art 2 Abs 2 des Pakts der Vereinten Nationen und des Art 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention werden von etlichen Behörden und Gerichten, aber auch von manchen Landesregierungen nicht als »ernstzunehmende richtige Menschenrechte«, sondern als Lappalien und Petitessen angesehen, die man nicht beachten muss: New York, Genf und Straßburg sind ja weit entfernt. Diese »Petitessen« müsse man nicht so ernst nehmen und deren Verletzung sei nicht so schlimm. Das ist aber nicht so.
Die deutschen Gerichte verstoßen gegen den Standard des allgemeinen Völkerrechts, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und gegen die deutsche Verfassung, wenn sie eine abschließende Entscheidung über ein strittiges Rechtsverhältnis oder einen Strafvorwurf nicht in angemessener Zeit zu Stande bringen.
Möglicherweise kennen viele Behörden und Gerichte sowie Landesregierungen nicht einmal den allgemeinen Standard des Völkerrechts und die völkerrechtlichen Verträge, die sie einzuhalten verpflichtet sind. Sie können diese wegen Unkenntnis dann auch nicht einhalten. Dabei ist es übrigens nicht selten so, dass diejenigen Gerichte, die angemessene Verfahrensdauern nicht einhalten, auch das Fairnessgebot nicht ernstnehmen und man manchmal den Eindruck hat, dass sie ihre Entscheidungen durch »Flaschendrehen« finden.
1.1 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angeordnete Regelung einer verschuldensunabhängigen Entschädigung
Da Rechtsuchende in Deutschland häufig nicht – wie das Wort impliziert – als Personen angesehen werden, die ihr Recht suchen, sondern als die Behörden – und Gerichtsruhe bloß störende Querulanten, die sich dem Staat und insbesondere den Staatsdienern bedingungslos unterzuordnen haben und die sich intellektuell überschätzenden unter den deutschen Richtern die Regelungen der EMRK oft nicht einmal kennen, blieb dieses Recht in Deutschland fast durchgängig unbeachtet und deutsche Gerichte wandten und wenden die geschriebenen Regelungen der EMRK nicht an.
Hinsichtlich der Möglichkeit, sich gegen überlange Verfahrensdauern zu wenden, gab es bis 2011 nicht einmal ein den Bürgern zugängliches geschriebenes Rechtsmittel des deutschen Gesetzgebers, sondern nur den außerordentlichen und daher den Konventionsgarantien nicht genügenden Rechtsbehelf der Untätigkeitsbeschwerde.
Das verwundert angesichts der Tatsache nicht, dass Deutschland (anders als andere Länder, wie z.B. China) bis heute immer noch kein einheitliches und verständliches Staatshaftungsgesetz hat, sondern völlig diffuse Rechtsregelungen bestehen, die sich teilweise sogar im Sinne einer gewohnheitsrechtlichen Übung auf Rechtsvorschriften aus dem Jahre 1794 (die §§ 74 und 75 der Einleitung des Allgemeinen Preußischen Landrechts, welche Aufopferungsansprüche regeln) stützen:
»Dem geltenden Staatshaftungsgesetz liegt kein abgerundetes und inhaltlich abgestimmtes System zugrunde … Haftungsgrundlagen und Haftungstatbestände sind teils anachronistische , teils antiquierte, aber bis in die Gegenwart fortgeschleppte Ablagerungen.« (Ossenbühl, Staatshaftungsrecht, S 438)
Auf Regelungen aus dem Jahre 1794 zurückgreifende außerordentliche Rechtsmittel erfüllen jedoch im Europa des 21. Jahrhunderts nicht die Anforderungen des Art 13 EMRK. Das gilt auch für Rechtsmittel gegen zu lange Bearbeitungszeiten durch staatliche Einrichtungen, was sogar das BVerfG erkannte; allerdings erst, nachdem der EGMR dies im Falle Sürmeli/Deutschland festgestellt hatte:
»Zum Zweck der Schließung tatsächlicher oder vermeintlicher Lücken im bisherigen Rechtssystem geschaffene außerordentliche Rechtsbehelfe außerhalb des geschriebenen Rechts verstoßen gegen die verfassungsrechtlichen Anforderungen der Rechtsmittelklarheit.« (BVerfG v 16.1.2007, 1 BvR 2803/06)
»Außerhalb des geschriebenen Rechts stehende Rechtsmittel genügen den Anforderungen an die Rechtsmittelklarheit nicht. Rechtsbehelfe müssen im geschriebenen Recht geregelt und für den Bürger erkennbar sein.« (BVerfG, 1 PbuV 1/02 <63>)
»Für den Bürger muss eine gewisse Vorhersehbarkeit staatlicher Entscheidungen gegeben sein.« (BVerfG, 1 BvR 571/07 <28>)
Auch der Gesetzgeber (BTDrs 17/3802, S 1) hat aufgrund der Entscheidungen des EGMR erkannt, dass das Recht auf eine wirksame Beschwerde an ein geschriebenes Rechtsmittel gebunden ist und sogar das Bundesverfassungsgericht betont inzwischen, dass dies ein Verfassungsanspruch der Bürger ist. (BVerfG, 1 BvR 2736/08 <42>)
Der EGMR setzt im Ergebnis die Schriftlichkeit von Rechtsmitteln als konventionserforderlich voraus, die an die Kriterien der Erreichbarkeit, Genauigkeit und Vorhersehbarkeit geknüpft ist:
»The principle of lawfulness also presupposes that the provisions of domestic law must be sufficiently acessible, precise and foreseeable.« (EGMR v 5.1.2000, 33202/96, § 106, 109 – Beyeler/Italien)
bzw »perfectly clear, precise and directly applicable« (EGMR v 16.4.2002, § 47 – Dangeville/Frankreich)
oder »easily acessible, foreseeable and consistent«. (EGMR v 25.11.2014, 44019/11, § 41 – Mraz u.a./Slowakei)
Manche Behörden und Gerichte sehen das trotzdem immer noch anders. (z.B. KZVN – Schneider, LSG Nds, L 3 KA 97/16 – Pilz, Dr. Blöcher, Hörner) Die Bekanntmachungspflicht wird aus dem Rechtsstaatsgebot des Art 20 Abs 3 GG und der Garantie des effektiven Rechtsschutzes gem. Art 19 Abs 4 GG hergeleitet (so: BVerwG, 5 CN 1.03), so dass die Grundrechte verletzt sind, wenn unklar ist, wie Rechtsschutz gegen atypische Bearbeitungsdauern gesucht werden kann (dazu: BVerfG, 1 BvR 2298/09 <17>) oder nicht vorhergesehen werden kann, in welchen Fällen und mit welcher Tendenz von einer Regelung Gebrauch gemacht wird und welchen Inhalt die Norm haben könnte (stRSpr z.B.: BVerfG, 2 BvR 871/04 <38>; BVerfG, 2 BvR 414/08 <38 u.a.) und die EMRK auch verletzt ist, wenn Art und Weise der Normanwendung nicht mit hinreichender Genauigkeit geregelt sind (EGMR v 15.11.96, Slg 1996 – V, S 1800, § 33 – Domenichini/Italien), wie dies auf ungeschriebene Normen zutrifft. Außerdem ist es unzulässig, Rechtsuchenden tatsächliche oder rechtliche Auslegungsschwierigkeiten aufzubürden (so: OVG NRW, 13 A 2483/15 <10>), was stets der Fall ist, wenn Jemand mit einer ungeschriebenen und ihm nicht bekanntgegebenen Norm konfrontiert wird.
Das Alles interessiert die offensichtlich dem gestrigen Überordnungsgedanken des Staates über den Bürger anhängende nds SGb herzlich wenig, die es für rechtmäßig ansieht, dass Rechtssuchenden keine schriftlichen Normen mitgeteilt werden und sie keine Möglichkeit erhalten müssen, ihre Rechte nachzulesen. (LSG Nds, L 3 KA 2/19 – Pilz, Dr. Blöcher, Hörner)
Aus allen diesen Gründen war jedem Einsichtigen klar, dass es in Deutschland kein wirksames Rechtsmittel gegen überlange Verfahren gab. Das hat der EGMR – wie bereits angedeutet – in einer aufgrund der Verfahrensdauer in Niedersachsen beim EGMR entschiedenen Sache bereits im Jahre 2006 als »lack of an effective remedy in German law« festgestellt. (EGMR v 8.6.2006, 75529/09, § 136 – Sürmeli/Deutschland)
Bereits in dieser Entscheidung hatte der EGMR ausdrücklich auf das Fehlen einer wirksamen Beschwerde hingewiesen. Deutschland wurde aufgrund dieses (natürlich aus Niedersachsen stammenden) Verzögerungsfalles wegen der Verletzung von Art 13 (Fehlen einer wirksamen Beschwerde) und Art 6 Abs 1 EMRK (überlange Verfahrensdauer) zur Zahlung einer Entschädigung an den Beschwerdeführer Sürmeli von 10.000 Euro und den Kosten (insgesamt ca. 15.000 Euro) verurteilt.
Die Feststellung des EGMR, dass in Deutschland kein wirksames Rechtsmittel gegen überlange Gerichtsverfahren angewendet wird, interessierte jedoch weder den deutschen Gesetzgeber nachhaltig, noch die deutschen Gerichte, die weiterhin die Rechte der Bürger aus der Verfassung und der EMRK ignorierten. Sogar das BVerfG forderte noch 2007 in Kenntnis der EGMR – Entscheidung Sürmeli ausdrücklich in schikanöser Weise bloß weiterverzögernde und nutzlose Untätigkeitsbeschwerden. (BVerfG, 1 BvR 762/07 – Papier, Steiner, Gaier)
Deshalb stellte der EGMR immer wieder fest, dass Deutschland hinter europäischen Menschenrechtsstandards hinterherhinkt und es in Deutschland kein wirksames Mittel i.S. des Art 13 EMRK gegen das überlange Befassen des Staates mit den Rechtsanliegen der Bürger gibt:
»Der Gerichtshof hat bereits festgestellt, dass das deutsche Rechtssystem keinen wirksamen Rechtsbehelf vorsieht, der geeignet ist, Abhilfe für die unangemessene Dauer zivilrechtlicher Verfahren zu schaffen.« (EGMR v 24.6.2010, 39444/08, §68 – Afflerbach/Deutschland)
»Der Gerichtshof weist erneut auf seine neuere Rechtsprechung hin, wonach das deutsche Recht keinen wirksamen Rechtsbehelf vorsieht …« (EGMR v 30.3.2010, 54188/07, § 48 – Volkmer/Deutschland)
»Der Gerichtshof hat bereits festgestellt, dass es in Deutschland keinen Rechtsbehelf im Sinne des Art 13 EMRK gibt.« (EGMR v 30.3.2010, 32338/07, § 45 – Ritter Coulais/Deutschland)
»Der Gerichtshof hat bereits festgestellt, dass es in Deutschland keine Instanz für Beschwerden bezüglich der überlangen Dauer von Verfahren gäbe.«(EGMR v 24.6.2010, 25756/09, § 30 – Perschke/Deutschland)
Diese und Dutzende weiterer solcher Urteile konnten die Bundesregierung, die sich in Art 1 EMRK zur Gewährleistung der Konventionsgarantien verpflichtet hatte, immer noch nicht bewegen, umgehend ihrer in Art 1 EMRK übernommenen völkervertraglichen Pflicht zur Bereitstellung eines geeigneten Rechtsbehelfs nachzukommen. Die deutsche Regierung ließ sich weiterhin lieber vom EGMR in einer Vielzahl von Verfahren zu Entschädigungen in Millionenhöhe an die Verzögerungsopfer verurteilen. Die Urteile des EGMR wurden von der deutschen Regierung bezahlt, fanden aber weiterhin keinerlei innerstaatliches Interesse; im Gegenteil: Trotz der Feststellung, dass eine Untätigkeitsbeschwerde kein wirksames Rechtsmittel ist, befasste sich die deutsche Regierung nicht mit dem erforderlichen Nachdruck mit dem vom EGMR aufgezeigten Problem langer Verfahrensdauern und auch das zum Schutz der Grund- und Menschenrechte berufene BVerfG trug zur Beseitigung langer Verfahrensdauern Nichts bei, sondern verlangte mit erstaunlicher Dickfelligkeit und Dreistigkeit von unter langen Verfahrensdauern leidenden Personen ausdrücklich das Einlegen der vom EGMR als »unwirksam« benannten Untätigkeitsbeschwerden. (siehe oben: BVerfG, 1 BvR 762/07 – Papier, Gaier, Steiner) Diese vom Präsidenten des BVerfG, Papier und den Verfassungsrichtern Gaier und Steiner rechtsmissbräuchlich verlangten und bloß grundrechts- und konventionswidrig schikanös weiterverzögernden Untätigkeitsbeschwerden wurden dann natürlich erwartungsgemäß von den insoweit hinsichtlich der Konventionsrechtsprechung kundigen Fachgerichten als unzulässig abgewiesen, weil sie kein wirksames Rechtsmittel waren. Im Ergebnis hat das BVerfG durch seinen Präsidenten Papier und seine Richter Gaier und Steiner bereits verzögerte Verfahren auf diese Weise missbräuchlich und menschenrechtswidrig noch weiter verzögert, nur um sich mit der Verzögerungsproblematik nicht befassen zu müssen. – Eine Beanstandung durch das BVerfG hätte ja den verzögernden Gerichten »weh tun« können, und damit dem Korpsgeist oder Seilschaftsgedanken des »eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus« widersprochen.
Aufgrund der sich wegen der Nichtbeanstandung durch das BVerfG beim EGMR weiterhin häufenden Individualbeschwerden wegen zu lange dauernder Gerichtsverfahren machte der EGMR nun kurzen Prozess. Der EGMR nahm – nachdem er Deutschland in einer Vielzahl von Verfahren zu Entschädigungen in Millionenhöhe an die Verzögerungsopfer verurteilt hatte sowie über vier Jahre lang dabei zugesehen und dies in etlichen Urteilen kritisiert hatte, dass in Deutschland überhaupt Nichts geschehen war, um konventionskonforme Verhältnisse zu schaffen – die Sache Rumpf zum Anlass, um ein Piloturteil gegen Deutschland zu erlassen. Piloturteile werden erlassen, wenn die Staaten nicht wissen, wie sie ihren Konventionspflichten nachkommen sollen. Im Piloturteil Rumpf wurde Deutschland nun vom EGMR machtvoll dazu verpflichtet, die konventionskonforme Möglichkeit einer wirksamen Beschwerde bei einer innerstaatlichen Instanz gegen lange Gerichtsverfahren innerhalb eines Jahres zu verwirklichen. (EGMR v 2.9.2010, 46344/06 § 73 – Rumpf/Deutschland)
Außerdem wurde Deutschland zu einer an den Beschwerdeführer Rumpf zu zahlenden Entschädigung von 10.000 Euro und zu den Verfahrenskosten (insgesamt ca. 14.000 Euro) verurteilt. Der EGMR wies ausdrücklich darauf hin, dass seine Anordnung, dass Deutschland innerhalb eines Jahres einen Rechtsbehelf gegen Verzögerungen zu schaffen habe, eine »Verpflichtung« darstellt (EGMR Rumpf/ Deutschland, a.a.O. § 73) und der innerhalb eines Jahres zu schaffende Rechtsschutz nicht »irgendwie« gestaltet werden darf, sondern
»in der Theorie als auch in der Praxis den vom Gerichtshof genannten Schlüsselkriterien entsprechen« muss. (EGMR, Rumpf/Deutschland a.a.O., § 73)
Daran, dass diese Forderung des EGMR in Deutschland tatsächlich in effektiver und wirksamer Weise korrekt verwirklicht wurde und wird, dürften angesichts der praktischen Anwendung des daraufhin beschlossenen »Rechtsschutzgesetzes« (§§ 198 ff GVG) durch die inzwischen ergangenen deutschen Urteile zur beanstandeten Dauer von Verfahren berechtigte Zweifel angebracht sein.
Das Rechtsschutzgesetz »erweist sich bisher in der Praxis als ein reines Alibigesetz, um die Forderungen des Europäischen Gerichtshofs zu erfüllen.« (Wagner, Gerichtsverfahren in Deutschland dauern zu lange) Damit genügt Deutschland den Ansprüchen an die RSpr des EGMR nicht einmal ansatzweise; denn die deutschen Gerichte müssen das Recht so anzuwenden, wie es der EGMR tut (EGMR v 29.5.2010, 53126/07, § 39 – Taron/Deutschland). Das heißt, dass die Konventionsgarantien so wie der EGMR es tut, also nicht theoretisch und scheinbar, sondern praktisch und wirksam angewendet werden müssen.
Statt Rechtsschutz in angemessener Zeit zu gewährleisten, nutzten und nutzen die Gerichte – weil damals in Deutschland hunderttausende – geschätzt eine halbe Million – Gerichtsverfahren verzögert waren (so: Bundesrat, 875. Sitzung)- die gem. § 198 GVG gerichtskostenpflichtig eingereichten Verzögerungsklagen nahezu ausnahmslos als willkommene zusätzliche Einnahmequelle des Staates für Gerichtskosten. Sie wiesen die Verzögerungsklagen haufenweise – man kann sagen: nahezu vollständig – ab, um die wegen der abgewiesenen Klagen von den Verzögerungsopfern abgegriffenen Gerichtskosten einzukassieren. Die §§ 198 GVG wurden praktisch als zusätzliche Einnahmequelle des Staates missbraucht.
Dass das den Sinn des Piloturteils Rumpf pervertierte, war und ist augenscheinlich.
Kurz nach Inkrafttreten der durch die deutsche RSpr zu einem zusätzlichen Gerichtskostengeschäft verkommenen §§ 198 GVG gab es deshalb von den die konventionswidrige Haltung deutscher Behörden und Gerichten realistisch einschätzenden Bürgern erneute Beanstandungen beim EGMR, dass wirksamer Rechtsschutz gegen überlange Gerichtsverfahren in Deutschland von den Gerichten weiterhin nicht gewährt wird. Deutschland verweigerte und verweigert praktisch die Anwendung korrekten Rechts; »justice delayed is justice denied«. (=verzögertes Recht ist verweigertes Recht) 83% der Bürger halten die Dauern deutscher Gerichtsverfahren immer noch als entschieden zu lang. (so: Allensbach in Wagner, Gerichtsverfahren in Deutschland dauern zu lange)
Wegen der damals noch kurzen Anwendungsdauer der §§ 198 GVG behielt sich der EGMR eine Beobachtungszeit vor und ging gutgläubig von zukünftig konventionskonformer RSpr in Deutschland aus, nämlich von der Erwartung, dass die deutschen Gerichte bei ihren Entscheidungen über Entschädigungsansprüche »die Konventionsrechte so beachten, wie es der Rechtsprechung des Gerichtshofs entspricht.« (EGMR v 29.5.2012, 53126/07, § 39 – Taron/Deutschland)
Diese optimistische Hoffnung war – sieht man sich die inzwischen verwirklichte Rechtssprechungspraxis an – offensichtlich verfehlt. Auch der EGMR hat selber insoweit inzwischen Zweifel an der korrekten Umsetzung seiner Vorgabe durch Deutschland bekommen. Der EGMR hat der deutschen Regierung deshalb in einer Verfahrensdauersache die Frage gestellt:
»Did the applicant have at this disposal an effective domestic remedy for his complaint under Article 6 § 1 of the Convention, as required by Article 13 of the Convention? In particular, did Section 198 of the Courts act, in light of the Federal Court of Justice›s reasoning, constitute a remedy capable of dealing with the substance of the applicant›s complaint under Article 6 § 1 of the Convention that the length of the proceedings was excessive, and of granting appropiate relief? (EGMR communicated on 10 May 2017, Zacharias/Germany, lodged on 16 August 2016)
Die Zielrichtung dieser Fragen ist recht eindeutig. Realistischerweise ist davon auszugehen, dass es aufgrund der deutschen Gerichtspraxis über kurz oder lang zu einem neuen Piloturteil gegen Deutschland kommen wird.
1.2 Umsetzungsversuch der verschuldensunabhängigen Entschädigungsregelung
In Deutschland gibt es aufgrund der oben dargestellten Anordnung des EGMR seit 2011 bezüglich langer Dauer staatlichen Handelns die folgende gesetzliche Regelung:
»Wer infolge unangemessener Dauer eines Gerichtsverfahrens als Verfahrensbeteiligter einen Nachteil erleidet, wird entschädigt. Die Angemessenheit der Verfahrensdauer richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles, insbesondere nach der Schwierigkeit und Bedeutung des Verfahrens und nach dem Verhalten der Verfahrensbeteiligten und Dritter.« (§ 198 Abs 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes – GVG)
»Ein Nachteil, der nicht Vermögensnachteil ist, wird vermutet, wenn ein Gerichtsverfahren unangemessen lange gedauert hat.(…)« (§ 198 Abs 2 GVG)
Die Durchführung und (oft falsche, weil der RSpr des EGMR nicht entsprechende und somit konventionswidrige) Auslegung dieser gesetzlichen Regelung durch eine ganze Reihe deutscher Behörden und Gerichte verifiziert die Auffassung: »Nie kann man einen Übelstand vermeiden, ohne dass daraus ein anderer entstünde.« (Machiavelli, Vom Staate, 45)
1.3 Wirksamkeit der verschuldensunabhängigen Entschädigungsregelung
Zweck der §§ 198 ff GVG ist nach dem Willen des Gesetzgebers ein u.a. den Anforderungen des Art 13 EMRK genügender Rechtsbehelf. Dieser war auch dringend erforderlich, um auf einen Standard zu gelangen, der in anderen europäischen Ländern längst gang und gäbe ist. Art 13 EMRK verlangt einen Rechtsbehelf (Möglichkeit wirksamer Beschwerde) der bei innerstaatlichen Instanzen, also nicht nur bei Gerichten, sondern auch bei Behörden wegen überlanger Gerichtsverfahren geltend gemacht werden kann.
»Wirksam« ist der in Deutschland gem. Art 1 EMRK konventionsrechtlich verpflichtend zu gewährleistende Rechtsbehelf nur, wenn
mit ihm entweder die Rechtsverletzung verhindert werden kann, d.h. gar keine Verzögerung eintritt,
oder
eine bereits geschehene Rechtsverletzung entschädigt wird.
§ 198 GVG genügt seinem eigenen Ziel der Gewährleistung einer »wirksamen Beschwerde gem. Art 13 EMRK« schon deshalb nicht, weil mit ihm – auch in der RSpr – die unangemessene Dauer von behördlichen Verfahren ausklammert wird, obwohl Art 13 EMRK ausdrücklich die wirksame (also in angemessener Zeit abgeschlossene) Beschwerde nicht nur bei Gerichten, sondern bei allen innerstaatlichen Instanzen, also auch bei Behörden gewährt und die Erledigung eines Rechtsschutzbegehrens durch Gewährleistung eines fairen Verfahrens in angemessener Zeit keine isolierbaren – bloß scheinbaren und theoretischen – Rechte darstellt, sondern eine praktische und wirksame Gesamtgarantie ist. Weder reicht es aus, Rechtsschutz durch ein faires Verfahren in unangemessener Zeit zu gewähren, noch erfüllt ein unfaires Verfahren in angemessener Zeit den aus Art 6 EMRK fließenden Anspruch.
Hinzu kommt, dass Jeder einen – übrigens auch in der deutschen Verfassungstheorie gewährleisteten – Anspruch auf eine abschließende, also alle Instanzen umfassende abschließende Entscheidung in angemessener Zeit hat. Dazu zählt – sofern gesetzlich vorgesehen – auch eine Entscheidung im behördlichen Verfahren und einer Berufungs- oder sogar Revisionsinstanz. Die Entscheidungen von Rechtsanliegen (nicht bloß von Teilaspekten dieser Rechtsanliegen wie primärer Rechtsschutz) haben verfassungstheoretisch in angemessener Zeit zu erfolgen und sind nicht nur auf eine angemessene Dauer einer einzigen Gerichtsinstanz beschränkt, wie es § 198 GVG vorsieht; denn:
»Strittige Rechtsverhältnisse sind in angemessener Zeit zu klären.« (so: BVerfG, 1 BvR 232/11)
»Strittige Rechtsverhältnisse« heißt nicht: »Teilaspekte«, wie z.B. »Untätigkeitsklagen«, »Zwischenverfahren«, »primärrechtliche Verfahren« u.ä.
Untätigkeitsklagen wegen des behördlichen Nichtbefassens mit einem strittigen Rechtsverhältnis klären das eigentlich strittige Rechtsverhältnis in keiner Weise. Zwischenverfahren und primärrechtliche Verfahren klären die strittigen Rechtsverhältnisse ebenfalls nicht. Des Weiteren sind strittige Rechtsverhältnisse auch nicht »instanzenbegrenzt«. Eine Instanz reicht oft nicht aus, ein strittiges Rechtsverhältnis zu klären.
In der Nichtbeachtung oder verzerrten Auslegung dieses Gebots scheint einer der zahlreichen Grundmängel in der Anwendung des § 198 GVG zu liegen.
Die Probleme werden durch die RSpr der Gerichte oft noch erheblich verstärkt. § 198 GVG bietet ausreichend viele Ansatzpunkte, die sich als »findig« haltende Richter fleißig nutzen, um das Ziel der gesetzlichen Regelung wegen der in ihr enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe zu verbiegen (»Ein ›guter‹ Jurist kann auch die verrückteste Entscheidung ›vernünftig‹ begründen«), so dass sich die Frage nach der wirksamen Anwendung der §§ 198 ff GVG stellt und vom EGMR auch schon gestellt worden ist (siehe EGMR – Zacharias/Deutschland, a.a.O.)
Schließlich enthält das Gesetz die Rechtswahrnehmung erschwerende und unterlaufende Regelungen und werden bestimmte Verfahrensregelungen (Verzögerungsrüge pp.) von deutschen Gerichten regelmäßig missbraucht, um Verzögerungsentschädigungen zu vereiteln.
Hier muss man sich darüber im Klaren sein, dass mit dem Erschöpfen des deutschen Rechtsweges »das Ende der Fahnenstange« noch nicht erreicht ist, sondern die letzte Entscheidung beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte liegt, dessen auf Effektivität und Wirksamkeit gerichtete Rechtsprechung klar und übersichtlich ist. Jeder, der sich in seinem Recht auf Entscheidungen in angemessener Zeit verletzt fühlt, denen innerstaatliche Instanzen nicht mit dem erforderlichen Nachdruck nachgehen, kann unter Berücksichtigung der Zulässigkeitsvoraussetzungen (www. hudoc com) beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Straßburg (EGMR) auf einem im Internet ausdruckbaren oder vom EGMR zugeschickten Formular eine Individualbeschwerde wegen der Verletzung seiner Konventionsrechte in deutscher Sprache einreichen. Er/Sie sollte das unbedingt auch tun; denn je mehr Individualbeschwerden beim EGMR zu einem Problem eingehen, umso eher nimmt sich der EGMR des nationalen Missstands an.
Erklärt der EGMR eine Individualbeschwerde für zulässig, stellt der EGMR in der Regel eine Verletzung der Konventionsgarantien fest. Er setzt dann fast immer eine vom betreffenden Staat an den in seinen Konventionsrechten Verletzten zu bezahlende Geldentschädigung fest. Deutschland muss dann einen Entschädigungsbetrag innerhalb eines halben Jahres an den Betroffenen bezahlen. Außerdem veröffentlicht der EGMR die Entscheidung in seiner Datenbank (Human Documents – »www. hudoc com«) und überprüft das Ministerkomitee des Europarats, ob der verurteilte Staat die Auflagen des Urteils erfüllt hat.
Elektronische Einreichung oder Fax-Zusendung des Individualbeschwerde – Formulars reicht nicht aus. Die Individualbeschwerde muss 6 Monate nach Abschluss der letzten innerstaatlichen Instanz eingelegt werden, wobei der EGMR die Verfassungsbeschwerde zum BVerfG als auszuschöpfendes Rechtsmittel ansieht.
Nach – zwar nicht nachvollziehbarer, aber gleichwohl vorsichtshalber zu beachtender – Auffassung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts (Thür OVG, U v 22.10.2011, 2 SO 182/12, S 19) sei für alle Individualbeschwerden der Rechtsweg zum BVerfG auszuschöpfen – jedoch nicht für die Individualbeschwerden, die Verfahrensverzögerungen gem. Art 6 Abs 1 S 1 EMRK betreffen. Verzögerungssachen stellen angeblich eine Ausnahme dar. Vorsichtshalber sollte man rechtzeitig klären – ggf. durch eine Vorabauskunft des EGMR – ob diese Rechtsansicht zutrifft, oder falsch ist; denn wenn diese Ansicht falsch ist und deshalb der Rechtsweg zum BVerfG nicht ausgeschöpft wird, unterliegt die Individualbeschwerde wegen nicht erschöpften Rechtsweges der Abweisung. Ist die Ansicht hingegen richtig, und wird die Entscheidung des BVerfG abgewartet, ist die Individualbeschwerde verfristet.
Die Anschrift des EGMR lautet: European Court of Human Rights; Cour Europeenne des Droits de l›Homme, F 67075 Strasbourg – Cedex, France.
Da sich Deutschland in Art 2 des Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte zur Achtung und Gewährleistung der im Pakt garantierten Rechte verpflichtet hat, ist es – wenn zu lange Verfahrensdauern in Deutschland unbeachtet bleiben – auch durchaus möglich, sich über zu lange Verfahrensdauern bei den Vereinten Nationen zu beschweren, die der Sache dann nachgehen. Die Vereinten Nationen setzen aber keine an den Betroffenen zu bezahlende Entschädigung fest, sondern beschränken sich auf die öffentliche Feststellung, dass Deutschland das Völkerrecht verletzt hat. Die Beschwerde (Individual Complaint) wird beim Menschenrechtsrat eingereicht.
Die Adresse lautet: High Commissioner for Human Rights in New York (CH CHR – NY), UN Headquarters, New York, NY 10017, USA.
1.4 verschuldensabhängige Schadensersatzregelung
Interessant ist neben den vorgenannten Regelungen auch die weitgehend unbeachtete und teilweise, selbst bei – manchmal erstaunlich rechtsunkundigenRichtern völlig unbekannte, mit verzögertem Handeln des Staates im Zusammenhang stehende Haftungsregelung im § 839 Abs 2 S 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).
Daraus ist ersichtlich, dass sich verzögernde Staatsdiener, also Angestellte, Beamte und Richter, wegen schuldhafter Verzögerung der ihnen obliegenden Amtsgeschäfte haftpflichtig machen können; und zwar nicht nur Angestellte und Beamte, sondern ausdrücklich auch Richter.
Ein Beamter oder Richter haftet außerhalb der Verweigerung oder Verzögerung der Ausübung seines Amtes nur für strafbare Amtspflichtverletzungen bei einem Urteil. Wie die Rechtsrealität zeigt, sind zwar Amtspflichtverletzungen von Beamten oder Richtern ›bei einem Urteil‹ gar nicht so selten; auch solche die die Kriterien der Strafbarkeit erfüllen. Dennoch ist es eine Illusion zu glauben, dass jemals die Strafbarkeit einer richterlichen Amtspflichtverletzung ›bei einem Urteil‹ festgestellt wurde oder festgestellt werden wird. Dass jemals eine Rechtsbeugung festgestellt wird, entspricht aufgrund des vorherrschenden Korpsgeistes nicht der deutschen Rechtspraxis.
Praktisch alle Berufskarrieren derjenigen Richter belegen das ohne Ausnahme, die im Dritten Reich dazu beigetragen haben, den früheren Ruf Deutschlands als »das Land der Dichter und Denker« in den Ruf des Landes »der Richter und Henker« zu diskreditieren, was keiner weiteren Erläuterung bedarf.
M.W ist kein einziger dieser Richter anschließend zur Rechenschaft gezogen worden. Im Gegenteil: Viele wurden in den Staatsdienst übernommen und bekleideten dort wichtige und hoch alimentierte Positionen. Im Ergebnis heißt das, dass ein deutscher Richter in der Rechtspraxis regelmäßig auch durch strafbare Amtspflichtverletzungen »bei einem Urteil« de facto in der Rechtspraxis nicht haftpflichtig wird. Ein solcher Fall ist m.W. jedenfalls noch nie bekanntgeworden.
Bei Verzögerungen könnte das aber – jedenfalls rechtstheoretisch – anders sein. Der Gesetzgeber hat ausdrücklich entschieden, dass Verzögerungen nicht ›bei einem Urteil›‚ geschehen. Hier kommt es nicht auf die Strafbarkeit an; denn »auf eine pflichtwidrige Verweigerung oder Verzögerung der Ausübung des Amtes findet diese Vorschrift keine Anwendung.« (§ 839 Abs 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs – BGB)
Für schlampig und schludrig mit der Verfahrensdauer umgehende, selig schlafende und die Verfahrenstermine (z.B. die Zeitvorgaben für die Erstellung von Sachverständigengutachten) nachlässig behandelnde Richter kann § 839 Abs 2 S 2 BGB zum Prüfstein mit für sie fatalen Folgen werden, der sich ggf. bis zum EGMR verfolgen ließe. Das weiß aber eben kaum Jemand.
1.5 Verhältnis von Entschädigungs- und Schadensersatzregelung
Die §§ 198 GVG und 839 Abs 2, S 2 BGB stehen nebeneinander. Das heißt, es gibt keine Subsidiarität, wie in anderen Teilen des staatlichen Haftungsrechts. Beide Anspruchsgrundlagen bestehen unabhängig voneinander und schließen sich nicht gegenseitig aus. Der Gesetzgeber hat bezüglich der Anwendung der §§ 198 ff GVG ausdrücklich festgestellt:
»Andere mögliche Ansprüche, insbesondere aus Amtshaftung bleiben unberührt; sie stehen mit dem Entschädigungsanspruch in Anspruchskonkurrenz, die allerdings nicht zu einer Überkompensation führen darf.« (Dt. Bundestag. BTDrs 17/3802, S 19, Sp 2 oben)
Das heißt z.B., dass Richter, deren schuldhaft verzögernde Verfahrensführung zu immateriellen und materiellen Anspruchsverlusten führen, dafür – wie alle im normalen Berufsleben tätigen Bürger – haften, ohne dass sie sich auf die Voraussetzung eines (in Deutschland gegen Richter durch Richter entschiedenen und daher aufgrund der Seilschaftsregel realitätsfernen) rechtskräftigen Strafurteils berufen können. Dieses Einredeprivileg eines nicht vorhandenen Strafurteils (ein solches hat es m.W. noch nie gegeben) entfällt bei Verzögerungen.
Vor der Inanspruchnahme wegen der Haftung für die verzögerter Wahrnehmung der Amtsgeschäfte sind Richter also – entgegen allgemeiner, auch bei zahlreichen Richtern bestehender Auffassung (z.B. Beyer, Präsidentin des SG Hannover; Dr. Castendiek, LSG, L 3431 – 002/18 v 30.5.2018 ) – nicht durch das Spruchrichterprivileg der Unabhängigkeit und nicht durch die Einrede eines fehlenden Strafurteils des § 839 Abs 2 S1 BGB geschützt. Verweigerungen oder Verzögerungen der Ausübung des Amtes haben gem. § 839 Abs 2 S 2 BGB mit dem Spruchrichterprivileg und einem Strafurteil überhaupt nichts zu tun.
Verzögerungen sind als nicht ordentlich geführte Amtsgeschäfte von Vorgesetzten dienstrechtlich vorzuhalten. Die Präsidentin des SG Hannover, Frau Beyer vertritt die davon abweichende, offensichtlich amtspflichtwidrige Ansicht, sie müsse statistisch nicht überlasteten und keine Überlastung anzeigenden, aber trotzdem verzögernden Richtern (z.B. S 35 KA 34/11; S 35 KA 46/11 u.a.) deren verzögernde Verfahrensführung nicht dienstrechtlich vorhalten, für die das Land Niedersachsen Verzögerungsentschädigungen aus Steuermitteln bezahlen muss. Die Präsidentin Frau Beyer verletzt dadurch offensichtlich selber pflichtwidrig ihre Amtspflicht aus § 839 Abs 2 S 2 BGB.
Merke:
Dass strittige Rechtsverhältnisse oder staatliche Beschuldigungen in angemessener Zeit abschließend geklärt werden, ist keine Besonderheit des deutschen Rechts, sondern eine Selbstverständlichkeit des gem. Art 25 Abs 2 GG über deutschem Recht stehenden allgemeinen Völkerrechts, das von den Vereinten Nationen im von ca. 170 Ländern anerkannten Internationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte niedergeschrieben und in die Europäische Menschenrechtskonvention inhaltlich übernommen wurde.
Es gibt in Deutschland zwei Rechtsgrundlagen, aus denen Rechtsansprüche der Schäden, die wegen langer Verfahren entstanden sind, hergeleitet werden können.
Eine Rechtsgrundlage ist relativ neu und erst auf ausdrückliche Anweisung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) im Jahre 2010 in Deutschland zustande gekommen. Sie besteht in den §§ 198 ff GVG, die nicht von Art 6 EMRK und der RSpr des EGMR abweichend angewendet werden dürfen. Man kann sich also direkt an die umfassende RSpr des EGMR halten.
Die andere Rechtsgrundlage besteht seit langer Zeit im § 839 Abs 2 Satz 2 BGB.
Die §§ 198 ff GVG regeln Verzögerungsschäden ohne Rücksicht darauf, ob sie auf Verschulden oder Rechtswidrigkeit beruhen.
Ob die Anwendung der §§ 198 ff GVG durch deutsche Gerichte so geschieht, wie es der EMRK entspricht und sich das der EGMR vorgestellt und angeordnet hat, dürfte zu bezweifeln sein.
Wenngleich auch § 839 Abs 2 Satz 2 BGB keine (durch ein Strafurteil festgestellte) Rechtswidrigkeit voraussetzt, dürften Verzögerungen stets auf rechtswidriger Amtsführung beruhen; denn die unverzögerte Sachbehandlung ist eine Amtspflicht, und die Nichteinhaltung von Amtspflichten ist stets rechtswidrig. Das heißt, dass jede unangemessene Verfahrensdauer rechtswidrig sein dürfte.
Kurz: Ansprüche können unabhängig voneinander auf die §§ 198 ff GVG und den § 839 Abs 2 Satz 2 BGB gestützt und parallel rechtshängig geltend gemacht werden. Eine Überkompensation des Schadens darf nicht stattfinden.
2. Grenzen der Auslegung
2.1 Pflicht zu strikt EGMR-konformer Rechtsanwendung
Der von ca. 170 Staaten ratifizierte Internationale Pakt der bürgerlichen und politischen Rechte der Vereinten Nationen (IPbürg – siehe BGBl 1973 II, 1553) fasst das zusammen, was die Weltgemeinschaft als allgemeinen Standard des Völkerrechts ansieht, der in Deutschland gem. Art 25 GG über dem Bundesrecht steht. Das im allgemeinen Völkerrecht enthaltene – als von Kant »Weltbürgerrecht« genannte Abkehr von der »Rohigkeit, Ungeschliffenheit und viehischen Abwürdigung der Menschlichkeit« der »gesetzlosen Freiheit der Wilden«, einem »verworfenen Zustand« – sich ständig weiter ausformende allgemeine Menschenrecht ist »keine phantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des ungeschriebenen Kodex …und des Staatsrechts.« (Kant, Vom Völkerrecht) Deutsche Behörden und Gerichte sind verfassungsrechtlich verpflichtet, den allgemeinen Völkerrechtsstandard zu garantieren. Nationale Gesetze können keine Grundlage für die Nichteinhaltung des Völkerrechts oder Völkervertragsrechts sein. (siehe auch: Art 27 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23.5.1969) Erst Recht kann die Rechtsprechung nicht völkerrechtswidrig ausgestaltet werden.
Aufgrund des Völkerrechts hat Jeder u.a. die Möglichkeit einer wirksamen Beschwerde (Art 2 Abs 3 IPbürg) und des Weiteren hat Jedermann einen Anspruch darauf, dass über eine strafrechtliche Anklage oder zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen in billiger Weise verhandelt wird. In »billiger Weise« heißt auch in angemessener Zeit.
Dieser Völkerrechtsstandard (IPbürg und inhaltsgleiche EMRK) geht Bundesrecht (§ 198 ff GVG) vor:
»Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts …gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebiets.« (Art 25 Satz 2 Grundgesetz – GG)
Der Europarat hat den von den Vereinten Nationen im IPbürg niedergeschriebenen allgemeinen Völkerrechtsstandard (hier: auf »billige« Verfahren sowie eine Beschwerdemöglichkeit) in Art 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention – EMRK (wirksame Beschwerde) und Art 6 EMRK (Recht auf ein faires Verfahren in angemessener Zeit) inhaltlich übernommen. Die Art 13 EMRK und Art 6 EMRK verkörpern damit einen allgemeinen Völkerrechtsstandard, der gem. Art 25 Satz 2 dem Bundesrecht vorgeht. Für andere Artikel der EMRK mag anderes gelten, nämlich, dass sie gem. Art 59 GG im Range von Bundesgesetzen stehen, sofern sie kein allgemeines Völkerrecht verkörpern. Verkörpern sie hingegen allgemeines Völkerrecht, gilt Art 25 Abs 2 GG.
Die den allgemeinen Völkerrechtsstandard verkörpernden Art 6 und 13 EMRK stehen damit – wegen ihres völkerrechtlichen Gehalts – im Normenrange über dem Bundesrecht, was deutsche Gerichte gem. Art 25 Satz 2 GG strikt zu beachten verpflichtet sind. Dabei ist auch zu beachten, dass zu den Völkerrechtsnormen verkörpernden Art 13 EMRK und Art 6 EMRK eine umfangreiche rechtskräftige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) vorliegt, die folglich nicht unbeachtet bleiben kann und gegen welche keine deutschen Urteile ergehen können (Art 27 des Wiener Übereinkommens …a.a.O.), sondern die von deutschen Behörden und Gerichten zu beachten und anzuwenden ist.
Die Existenz eines allgemeinen Prinzips, das den richterlichen Willen beeinflusst, heißt Gebot. Die Formel des Gebots ist der Imperativ. Das hat auch der EGMR ausdrücklich festgestellt
»Deutsche Gerichte müssen bei ihren Entscheidungen über Entschädigungsansprüche das Recht so anwenden, wie es der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte entspricht.« (EGMR v 29.5.2012, 53126/07, § 39 – Taron/Deutschland)
Das heißt klipp und klar: deutsche Gerichte sind nicht frei, wie sie entscheiden wollen, sondern der EGMR hat Deutschland expressis verbis vorgeschrieben, dass die deutschen Gerichte die §§ 198 GVG so anwenden müssen, wie es der RSpr des EGMR entspricht. Damit bestehen wegen der inzwischen mehrere zehntausend Urteile zu Art 6 EMRK umfassenden RSpr des EGMR praktisch kaum noch Auslegungsspielräume; jedenfalls nicht in der Vielzahl der vom EGMR entschiedenen Punkte. Die konventionswidrige Auffassung eines der höchsten deutschen Gerichte:
»Bei den Entschädigungsregelungen des § 198 GVG handelt es sich um einen autonomen Teil des Bundesrechts, der unabhängig neben den menschen- und grundrechtlichen Garantien steht. Die einfachgesetzlichen Vorschriften sind daher …auszulegen« (BSG U v 10.7.2014, B 10 ÜG 8/13 R, II, 3,b))
ist daher völlig unverständlich und hochgradig abwegig. Offensichtlich wollen manche Gerichte und Landesregierungen sich weiterhin um die Verpflichtung herumdrücken, das Entschädigungsrecht so anzuwenden, wie es der EGMR tut (siehe: Taron/Deutschland, a.a.O. § 39), indem sie die EMRK anders »auslegen« (besser gesagt: »unterlaufen«), als der EGMR dies in seinem quasi erschöpfenden case-law getan hat. In Wahrheit müsste man lange suchen, weil es fast Nichts gibt, was der EGMR noch nicht entschieden hätte. Es sind alle wesentlichen Punkte geklärt und es gibt überhaupt keine grundsätzlichen Auslegungsfragen mehr; es existieren allenfalls noch zu höchst speziellen Einzelsachverhalten seltene marginale Einzelfragen, die auszulegen sein könnten. Alles Wesentliche ist bereits vom EGMR geklärt, wie die fachkundigen unter den Gerichten auch richtig erkannt haben; denn:
»Die gesetzliche Regelung des § 198 GVG nimmt praktisch die schon jahrelang bestehende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auf. Mit anderen Worten, bei der Prüfung, der Angemessenheit der Verfahrensdauer sind gerade keine schwierigen Rechtsfragen zu lösen, sondern vielmehr die ständige und gefestigte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte anzuwenden.« (LSG Baden-Württemberg, Beschl. v 22.1.2012, 23 SchH 3/13 <9>)
Dass trotz dieser ebenso einfachen wie klaren und richtigen Aussage die oben zitierte Falschauffassung des BSG von manchen Landesgerichten blind nachgebetet wird:
»Dem kann der Kläger nicht die von ihm zutreffend zitierte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte entgegenhalten. (…) Das deutsche Recht hat indessen mit § 198 GVG eine eigenständige, von § 198 GVG unabhängige Regelung getroffen.« (LSG Nds, U v 10.11.2016, L 10 SF 38/14 EK KA – Thommes, Dürre, Dr. Dietrich)
drückt eine eindeutig völkerrechts- menschenrechts- und grundrechtswidrige Haltung aus und verwundert jedenfalls bei solchen Gerichten und Landesregierungen nicht, die offensichtlich bemüht sind, durch konventionswidrige »Auslegungen« die Regelungen des Art 6 EMRK in der für deutsche Gerichte maßgeblichen Auslegung des EGMR zu unterlaufen. Solche Auffassungen deutscher Gerichte missachten durch ihre Behauptung, es handele sich um autonomes Recht nicht nur ausdrücklich um die Pflicht, bei den Entscheidungen über Entschädigungsansprüche das Recht so anzuwenden, wie es der RSpr des EGMR entspricht, sondern verkennen auch noch in grober Weise die Tatsache, dass es nicht um autonomes Recht, sondern um (von ca. 170 Ländern im Internationalen Pakt bürgerlicher und politischer Rechte der Vereinten Nationen anerkanntes) allgemeines Völkerrecht geht, das lediglich in die EMRK übernommen wurde und das in Deutschland im Normenrange über deutschem Bundesrecht steht. (Art 25 Abs 2 GG) Solche Richter wissen schlicht und einfach nicht, dass nationale Gesetze niemals die Grundlage für die Nichteinhaltung von Völkerrecht oder von Völkervertragsrecht sein können. (siehe auch: Art 27 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23.5.1969)
Kommt es trotz des umfangreichen case-law des EGMR dennoch in äußerst wenigen möglicherweise verbliebenden unwesentlichen Fallkonstellationen zu Fragen, zu denen sich der EGMR noch nicht geäußert hat, so muss eine Auslegung im Sinne des EGMR erfolgen. Die Auslegung darf – und zwar nur dann, wenn überhaupt auslegungsbedürftige Lücken bestehen – nicht EGMR-widrig sein; das wäre eine rechtswidrige Auslegung »contra legem«. Sie muss stattdessen im Sinne des EGMR so erfolgen, dass sie keine theoretischen oder scheinbaren, sondern praktische und wirksame Rechte gewährt.
»In this connection it should reiterated that the Convention is intended to guarantee not theoretical or illusory rights, but rights that are practical and effective. (EGMR,42527/95, § 45 – Prinz Hans Adam von Liechtenstein/Deutschland)« EGMR, GK v 29.3.2006, 62361/00, § 82 – Riccardi Pizzati/Italien)
Die Auslegung hat – wenn sie denn überhaupt erforderlich ist, weil hierzu keinerlei case-law des EGMR existiert; nur dann (!) – sich des Weiteren am (konventionsrechtlich ausgelegten) Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes und der wirksamen Beschwerde unter Beachtung der auch im Konventionsrecht geltenden Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, Gleichmäßigkeit und des Vertrauensschutzes zu orientieren. Wenn trotz der umfangreichen Rechtsprechung des EGMR, die deutsche Gerichte so anzuwenden verpflichtet sind, wie es der EGMR tut, in einem sehr seltenen Ausnahmefall überhaupt noch Auslegungsprobleme entstehen sollten, ist zu beachten:
Grundsätzlich muss die Auslegung von Normen – hier der §§ 198 GVG – »nach objektiven Kriterien erfolgen und dabei vor Allem den Wortlaut, den Zweck und die systematische Stellung berücksichtigen. (vgl. nur: Hüffer, AktG 13. Aufl. § 23 RN 39).« (LG München I, Beschl. v 27.2.2017, 5 HK O 14748/16 <15>)