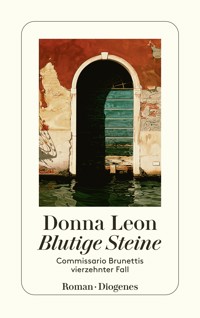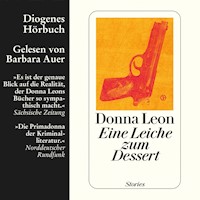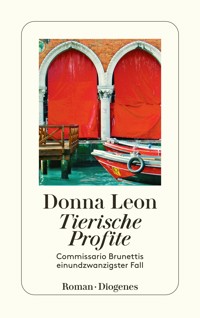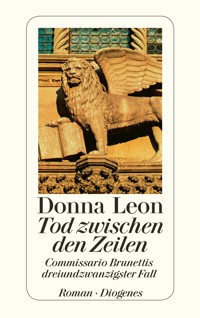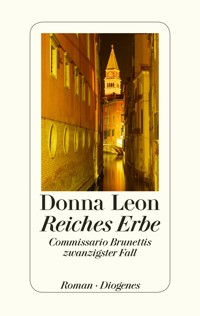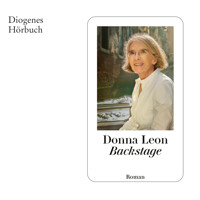9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
»Lasset die Kinder zu mir kommen, und wehret ihnen nicht« – so steht es in der Bibel. Die Wirklichkeit sieht anders aus: Bambini sind knapp, auch im kinderlieben Italien. Was ist geschehen, wenn schwerbewaffnete Carabinieri die Wohnung eines Kinderarztes stürmen und ihm sein 18 Monate altes Baby entreißen? Brunetti gibt keine Ruhe, bis er die Hintergründe kennt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Donna Leon
Lasset die Kinder zu mir kommen
Commissario Brunettis sechzehnter Fall
Roman Aus dem Amerikanischen von
Titel des Originals:
›Suffer the Little Children‹
Die deutsche Erstausgabe
erschien 2008 im Diogenes Verlag
Das Motto aus: Mozart, Die Zauberflöte
Text von Emanuel Schikaneder,
hrsg. von Kurt Soldan. Leipzig: Peters 1932
Covermotiv: Foto von Rita Crane (Ausschnitt)
Copyright © Rita Crane/ritacranestudio.com
Für Ravi Mirchandani
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24011 5
ISBN E-Book 978 3 257 60075 9
Welche Freude wird das sein, wenn die Götter uns bedenken, unsrer Liebe Kinder schenken,
[7] 1
»…und dann hat meine Schwiegertochter mich bekniet, damit ich in die Questura komme und es Ihnen melde. Ich wollte eigentlich nicht, und mein Mann sagte, ich wär schön blöd, wenn ich mich mit Ihnen einließe, weil das nur Scherereien brächte, und davon hätte er im Moment weiß Gott genug. Es würde genauso enden wie damals, hat er mir prophezeit, als der Nachbar von seinem Onkel dem die ENEL-Leitung angezapft und ihm den Strom geklaut hatte. Der Onkel hat die Polizei alarmiert, aber als die dann kam, haben sie ihm gesagt, er muß –«
»Verzeihen Sie, Signora, aber könnten wir wieder auf das zurückkommen, was letzten Monat passiert ist?«
»Ja doch, natürlich, es ist nur so, daß er, also der Onkel, am Ende um dreihunderttausend Lire ärmer war.«
»Signora!«
»Also meine Schwiegertochter hat gesagt, wenn ich’s nicht mache, dann würde sie selber anrufen. Und da schließlich ich diejenige war, die’s gesehen hat, ist es wohl besser, Sie hören’s von mir, nicht wahr?«
»Gewiß.«
»Ja, und als das Radio heute morgen Regen ansagte, da habe ich Schirm und Stiefel an der Tür bereitgestellt, für alle Fälle. Aber dann hat’s doch nicht geregnet, stimmt’s?«
»Nein, Signora. Aber wollten Sie mir nicht von ungewöhnlichen Vorkommnissen berichten, die Sie in der Wohnung gegenüber beobachtet haben?«
[8] »Ja, dieses Mädchen.«
»Was für ein Mädchen, Signora?«
»Na, das junge Ding, die Schwangere.«
»Wie jung war sie Ihrer Meinung nach, Signora?«
»Ach, siebzehn vielleicht, oder etwas älter, kann aber auch jünger gewesen sein. Ich habe zwei Söhne, wissen Sie. Also wenn’s ein Junge gewesen wäre, hätte ich mich ausgekannt, aber es war nun mal ein Mädchen.«
»Und Sie sagten, daß die junge Frau schwanger war, Signora?«
»Ja, und stand kurz vor der Geburt. Darum habe ich’s ja meiner Schwiegertochter erzählt, und die meinte, ich müsse kommen und es Ihnen melden.«
»Daß sie schwanger war?«
»Daß sie entbunden hat.«
»Aber wo denn, Signora?«
»Na, gleich bei mir gegenüber, in unserer calle. Also natürlich nicht draußen auf der Gasse, sondern in der Wohnung auf der anderen Straßenseite. Von mir aus liegt die ein wenig versetzt, eigentlich schon auf der Höhe vom Nebenhaus, aber weil das Gebäude ein bißchen vorsteht, kann ich in die Fenster schauen, und da habe ich sie gesehen.«
»Wo ist das genau, Signora?«
»Calle dei Stagneri. Kennen Sie bestimmt. In der Nähe von San Bortolo, die calle, die zum Campo della Fava führt. Ich wohne auf der rechten Seite, und das Mädchen war links, auf derselben Seite wie die Pizzeria, nur, genau wie ich, weiter unten, schon fast an der Brücke. Früher gehörte die Wohnung einer alten Frau – ihren Namen weiß ich nicht mehr –, aber als die gestorben war, erbte ihr Sohn, [9] und der vermietet die Räume unter der Hand, wochen- oder monatsweise: an Ausländer, wie das heute so üblich ist, Sie wissen ja.
Als das Mädchen drüben auftauchte und ich sah, daß sie schwanger war, dachte ich, er würde jetzt vielleicht offiziell vermieten, also mit Vertrag und allem Drum und Dran. Und wenn die Kleine ein Kind bekam, dann war sie doch wohl eine von uns und keine Touristin, oder? Kurzfristig zu vermieten rentiert sich allerdings bestimmt mehr, besonders an Ausländer. Und dann spart man sich ja auch die…
Oh, tut mir leid. Das gehört wohl nicht hierher, wie? Also wie ich schon sagte, sie war schwanger: Deshalb dachte ich zuerst, er hat vielleicht an ein junges Paar vermietet, bis ich feststellte, daß nie ein Mann bei ihr war.«
»Und die junge Frau, wie lange hat sie denn dort gewohnt, Signora?«
»Oh, höchstens eine Woche. Aber lange genug, daß ich ihre Gewohnheiten kennenlernen konnte.«
»Und könnten Sie mir die schildern?«
»Ihre Gewohnheiten?«
»Ganz recht.«
»Nun ja, allzuoft habe ich sie nicht gesehen. Nur wenn sie am Fenster vorbei in die Küche ging. Nicht, daß sie je was gekocht hätte, zumindest habe ich nichts davon mitbekommen. Aber ich kenne ja die übrige Wohnung nicht; keine Ahnung, was sie dort gemacht hat. Ich vermute mal, sie hat einfach gewartet.«
»Gewartet?«
»Ja, auf das Baby. Kinder entscheiden selbst, wann sie zur Welt kommen.«
[10] »Ich verstehe. Hat die junge Frau Sie denn je bemerkt, Signora?«
»Nein. Ich habe Vorhänge, wissen Sie, aber da drüben gibt’s keine. Die calle ist ja auch so dunkel, daß man sich eigentlich nicht gegenseitig in die Fenster schauen kann. Doch vor etwa zwei Jahren oder wann immer es war, haben sie eine dieser neumodischen Straßenlaternen genau bei uns gegenüber aufgestellt, und seitdem ist es dort nachts immer ganz hell. Ich weiß nicht, wie die Leute das ertragen. Wir schlafen bei geschlossenen Fensterläden, aber wenn man keine hat, kann ich mir nicht vorstellen, wie man so seine Nachtruhe findet, Sie vielleicht?«
»Keine Ahnung, Signora. Sie sagten, Sie hätten den mutmaßlichen Ehemann nie gesehen. Aber waren vielleicht irgendwann andere Personen bei der jungen Frau drüben?«
»Manchmal. Allerdings immer nur nachts. Na ja, so nach dem Abendessen, auch wenn ich sie, wie gesagt, nie habe kochen sehen. Aber irgendwas muß sie sich wohl gemacht haben, oder? Es sei denn, sie bekam die Mahlzeiten geliefert. Schwangere müssen schließlich essen. Also ich habe geschlungen wie ein Wolf, als meine Jungs unterwegs waren. Deshalb bin ich sicher, daß auch sie gegessen hat, bloß habe ich sie eben nie kochen sehen. Aber man kann eine schwangere Frau nicht einfach in irgendeiner Wohnung abstellen, ohne sie zu verköstigen, oder?«
»Gewiß nicht, Signora. Und wen haben Sie nun bei der jungen Frau in der Wohnung beobachtet?«
»Manchmal kamen abends Männer, setzten sich um den Küchentisch und redeten. Bei offenem Fenster, weil sie geraucht haben.«
[11] »Wie viele Männer, Signora?«
»Drei. Sie saßen in der Küche am Tisch, unter der Lampe, und unterhielten sich.«
»Auf italienisch, Signora?«
»Lassen Sie mich nachdenken. Ja, sie haben italienisch gesprochen, aber es waren keine von uns. Keine Venezianer, meine ich. Den Dialekt habe ich zwar nicht erkannt, aber Veneziano war es auf keinen Fall.«
»Und diese Männer haben einfach nur dagesessen und geredet?«
»Ja.«
»Und die junge Frau?«
»Die habe ich nie gesehen, wenn die Männer da waren. Manchmal kam sie hinterher – nachdem die drei gegangen waren – in die Küche, vielleicht um sich ein Glas Wasser zu holen. Zumindest sah ich sie dann am Fenster.«
»Aber Sie haben nicht mit ihr gesprochen?«
»Nein. Ich hatte, wie gesagt, nie mit ihr oder diesen Männern zu tun. Ich habe die Kleine nur beobachtet und gehofft, sie würde tüchtig essen. Als ich mit Luca und Pietro schwanger war, da habe ich andauernd gegessen; ständig hatte ich so einen Heißhunger. Zum Glück habe ich aber nie übermäßig zugenommen, so daß –«
»Haben die Männer drüben gegessen, Signora?«
»Wie bitte? Nein, also ich kann mich nicht erinnern. Komisch nicht, jetzt, wo Sie mich drauf bringen? Getrunken haben sie auch nichts. Saßen bloß da und redeten, als ob sie auf ein Vaporetto warten würden oder so. Wenn sie weg waren, ging das Mädchen manchmal in die Küche, doch sie hat nie Licht gemacht. Das war schon merkwürdig: Sie hat [12] nachts nie Licht gemacht, in der ganzen Wohnung nicht, soweit ich es mitbekam. Die Männer sah ich abends am Küchentisch sitzen, aber das Mädchen habe ich nur bei Tag gesehen und nachts höchstens dann, wenn sie mal an einem Fenster vorbeiging.«
»Und was geschah dann weiter?«
»Eines Nachts hörte ich sie ganz laut rufen, aber ich habe nichts verstanden. Eins der Wörter war vielleicht mamma, doch sicher bin ich mir nicht. Und dann hörteich ein Baby schreien. Sie wissen, wie ein Neugeborenes klingt? Das ist mit nichts auf der Welt zu vergleichen. Ich weiß noch genau, als Luca zur Welt kam…«
»War sonst noch jemand dort?«
»Was? Wann?«
»Bei der Geburt.«
»Also gesehen habe ich niemanden, wenn Sie das meinen, aber irgend jemand muß dagewesen sein. Man kann so ein junges Ding schließlich nicht mutterseelenallein entbinden lassen, nicht wahr?«
»Haben Sie sich seinerzeit mal gefragt, Signora, warum das Mädchen allein dort wohnte?«
»Oh, ich weiß nicht. Ich dachte wohl, ihr Mann würde irgendwo auf dem Festland arbeiten oder sie hätte vielleicht gar keinen. Ja, und dann kam das Kind vermutlich so schnell, daß sie es nicht mehr ins Krankenhaus geschafft hat.«
»Aber die Klinik ist doch nur ein paar Minuten von dort entfernt, nicht wahr, Signora?«
»Ich weiß, ich weiß. Doch es kommt schon mal vor, daß es einschlägt wie der Blitz. Meine beiden Söhne haben sich [13] ja viel Zeit gelassen, aber ich weiß von Frauen, bei denen hat’s nur eine halbe oder höchstens eine Stunde gedauert. Also dachte ich, bei ihr sei’s auch so schnell gegangen. Jedenfalls hörte ich erst sie, gleich darauf das Baby, und danach war alles still.«
»Und was geschah dann, Signora?«
»Am Tag darauf oder vielleicht auch erst am übernächsten – ich erinnere mich nicht mehr – sah ich eine andere Frau am offenen Fenster stehen und in ein telefonino sprechen.«
»Auf italienisch, Signora?«
»Auf italienisch? Warten Sie – ja, doch, es war Italienisch.«
»Und was hat Sie gesagt?«
»So was wie: ›Alles bestens. Wir sehen uns morgen in Mestre.‹«
»Könnten Sie diese Frau beschreiben, Signora?«
»Sie meinen, wie sie aussah?«
»Ja.«
»Oh, lassen Sie mich nachdenken. Also sie war ungefähr so alt wie meine Schwiegertochter. Die ist achtunddreißig. Dunkle Haare, kurz geschnitten. Groß, wie meine Schwiegertochter, aber vielleicht nicht ganz so schlank. Allerdings habe ich sie, wie gesagt, nur diese eine Minute gesehen, während sie telefonierte.«
»Und dann?«
»Und dann waren sie fort. Tags darauf war niemand mehr in der Wohnung, und die nächsten paar Wochen habe ich keinen Menschen drüben gesehen. Die waren einfach auf und davon.«
[14] »Wissen Sie, ob von Ihren Nachbarn jemand diese Vorgänge bemerkt hat, Signora?«
»Nur der spazzino. Eines Tages bin ich ihm begegnet, und er sagte, es muß jemand drin sein, in der Wohnung, weil nämlich jeden Morgen ein Müllsack vor der Tür steht. Aber er habe nie jemanden reingehen oder rauskommen sehen.«
»Hat Sie vielleicht aus der Nachbarschaft jemand auf die schwangere Frau angesprochen?«
»Nein, das nicht. Aber ich denke schon, daß der eine oder andere was gehört oder sonstwie mitbekommen hat, daß da wer drin war, in der Wohnung.«
»Und Sie, Signora? Haben Sie mit jemandem darüber gesprochen?«
»Eigentlich nicht. Nur mit meinem Mann, aber der hat gesagt, ich soll mich da raushalten, das geht uns nichts an. Ich weiß nicht, was er tun würde, wenn er wüßte, daß ich jetzt hier bin. Wir hatten noch nie mit der Polizei zu tun, das bringt doch immer nur Ärger… Oh, verzeihen Sie. Ich hab’s nicht so gemeint, aber Sie wissen ja, wie das ist, also wie die Leute denken.«
»Ja, Signora, ich weiß. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein?«
»Nein, eigentlich nicht.«
»Glauben Sie, daß Sie das Mädchen wiedererkennen würden?«
»Vielleicht. Aber die Schwangerschaft verändert uns so sehr, besonders zum Schluß, kurz vor der Geburt. Bevor Pietro zur Welt kam, sah ich aus wie –«
»Wie steht’s mit den Männern, Signora? Würden Sie einen von denen wiedererkennen?«
[15] »Könnte sein, ja, vielleicht. Aber vielleicht auch nicht.«
»Und die Frau mit dem telefonino?«
»Nein, eher nicht. Die stand ja bloß eine Minute dort am Fenster, und noch dazu seitwärts, als ob sie drinnen in der Wohnung etwas im Auge behalten wollte. Nein, die würde ich wohl nicht wiedererkennen.«
»Fällt Ihnen sonst noch etwas ein, das vielleicht wichtig sein könnte?«
»Nein, ich glaube nicht.«
»Dann danke ich Ihnen für Ihren Besuch, Signora.«
»Ich wäre nicht gekommen, wenn meine Schwiegertochter mir nicht so zugesetzt hätte. Wissen Sie, ich hatte ihr erzählt, wie merkwürdig es drüben zuging, mit den Männern und dem Mädchen, das kein Licht machte und alles. Es war einfach Gesprächsstoff, verstehen Sie. Aber als die Kleine dann ihr Baby bekam und hinterher plötzlich alle verschwunden waren, also da hat meine Schwiegertochter gesagt, ich müßte herkommen und Ihnen das melden. Sie meint, ich könnte Scherereien kriegen, falls irgendwas passiert und Sie rausfinden, daß ich das Mädchen dort gesehen und alles für mich behalten habe. So ist sie nun mal, meine Schwiegertochter, ständig in Sorge, daß sie was falsch machen könnte. Oder in dem Fall ich.«
»Verstehe. Ich glaube, sie hat Ihnen das Richtige geraten.«
»Mag sein. Ja, wahrscheinlich ist es gut, daß ich Ihnen Bescheid gesagt habe. Wer weiß, was dahintersteckt, hm?«
»Haben Sie nochmals Dank für Ihre Mühe, Signora. Der Inspektor wird Sie hinunterbringen.«
»Danke. – Ähm…?«
[16] »Ja, Signora?«
»Mein Mann braucht doch nicht zu wissen, daß ich hier war, oder?«
»Von uns erfährt er’s bestimmt nicht, Signora.«
»Danke. Denken Sie bitte nicht schlecht von ihm, aber er möchte nun mal nicht, daß wir in irgendwas hineingezogen werden.«
»Das verstehe ich nur zu gut, Signora. Sie können sich darauf verlassen, daß Ihr Mann nichts erfahren wird.«
»Ich danke Ihnen. Und guten Tag.«
»Guten Tag, Signora. – Inspektor Vianello, würden Sie die Signora zum Ausgang begleiten?«
[17] 2
Gustavo Pedrolli lag an den Rücken seiner Frau geschmiegt und glitt sanft hinüber in den Schlaf der Gerechten. Noch schwebte er in jener nebelhaften Sphäre zwischen Wachen und Traum und zögerte, sein beglückendes Hochgefühl dem profanen Schlaf zu opfern. Der Tag hatte ihm eine bisher nie gekannte Empfindung beschert, und er mochte die leuchtende Erinnerung daran noch nicht loslassen. Er versuchte sich zu entsinnen, wann er je so glücklich gewesen war. Vielleicht als Bianca eingewilligt hatte, ihn zu heiraten, oder an ihrem Hochzeitstag, als Santa Maria dei Miracoli im weißen Blumenschmuck prangte und er, sobald Bianca aus der Gondel stieg, die Stufen des Landungsstegs hinuntereilte, um ihre Hand in die seine und sie zur Frau zu nehmen, für immer.
Gewiß, er hatte auch früher schon glückliche Momente erlebt – den erfolgreichen Abschluß seines Medizinstudiums, als er endlich un dottore war, oder die Ernennung zum stellvertretenden Leiter der Pädiatrie –, aber diese Art von Glück reichte bei weitem nicht an die überbordende Freude heran, die ihm heute abend zuteil wurde, als er Alfredo vor dem Essen gebadet hatte. Mit geübtem Griff hatte er seinem Sohn die Windel angelegt und ihm die flauschige Pyjamahose angezogen. Dann streifte er ihm das mit gelben Entchen bedruckte Oberteil über den Kopf, und als der wieder zum Vorschein kam, war das der Auftakt für ihr allabendliches Spiel: Beide suchten eifrig nach den Händen [18] des Kindes, die Gustavo schließlich eine nach der anderen aus den Ärmeln zog. Alfredo quietschte vor Vergnügen und staunte wie sein Vater beim Anblick der winzigen Finger, die aus den Armlöchern hervorlugten.
Gustavo faßte den Kleinen um die Taille, stemmte ihn hoch und ließ ihn wieder nach unten gleiten, und Alfredo ruderte dazu im Takt mit den Armen. »Und wer ist ein Prachtjunge? Wer ist papàs Liebling?« fragte Gustavo. Worauf Alfredo wie immer eins dieser wunderbaren Fäustchen emporhob, einen Finger ausstreckte und sich an die eigene Nase tippte. Die dunklen Augen aufmerksam auf den Vater gerichtet, drückte er sein breites Näschen platt; dann nahm er den Finger weg, zeigte aber noch mehrmals auf sich, warf die Arme in die Luft und jauchzte vor Vergnügen.
»Stimmt genau, Alfredo ist papàs Liebling, papàs Liebling, papàs Liebling!« Und wieder wurde der Kleine hochgehoben, herumgeschwenkt und wedelte dazu mit den Armen. Nur in die Luft warf Gustavo das Baby nicht, denn Bianca fand, das Kind rege sich zu sehr auf, wenn sie vor dem Schlafengehen gar so wild herumtollten. Also schwenkte er den Kleinen nur immer wieder hoch und runter und zog ihn zwischendurch an sich, um ihn auf die Nasenspitze zu küssen.
Schließlich brachte er seinen Sohn ins Kinderzimmer, wo über dem Bettchen Scharen von Tieren und Fabelwesen schwebten. Auch auf der Kommode war eine ganze Menagerie versammelt. So sanft und behutsam, wie es mit Rücksicht auf den zarten Brustkorb des Kleinen geboten war, drückte Gustavo ihn an sich. Alfredo zappelte, und [19] Gustavo barg sein Gesicht in den weichen Nackenfalten seines Sohnes.
Der Vater ließ seine Hände nach unten gleiten und hielt den Jungen auf Armeslänge von sich. Und da er einfach nicht genug bekommen konnte, fragte er noch einmal mit trällernder Stimme: »Und wer ist papàs Liebling?« Wieder faßte Alfredo sich an die Nase, und Gustavo schmolz schier das Herz. Die zarten Fingerchen fuhren durch die Luft, bis eines auf Gustavos Nasenspitze landete und der Kleine etwas lallte, das wie papà klang. Dazu ruderte er mit den Armen und zeigte sein täppisches, zahnloses Lächeln.
Es war das erste Mal, daß Gustavo dieses Wort aus dem Mund seines Sohnes gehört hatte, und vor lauter Rührung griff er sich mit flatternder Hand ans Herz. Durch diese unwillkürliche Bewegung verlor Alfredo den Halt und taumelte gegen seine Schulter. Zum Glück hatte Gustavo die Geistesgegenwart und auch genügend Erfahrung mit verschreckten Kindern, um einen Scherz daraus zu machen. »Und wer versucht da, in papàs Jacke zu klettern?« Damit drückte er Alfredo an seine Brust und wickelte eine Hälfte seiner Strickjacke um den Rücken des Jungen. Sein lautes Lachen sollte zeigen, was für ein wunderbares neues Spiel das sei.
»O nein, du kannst dich da jetzt nicht verstecken. Auf keinen Fall. Es ist Schlafenszeit.« Gustavo hob den Kleinen hoch und legte ihn auf dem Rücken ins Bettchen. Er zog die Wolldecke nach oben und achtete darauf, daß sie seinem Sohn bis über die Brust reichte.
»Träum schön, mein kleiner Prinz«, sagte er, wie jeden Abend, seit Alfredo hier in seinem Kinderbett schlief. An [20] der Tür blieb er noch einmal stehen, aber nur ganz kurz, damit der Junge sich nicht etwa angewöhnte, den Abschied vom Vater hinauszuzögern. Während er ein letztes Mal auf das kleine Bündel blickte, wurden ihm die Augen feucht. Doch da es ihm peinlich gewesen wäre, sich so vor seiner Frau zu zeigen, wischte er die Tränen fort, ehe er sich von der offenen Tür abwandte.
Als er in die Küche kam, goß Bianca gerade die Nudeln ab und hatte ihm den Rücken zugewandt. Gustavo machte den Kühlschrank auf und nahm einen Moët & Chandon aus dem untersten Fach. Er stellte die Flasche auf den Küchentresen und holte zwei geschliffene Sektflöten von dem Zwölferset aus der Vitrine, das Biancas Schwester ihnen zur Hochzeit geschenkt hatte.
»Champagner?« fragte Bianca freudig überrascht.
»Mein Sohn hat papà zu mir gesagt«, antwortete Gustavo und schälte die Goldfolie vom Korken. Ihrem skeptischen Blick ausweichend, ergänzte er: »Unser Sohn. Aber weil er papà gesagt hat, möchte ich ihn, dieses eine Mal, meinen Sohn nennen. Nur für eine Stunde, okay?«
Sein verklärtes Gesicht hatte etwas so Rührendes, daß Bianca die dampfende Pasta stehenließ und zu ihrem Mann trat. Sie nahm die Gläser vom Tisch und hielt sie ihm hin. »Schenk bitte ein, damit wir auf deinen Sohn anstoßen können.« Dann beugte sie sich vor und küßte ihn auf den Mund.
Wie damals, in den ersten Tagen ihrer Ehe, wurde die Pasta in der Spüle kalt, und sie tranken den Champagner im Bett. Lange nachdem die Flasche leer war, tappten sie nackt und mit knurrendem Magen in die Küche. Sie verschmähten die eingetrocknete Pasta und löffelten statt [21] dessen, an den Tresen gelehnt, die Tomatensauce auf dicke Brotscheiben, mit denen sie sich gegenseitig fütterten und die sie mit einer halben Flasche Pinot Grigio hinunterspülten. Dann gingen sie zurück ins Schlafzimmer.
Erschöpft hing Gustavo der Erinnerung an diesen schönen Abend nach und wunderte sich, wieso er in den letzten Monaten befürchtet hatte, Bianca habe sich verändert in ihrer… ja, worin? Er wußte aus seiner Praxis, daß es ganz natürlich war, wenn eine Mutter kurz nach der Geburt eines Kindes aus dem Gleichgewicht geriet und sich vorübergehend scheinbar nicht mehr für den Vater interessierte. Doch mit dieser Nacht, in der sie sich beide aufführten wie zwei wildgewordene Teenager, die gerade für sich den Sex entdeckt hatten, waren alle Unsicherheiten verflogen.
Und er hatte dieses Wort gehört: Sein Sohn hatte ihn papà genannt. Wieder wollte Gustavo das Herz übergehen, und er schmiegte sich fester an Bianca, in der leisen Hoffnung, daß sie aufwachen und sich ihm zuwenden würde. Doch sie schlief weiter, und er dachte an den nächsten Morgen und den Frühzug nach Padua, den er erreichen mußte, weshalb er sich auf Schlaf polte, nun bereit, in dessen sanftes Reich hinüberzugleiten und vielleicht von einem zweiten Sohn zu träumen oder von einer Tochter oder von beiden.
Vage bemerkte er ein Geräusch jenseits der Schlafzimmertür und strengte sich an, hinzuhören, festzustellen, ob Alfredo weinte oder nach ihm rief. Aber da war der hallende Ton schon verklungen, und so ließ er sich wieder fallen; seine Lippen kräuselten sich, in Erinnerung an jenes Wort, zu einem Lächeln.
Als Dottore Gustavo Pedrolli in den ersten Tiefschlaf [22] dieser Nacht sank, kam das Geräusch wieder, aber weder er hörte es, noch seine Frau, die nackt, erschöpft und liebessatt neben ihm schlummerte, noch das glückselige Kind im anderen Zimmer, das vielleicht von dem wunderbaren, heute abend erlernten neuen Spiel träumte, bei dem der Kleine in der Obhut des Mannes, von dem er jetzt wußte, daß es sein papà war, ein sicheres Versteck fand.
Die Zeit verrann, und Träume gaukelten durch die Köpfe der Schlafenden. Sie sahen Schwingungen und Farben; einer von ihnen sah etwas, das einem Tiger ähnelte; und alle drei schliefen weiter.
Bis die Nacht explodierte. Die Wohnungstür barst nach innen und knallte gegen die Wand: Die Klinke rammte ein Loch in den Putz. Ein Mann enterte die Wohnung: Er trug eine Skimaske, einen Tarnanzug, schwere Stiefel und hielt eine Maschinenpistole im Anschlag. Ihm folgte ein zweiter Maskierter in ähnlicher Montur. Hinter den beiden kam ein Hüne in dunkler Uniform, aber ohne Maske. Zwei weitere Männer in der gleichen dunklen Kluft postierten sich draußen vor dem Haus.
Die beiden Maskierten stürmten durchs Wohnzimmer und den Flur entlang zu den Schlafräumen. Der ohne Maske folgte ihnen etwas besonnener. Einer der Maskierten stieß die erste Tür auf, und als er sah, daß sie in ein Bad führte, ließ er sie offen und sprintete den Flur hinunter auf eine weitere, leicht angelehnte Tür zu. Er sah das Kinderbettchen und die Mobiles, die sich in der Zugluft langsam zu drehen begannen.
»Ich hab ihn!« rief der Mann, ohne seine Stimme zu dämpfen.
[23] Der zweite Maskierte hechtete vor die Tür zum Schlafzimmer gegenüber. Mit vorgehaltener Maschinenpistole stürmte er hinein, dicht gefolgt von seinem Kameraden. Das Ehepaar im Bett fuhr hoch, aufgeschreckt von dem Licht im Flur: Der dritte Mann hatte es angeknipst, bevor er das Kinderzimmer betrat.
Die Frau schrie und zog sich die Decke über die Brust. Dottor Pedrolli katapultierte sich so blitzartig aus dem Bett, daß er den ersten Eindringling überrumpelte. Bevor der Maskierte reagieren konnte, hatte der nackte Mann ihn gepackt und trommelte mit einer Faust auf seinen Schädel ein, während die andere seine Nase bearbeitete. Der Eindringling schrie vor Schmerz und ging zu Boden, während Pedrolli seiner Frau zurief: »Ruf die Polizei, ruf die Polizei!«
Der zweite Maskierte bedrohte Pedrolli mit vorgehaltener Waffe. Er sagte etwas, das aber durch die Maske verzerrt wurde, und keiner im Raum konnte ihn verstehen. Pedrolli hätte sowieso nicht auf ihn gehört. Schon stellte er sich ihm mit erhobenen Fäusten kampfbereit entgegen. Der Maskierte reagierte instinktiv. Er zielte mit dem Schaft seiner Waffe auf den Kopf des Gegners und traf ihn über dem linken Ohr.
Die Frau schrie, und aus dem anderen Zimmer antwortete das Baby mit einem Wimmern, jenem hohen, markerschütternden Laut kindlicher Panik. Worauf die Frau die Bettdecke zurückschlug und, ungeachtet ihrer Nacktheit und nur noch ihrem Instinkt folgend, zur Tür rannte.
Sie blieb abrupt stehen, als der Unmaskierte ihr den Weg versperrte, und hob unwillkürlich die Arme, um ihre [24] Brüste zu bedecken. Er, sobald er die Situation erfaßt hatte, sprang rasch neben den Vermummten, der seine Waffe auf den nackten Mann gerichtet hielt, der reglos zu seinen Füßen lag. »Du Idiot!« fauchte er den Maskierten an und verkrallte sich im dicken Stoff seiner Jacke. Er zerrte den Mann im Halbkreis herum und stieß ihn dann so jäh von sich, daß der andere ins Taumeln geriet. Nun wandte er sich mit erhobenen Händen der Frau zu. »Dem Baby geht es gut, Signora. Ihm wird nichts geschehen.«
Sie stand da, vor Panik wie versteinert, und konnte nicht einmal schreien.
Der Maskierte am Boden, der stöhnend und schwankend, wie ein Betrunkener, auf die Füße kam, brach schließlich den Bann. Er fuhr sich mit einer behandschuhten Hand über die Nase und schien, als er sie zurückzog, schockiert vom Anblick des eigenen Blutes. »Er hat mir die Nase gebrochen«, klagte er mit dumpfer Stimme, bevor er die Maske vom Gesicht streifte und zu Boden fallen ließ. Aus der Nase sickerte das Blut auf seine Jacke. Als er sich dem Mann zuwandte, der offenbar das Kommando hatte, sah die Frau den Schriftzug, der in Leuchtbuchstaben auf seiner wattierten Jacke prangte.
»›Carabinieri?‹« fragte sie. Ihre Stimme konnte sich kaum durchsetzen gegen das unaufhörliche Geschrei des Babys.
»Ja, Signora. Carabinieri«, sagte der Mann, der sie angesprochen hatte. »Wußten Sie denn nicht, daß wir kommen würden, Signora?« Und es schwang fast so etwas wie Anteilnahme in seiner Stimme mit.
[25] 3
Guido Brunetti lag an den Rücken seiner Frau geschmiegt und glitt sanft hinüber in den Schlaf der Gerechten. Er schwebte in jener nebelhaften Sphäre zwischen Traum und Wachen und mochte das Hochgefühl, das ihm dieser Tag beschert hatte, nur ungern loslassen. Sein Sohn hatte beim Abendessen beiläufig und ohne den erleichterten Blickwechsel seiner Eltern zu bemerken, einen seiner Klassenkameraden für ziemlich blöd erklärt, weil der mit Drogen experimentierte. Seine Tochter hatte sich bei ihrer Mutter für eine patzige Bemerkung vom Vortag entschuldigt, und die Worte »Berg« und »Prophet« drängten sich schemenhaft in Brunettis Bewußtsein. Seine Frau endlich, mit der er seit über zwanzig Jahren glücklich verheiratet war, hatte ihn mit einem Ansturm amourösen Verlangens überrascht, der ihn so erregte, daß diese zwei Jahrzehnte wie ausgelöscht waren.
Brunetti ließ sich treiben, vollauf zufrieden und begierig, alles noch einmal Revue passieren zu lassen. Die freiwillige Reue eines Teenagers: Sollte er die Presse alarmieren? Noch mehr allerdings wunderte er sich über Paolas Beteuerung, daß Chiara ihre Entschuldigung ganz uneigennützig und ohne nach irgendeiner Gegenleistung zu schielen, vorgebracht habe. Chiara war bestimmt klug genug, um zu wissen, wie gut ein solcher Trick funktioniert hätte, aber Brunetti zog es vor, seiner Frau zu glauben, die ihm versicherte, für so was sei ihre Tochter schlicht zu aufrichtig.
[26] War das die größte Illusion, überlegte er, der Glaube an die Aufrichtigkeit unserer Kinder? Die Frage entglitt ihm unbeantwortet, und er schlief langsam ein.
Das Telefon schrillte.
Es klingelte fünfmal, ehe Brunetti sich mit der dumpfen Stimme eines Betäubten oder Übertölpelten meldete. »Sì?« brummte er, während seine Gedanken wie der Blitz den Flur hinunterjagten. Doch die Erinnerung daran, daß er beiden Kindern gute Nacht gesagt hatte, als sie zu Bett gegangen waren, beruhigte ihn sofort wieder.
»Ich bin’s, Vianello«, sagte die vertraute Stimme am anderen Ende. »Ich bin im Ospedale Civile. Wir haben ein Problem am Hals.«
Brunetti setzte sich auf und machte Licht. Nicht nur Vianellos Nachricht, sondern auch sein eindringlicher Ton sagte ihm, daß er wohl keine andere Wahl hatte, als dem Inspektor ins Krankenhaus zu folgen. »Was für ein Problem?«
»Einer der Mediziner hier, ein Kinderarzt, liegt in der Notaufnahme, und seine Kollegen befürchten eine Hirnschädigung.« Auch in weniger benommenem Zustand hätte Brunetti sich darauf keinen Reim machen können, aber da er wußte, daß Vianello rasch auf den Punkt kommen würde, fragte er nicht nach.
»Er wurde in seiner Wohnung überfallen«, fuhr der Inspektor fort. Dann, nach längerer Pause, setzte er hinzu: »Von der Polizei.«
»Von uns?« fragte Brunetti verblüfft.
»Nein, von den Carabinieri. Sie sind bei ihm eingedrungen und wollten ihn festnehmen. Der verantwortliche [27] Hauptmann sagt, der Arzt hätte einen seiner Männer angegriffen«, erklärte Vianello. Brunetti kniff die Augen zusammen, während der Inspektor ergänzte: »Aber es ist ja klar, daß er sich auf so was rausredet, nicht wahr?«
»Zu wie vielen waren sie denn?« wollte Brunetti wissen.
»Zu fünft«, antwortete Vianello. »Drei im Haus und zwei draußen als Verstärkung.«
Brunetti stieg aus dem Bett. »Ich bin in zwanzig Minuten da.« Dann fragte er: »Weißt du, warum die Carabinieri dort waren?«
Vianellos Antwort kam zögernd. »Sie wollten seinen Sohn rausholen. Ein Baby von achtzehn Monaten, adoptiert. Laut den Carabinieri illegal.«
»In zwanzig Minuten«, wiederholte Brunetti und legte auf.
Erst als er aus dem Haus trat, vergewisserte sich der Commissario, wie spät es war. Viertel nach zwei. Die erste Herbstkühle schlug ihm entgegen, und er war froh, daß er daran gedacht hatte, eine Jacke überzuziehen. Am Ende der calle bog er rechts ab, Richtung Rialto. Wahrscheinlich hätte er ein Polizeiboot anfordern sollen, aber man wußte nie, wie lange die brauchten, wogegen Brunetti die Strecke zu Fuß auf die Minute genau taxieren konnte.
Von der nächtlichen Stadt ringsum nahm er kaum Notiz. Fünf Mann, um ein anderthalbjähriges Kind in Gewahrsam zu nehmen. Wenn der Adoptivvater jetzt mit Verdacht auf Hirnschaden im Krankenhaus lag, so hatten die Carabinieri vermutlich nicht bei ihm geklingelt und höflich um Einlaß gebeten. Brunetti hatte selbst an zu vielen nächtlichen Razzien teilgenommen, um sich über die Panik, die sie [28] auslösten, noch irgendwelche Illusionen zu machen. Er hatte hartgesottene Verbrecher erlebt, die unter dem Ansturm bewaffneter Sturmtrupps in die Hosen pinkelten: Wie würde da erst ein Arzt reagieren, illegal adoptiertes Kind hin oder her? Und die Carabinieri – Brunetti hatte zu viele von ihnen erlebt, die mit Vorliebe unangemeldet hereinplatzten und mit ihrer einschüchternden Autorität auftrumpften, als ob Mussolini noch immer an der Macht wäre und niemand sich ihnen in den Weg stellen dürfe.
Auf dem Scheitel der Rialtobrücke war Brunetti zu sehr mit seinen Gedanken beschäftigt, um den Blick nach rechts oder links schweifen zu lassen. Vielmehr lief er eilig hinunter zur Calle della Bissa. Warum brauchten die Carabinieri ein fünfköpfiges Kommando, und wie waren sie überhaupt an den Tatort gelangt? Ohne Zweifel hatten sie ein Boot nehmen müssen, aber wer hatte sie ermächtigt, einen solchen Einsatz hier in der Stadt durchzuführen? Wer hatte Kenntnis davon, und falls die Razzia mit der Questura abgesprochen war, wieso hatte man ihn dann nicht informiert?
Der Pförtner war anscheinend hinter dem Fenster seiner Loge eingeschlafen: Jedenfalls sah er nicht auf, als Brunetti die Klinik betrat. Der Commissario tappte blindlings durch die prachtvolle Eingangshalle, spürte jedoch den jähen Temperatursturz, während er sich erst nach rechts wandte und dann zweimal links abbog, bis er vor die Notaufnahme gelangte. Die äußere, automatisch gesteuerte Eingangstür glitt zur Seite und ließ ihn passieren. Auf der Schwelle zur zweiten zückte Brunetti seinen Dienstausweis und wandte sich an den weißbekittelten Wärter hinter der Glaswand.
Der beleibte Mann hatte ein sympathisches Gesicht und [29] wirkte sehr viel fröhlicher, als Zeit und Umständen angemessen war. Nach einem flüchtigen Blick auf Brunettis Ausweis sagte er lächelnd: »Da links runter, Signore. Dann die zweite Tür rechts. Dort liegt er.«
Brunetti bedankte sich und folgte der Wegbeschreibung. An der bezeichneten Tür klopfte er einmal und trat ein. Der Mann im Kampfanzug, der auf einem Untersuchungstisch lag, war ihm zwar fremd, doch dafür erkannte er die Uniform eines zweiten, der am Fenster stand. Eine Frau im weißen Laborkittel saß neben dem Patienten und glättete einen Streifen Klebeband über seiner Nase. Brunetti sah zu, wie sie einen zweiten Streifen zurechtschnitt und neben dem ersten anbrachte. Sie dienten dazu, einen dicken Mullverband über der Nase des Patienten zu befestigen; in beiden Nasenlöchern steckten Wattepfropfen. Unter den Augen des Mannes hatten sich dunkle Ringe gebildet.
Der Uniformierte am Fenster lehnte in lässiger Pose, die Arme verschränkt, die Beine gekreuzt, an der Wand und beobachtete die Szene. Er trug die drei Sterne eines Capitanos und ein Paar hohe, schwarze Lederstiefel, die eher zu einem Dressurreiter gepaßt hätten als zum Lenker einer Ducati.
»Guten Morgen, Dottoressa«, grüßte Brunetti, als die Frau zu ihm aufsah. »Ich bin Commissario Guido Brunetti, und ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir sagen könnten, was hier vorgeht.«
Brunetti, der erwartet hatte, daß der Hauptmann sich einschalten würde, war überrascht und enttäuscht zugleich, als der Mann am Fenster unverändert schwieg. Die Ärztin wandte sich wieder ihrem Patienten zu und drückte [30] ein paarmal gegen die Enden der Klebestreifen, bis sie sicher auf der Haut des Mannes hafteten. »Lassen Sie den Verband mindestens zwei Tage drauf. Der Knorpel hat sich verschoben, doch das sollte sich problemlos wieder normalisieren. Sie müssen nur vorsichtig sein. Heute abend vor dem Zubettgehen nehmen Sie bitte die Wattepfropfen raus. Falls der Verband abgehen sollte oder die Blutung wieder einsetzt, konsultieren Sie einen Arzt, oder kommen Sie wieder hierher zu uns. Alles klar?«
»Sì, Signora«, bestätigte der Mann mit unnatürlich näselnder Stimme.
Die Ärztin streckte eine Hand aus, und der Patient griff danach, während er die Füße auf den Boden setzte und, mit der anderen Hand auf den Untersuchungstisch gestützt, zum Stehen kam. Er brauchte einen Moment, um sein Gleichgewicht zu finden. Die Ärztin ging in die Hocke und inspizierte von unten die Mulltupfer in der Nase ihres Patienten. Offenbar fand sie nichts zu beanstanden, denn sie richtete sich gleich wieder auf und trat zurück. »Auch wenn Sie keine Beschwerden haben, kommen Sie in drei Tagen wieder und lassen sich noch mal anschauen, ja?« Der Mann nickte sehr vorsichtig und wollte etwas entgegnen, aber die Ärztin kam ihm zuvor. »Und seien Sie unbesorgt«, setzte sie hinzu. »Das wird schon wieder.«
Der Patient blickte den Hauptmann an, ehe er sich wieder an die Ärztin wandte. »Ich bin aus Verona, Dottoressa«, nuschelte er.
»Wenn das so ist«, gab sie forsch zurück, »gehen Sie nach drei Tagen zu Ihrem Hausarzt. Oder auch früher, falls es erneut zu Blutungen kommt. In Ordnung?«
[31] Er nickte und wandte sich dann an den Hauptmann. »Und mein Dienst, Capitano?«
»Ich glaube nicht, daß Sie damit diensttauglich sind.« Der Hauptmann deutete auf den Verband. »Ich regele das mit Ihrem Sergente.« Und an die Ärztin gerichtet setzte er hinzu: »Wenn Sie ihm irgendein Attest ausstellen würden, Dottoressa, kann er ein paar Tage krankfeiern.«
Irgend etwas, vielleicht nur ein Gespür fürs Theatralische oder ein zur Gewohnheit gewordenes Mißtrauen, veranlaßte Brunetti, sich zu fragen, ob der Hauptmann sich auch so liebenswürdig gezeigt hätte, wenn kein ausgewiesener Kriminalbeamter zugegen gewesen wäre. Die Ärztin trat an den Schreibtisch und griff nach einem Notizblock. Sie warf ein paar Zeilen aufs Papier, riß das Blatt ab und reichte es dem Verletzten, der sich bei ihr bedankte und, nachdem er vor dem Hauptmann salutiert hatte, hinausging.
»Mir wurde gemeldet, es sei noch jemand eingeliefert worden, Dottoressa«, sagte Brunetti. »Können Sie mir sagen, wo ich diesen zweiten Patienten finde?«
Er merkte erst jetzt, wie jung sie war, viel jünger, als sich das für eine Ärztin gehörte. Sie war nicht schön, aber sie hatte ein nettes Gesicht, eines, das sich gut halten und mit dem Alter an Reiz gewinnen würde.
»Er ist ein Kollege von mir, der stellvertretende Leiter der Kinderstation«, begann sie und betonte den Titel wie eine Beglaubigung dafür, daß die Carabinieri sich nicht an ihm hätten vergreifen dürfen. »Seine Verletzungen gefielen mir gar nicht« – dies mit Blick zum Hauptmann –, »darum habe ich ihn in die Neurologie geschickt und den leitenden Oberarzt zu Hause verständigt.« Brunetti spürte, daß der [32] Hauptmann ihr ebenso gespannt zuhörte wie er. »Die Pupillen reagierten nicht, und er konnte den linken Fuß kaum bewegen. Deshalb schien es mir ratsam, einen Neurologen hinzuzuziehen.«
An dieser Stelle griff der Hauptmann von seinem Fensterplatz aus ein. »Hätte das nicht warten können, Dottoressa? Man braucht doch nicht gleich einen Spezialisten aus dem Bett zu trommeln, nur weil sich jemand den Kopf angeschlagen hat, oder?«
Die Ärztin wandte sich dem Hauptmann zu, und ihr Blick verhieß ein Sperrfeuer. Statt dessen erwiderte sie ganz gelassen: »Es schien mir geboten, Capitano, weil es ja offenbar ein Gewehrkolben war, mit dem der Kopf des Patienten kollidierte.«
Eins zu null für die Dame, Capitano, dachte Brunetti. Doch dann fing er den Blick auf, den der Offizier der Ärztin zuwarf, und stellte überrascht fest, daß der junge Mann tatsächlich verlegen wirkte.
»Hat er das behauptet, Dottoressa?« fragte der Capitano.
»Nein. Er hat gar nichts gesagt. Ihr Soldat hat es mir erzählt, als ich ihn fragte, was mit seiner Nase passiert ist.« Die Ärztin sprach jetzt ganz sachlich.
Der Hauptmann nickte, stieß sich von der Wand ab und trat mit ausgestreckter Hand auf Brunetti zu. »Marvilli«, stellte er sich vor, während sie einander die Hand schüttelten. Dann fuhr er, an die Ärztin gewandt, fort: »Er ist übrigens keiner von meinen Männern, Dottoressa, sondern in Verona stationiert, wie er Ihnen gesagt hat. Alle vier stammen von dort.« Als weder Brunetti noch die Ärztin darauf [33] eingingen, offenbarte der Capitano seine Jugend und seine Unsicherheit, indem er erklärend nachschob: »Der Offizier, der den Einsatz hätte leiten sollen, wurde überraschend nach Mailand abkommandiert, und da ich hier stationiert bin, mußte ich kurzfristig einspringen.«
»Verstehe«, sagte die Ärztin. Brunetti, der weder das Ausmaß der Operation noch deren Hintergründe kannte, schwieg vorsichtshalber.
Marvilli hatte offenbar nichts hinzuzufügen, und so bat Brunetti nach einer Pause: »Wenn Sie erlauben, Dottoressa, würde ich diesen Patienten gern sehen. Den in der Neurologie.«
»Wissen Sie, wo das ist?«
»Gleich neben der Dermatologie?«
»Stimmt. Also wenn Sie den Weg kennen, dürfen Sie von mir aus ruhig hinaufgehen«, erklärte die Ärztin.
Brunetti, der ihr namentlich danken wollte, schielte nach dem Schildchen an ihrem Revers. Dottoressa Claudia Cardinale, las er. Damit mußte sie wohl leben, aber hatten manche Eltern denn gar keinen Verstand?
»Ich danke Ihnen, Dottoressa Cardinale«, sagte er förmlich. Die Ärztin ergriff seine dargebotene Hand und dann, zu Brunettis Verblüffung, auch die des Hauptmanns. Gleich darauf ließ sie die beiden Männer allein.
»Capitano«, sagte Brunetti in sachlichem Ton, »dürfte ich vielleicht erfahren, was hier vorgeht?«
Marvilli hob die Hand, eine für ihn überraschend verhaltene Geste. »Ich kann Ihre Frage immerhin zum Teil beantworten, Commissario.« Als Brunetti schwieg, fuhr Marvilli fort: »Der Einsatzbefehl heute nacht erfolgte aufgrund [34] einer Ermittlung, die schon geraume Zeit läuft: seit fast zwei Jahren, um genau zu sein. Dottor Pedrolli«, fuhr er fort, und Brunetti nahm an, daß dies der Name des Patienten in der Neurologie sei, »Dottor Pedrolli hat vor achtzehn Monaten illegal ein Baby adoptiert. Er und eine Reihe anderer, die sich des gleichen Vergehens schuldig gemacht haben, wurden heute nacht im Zuge einer Großrazzia verhaftet.«
Obwohl ihn die Anzahl der Betroffenen interessiert hätte, erwiderte Brunetti nichts, und Marvilli hielt offenbar keine weitere Erklärung für nötig.
»Ist es das, was man ihm anlastet?« nahm Brunetti endlich das Gespräch wieder auf. »Illegale Adoption?« Eine Frage, mit der er sich unversehens in Gustavo Pedrollis ohnmächtigen Kampf gegen die Allmacht des Gesetzes verstrickte.
»Ich nehme an«, versetzte Marvilli, »daß man ihm außerdem Beamtenbestechung, Urkundenfälschung, Entführung eines Minderjährigen und illegalen Devisentransfer zur Last legen wird.« Er beobachtete Brunettis Gesicht, und als er sah, wie sich die Miene des Commissarios verdüsterte, fuhr der Hauptmann fort: »Im Verlauf der Ermittlungen werden zweifellos weitere Anschuldigungen hinzukommen.« Mit der Spitze eines seiner eleganten Stiefel stieß er einen Fetzen blutigen Verbandsmull vor seinen Füßen weg, bevor er zu Brunetti aufblickte. »Und es würde mich nicht wundern, wenn Widerstand gegen die Staatsgewalt und gegen einen Beamten in Ausübung seines Dienstes darunterfielen.«
Wohl wissend, wie mangelhaft er über die Vorgänge unterrichtet war, übte Brunetti sich weiter in Schweigen. Er [35] öffnete die Tür zum Flur und ließ Marvilli den Vortritt. Seinem Akzent nach stammte der Hauptmann aus dem Veneto, war jedoch kein Venezianer, weshalb Brunetti annahm, daß er sich im Labyrinth der Klinik nicht auskennen würde. Wortlos führte der Commissario seinen Begleiter durch die leeren Korridore, wobei er, ohne groß nachzudenken, bald nach links, bald nach rechts abbog.
Vor dem Eingang zur Neurologischen Abteilung machten sie halt. »Haben Sie einen Ihrer Männer bei ihm postiert?« fragte Brunetti.
»Ja. Den, den er nicht angegriffen hat«, versetzte der Hauptmann. Als er merkte, wie das klang, schob er berichtigend nach: »Einen aus der Abteilung von Verona.«
Brunetti stieß die Stationstür auf. Hinter dem Empfangstresen saß eine junge Krankenschwester mit langem schwarzem Haar. Sie blickte auf, und Brunetti fand, sie wirkte müde und verdrossen. »Sie wünschen?«
Bevor sie ihnen erklären konnte, die Station sei für Besucher geschlossen, trat Brunetti versöhnlich lächelnd auf sie zu. »Verzeihen Sie die Störung, Schwester, aber ich bin von der Polizei und möchte Dottor Pedrolli sprechen. Wenn ich recht informiert bin, ist mein Inspektor schon hier.«
Bei dem Hinweis auf Vianello hellte ihre gestrenge Miene sich ein wenig auf. »Er war da, aber ich glaube, er ist nach unten gegangen. Dottor Pedrolli wurde vor einer Stunde eingeliefert: Dottor Damasco untersucht ihn gerade.« Damit wandte die Schwester sich von dem venezianisch sprechenden Brunetti an den uniformierten Marvilli. »Anscheinend haben ihn die Carabinieri zusammengeschlagen.«
[36] Brunetti, der spürte, wie Marvilli sich versteifte und vorpreschen wollte, versperrte ihm vorsorglich den Weg. »Dürfte ich wohl zu ihm?« fragte er und hinderte Marvilli mit gebieterischem Blick daran, sich einzumischen.
»Ich denke schon«, erwiderte die Schwester gedehnt und erhob sich mit der Aufforderung, ihr zu folgen, von ihrem Platz. Im Vorbeigehen sah Brunetti, daß auf dem Computer am Tresen ein Historienfilm lief, vielleicht Der Gladiator, vielleicht auch Alexander.
Er ging hinter der Schwester her den Flur entlang, Marvillis Schritte im Rücken. Vor einer Tür auf der rechten Seite blieb die Schwester stehen, klopfte, stieß dann – einer Aufforderung folgend, die Brunetti entging – die Tür auf und steckte den Kopf ins Zimmer. »Jemand von der Polizei, Dottore«, sagte sie.
»Da ist doch schon einer hier, verdammt!« knurrte eine gereizte Männerstimme. »Das reicht. Sagen Sie dem anderen, er soll warten.«
Die Schwester zog den Kopf zurück und schloß die Tür. »Sie haben’s gehört«, verkündete sie, und alle Freundlichkeit war aus ihrer Stimme und Mimik gewichen.
Marvilli sah auf die Uhr. »Wann macht denn die Cafeteria auf?« fragte er.
»Um fünf«, antwortete die Schwester. Auf sein enttäuschtes Gesicht hin fuhr sie in sanfterem Ton fort: »Aber im Erdgeschoß finden Sie einen Kaffeeautomaten.« Ohne ein weiteres Wort überließ sie die beiden Männer sich selbst und kehrte zu ihrem Film zurück.
Marvilli erkundigte sich, ob Brunetti auch etwas trinken wolle, doch der lehnte dankend ab. Mit dem Versprechen, [37] gleich wieder dazusein, machte der Hauptmann sich auf den Weg. Prompt bereute Brunetti seine Entscheidung und wollte dem Davoneilenden schon nachrufen: »Caffè doppio, con due zuccheri, per piacere«, aber er scheute sich, die Stille zu durchbrechen. Als Marvilli durch die Schwingtür am Ende des Korridors verschwunden war, ging Brunetti zu einer Reihe orangefarbener Plastikstühle, setzte sich und wartete darauf, daß jemand aus Pedrollis Zimmer kam.
[38] 4
Brunetti nutzte die Wartezeit dafür, seine Gedanken zu ordnen. Wenn man um drei Uhr morgens den leitenden Oberarzt der Neurologie herbeordert hatte, dann mußte es schlimm stehen um diesen Dottor Pedrolli, auch wenn Marvilli sich alle Mühe gab, die Sache herunterzuspielen. Brunetti verstand nicht, warum die Carabinieri mit so massiver Gewalt vorgegangen waren. Aber es konnte natürlich sein, daß ein Hauptmann, der nicht zur Einsatztruppe gehörte, die Operation nicht so gut im Griff hatte wie ein Offizier, der mit seinen Männern vertraut war. Kein Wunder, daß Marvilli so nervös wirkte.
Ob dieser Dottor Pedrolli über seine Privataffäre hinaus in Adoptionsgeschäfte verwickelt war? Schließlich hatte er als Pädiater Zugang zu Kindern und, durch sie, zu den Eltern, vielleicht auch zu solchen, die sich erfolglos um mehr Nachwuchs bemühten, oder gar zu denen, die man dazu bewegen konnte, sich von einem ungewollten Kind zu trennen.
Ferner könnte Pedrolli Kontakt zu Waisenhäusern unterhalten: Deren Insassen bedurften ärztlicher Betreuung gewiß mindestens ebenso wie Kinder, die daheim in der eigenen Familie aufwuchsen. Brunetti wußte, daß Vianello mit Waisen großgeworden war: Seine Mutter hatte die Kinder einer Freundin aufgenommen, allerdings gerade um sie vor dem Heim, jenem Schreckbild seiner Elterngeneration, zu bewahren. Inzwischen herrschten, dank der regen Tätigkeit von Sozialdiensten und Kinderpsychologen, sicher [39] andere Verhältnisse. Auch wenn Brunetti sich eingestehen mußte, daß er keine Ahnung hatte, wie viele Waisenhäuser es in Italien noch gab und wo.
Unwillkürlich dachte er zurück an seine ersten Ehejahre mit Paola. Damals hielt sie an der Universität ein Seminar über Dickens, und mit dem Enthusiasmus des Jungvermählten hatte er die Romane gemeinsam mit ihr gelesen. Schaudernd erinnerte er sich an das Waisenhaus, in dem Oliver Twist gequält wurde, doch dann fiel ihm jene Stelle aus Große Erwartungen ein, die ihm seinerzeit das Blut in den Adern gefrieren ließ, nämlich Mrs. Joes Leitspruch, Kinder gehörten »von Hand aufgezogen«, eine Formulierung, die weder er noch Paola zu deuten wußten, die sie aber gleichwohl beide verstört hatte.
Charles Dickens hatte allerdings vor zweihundert Jahren geschrieben, als es, nach heutigen Maßstäben, noch richtige Großfamilien gab: Selbst Brunettis Eltern hatten noch je sechs Geschwister gehabt. Wurden die Kinder heute besser umsorgt, weil sie inzwischen Mangelware sind?
Inmitten dieser Gedanken tippte sich der Commissario plötzlich mit den Fingern seiner rechten Hand an die Stirn: Gegen Dottor Pedrolli war keine offizielle Anklage erhoben worden, Brunetti hatte keine Beweismittel zu Gesicht bekommen, und doch ging er, nur auf das Wort eines Hauptmanns in Reitstiefeln hin, von der Schuld des Mannes aus!
Hier wurde der Commissario in seinen Betrachtungen unterbrochen: Vianello kam mit langen Schritten den Korridor entlang und setzte sich zu ihm. »Bin ich froh, daß du da bist«, sagte der Inspektor nur.
[40] »Was ist hier eigentlich los?« fragte Brunetti, nicht minder erleichtert über die Anwesenheit seines Kollegen.
Mit gedämpfter Stimme begann Vianello die Situation zu erklären. »Riverre und ich, wir hatten Nachtdienst, als der Anruf kam. Zuerst wurde ich nicht schlau daraus.« Er versuchte vergebens, ein Gähnen zu unterdrücken.