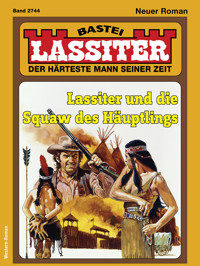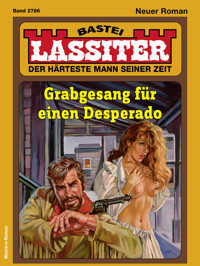1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lassiter
- Sprache: Deutsch
Ein eiskaltes Auge ruhte über Kimme und Korn der Winchester auf einem der drei Arapahoe-Krieger, die auf der Sohle eines Canyons um ein Lagerfeuer saßen, rauchten und palaverten. Es waren Jäger. Keiner der drei ahnte, dass der Tod bereits die knöcherne Klaue nach ihnen ausstreckte. Der Tod hatte einen Namen: Sterling Lloyd. Sein Hass auf alles, was eine rote Hautfarbe besaß, war grenzenlos. Arapahoes hatten vor zehn Jahren seine Farm überfallen. Seine Frau und seine beiden Kinder waren dabei gestorben. Er selbst hatte nur knapp überlebt. Der Schuss peitschte. Der Krieger wurde regelrecht herumgewirbelt, um im nächsten Moment tot zusammenzubrechen. Die beiden anderen Arapahoes kamen nicht zum Reagieren. In rasender Folge feuerte Sterling Lloyd zwei weitere Male. Die ineinander verschmelzenden Echos der Schüsse verhalten. Drei reglose Gestalten lagen beim Feuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Hass, der keine Grenzen kennt
Vorschau
Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
Hass, der keine Grenzen kennt
von Pete Hackett
Ein eiskaltes Auge ruhte über Kimme und Korn der Winchester auf einem der drei Arapahoe-Krieger, die auf der Sohle eines Canyons um ein Lagerfeuer saßen, rauchten und palaverten. Es waren Jäger. Keiner der drei ahnte, dass der Tod bereits die knöcherne Klaue nach ihnen ausstreckte.
Der Tod hatte einen Namen: Sterling Lloyd. Sein Hass auf alles, was eine rote Hautfarbe hatte, war grenzenlos. Arapahoes hatten vor zehn Jahren seine Farm überfallen. Seine Frau und seine beiden Kinder waren dabei gestorben. Er selbst hatte nur knapp überlebt.
Der Schuss peitschte. Einer der Krieger wurde regelrecht herumgewirbelt, um im nächsten Moment tot zusammenzubrechen.
Die beiden anderen Arapahoes kamen nicht zum Reagieren. In rasender Folge feuerte Sterling Lloyd zwei weitere Male. Die ineinander verschmelzenden Echos der Schüsse verhalten. Drei reglose Gestalten lagen beim Feuer.
Licht- und Schattenreflexe, die die züngelnden Flammen in die Umgebung warfen, huschten über die still am Boden Liegenden hinweg.
Sterling Lloyd wartete noch kurze Zeit. Die Härte in seinen Augen milderte sich nicht.
Als von den Rothäuten kein Lebenszeichen mehr ausging, wuchs seine hohe, hagere Gestalt hinter dem Felsen, der ihn gedeckt hatte, in die Höhe. Mit kurzen abgezirkelten Schritten, die Winchester an der Seite im Anschlag, näherte er sich seinen Opfern.
Obwohl er auf blitzschnelle Reaktion eingestellt war, wurde er überrascht, als der Oberkörper eines der Krieger in die Höhe schnellte. Ein Tomahawk wirbelte auf Sterling Lloyd zu.
Es war jener Sekundenbruchteil, der zwischen Erkennen und Reagieren lag und der oftmals über Leben oder Tod entschied, den er verpasste. In dem Moment, als er abdrückte, traf ihn das Kriegsbeil, und die Schneide bohrte sich in seine rechte Hüfte.
Sein Schuss löschte das Leben des Arapahoe-Kriegers aus.
Sterling Lloyds rechtes Bein wurde schlagartig kraftlos und knickte ein. Der Indianertöter sank auf das Knie nieder und stöhnte, sein Gesicht verzerrte sich zur gequälten Grimasse. Der Schmerz jagte bis unter seine Schädeldecke. Die Winchester entglitt seinen Händen und fiel auf den Boden.
Seine rechte Hand umklammerte den Griff des Tomahawks. Ein Ruck, und er zog den aus Eisen gefertigten Kopf des Kriegsbeils aus der Wunde, schrie auf und fiel auf die Seite. Sein Körper erging sich in Zuckungen, die er nicht zu kontrollieren vermochte. Der Schmerz eskalierte, aus der schrecklichen Wunde an seiner Hüfte pulsierte Blut.
»Verdammte, dreckige Rothaut!«, presste Lloyd zwischen den Zähnen hervor. Aus blutunterlaufenen Augen starrte er auf die leblosen Gestalten. Obwohl sie tot waren, war sein Hass auf sie unbeschreiblich – und unauslöschlich.
Mit zitternden Händen knüpfte er sein Halstuch auf. Er öffnete seine Hose und schob das Halstuch unter den Hosenbund, presste es auf die Wunde und atmete rasselnd. Pulsierender Schmerz quälte ihn. Er stöhnte und ächzte, Benommenheit brandete gegen sein Bewusstsein an.
Sterling Lloyd lag reglos am Boden und kämpfte gegen den Schwindel an, der ihn von Zeit zu Zeit befiel und dunkle Schleier vor seinem Blick schuf. Das Feuer, das die drei Arapahoes unterhalten hatten, brannte herunter. Schließlich war es nur noch ein Haufen Glut, über dem sich nach und nach weiße Asche bildete. Lloyd konnte nicht mehr unterscheiden, ob es die Finsternis einer sternenlosen Nacht war oder die Benommenheit, die mit geradezu undurchdringlicher Schwärze vor seinem Blick wob.
Irgendwann riss sein Denken ...
✰
Als er wiedererwachte, war die Wolkendecke hoch oben aufgerissen und über ihm stand ein kugelrunder Mond, der mit seinem kalten Licht die Hügelkuppen und Felsgipfel der Wind River Range versilberte.
Lloyd sah jetzt wieder klarer. Das Halstuch, das er auf die Wunde gepresst hatte und das seine rechte Hand umklammerte, war steif vom eingetrockneten Blut. Lloyd hatte keine Ahnung, wie lange er bewusstlos gewesen war. Aber es mussten mehrere Stunden gewesen sein. Das leise Säuseln des Nachtwindes umgab ihn. Von irgendwoher erklang das Bellen eines Kojoten.
In den Schläfen des Indianerhassers dröhnte es. Er war benommen, und es dauerte eine ganze Weile, bis seine Gedanken einigermaßen klar waren.
Die erste Tatsache, die sein Gehirn mit Schrecken erfasste, war, dass er sein rechtes Bein nicht bewegen konnte. Es war gefühllos, jegliche Kraft schien daraus verschwunden zu sein.
Er musste weg von hier. Irgendwann würden andere Arapahoes ihre Stammesbrüder vermissen und sie suchen. Wenn sie ihn, Lloyd, bei den drei Leichen fanden, würden sie kurzen Prozess mit ihm machen.
Seine linke Hand tastete über den Boden, und seine Fingerspitzen berührten den Kolben seiner Winchester. Er griff zu, erwischte sie am Schaft und stellte das Gewehr mit der Kolbenplatte auf den Boden. Dann griff er auch mit der rechten Hand zu. Das Halstuch blieb unter der Hose auf der Wunde kleben. Es war angetrocknet.
Seine Muskeln und Sehnen in beiden Armen drohten zu reißen, so sehr strengte es ihn an, sich am Gewehr in die Höhe zu ziehen.
Er kam halb hoch, doch dann verließ ihn die Kraft und er fiel mit einem verlöschenden Laut in der Kehle zurück. Ohne von einem bewussten Willen geleitet zu werden, rollte er auf den Bauch. Sein Gesicht fiel seitlich auf die Erde. Verbissen stemmte er sich gegen die Nebel, die auf ihn zuzukriechen schienen.
Das Feuer des Widerstandes, das ihm für wenige Augenblicke Kraft gegeben hatte, sank zusammen. Da waren wieder die wühlenden Schmerzen, die dunklen Schleier vor seinen Augen und die Übelkeit, die seinen Magen zusammenkrampfte. Benommenheit spülte ihn hinweg wie eine graue, alles verschlingende Flut.
Er biss die Zähne zusammen und begann zu kriechen. Sein rechtes Bein konnte er nicht einsetzen. Seine Finger verkrallten sich in Grasbüscheln und im Boden.
Mit der Kraft seiner Arme zog er sich über den Boden. Seine Nägel brachen. Es war eine Anstrengung, eine Überwindung, die all seinen Willen erforderte. Er röchelte, stöhnte und ächzte.
Yard für Yard kämpfte er sich weiter. Ihm brach der Schweiß aus, rann über sein Gesicht und brannte in seinen Augen. Es ging ums Überleben. Er wollte an diesem Platz nicht elend verrecken. Die Angst davor ließ ihn durchhalten. Ein nahezu dämonischer Selbsterhaltungstrieb peitschte ihn vorwärts.
Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte er sein Pferd, das er in einem Seitencanyon zurückgelassen hatte. Der Schmerz von seiner Hüfte war kaum zu ertragen. Es gelang ihm, das Tier loszubinden und sich in den Sattel zu kämpfen. Nach vorne gekrümmt, bar jeglichen Willens, ritt er davon.
Sein zerrissenes Bewusstsein zeigte tiefe Spalten. Denkvorgänge fielen aus, Erinnerungen schwanden, Zusammenhänge kamen nicht zustande. Er war mehr tot als lebendig, als er – der Tag war längst angebrochen und die Sonne brannte heiß vom Himmel – in Grass Creek, einem bedeutungslosen Ort, lediglich eine Ansammlung von Hütten, nördlich der Wind River Indianer Reservation, aus dem Sattel kippte.
Ein übermenschlicher Wille zum Durchhalten hatte verhindert, dass er draußen in der Wildnis vor die Hunde gegangen war. Vielleicht war es auch der mörderische Hass, der in ihm mit heißer Flamme brannte, der ihn hatte durchhalten lassen.
Vielleicht hatte auch der Satan die Hand im Spiel ...
✰
Das Land, das Lassiter umgab, war karg und öd und schien nur aus totem Gestein, heißem Wind und rötlichem Staub zu bestehen. Vereinzelte anspruchslose Bäume oder dorniges Strauchwerk fristeten ein kümmerliches Dasein. In der Runde beherrschten gewaltige Bergketten das Blickfeld.
Müde zog der Falbe, den Lassiter ritt, die Hufe durch den Staub. Kleine Staubfontänen wurden aufgewirbelt. Vereinzelte Windböen, die heulend wie ein hungriges Wolfsrudel heranfuhren, rissen Staubwolken vom Boden in die Höhe, die den einsamen Reiter einhüllten und ihm fast die Luft nahmen.
Im Gesicht Lassiters hatte sich eine dünne Schicht aus Staub und Schweiß gebildet. Die Hitze war geradezu unerträglich, sie füllte beim Atmen die Lunge wie mit Feuer. Schweiß, der unter Lassiters Stetson hervor über sein Gesicht rann, hinterließ helle Linien in der Staubschicht auf seiner Haut. Sein Hemd war unter den Achseln und zwischen den Schulterblättern nass und klebte an seinem Körper.
Dieses Land war die Hölle. Der Satan persönlich musste es geschaffen haben.
Lassiters Ziel war das Wind River Basin, genau gesagt die Agentur der Wind River Indianerreservation. Er folgte einem Trail, der von Hufen aufgewühlt und von Wagenspuren zerfurcht war und der in dem Reservat enden sollte. Den Trail säumten die Masten einer Telegrafenleitung, die in Fort Washakie endete.
Der Agent der Brigade Sieben war am frühen Morgen in Lander, einer kleinen Stadt an der Südgrenze des Indianergebiets, aufgebrochen. Die Agentur befand sich im Fort Washakie. Zwei Kompanien Kavallerie waren zum Schutz der Agentur und zur Sicherung des Friedens im Reservat in dem Militärposten stationiert.
Die Sonne hatte ihren Zenit überschritten und stand fast senkrecht über dem Fort, als Lassiter beim Palisadentor von zwei Wachsoldaten, die ihre Karabiner geschultert hatten, aufgehalten wurde.
»Wohin, Stranger?«, fragte einer. »Im Reservat haben weiße Zivilisten nichts zu suchen«, fügte er mahnend hinzu.
In den Augen des Troopers loderte unübersehbar das Misstrauen. Obwohl es verboten war, trieb sich innerhalb der Grenzen des Reservats eine Menge zwielichtiges Gesindel herum, Männer, die das Licht der Öffentlichkeit scheuten und die das Gesetz fürchten mussten wie der Teufel das Weihwasser.
»Mein Name ist Lassiter«, stellte sich dieser vor. »Ich will zu Mr. Shane Talbott, dem Indianeragenten. Es ist wegen der mysteriösen Morde an einigen Arapahoes und Cheyennes.«
Der Soldat schien Bescheid zu wissen, denn er wies Lassiter den Weg zum Büro der Agentur.
Lassiter ritt am Paradeplatz entlang. An einem von Regen, Wind und Sonne verkrümmten Mast hing schlaff das etwas zerschlissene Sternenbanner. Der heiße Wind, der Staubwirbel über die große, freie Fläche trieb, blies nicht heftig genug, um es zu bewegen. Die Böen wurden von den hohen Palisaden aufgehalten.
Lassiter ließ den Blick schweifen. Er sah einige blau Uniformierte, die irgendwelchen Beschäftigungen nachgingen. Von irgendwoher erklangen helle Hammerschläge. Im Schatten einer Mannschaftsbaracke lag ein schwarzer Hund und schlief.
Das Fort vermittelte Ruhe und Frieden. Lassiter sagte sich, dass wohl die meisten der Soldaten auf Patrouille in der Reservation unterwegs waren.
Denn Ruhe und Frieden waren trügerisch. Einige Krieger waren ermordet worden, und man hatte ihnen die Skalps genommen. In den Dörfern der Arapahoes und Cheyenne herrschten Angst – eine geradezu hysterische Angst – und gefährliche Unruhe. Die Armee und das Gesetz waren nicht in der Lage, die Morde aufzuklären.
Manche Häuptlinge riefen ihre Krieger dazu auf, selbst nach den Mördern zu suchen und sie zu bestrafen. Dagegen aber würde die Armee eine Menge einzuwenden haben.
Das Reservat glich einem Pulverfass, in das nur noch der Funke zu fallen brauchte. Sollten weitere Morde geschehen, war es nicht auszuschließen, dass die Krieger auf die Barrikaden gingen, und das bedeutete im Endeffekt einen neuen Indianerkrieg. Denn die Armee konnte und durfte dabei nicht tatenlos zusehen.
Lassiters Auftrag lautete, mit dem Indianeragenten Shane Talbott Verbindung aufzunehmen und dann alle Hebel in Bewegung zu setzen, um dem Skalpjäger respektive den Skalpjägern das blutige Handwerk zu legen.
Unter Umständen ein Himmelfahrtskommando. Denn in einem Reservat voll nervöser Krieger zu agieren, war ungefähr so, als würde man sich freiwillig in ein Raubtiergehege begeben.
✰
Lassiter erreichte die Indianeragentur. Ein großes Holzschild auf dem flachen Dach, auf das mit großen schwarzen Lettern »Bureau of Indian Affairs – Field Office Fort Washakie« gepinselt worden war, verriet Lassiter, dass er am Ziel war.
Vor der Agentur lungerten einige heruntergekommen anmutende Indianer herum. Ihre Kleidung wirkte zerlumpt, ihre langen Haare waren strähnig und verfilzt. Sie waren der Abschaum ihrer Rasse, verachtet sowohl von den Weißen als auch von den eigenen Leuten.
Ausdruckslos beobachteten sie Lassiter. Von dem Stolz, der einmal ihrem Volk zu eigen war, den jeder einzelne Krieger der Cheyenne und Arapahoe vermittelt hatte, konnte Lassiter nichts mehr wahrnehmen.
Er ließ sich aus dem Sattel gleiten, nahm das Pferd am Kopfgeschirr und führte es zu einem Tränketrog beim Holm. Auf dem Wasser schwamm ein hauchdünner Staubfilm. Lassiter schob ihn mit beiden Händen auseinander, dann wusch er sich Staub und Schweiß aus dem Gesicht. Der Falbe hatte schon die Nase in das abgestandene Wasser getaucht und zu saufen begonnen.
Nachdem sich Lassiter mit dem Halstuch das Gesicht abgetrocknet und das Pferd seinen Durst gestillt hatte, führte er das Tier zum Haltebalken, schlang den langen Zügel um den Querholm und tätschelte den Hals des Tieres, dann stieg er die drei Stufen zum Vorbau hinauf und klopfte gleich darauf gegen die Eingangstür.
»Herein!«, ertönte es.
Lassiter öffnete die Tür und trat ein. Vor der der Tür gegenüberliegenden Wand stand ein Schreibtisch, dahinter saß ein grauhaariger, hagerer Mann um die sechzig, dessen Gesicht von einem grauen Bart eingerahmt war. Graue Augen waren fragend auf Lassiter gerichtet.
Der Agent der Brigade Sieben grüßte und sagte: »Mein Name ist Lassiter. Man hat mich angewiesen, bei Ihnen vorstellig zu werden, Mr. Talbott. Da bin ich.«
Shane Talbott war keineswegs überrascht. »Ich habe gestern ein Telegramm erhalten, mit dem mir Ihre Ankunft angekündigt wurde. Bitte, Mr. Lassiter, nehmen Sie Platz.«
Talbott wies auf einen Stuhl, der vor dem Schreibtisch stand.
Lassiter ließ sich nieder. »Es geht, wenn ich richtig informiert bin, um die Ermordung mehrerer Arapahoes und Cheyenne«, sagte er. »Man befürchtet einen Indianeraufstand.«
»So ist es«, sagte der Indianeragent und lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Bis vor drei Jahren gab es schon einmal so eine Mordserie. Sie endete abrupt. Drei Arapahoe-Krieger waren die letzten Opfer. Sie waren im sogenannten Eagle Canyon ermordet worden. Vor zwei Monaten hat die Mordserie nun wieder ihren Anfang genommen. Acht tote Krieger. Die Ermordeten wurden skalpiert. Die Spur des oder der Mörder endet irgendwo in der Ödnis. Nun, das Reservat ist groß, es treibt sich viel Gesindel herum. Zwei Deputies des US-Marshals sind unverrichteter Dinge wieder nach Casper zurückgekehrt. Die Patrouillen der im Fort stationierten Kavallerie haben sich ebenfalls die Zähne ausgebissen. In den Dörfern herrscht brodelt es wie in einem Vulkan. Es gibt einige Häuptlinge, die die Krieger aufrufen, die Suche nach dem Mörder oder den Mördern aufzunehmen und sie zu bestrafen. Das gilt es zu verhindern, indem dem Killer oder den Killern das Handwerk gelegt wird. Der Hass, den die Indianer gegen den weißen Mann in sich tragen, wird aufs Neue geschürt. Es besteht die Gefahr, dass die Rothäute jeden Weißen, den sie im Reservat antreffen, ermorden.«
»Und dann müsste die Armee einschreiten«, vollendete Lassiter. »Das Ende vom Lied wäre ein Krieg zwischen Rot und Weiß. So ist es doch, oder täusche ich mich?«
»Sie täuschen sich nicht. Wer immer auch hinter den brutalen Morden steckt, ihm respektive ihnen muss das grauenvolle Handwerk gelegt werden, und zwar so schnell und so nachhaltig wie möglich. Wie gesagt, unter der Oberfläche brodelt es. Die Indianer fühlen sich ausgeliefert. Wenn die Lage eskaliert, wird das Land wieder einmal im Blut seiner Menschen ertrinken.«
»Es kann nur jemand sein, der die Indianer hasst und der in seinem Hass zu allem fähig ist«, murmelte Lassiter versonnen. »Und er muss sich entweder im Reservat oder nahe beim Reservat aufhalten. Wenn dem Mörder danach ist, schlägt er zu.«
»Es gibt einen Mann, den ein indianischer Tomahawk gewissermaßen an den Rollstuhl gefesselt hat. Es war vor drei Jahren, da fiel er mit einer schrecklichen Wunde an der Hüfte in Crass Creek aus dem Sattel. Er war damals dem Tod näher als dem Leben, aber er hat es geschafft.«
»Vor drei Jahren hat man auch die letzten drei ermordeten Arapahoes im Eagle Canyon gefunden«, sagte Lassiter. »Hat man diesen Mann, der in Crass Creek vom Pferd kippte, dahingehend nicht befragt?«
»Doch. Ihm war jedoch nichts nachzuweisen. Er berichtete, dass der Tomahawk aus dem Hinterhalt geworfen wurde und er sich mit letzter Kraft vor einer Handvoll Verfolgern retten konnte. Das Gegenteil war ihm nicht zu beweisen. Er lebt in Pinedale. Das ist ein Nest am westlichen Rand der Wind River Range. Sein Name ist Sterling Lloyd. Er betreibt eine Handelsstation, einen Saloon, ein Hotel und einen Mietstall.«
»Was weiß man von ihm?«, fragte Lassiter.