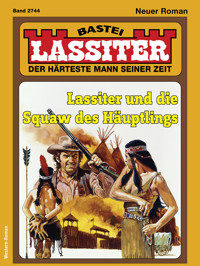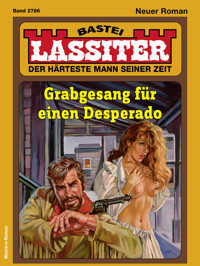Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Western: (499) Pete Hackett: McQuade - unterwegs in tödlicher Mission Wilfried A. Hary: John Steins Rache Wilfried A. Hary: Blutrache in Ghost Town City Pete Hackett: McQuade, vier Banditen und ein Town Marshal Pete Hackett: McQuade und die Colthaie von Tucson Ben Raider war nach Thompson gekommen, um seinen Bruder John zu treffen. Zehn Jahre hatten sie sich nicht gesehen, bis Ben von John einen Brief erhielt, in dem er ihn um Hilfe bat. Bei seiner Ankunft in dem gottverlassenen Nest begegnet man Ben feindselig – erst von der rätselhaften Saloonlady erfährt er, dass John tot ist. Ermordet! Schnell wird Ben klar, dass sie es auch auf ihn abgesehen haben – aber warum? Welches Geheimnis hatte John zu verbergen? Ben will seinen Bruder rächen, doch vorher muss er fliehen – in den Höllencanyon ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilfried A. Hary, Pete Hackett
Super Western 5er Band 1001
Inhaltsverzeichnis
Super Western 5er Band 1001
Copyright
McQuade - unterwegs in tödlicher Mission
John Steins Rache
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Blutrache in Ghost Town City
McQuade, vier Banditen und ein Town Marshal
McQuade und die Colthaie von Tucson
Super Western 5er Band 1001
Wilfried A. Hary, Pete Hackett
Dieser Band enthält folgende Western:
Pete Hackett: McQuade - unterwegs in tödlicher Mission
Wilfried A. Hary: John Steins Rache
Wilfried A. Hary: Blutrache in Ghost Town City
Pete Hackett: McQuade, vier Banditen und ein Town Marshal
Pete Hackett: McQuade und die Colthaie von Tucson
Ben Raider war nach Thompson gekommen, um seinen Bruder John zu treffen. Zehn Jahre hatten sie sich nicht gesehen, bis Ben von John einen Brief erhielt, in dem er ihn um Hilfe bat. Bei seiner Ankunft in dem gottverlassenen Nest begegnet man Ben feindselig – erst von der rätselhaften Saloonlady erfährt er, dass John tot ist. Ermordet! Schnell wird Ben klar, dass sie es auch auf ihn abgesehen haben – aber warum? Welches Geheimnis hatte John zu verbergen? Ben will seinen Bruder rächen, doch vorher muss er fliehen – in den Höllencanyon ...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
McQuade - unterwegs in tödlicher Mission
Der Kopfgeldjäger Band 73:
Western von Pete Hackett
Pete Hackett Western - Deutschlands größte E-Book-Western-Reihe mit Pete Hackett's Stand-Alone-Western sowie den Pete Hackett Serien "Der Kopfgeldjäger", "Weg des Unheils", "Chiricahua" und "U.S. Marshal Bill Logan".
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author
© der Digitalausgabe 2014 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
Der Umfang dieses Ebook entspricht 45 Taschenbuchseiten.
1
Vor McQuade lagen etwa hundertzwanzig Meilen durch die Felswüste; und er musste von sich und seinem Pferd das Letzte fordern, um zu verhindern, dass eine Truppe Freiwilliger, die der Tucson-Ring zusammenstellte, zu einem blutigen Rachefeldzug in die Gebiete der Chiricahuas zog.
Hinter dem Kopfgeldjäger lag ein mörderischer Kampf gegen vier Coltschwinger des Tucson-Rings. Er und Gray Wolf hatten das höllische Quartett auf zwei Mann reduziert, die jedoch beide verwundet und außer Gefecht gesetzt waren.
Tausend Strapazen und Entbehrungen erwarteten McQuade; Hitze, Staub, Klapperschlangen, Skorpione und – Apachen. Wenn er es nicht schaffte, war sicherlich ein brutales Gemetzel die Folge, das vielen Weißen und Roten den Tod bringen und neuem Hass Nahrung geben würde.
Der Kopfgeldjäger durfte den Falben nicht allzu sehr verausgaben. Auf die Kraft und die Ausdauer des Pferdes war er womöglich noch angewiesen in diesem wilden Land, in dem der Tod hinter jedem Busch, Hügel oder Felsen lauern konnte.
Die Sonne stand hoch, die Hitze war geradezu unerträglich, in der flirrenden Luft verschwammen die Konturen wie hinter einer Wand aus Wasser, eine große Plage waren auch die Stechmücken, von denen ein ganzer Schwarm Pferd und Reiter piesackten.
McQuade ritt durch die Ebene zwischen den Santa Catalina Mountains im Norden und den Tanque Verde Bergen im Süden. Überall hier wuchsen riesige Saguaro Kakteen, oft standen sie so eng zusammen, dass man von Saguaro Wäldern sprechen konnte. Dazwischen wucherten Kreosot, Comas und Mesquites. Es war ein karger, menschenfeindlicher Landstrich – aber von einer geradezu überwältigenden Schönheit. In diesem Land hatte nur derjenige eine Chance, der aus seinen Lektionen gelernt hatte und über die nötige Härte verfügte. Schwächlinge verschwanden sehr schnell in einem namenlosen Grab.
McQuade gehörte zu den Starken. Auch wenn der Ritt seinen Tribut von ihm forderte, am Abend des dritten Tages nach seinem Aufbruch in Tucson kam er in Fort Bowie an. Das Fort war zur Kontrolle des Apache Passes errichtet worden, von hier aus sollten auch die renitenten Chiricahuas unter ihren Häuptlingen Cochise und Geronimo, die in den Chiricahuas Mountains und in den Dragoons ihr Unwesen trieben, in Schach gehalten werden.
Das Fort war keine befestigte Anlage, es gab keine Wälle und Palisaden, denn die Armeeführung war der Ansicht, dass die Wachsamkeit der Soldaten größer wäre, wenn sie sich nicht hinter Erdhaufen und hölzernen Brustwehren verstecken konnten. Die Soldaten und niederen Offiziersränge, die tagtäglich mit einem Überfall der Apachen, die unberechenbar waren und völlig überraschend zuschlugen, rechnen mussten, waren anderer Ansicht.
Bei Fort Bowie handelte sich lediglich um eine Ansammlung von flachen Mannschaftsunterkünften, einer Kommandantur, Stallungen, Scheunen, Schuppen und Corrals rund um einen großen, rechteckigen Paradeplatz, auf dem ein von Hitze und Regen verkrümmter Fahnenmast aufgestellt worden war, an dem schlaff das Sternenbanner hing.
Zwei Doppelposten gingen Streife. Dort, wo ein schmaler Reitweg in das Fort führte, stand eine Wachbaracke.
Aus den Fenstern der Unterkünfte und der Wachbaracke fiel gelber Lichtschein. Aus der Kantine war das Durcheinander rauer Stimmen zu vernehmen. McQuade wurde angerufen. „Halt, wer da?“
Der Kopfgeldjäger zügelte den Falben. „Mein Name ist McQuade. Ich komme von Tucson herüber und muss unbedingt den Kommandeur sprechen.“
Gray Wolf legte sich auf den Boden und starrte in die Dunkelheit hinein, aus der sich die beiden Wachposten mit den Karabinern in den Fäusten näherten.
McQuade hielt die Zügel straff. Der Höllenritt über hundertzwanzig Meilen steckte ihm in den Knochen, er war erschöpft, verstaubt und verschwitzt.
Unter den Stiefelsohlen der Wachleute knirschte feiner Sand. Das Geräusch endete, als sie drei Schritte vor dem Texaner anhielten. Einer sagte: „Ja, ich kenne dich, McQuade. In welcher Angelegenheit musst du Major Havelock sprechen?“
„Es geht um die Apachen. In Tucson stellt man eine kleine Armee von Freiwilligen für eine Strafexpedition auf die Beine, nachdem die Apachen wieder einmal einen Wagenzug angegriffen haben.“
„Reite zur Wachbaracke und sag es dem Wachhabenden“, knurrte der Posten.
McQuade tippte lässig mit dem Zeigefinger seiner Rechten an die Hutkrempe, dann trieb er den Falben mit einem Schenkeldruck an. Gray Wolf folgte dem Pferd. Bei dem kleinen Wachgebäude saß der Texaner ab, klopfte gegen die Tür und öffnete sie, ohne die Aufforderung zum Eintreten abzuwarten. Ein Mann, ein Korporal, saß an einem Schreibtisch, auf einer Pritsche an der Wand lag ein zweiter Mann. Eine Tür führte in einen Nebenraum.
„Guten Abend“, grüßte McQuade.
„Ah, Sie sind es, McQuade“, kam es von dem Korporal. „Sie sehen ja aus, als hätte sie die Hölle ausgespuckt.“
In der Tat vermittelte der Kopfgeldjäger einen ziemlich heruntergekommenen Eindruck. Seine Augen lagen in tiefen, dunklen Höhlen, sein Gesicht schien noch hohlwangiger geworden zu sein, tagealte Bartstoppeln wucherte auf Kinn und Wangen, eine dünne Schicht aus Staub bedeckte sein Gesicht, staubig waren auch sein langer, brauner Mantel und die Stiefel mit dem brüchigen Leder.
„Ich komme aus Tucson …“ McQuade berichtete mit knappen Worten, was ihn durch die Wildnis getrieben hatte. Und eine Viertelstunde später traf er sich mit Major Havelock in der Kommandantur. Auch einige andere Offiziere, die von den wachfreien Kavalleristen informiert worden waren, fanden sich ein. Erneut berichtete der Kopfgeldjäger. Nachdem er geendet hatte, herrschte sekundenlanges, betroffenes Schweigen. Schließlich ergriff Major Havelock, ein im Dienst ergrauter Offizier mit dichten Koteletten, so genannten Sideburns, und einem dicken Schnurrbart, der seine Oberlippe völlig verdeckte, das Wort, indem er hervorstieß: „Diese elenden Dummköpfe! Wissen sie denn nicht, was sie mit einer solchen Strafexpedition anrichten? Wir sind seit Jahren bemüht, Cochise an unseren Tisch zu kriegen, und nun …“
Ein Captain sagte: „Ein Postreiter hat uns erzählt, dass man in Tucson ein Komitee für öffentliche Sicherheit gegründet hat. Ist diese Einrichtung etwa auch auf dem Mist des Tucson-Rings gewachsen?“
„Ich hab auch nur von diesem Komitee gehört“, antwortete McQuade. „Ich schließe aber nicht aus, dass der Tucson-Ring hinter der Gründung steckt. Aufgabe des Komitees ist es, Tucson vor indianischen Übergriffen zu sichern. Das Problem dürfte allerdings sein, dass sich in der Nähe von Tucson seit Jahren kein Apache mehr sehen ließ.“
„Und weil das so ist, schickt der Tucson-Ring seine Killer jetzt zu den Chiricahuas“, presste der Major zwischen den Zähnen hervor. „Zu dieser Strafexpedition darf es auf keinen Fall kommen“, sagte er mit erhobener Stimme. „Captain Williams!“
„Sir!“
„Sie reiten mit der A und B-Kompanie diesem Söldnertrupp entgegen und halten ihn auf, notfalls mit Waffengewalt. Stellen Sie diesen Leuten in Aussicht, dass wir jeden von ihnen, der auch nur einen Schuss auf einen Apachen abgibt, vor Gericht bringen. Die Apachen zur Raison zu bringen ist die Aufgabe der Armee. Wir lassen uns von diesen Leuten nicht in die Suppe spucken.“
„Wann soll ich aufbrechen, Sir?“, fragte der Captain, ein Mann um die dreißig, der in seiner Uniform wie frisch aus dem Ei gepellt aussah.
McQuade kannte den Captain nicht und vermutete, dass er noch nicht allzu lange in Fort Bowie Dienst versah.
„Morgen Früh noch vor Sonnenaufgang.“
„In Ordnung, Sir. Wenn Sie gestatten …“
„Gehen Sie nur, Captain, und sagen Sie den Leuten Bescheid.“
Der Captain erhob sich, salutierte, drehte sich zackig um und verließ das Büro.
Der Major wandte sich an den Kopfgeldjäger. „Ich denke, Sie reiten mit den beiden Kompanien nach Tucson, McQuade.“
Der Kopfgeldjäger nickte.
2
Als im Osten über den Bergen ein schmaler, heller Streifen den Sonnenaufgang ankündigte, waren die beiden Kompanien vollzählig angetreten. McQuade hielt sich ein wenig abseits. Captain Ben Williams – er wurde von zwei Master Sergeanten flankiert -, rief an die Mannschaften gewandt: „In Tucson spielen ein paar Dummköpfe verrückt, Leute. Wir haben die Order, zu verhindern, dass sie in die Apacheria ziehen und dort ein Blutbad anrichten - respektive dass sie von den Chiricahuas niedergemetzelt werden. – Lassen Sie aufsitzen, Master Sergeant McIntosh, und dann rücken wir ab.“
„Jawohl, Sir!“ Einer der Unteroffiziere salutierte, dann rief er mit Stentorstimme: „A-Kompanie – mount up!“ Die Hälfte der Reiter schwang sich auf die Pferde. „B-Kompanie – mount up!“ Nun saß auch die andere Hälfte auf.
Auf einen weiteren Befehl hin wurden die Pferde um neunzig Grad um die linke Hand gezerrt, dann erschallte es: „Fall in!“
Die Kavalleristen setzten ihre Pferde in Bewegung. Sie ritten in Dreierreihe, trotzdem war es ein langer Zug, der sich aus dem Fort in Richtung Süden bewegte. Sobald sie über den Apache Pass waren würden sie sich nach Westen wenden.
Drei Mescalero-Scouts ritten voraus, um den Weg zu erkunden und mögliche Gefahren zu umgehen, oder die Soldaten zu warnen, sodass sie sich rechtzeitig drauf einstellen konnten.
Die Dunkelheit lichtete sich mehr und mehr, die Sterne verblassten, die Jäger der Nacht begaben sich zur Ruhe und Vögel begannen mit ihrem Gezwitscher den Tag zu begrüßen. Die Geräusche, die der Zug produzierte, verschmolzen ineinander und rollten vor den beiden Kompanien her, so dass sie schon von weitem zu hören waren, wahrscheinlich ehe man sie sehen konnte.
McQuade ritt am Ende des Zuges. Gray Wolf trottete mit hängendem Kopf und aus dem Maul hängender Zunge neben dem Falben her. Dunkel und schweigend erhoben sich rechter Hand die mächtigen Berge und säumten drohend die Ebene, durch die sie zogen. Wispernd strich der frische Morgenwind an den kahlen Felsen entlang, raschelte in den Zweigen der halbverdorrten Sträucher und wühlte im Staub, der das ganze Land wie grauer Puder überzog.
Die Sonne schob sich über die Berge und grelles Licht flutete ins Land. Noch waren die Schatten lang, und die Hitze war erträglich. Aber das sollte sich sehr schnell ändern. Und als die Sonne fast senkrecht über ihnen stand und die Luft zu kochen schien, ordnete Captain Williams eine Pause an.
Die Soldaten schwangen sich von den Pferden, Wachen wurden eingeteilt, die Männer aßen von ihrem Proviant und tranken dazu brackiges Wasser aus ihren Feldflaschen. Längst hatten sie die Uniformjacken ausgezogen, zusammengerollt und hinter den Sätteln festgeschnallt.
Von den Scouts war nichts zu sehen. McQuade hielt sich auch jetzt etwas abseits. Er hatte Pemmikan gegessen und nun rauchte er eine Zigarette. Captain Ben Williams erregte seine Aufmerksamkeit, als er sich ihm näherte. Der Kopfgeldjäger schaute ihm entgegen, schließlich fiel der Schatten des Offiziers über ihn, und der Captain sagte: „Die Scouts sollten längst zurück sein. Ich mache mir Sorgen, McQuade.“
„Ich schließe nicht aus“, antwortete der Texaner, „dass wir längst von den Spähern der Chiricahuas beobachtet werden. Zwei Kompanien Kavallerie können sich nicht unbemerkt durch die Apacheria bewegen.“
„Müssen wir mit einem Angriff rechnen?“
McQuade zuckte mit den Achseln, dann meinte er: „Ich glaube nicht. Die Apachen wissen, dass zwei Kompanien Soldaten mit ihren Karabinern kaum zu schlagen sind. Es sind keine Selbstmörder, und weil das so ist, greifen sie nur an, wenn sie die Chance sehen, erfolgreich zu sein. Aber …“
McQuade brach ab.
„Warum sprechen Sie nicht weiter?“
„Ich will Sie nicht verunsichern, Captain. Aber ihre Kundschafter sind Apachen – wenn auch keine Chiricahuas. Als man anno 62 die Mescaleros zwang, nach Bosque Redondo ins Reservat zu gehen, flohen viele von ihnen und schlossen sich anderen Apachenstämmen - so auch den Chiricahuas an. Ihre Scouts sind wahrscheinlich noch immer ihren Brüdern, die sich nicht unterworfen haben, verbunden. Und wenn die Gelegenheit günstig ist …“
Erneut verstummte der Kopfgeldjäger.
„Sie denken, dass uns die Scouts verraten?“, kam es fast entsetzt von dem Captain.
„Ich schließe es zumindest nicht aus, Captain. Die drei wissen, dass in Tucson eine Armee aufgestellt wird, die in der Apacheria für Furore sorgen möchte. Die Order lautet sicherlich: Keine Gefangenen! Das gilt gleichermaßen für die Krieger wie für die Alten, die Squaws und die Kinder. Blut ist dicker als Wasser, Sir. Vielleicht nehmen die Kundschafter Kontakt mit herumstreifenden Kriegergruppen auf, um Cochise zu warnen.“
„Dann wird er ja auch erfahren, dass wir unterwegs sind, um diese Freiwilligenarmee zu stoppen.“
„Erwarten Sie nur nicht, dass er vor lauter Dankbarkeit ein Freund der Armee wird.“
Die Brauen des Captains schoben sich zusammen. „Das klang ziemlich sarkastisch, McQuade. Haben Sie etwa Verständnis für die Verbrechen, die die Rothäute an den Weißen, namentlich an der Armee begangen haben?“
„Man hat Cochise großes Unrecht zugefügt“, erwiderte der Kopfgeldjäger. „Deswegen hasst er die Weißen. Hätten ihm andere Indianer dieses Unrecht zugefügt, würde er sie hassen. Es ist also nicht ausschließlich wegen der Hautfarbe. Hier, im Südosten Arizonas, geschehen ständig irgendwelche Übergriffe auf Farmen, Ranches, Postkutschen und Goldgräbercamps. Und jeden dieser Überfälle schiebt man Cochise und seinen Chiricahuas in die Schuhe. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass die meisten dieser Verbrechen von Weißen selbst oder von mexikanischen Bravados, die immer wieder über die Grenze kommen, ausgeführt wurden. Im ganzen Land schreit man nach Cochises Kopf. Ist es verwunderlich, wenn er misstrauisch ist und sein Versteck nicht verlässt, um sich mit Vertretern der Armee oder Leuten aus Washington an den runden Tisch zu setzen?“
Jetzt schaute der Captain nachdenklich drein. Schließlich sagte er: „Sie sind ein sehr erfahrener Mann, McQuade. Und weil das so ist, möchte ich Sie bitten, nachzusehen, warum die Scouts nicht zurückkehren.“
„Eine Bitte, die ich kaum abschlagen kann“, murmelte der Kopfgeldjäger. Und fügte in Gedanken hinzu: Es geht schließlich um unser aller Sicherheit.
McQuade erhob sich …
3
Die Einsamkeit und die Stille der Berge umgaben McQuade und Gray Wolf. Die riesigen Felsen standen majestätisch und schier unüberwindlich wie riesige Grabsteine, Schweigen herrschte in der steinernen Welt.
Gray Wolf führte den Kopfgeldjäger auf der Spur der Scouts. Es ging durch enge, kühle Schluchten, über Hügel und Geröllfelder sowie windige Hochplateaus, die Vegetation war spärlich und erschöpfte sich in dornigem, verkrüppeltem Strauchwerk.
Als McQuade wieder aus einem ansteigenden Canyon auf eine felsige Ebene kam, die rundum von Felsketten begrenzt war, sah er im Südwesten ein Rauchsignal. Es war eine fast schwarze Rauchsäule, die unterbrochen wurde, um im nächsten Moment wieder senkrecht zum Firmament zu steigen.
Es war das Kommunikationssystem der Wildnis – und der Kopfgeldjäger gab sich keinen falschen Hoffnungen hin: es funktionierte.
Er wusste nicht, was die Rauchzeichen bedeuteten, doch ging er davon aus, dass sie mit Captain Ben Williams und seinen beiden Kompanien in Zusammenhang zu bringen waren.
McQuade hatte den Falben in den Stand gezerrt und beobachtete zwischen engen Augenschlitzen hervor die Rauchsignale. Sie ballten sich im Himmel zu kleinen Wolken, die träge nach Norden trieben und nach und nach vom lauen Wind zerfasert wurden.
Und die Rauchzeichen wurden beantwortet. Auch weiter westlich stieg dunkler Rauch in unregelmäßigen Abständen zum Himmel.
McQuade presste die Lippen zusammen, sodass sie nur noch einen dünnen, blutleeren Strich in seinem hohlwangigen Gesicht bildeten. Ein verbitterter Ausdruck kerbte sich in seine Mundwinkel. Möglicherweise sorgten die Rauchsignale für Aufruhr in der Apacheria. Denn wenn Cochise erfuhr, dass der Tucson-Ring gegen ihn ein ganzes Heer Freiwilliger, die nichts anderes wollten als töten, gegen ihn ins Fels schickte, würde er nicht tatenlos herumsitzen und warten, bis die ersten seiner Leute massakriert wurden. Er würde sich aber auch nicht darauf verlassen, dass die beiden Kompanien Kavallerie imstande waren, die gedungenen Mörder des Tucson-Rings aufzuhalten.
Die Zeichen standen auf Sturm. Der Satan verteilte wieder einmal die Karten für ein höllisches Spiel. Ungewiss war, wem er das Verliererblatt zuschob …
McQuade ruckte im Sattel und schnalzte mit der Zunge und der Falbe setzte sich prustend in Bewegung. Der Kopfgeldjäger lenkte das Tier in eine Schlucht, Gray Wolf lief vor ihm her. Plötzlich hielt der Wolfshund an, witterte mit erhobenem Kopf, um im nächsten Moment mit langen Sätzen davonzuschnellen. Irgendetwas hatte seine Aufmerksamkeit erregt – und sein Verhalten veranlasste McQuade, abzusteigen und das Gewehr zur Hand zu nehmen.
Einige Sekunden verstrichen, dann erschallte das Bellen des Wolfshundes. Die Echos zwischen den Felsen vervielfältigten es und die Felswände schienen es festzuhalten. McQuade führte den Falben am Zaumzeug weiter in die Schlucht hinein. Gray Wolf schwieg jetzt, kam sogleich dem Kopfgeldjäger entgegen, warf sich herum und lief bellend vor ihm her.
Und schließlich konnte McQuade sehen, was die Aufmerksamkeit Gray Wolfs erregt hatte. Es waren die Scouts. Verstreut lagen sie auf dem Grund der Schlucht herum – reglos und mit gebrochenen Augen, in denen das letzte Entsetzen ihres Lebens noch zum Ausdruck zu kommen schien. Aus jedem der Körper ragten einige Pfeile, einen hatten die Apachen sogar mit einer Lanze am Boden festgenagelt. Unzählige Fliegen krochen auf den Leichen herum, und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie Aasgeier und Coyoten anlockten.
Das Bild sprang dem Kopfgeldjäger mit erschreckender Schärfe in die Augen, er spürte die Übelkeit, die in seinen Eingeweiden zu rumoren begann, vergaß aber nicht, mit Blicken seine Umgebung zu erkunden und um sich zu sichern. Weit konnten ja die Apachen, die das hier angerichtet hatten, nicht sein.
Sie hatten nicht versucht, die Scouts zu bewegen, sich Cochise und seinen Guerillas anzuschließen, sondern sie als vermeintliche Verräter an der roten Rasse ohne zu zögern eliminiert. Sie waren dem Strom aus Unverständnis, Vergeltungssucht, Hass und Brutalität, der seit vielen Jahren die Menschen beider Rassen ins Unglück riss, zum Opfer gefallen.
Die Pferde der Kundschafter hatten die Apachen mitgenommen. Etwas, das auf unmittelbare Gefahr hindeutete, konnte der Kopfgeldjäger nicht entdecken.
Gray Wolf hatte sich auf die Hinterläufe niedergelassen. Er würde McQuade warnen, wenn er die Witterung von Apachen aufnahm. Den eigenartigen Tran- und Uringeruch, den die Kleidung der Indianer verströmte und der von der Gerbung mit genannten Mitteln herrührte, würde der Wolfshund von weitem riechen, vorausgesetzt der Wind stand richtig.
Für McQuade gab es hier nichts zu tun. Er rammte das Gewehr in den Scabbard, griff nach dem Sattelhorn, stellte den linken Fuß in den Steigbügel und riss sich in den Sattel. Der Kopfgeldjäger ritt den Weg zurück, den er gekommen war. Als ihn höchstens noch fünfzig Yards vom Maul der Schlucht trennten, zeigten sich einige Apachen. Sie traten aus Felsrissen und kamen hinter Felsblöcken hervor, die sich am Fuß der Felswand türmten, einige standen bis zu zwanzig Fuß über der Sohle der Schlucht auf Felsvorsprüngen.
Der Wind war aus der falschen Richtung gekommen.
McQuade stemmte sich derart jäh gegen die Zügel, dass der Falbe auf der Hinterhand einknickte. Er zählte sieben Krieger. Nur zwei von ihnen zielten mit Gewehren auf ihn, die anderen waren mit Pfeil und Bogen, Lanzen, Dolchen und Tomahawks bewaffnet. Bekleidet waren sie mit Hosen und Blusen aus hellem Leinen, über der Hose trugen sie einen Lendenschurz, die Füße steckten in kniehohen Wüstenmokassins. Farbige, um die Stirn gewundene Tücher umschlossen die langen, pechschwarzen Haare.
Die breitflächigen, mongolisch anmutenden Gesichter der Apachen muteten an wie aus Stein gemeißelt.
McQuade war schlagartig klar, dass er wieder einmal dem Tod ins unheimliche Antlitz sehen musste. Die tödliche Bedrohung, die von den Chiricahuas ausging, berührte ihn geradezu körperlich wie ein eisiger Hauch.
Von Gray Wolf kam ein gefährliches Knurren, der Kamm des Wolfshundes war aufgestellt und die Nackenhaare zitterten, seine Zähne waren gefletscht, die Lefzen über den Respekt gebietenden Fang gehoben.
Die Situation erforderte einen raschen Entschluss.
McQuade entschloss sich, es mit Worten zu versuchen, hob die rechte Hand, zeigte die Handfläche und rief: „Ich bin ein Freund der Apachen. Mein Name ist McQuade. Mit eurem Häuptling Cochise habe ich schon an einem Feuer gesessen.“
„Du ziehst mit den Pferdesoldaten durch unser Land“, rief einer, der der amerikanischen Sprache mächtig war. „Die drei Verräter, die euch geführt haben, haben wir für ihren Verrat bestraft. Und auch dich töten wir. Kein Weißer ist Freund der Chiricahuas.“
McQuades Hand war wieder nach unten gesunken. Die Atmosphäre war spannungsgeladen und die Luft schien zu knistern wie vor einem schweren Gewitter. Dem Kopfgeldjäger war klar, dass ihm ein Kampf auf Leben und Tod bevorstand. Er rechnete sich jedoch eine Chance aus, weil die Apachen nur über zwei Gewehre verfügten.
Und er handelte, hämmerte dem Falben die Sporen in die Seiten und zog zugleich den Revolver. Das Pferd sprang aus dem Stand an und streckte sich, Muskeln und Sehnen begannen zu arbeiten. McQuade begann zu feuern, sah einen der mit einem Gewehr bewaffneten Krieger zusammenbrechen, riss das Pferd nach links und hörte das andere Gewehr donnern. Ein Querschläger quarrte Ohren betäubend, und wieder bäumte sich der Colt auf in seiner Faust und die Kugel riss einen weiteren Apachen von den Beinen.
Pfeile flogen an ihm vorbei, einer schleuderte den Tomahawk, aber der Kopfgeldjäger zerrte den Falben mal nach links, mal nach rechts und bot so nur ein schlechtes Ziel.
Sein Leben hing an einem seidenen Faden.
Sein Pferd brach hinten ein. Er versuchte es hochzureißen, aber er bewirkte damit nur, dass das Tier zur Seite umkippte. Er schüttelte die Steigbügel ab, sprang auf die Beine, sah den Falben hochkommen und den Pfeil aus seinem linken, hinteren Oberschenkel ragen, und fiel dem durchgehenden Pferd in die Zügel. Das Tier stieg hoch und schlug mit den Vorderhufen nach ihm. Geschickt wich er aus, packte mit der linken Hand das Sattelhorn und schwang sich auf den Pferderücken.
Es war rasend schnell abgelaufen, und McQuade empfand es wie ein Wunder, dass er noch immer nicht getroffen worden war. Wie von Furien gehetzt stob das Pferd, von den Schmerzen und der Panik getrieben, davon. Dann war der Texaner durch. Er lag jetzt mit dem Oberkörper regelrecht auf dem Pferdehals, versenkte den Sechsschüsse im Holster und peitschte den Falben mit dem langen Zügel. Die Hufe des Tieres schienen kaum den Boden zu berühren, die Gegend flog geradezu an dem Kopfgeldjäger vorbei, die Hufe trommelten auf dem Fels, dass es knallend von den Felswänden widerhallte.
Das enttäuschte Geheul der Apachen folgte dem Texaner, der den Falben um Ende der Schlucht herumriss und in den Schutz der Felsen rechterhand sprengte.
McQuade registrierte, dass Gray Wolf dicht hinter dem Falben lief und scheinbar unverletzt geblieben war.
Der Kopfgeldjäger hielt erst an, als der Falbe nur noch dahintaumelte. Schaum stand vor den Nüstern des Pferdes, es röchelte und röhrte, sein Fell war nass vom Schweiß und seine Flanken zitterten.
McQuade befand sich in einer staubigen Mulde zwischen einigen Hügeln und Felsen, in der hartes, ungenießbares Büschelgras und Kakteen ein kärgliches Dasein fristeten. Der Pfeil ragte aus dem Schenkel des Falben, und er verstopfte die Wunde dermaßen, dass nur ein dünner Blutfaden aus ihr sickerte. McQuade brach vorsichtig den Pfeil ab. Das Stück des Schafts, das jetzt noch aus dem Pferdekörper ragte, war nicht einmal mehr handlang. Den Pfeil aus der Wunde zu ziehen wagte der Texaner nicht, denn die Spitze konnte über einen Widerhaken verfügen und er würde dem Tier nur eine unnötige Wunde reißen, einen großen Blutverlust riskieren und ihm schlimme Schmerzen bereiten.
Er tätschelte dem Falben den Hals. „Du wirst das schon aushalten, mein Freund. Wenn wir im Camp sind, wird sich ein Sanitäter um dich kümmern und dir die Pfeilspitze herausschneiden.“
Der Falbe prustete und scharte mit dem linken Vorderhuf den Boden auf.
McQuade lud den Revolver nach, dann ritt er weiter. Er rechnete fest damit, dass ihn die Apachen verfolgten. Er hatte verdammt großes Glück gehabt. Ob es ihm hold blieb? Darauf wollte sich der Kopfgeldjäger nicht verlassen.
4
McQuade ritt aus den Bergen und wandte sich nach Norden, wo Captain Williams mit seinen Soldaten auf seine Rückkehr wartete. Er war hellwach und angespannt, achtete auf die Zeichen der Natur, die möglicherweise Gefahr signalisierten, seine Augen waren unablässig in Bewegung.
Der Kopfgeldjäger ließ den Falben im Schritt gehen. Er wollte das Tier so gut es ging schonen. McQuade konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass er von tausend Augen beobachtet wurde – ein Gefühl, das ein seltsames Kribbeln zwischen seinen Schulterblättern auslöste. Die Gefahr, die von den Apachen ausging, war allgegenwärtig.
Und dann kamen sie wie erwartet. Sie hatten ihm durch die Berge den Weg abgeschnitten und nun stoben sie aus einem Ausschnitt zwischen zwei Hügeln, stießen Nerven zermürbendes, spitzes Geschrei aus und bearbeiteten ihre Mustang mit den Fersen. Die schwarzen Haare flatterten im Reitwind, die Pferde stoben mit aufgerissenen Mäulern dahin, Staub quoll unter ihren Hufen in die Höhe.
Es war ein Bild von heidnischer Schönheit – aber auch erschreckend in seiner Unmissverständlichkeit.
McQuade spornte sein Pferd an, zerrte es halb um die rechte Hand und galoppierte nach Osten, tiefer hinein in die Ebene, die sich meilenweit, bis über den San Simon Creek hinaus erstreckte. Natürlich gab es Bodenfalten und Hügel, und sporadisch erhoben sich sogar Felsen aus dem Boden, allenfalls hüfthoch, von der Erosion rund geschliffen und an schlafende Nashörner erinnernd.
Die Chiricahuas folgten ihm. Nun hatten sie ihr schrilles Geschrei eingestellt, aber der Eindruck von Wucht und Stärke und der Strom des Vernichtungswillens, der von der kleinen Schar ausging, waren nicht zu übersehen.
Der Kopfgeldjäger ritt einen weiten Bogen und gelangte wieder zwischen die Felsen. Eine ganze Weile zog er durch das Labyrinth aus Schluchten und Canyons, dann stellte er den Falben im Schutz einiger haushoher Felsen ab, band ihn an und glitt mit dem Gewehr in der Hand zu einem Felsblock, der am Fuß eines Hügels lag und gute Deckung bot.
Gray Wolf war verschwunden, als hätte ihn die Erde geschluckt.
McQuades Sinne waren aktiviert und arbeiteten mit doppelter Schärfe. Die Zeit verrann. Als über ihm loses Gestein kollerte und ein kaum wahrnehmbares Schaben in sein Gehör sickerte, glitt er um den Felsblock herum und postierte sich auf der anderen Seite, duckte sich und schmiegte sich eng an den Felsen.
Und nun konnte McQuade die huschende Gestalt oben auf dem Hügel wahrnehmen. Er riss das Gewehr an die Schulter, sein Zeigefinger verkrallte sich um den Abzug, er zog durch und spürte den Rückschlag. Sein Blei jaulte schräg nach oben. Der Schatten verschwand, und McQuade konnte nicht sagen, ob er getroffen hatte, dachte auch nicht länger darüber nach, denn nun ließen die Apachen die beiden Gewehre sprechen, die sie natürlich nicht zurückgelassen hatten, nachdem dem Kopfgeldjäger in der Schlucht der Durchbruch geglückt war. Mit ohrenbetäubendem Krach schickten sie ihre Geschosse die geröllübersäte Hügelflanke hinunter. Ein glühender Hauch raste an McQuades Kopf vorbei, der von einem grellen Zirpen begleitet wurde. Der Kopfgeldjäger zog sich hinter den Felsen zurück, um der Gefährdung durch Querschläger zu entgehen. Oben löste sich eine untersetzte, sehnige Gestalt aus dem Schatten eines Felsbrockens und hetzte geduckt ein Stück den Hang abwärts. McQuade sah auf diese kurze Distanz das maskenhaft verzerrte, breitflächige Gesicht, und folgte über die Zieleinrichtung der Henrygun jeder Bewegung des Apachen. Die anderen Krieger deckten den Felsen mit ihren Geschossen und Pfeilen ein. McQuade konnte hin und wieder sogar das Schwirren der zurückschnellenden Bogensehnen vernehmen. Aber er stand im toten Winkel zu den Chiricahuas und war nicht gefährdet.
Plötzlich schlug der Krieger einen Haken, in dem Augenblick, als McQuade abdrückte. Seine Kugel wirbelte Staub und Steinbrocken in die Höhe, und der Apache hechtete hinter einen Felsen.
Das Gewehrfeuer brach ab. Eine gutturale Stimme bellte irgendwelche Worte, die McQuade nicht verstand, und unvermutet wuchsen über den Hügelkamm die Gestalten zweier Krieger in die Höhe. Drohend schwangen sie die Tomahawks über ihren Köpfen, dann schnellten sie mit langen, raumgreifenden Sätzen den Hang herunter.
Noch war McQuade ruhig, aber es kostete ihm große Mühe angesichts der leidenschaftlichen und kompromisslosen Entschlossenheit der Krieger. Sie boten ein schlechtes Ziel, denn sie schlugen blitzschnelle Haken.
McQuade schoss, repetierte, schoss …
Einen der Krieger erwischte er im Sprung. Die Kugel riss ihn förmlich von den Beinen, und sekundenlang schien er schräg in der Luft zu hängen. Dann krachte er schwer zwischen scharfes Gestein, rollte noch ein Stück und blieb schließlich mit ausgebreiteten Armen auf dem Rücken liegen.
Der zweite wurde halb herumgerissen, ein dumpfer Aufschrei platzte über seine Lippen, er wankte und fiel auf die Knie. McQuade entging nicht der schreckliche, hassvolle Ausdruck in seinen schwarzen Augen, und er zögerte, dem Burschen endgültig den Garaus zu machen.
Da sengte eine Kugel heran, schrammte dicht neben dem Kopf McQuades über den Felsen und schleuderte ihm Splitter und Staub ins Gesicht. Er warf sich herum, strauchelte und knickte ein. Instinktiv öffneten sich seine Hände und suchten am Fels Halt, die Henry Rifle schepperte zwischen das Geröll.
Der Texaner sah keine zehn Yards von sich entfernt das fratzenhaft starre Gesicht mit den glühenden Augen, und er sah den Mündungsblitz, der aus dem Gewehrlauf hervorbrach. Er schleuderte sich vom Felsen weg, aber seine Reaktion kam eine Zehntelsekunde zu spät. Er wurde getroffen und konnte nicht verhindern, dass er noch weiter vom Felsen wegtaumelte und in die Knie ging. Von seinem Oberschenkel pulsierte der stechende Schmerz bis unter seine Schädeldecke und ein Stöhnen brach über seine Lippen. Aber sein Reflex war noch da. Er spürte den Revolverknauf in der Hand. Ziehen, spannen, zielen und schießen waren eine einzige, gleitende Bewegung. Dröhnend brach der Schuss, der Apache, der schon den Mund zu einem wilden Triumphgeheul aufreißen wollte, bäumte sich auf, dann schwang sein gedrungener Oberkörper nach vorn und sein Schrei erstarb. Er kam noch einmal hoch und stand einige Herzschläge lang wankend da, dann sackte er zusammen.
Den Schmerz ignorierend wirbelte McQuade herum. Sein Blick schnellte von einer möglichen Deckung zur anderen. Und dann humpelte er zurück zu dem Felsen, neben dem sein Gewehr lag. Er schnappte es sich und holsterte den Colt. Am Felsen vorbei beobachtete er den Hang. Mit der Linken tastete er nach seinem Oberschenkel, den die Kugel glatt durchschlagen hatte. Die Hose war mit Blut getränkt.
McQuade biss die Zähne zusammen. Denn nun kam der Schmerz mit Vehemenz und trieb ihm das Wasser in die Augen. Er lehnte das Gewehr an den Felsen, knüpfte sein Halstuch auf und band es über der Wunde um seinen Schenkel, zurrte es fest zusammen und hätte am liebsten aufgebrüllt, als die Schmerzen in seinem Körper zu explodieren schienen. Einige Augenblicke lang wurde es ihm schwarz vor den Augen, schließlich aber konzentrierte er sich wieder auf die anderen Apachen, die irgendwo in der Nähe stecken mussten.
Und er fasste den Entschluss, die Offensive zu ergreifen, denn er hatte keine Lust, sich hier festnageln zu lassen, bis die Kerle vielleicht Verstärkung erhielten. Es war nicht sehr wahrscheinlich, dass diese Handvoll Figuren alleine durch die Gegend streiften. Und in den Schluchten und Canyons rollten die Detonationen der Schüsse wie Donnerhall, und es war nicht auszuschließen, dass sie das scharfe Gehör ihrer Leute irgendwo in der näheren Umgebung erreichten. McQuade wollte weit weg sein, wenn sie kamen, denn auf eine Hetzjagd in der bizarren, unwirtlichen Bergwelt konnte er sich mit dem verwundeten Pferd und seinem durchschossenen Oberschenkel nicht einlassen. Die Apachen fanden sich hier in der Wildnis besser zurecht als Eidechsen und Skorpione.
Er spähte um den Felsblock herum, verdammte die Kraftlosigkeit seines zerschossenen Beins und humpelte los. In seinem Oberschenkel hämmerte und stach es wie verrückt. Das Bein war lahm und kaum noch zu gebrauchen. Ein Pfeil sirrte heran, prallte am Gestein ab und fiel zu Boden. McQuade erreichte den nächsten Felsbrocken und ging dahinter in Deckung. Im Hintergrund seiner Augen glomm grimmige Entschlossenheit.
Er stellte die Henrygun ab, zog den Colt, legte sich auf den Bauch und kroch in einer Geröllrinne nach links davon. Hinter dem Felsen oben rührte sich nichts. McQuade bewegte sich schnell und geschmeidig, das Toben und die Schwäche in seinem Bein nicht achtend.
Die Geröllrinne endete. McQuade schob sich auf dem Bauch den Hang hinauf und nutzte jeden Schutz aus, der sich ihm bot. Er kam unbehelligt oben an und machte rechter Hand einen Apachen aus, der nahezu am Felsen klebte und das Terrain unter sich mit Blicken abtastete. Das Gewehr lag neben ihm auf dem Felsen. Seine Faust umspannte den Kolbenhals.
McQuade rief den Krieger an.
Seine Stimme, hart wie Metall, ließ den Apachen herumfahren, geistesgegenwärtig riss er das Gewehr an die Seite und legte an. McQuade fackelte nicht lange. Tödliches Blei raste aus der Mündung seines Eisens. Es stieß den Apachen einige Schritte zurück, er stolperte, das Gewehr fiel aus seinen kraftlos werdenden Händen, und dann schlug der Krieger hin wie ein gefällter Baum.
Der Kopfgeldjäger hatte nichts gegen die Apachen. Wenn er einen tötete, dann gezwungenermaßen – wenn er, so wie jetzt, sein Leben verteidigen musste.
McQuade verlor keine Zeit, hinkte schräg den Abhang hinunter, holte sein Gewehr und humpelte weiter zu seinem Pferd. Rücksichtslos zerrte er den Falben am Zügel hinter sich her die Hügelflanke hinauf. Es war eine Überwindung, eine Anstrengung, die seinen ganzen Willen erforderte, und als er oben ankam, war er in Schweiß gebadet und beinahe am Ende seiner Kraft. Sein Herz raste, sein Atem flog regelrecht.
Wo waren die beiden anderen Krieger?
Und wo war Gray Wolf abgeblieben?
Ächzend stieg McQuade in den Sattel, trieb das Pferd über den Hügelrücken und lenkte es den Hang hinunter, stob über eine freie Fläche von etwa dreißig Yards und befand sich wieder im Schutz der Felsen. Herzschlag und Atmung nahmen wieder den regulären Rhythmus an. Er lauschte und witterte und ließ seinen Instinkten freien Lauf. Plötzlich glitt Gray Wolf aus einer engen Schlucht, stieg am Falben auf die Hinterläufe und fiepte. McQuade sah das Blut an seinen Lefzen und die blutverschmierte Schnauze, und ihm war klar, dass er den Rest der kleinen Kriegerschar nicht mehr zu fürchten brauchte. McQuade strich dem treuen Tier über den Kopf.
„Verschwinden wir, Partner!“, stieß er hervor und setzte den Falben in Bewegung. Gray Wolf ließ sich auf die vier Pfoten zurückfallen, bellte zweimal, als wollte er auf diese Weise seinen Triumph verkünden, dann folgte er dem Pferd.
5
McQuade erreichte den Lagerplatz, ritt bis zu dem Platz, an dem es sich Captain Williams und einige Unteroffiziere bequem gemacht hatten, stieg vorsichtig vom Pferd und sagte: „Ich habe die drei Scouts gefunden, Captain. Die Apachen haben kurzen Prozess mit ihnen gemacht. Sie werden von nun an ohne Kundschafter auskommen müssen.“
„Diese verdammten roten Teufel!“, presste Williams zwischen den Zähnen hervor. „Es waren ihre eigenen Leute.“
„In den Augen der Chiricahuas waren sie Verräter“, versetzte der Kopfgeldjäger und wechselte das Thema. „Ich habe Rauchsignale gesehen; im Südwesten und Westen. Was sie bedeuteten kann ich Ihnen nicht sagen, Sir. Ich vermute, dass sich die herumstreunenden Kriegergruppen davon in Kenntnis setzen, dass zig Kavalleristen in der Apacheria unterwegs sind, was den Apachen ziemlich ungewöhnlich erscheinen muss, sind sie doch nur Patrouillen von allenfalls zwei Dutzend Reitern gewöhnt.“
„Sie sind verwundet, McQuade“, konstatierte der Captain. „Hatten Sie einen Zusammenstoß mit den Apachen?“
„Eine kleine Gruppe stellte mich in einer Schlucht.“ McQuade zuckte mit den Achseln. „Ich konnte sie niederkämpfen. Allerdings hat auch mein Pferd etwas abbekommen.“
„Korporal Hastings!“, sagte der Captain.
Ein Mann erhob sich schnell und nahm Haltung an. „Sir?“
„Sagen Sie dem Sanitäter Bescheid; er soll sich um McQuade und das Pferd kümmern.“
„Jawohl, Sir!“ Der Korporal salutierte, machte kehrt und eilte davon.
„Sie sind sicher hungrig und durstig, McQuade“, sagte der Captain. „Setzen Sie sich zu uns.“
„Vielen Dank, Sir, aber ich muss mich um mein Pferd kümmern.“
„Das kann einer der Trooper übernehmen.“ Williams erteilte einen entsprechenden Befehl. An den Kopfgeldjäger gewandt fuhr er fort: „Wir müssen auch miteinander sprechen, McQuade. Also bitte, setzen Sie sich.“
McQuade ahnte, was der Captain mit ihm besprechen wollte. Fast widerwillig setzte er sich in den Kreis, den Williams sowie seine Kompanie- und Gruppenführer bildeten. „Sie möchten, dass ich Ihnen als Kundschafter diene, nicht wahr?“, kam es grollend von dem Texaner.
„Ja“, antwortete der Captain ohne Umschweife. „Sie verfügen über die Erfahrung, die ein Scout benötigt, außerdem haben wir denselben Weg. Das Ziel heißt Tucson. Und es ist doch so, dass wir auf Ihre Intervention hin reiten.“
„Nein, Sir, das sehe ich etwas anders“, widersprach der Kopfgeldjäger. „Sie reiten, um zu verhindern, dass noch mehr Blut fließt in diesem Land, das nur noch von Hass und Feindschaft regiert wird und in dem der Indianer nicht als Mensch sondern wie ein tollwütiges Tier behandelt wird.“
Einige der im Kreis Sitzenden kniffen die Augen zusammen, zwischen den Lidern funkelte es zornig, aber keiner sagte etwas. Im Grunde seines Herzens wusste jeder der Männer hier, dass McQuade nur die Wahrheit gesprochen hatte.
McQuade fuhr nach einigen Sekunden des betretenen Schweigens grollend fort: „In Washington bemüht man sich, Cochise dazu zu bringen, an Verhandlungen über einen dauerhaften Frieden teilzunehmen. Im April 65 ist es gelungen, mit Victorio und Nana zu verhandeln. Aber was hat man ihnen angeboten? Das Reservat von Bosque Redondo, einen Landstrich, in dem es nur unfruchtbares Land und alkalihaltiges Wasser gibt. Und nun sind einige Leute drauf und dran, das Wenige, das man bisher erreicht hat, ad absurdum zu führen, indem sie die Apachen wie wilde Tiere jagen und töten wollen. Das gilt es zu verhindern, Captain, und darum reiten Sie und ihre Männer.“
„Schon gut, schon gut, McQuade“, lenkte der Captain ein. „Ich will aber klarstellen, dass mein Verhältnis zu den Apachen ein anderes ist. Sie haben keinen Ehrenkodex, sie sind hinterhältig und mörderisch wie Skorpione, und sie führen ein Leben wie die wilden Tiere – um bei Ihrem Vergleich zu bleiben, McQuade. Sie fristen ihr Leben selbst dort noch, wo Klapperschlangen und Eidechsen keine Chance mehr haben.“
„Beenden wir dieses Thema“, schlug McQuade vor, der niemals im Leben versuchen würde, einen anderen auf seine ganz persönliche Meinung einzustimmen. Worte waren meistens in den Wind gesprochen, und ein solches Bemühen wurde nur allzu oft falsch ausgelegt. „Ich bin bereit, für Sie als Scout zu fungieren, Captain. Und ich schlage vor, dass wir bis zum Einbruch der Dunkelheit reiten. Wenn alles gut geht, können wir noch den Pass erreichen. Morgen früh ziehen wir dann auf die andere Seite.“
„In Ordnung“, sagte Williams, und an seine Unteroffiziere gewandt fügte er hinzu: „Die Männer sollen sich fertig machen und aufsitzen. Wir brechen in einer Viertelstunde auf.“
„Wir ziehen zwischen den Hügeln nach Süden“, erklärte McQuade. „Ich reite voraus und erkunde einen adäquaten Lagerplatz. Lassen Sie die Flanken der beiden Kompanien sichern, Captain. Ich schließe nicht aus, dass die Apachen einen Angriff wagen.“
McQuade drückte sich hoch, reckte die Schultern – und sah Korporal Hastings mit dem Sanitäter näher kommen. Als sie einen Schritt vor ihm anhielten, sagte der Sanitäter: „Ich habe ihrem Pferd die Pfeilspitze aus dem Schenkel geholt, McQuade. Und jetzt werde ich Sie verarzten. Ich denke, Sie sollten sich und dem Falben anschließend etwas Ruhe gönnen.“
„Das wird kaum möglich sein“, versetzte der Kopfgeldjäger.
6
Die nächsten Tage verliefen ohne Zwischenfälle. McQuade führte die beiden Kompanien über den Apache Pass, vorbei an den Ruinen der Pferdewechselstation, die die Butterfield Overland Mail Company bis vor einigen Jahren hier betrieb und die wegen des Aufstands der Apachen aufgelöst worden war. McQuade kannte die Geschichte. Der damalige Stationer, sein Name war Charles Culver, wurde von Cochise brutal ermordet.
Immer wieder beobachtete McQuade an verschiedenen Stellen die Rauchsignale der Apachen, einmal zeigten sich sogar vier berittene Krieger auf einem Hügelrücken, aber es erfolgte kein Angriff. Wahrscheinlich war keine der Apachengruppen stark genug, um einen Angriff wagen zu können, und um sich zu vereinigen fehlte es an der Zeit.
Die Truppe durchquerte das Sulphur Spring Valley, und am Spätnachmittag des vierten Tages nach dem Aufbruch in Fort Bowie erreichte sie den San Pedro River. Weiter westlich erhoben sich die Felsmassive der Tanque Verde Mountains.
McQuade wartete am Fluss auf Captain Williamson und seine Leute, als der Captain und ein Master Sergeant bei ihm anlangten, wies er mit dem linken Arm über den Fluss und sagte: „Die Arizona-Freiwilligen werden durch die Ebene zwischen den Tanque Verde Bergen und den Santa Catalina Mountains ziehen, um auf dem kürzesten Weg zum Apache Pass zu gelangen. Wenn wir hier warten, reiten sie uns direkt in die Arme.“
„In Ordnung“, kam es staubheiser von dem Captain. „Lassen Sie absitzen und lagern, Master Sergeant.“
Der Master Sergeant zog sein Pferd herum, ritt zu der wartenden Truppe und schrie einige Befehle.
McQuade sagte: „Ich reite morgen Früh über den Fluss und versuche herauszufinden, wann mit dem Auftauchen der Miliz zu rechnen ist.“
„Wir haben Ihnen eine Menge zu verdanken, McQuade“, kam es von Captain Williams, und es klang sehr ehrlich.
Der Kopfgeldjäger winkte ab. „Alles halb so schlimm, Captain. Außerdem ist es mir selbst viel daran gelegen, dass dieser Freiwilligentrupp aufgehalten wird. Hass erzeugt Gegenhass, aus Gewalt erwachsen weitere, brutalere Gewalttaten, und das Morden würde in diesem Landstrich niemals ein Ende finden. Das Schlimme an der ganzen Sache ist nämlich, dass es meistens Unschuldige erwischt – Leute, die mit dem Krieg nichts zu tun haben und auch gar nichts zu tun haben wollen.“
Die Nacht verlief ruhig. Als am Morgen noch die Flussnebel woben und der Himmel sich im Osten etwas heller zu verfärben begann, brach der Kopfgeldjäger auf. Da der San Pedro River infolge der langen Trockenheit nicht allzu viel Wasser führte, wurde McQuade nicht einmal nass, als er ihn durchquerte. Tief sanken am Ufersaum die Pferdehufe in den Schwemmsand und den Uferschlamm ein, schließlich aber hatte der Falbe wieder festen Boden unter den Hufen und er musste sich nicht mehr so sehr anstrengen, was auch seiner Verletzung gut tat. Auch McQuade spürte die Verletzung am Oberschenkel, es war ein Hämmern und Ziehen, aber die Schmerzen waren erträglich.
Der Texaner hielt auf die Berge zu, die im Morgendunst lagen und nur als graue, ineinander fließende Konturen auszumachen waren. Sehr schnell wurde es hell, der Himmel färbte sich blau, die Hitze nahm zu und bald war es lähmend heiß.
McQuade befand sich mitten in der Felswildnis, als er die Geräusche vernahm, die ihm entgegenkamen und wie fernes Rumoren an sein Gehör sickerten. Das waren Reiter – viele Reiter. Der Kopfgeldjäger lenkte den Falben eine Anhöhe hinauf, ließ das Pferd unterhalb des Kammes zurück und legte die letzten Yards zu Fuß zurück, wobei ihm Gray Wolf nicht von der Seite wich.
Die Geräusche wurden deutlicher. Und dann zogen die Reiter aus einer Schlucht – eine nicht enden wollende Reiterkette, die keine besondere Ordnung aufwies, und die von drei Männern angeführt wurde, die nebeneinander vor dem Pulk her ritten.
McQuade versuchte gar nicht, die Reiter zu zählen, er schätzte aber, dass es um die hundert waren. Sie waren allesamt mit Revolvern und Gewehren bewaffnet. Es war der personifizierte Tod in Gestalt mehrerer Dutzend vom Hass und von der Mordlust besessener Weißer, die von einer skrupellosen Interessengruppe manipuliert worden waren und die mit dem Entschluss im Herzen, gnadenlos Apachen zu töten, in die Apacheria zogen.
In den angespannten Zügen des Kopfgeldjägers arbeitete es krampfhaft, seine Kiefer mahlten, sein Blick drückte Abscheu aus. Jetzt wusste er mit letzter Sicherheit, dass sein Entschluss, nach Fort Bowie zu reiten, um die dort stationierte Kavallerie zu bewegen, den Irrsinn der brutalen Gewalt zu stoppen, richtig war.
„Verschwinden wir, Partner“, presste McQuade zwischen den Zähnen hervor, zog sich zurück, und als er von unten nicht mehr gesehen werden konnte, richtete er sich auf, lief zu seinem Pferd und stieg in den Sattel. Im Galopp ritt er zurück zum San Pedro River. Das Wasser spritzte, als er den Falben hindurch trieb, Captain Williams und seine Unteroffiziere sahen ihn kommen und schritten ihm entgegen. Am Flussufer trafen sie aufeinander. Fragend fixierte Williams den Texaner. McQuade sagte: „Sie kommen und sind nur noch etwa zwei Meilen vom Fluss entfernt. Es sind etwa hundert. Ich schlage vor, Captain, Sie verteilen Ihre Leute auf dieser Seite des Flusses, damit sie verhindern, dass die Meute ihn überquert.“
Der Captain nickte, schaute seine Kompanie- und Gruppenführer der Reihe nach an und knurrte: „Sie haben es gehört, Gentlemen. Wir machen es so, wie McQuade es vorgeschlagen hat. Sollte es hart auf hart kommen, gebe ich den Befehl, das Feuer zu eröffnen. Bevor ich es nicht befehle, fällt kein Schuss. Klar?“
Die Unterführer nickten, salutierten und stiefelten davon, um den Befehl auszuführen.
Mehr und mehr begann McQuade den Captain als klugen, umsichtigen Mann zu schätzen.
7
McQuade saß ab, führte den Falben ein Stück vom Fluss weg und beobachtete, wie die Kavalleristen in Stellung gingen. Die Soldaten verteilten sich auf eine Strecke von etwa einer halben Meile am Ufer. Der Captain kam zu McQuade und sagte: „Wenn man es sich richtig überlegt, McQuade, dann ist es ein Hohn, dass die Kavallerie die Apachen vor den Weißen beschützen muss.“
„Es ist notwendig“, versetzte der Kopfgeldjäger.
Der Captain nickte. Sein Blick verlor sich über dem Fluss in der Ferne.
Nicht ganz eine Dreiviertelstunde später kamen die Reiter aus Tucson ins Blickfeld McQuades und des Captains. Von ihnen ging eine höllische Verheißung aus, die Geräusche, die heranwehten, muteten an wie ein Vorbote von Unheil und Untergang.
Captain Williams kletterte aufs Pferd und rief einige der Unterführer zu sich. McQuade beschloss, sich im Hintergrund zu halten. Im Schritttempo rückten die Arizona-Volunteers näher. Williams und seine Begleiter verhielten in einer Reihe am Ufer des Flusses. An die Soldaten ging der Befehl, die Gewehre in die Hände zu nehmen.
Einer der Anführer der Miliz aus Tucson hob die rechte Hand und schrie einen Befehl. Die Horde kam zum Stehen. Die drei Führer ritten weiter und parierten am Westufer des Flusses die Pferde. Finster starrten sie die Soldaten am jenseitigen Ufer an.
Captain Williams ergriff das Wort, indem er rief: „Bis hierher, Leute, und keinen Schritt weiter. Jeder, der versucht über den Fluss zu kommen, muss damit rechnen, erschossen zu werden.“
„Es ist an der Zeit, mit dem roten Gesindel in den Dragoons und Chiricahua Mountains aufzuräumen!“, antwortete der mittlere der drei Reiter laut. Es war ein Mann um die vierzig mit einem dichten Bart, der sein Gesicht einrahmte und seinen Mund fast gänzlich verdeckte.
„Um die Apachen zur Raison zu bringen ist die Armee da“, versetzte der Captain. „Wegen der Chiricahuas hat man auch Fort Bowie gegründet. Die Armeeführung duldet nicht, dass Leute wie Sie Jagd auf die Apachen machen. Man ist nämlich an einem dauerhaften Frieden interessiert, und der ist nur möglich, wenn sich beide Seiten einander annähern und miteinander sprechen. Was Sie vorhaben ist keine Lösung – es wäre der Gewalt nur förderlich, und ein Friede würde in weite Ferne rücken.“
„Die Armee ist nicht in der Lage, die Apachen zur Raison zu bringen“, rief er Mann aus Tucson. „Vor wenigen Tagen wurde wieder ein Transportzug für Camp Grant von den roten Teufeln überfallen. Es vergeht fast keine Woche, in der nicht irgendein Übergriff geschieht. Man muss das Übel ausrotten, mit Stumpf und Stiel. Geredet wurde genug. Jetzt ist es an der Zeit …“
„Es sind nicht immer die Apachen, die die Überfälle verüben!“, unterbrach Williams den Mann. „Aber ich habe nicht vor, mit Ihnen zu diskutieren. Ich fordere Sie auf, mit Ihren Leuten umzukehren. Jeder, der über den Fluss kommt, wird erschossen oder festgenommen und vor das Kriegsgericht gestellt.“
„O verdammt, die Armee wendet sich gegen ihre eigene Rasse!“, brüllte einer der anderen Reiter aus Tucson. „Das darf doch nicht wahr sein. Ich werde jetzt in den Fluss reiten und ihn überqueren, und ich möchte mal sehen, wer es wagt, mich daran zu hindern. Das ist ein freies Land …“
„Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Rechte anderer beschnitten werden“, versetzte der Captain. „Ich habe die Order, zu verhindern, dass Sie auch nur einen einzigen Tropfen Apachenblut vergießen. Und ich werde es verhindern – mein Wort drauf.“
„Das wollen wir doch sehen!“, brüllte der Reiter wild und spornte sein Pferd an. „Folgt mir! Sie wagen es nicht, auf uns zu feuern. Damit würden Sie jeden Weißen im Land dazu bringen, auf die Barrikaden zu gehen. Mir nach, Leute!“
„Master Sergeant McIntosh – schießen Sie den Narren aus dem Sattel!“, befahl der Captain mit metallisch klingender Stimme.
Der Reiter hatte schon fast die Flussmitte erreicht, keiner folgte ihm jedoch. Fast gemächlich zog der Master Sergeant den Karabiner aus dem Sattelschuh, repetierte und hob das Gewehr an die Schulter.
Plötzlich schien der Bursche im Flussbett zu bemerken, dass seinem Aufruf, ihm zu folgen, niemand befolgte, und er sah das auf sich angeschlagene Gewehr und das kalte Auge, das ihn über Kimme und Korn anstarrte. Abrupt fiel er seinem Pferd in die Zügel.
„Warten Sie, Master Sergeant“, gebot Williams.
Der Mut des Mannes in der Flussmitte schien urplötzlich verraucht zu sein. Und als wäre der Funke der Unruhe auf das Pferd übergesprungen, begann es nervös auf der Stelle zu tänzeln. Der Mann zerrte und riss an den Zügeln, plötzlich wendete er das Tier und ritt zurück.
„Sie können nicht immer den San Pedro River abriegeln, Captain“, rief der bärtige Mann, der schon anfangs das Wort geführt hatte.
Darauf gab der Captain keine Antwort.
Einige Sekunden, in denen sich der Bärtige zu einer Entscheidung durchrang, verstrichen. Dann rief er: „Okay, wir kehren um. Aber denken Sie nicht, dass Sie damit etwas erreicht haben. Wie ich schon sagte: Sie werden zu Ihrem Standort zurückkehren und der Weg in die Apacheria wird frei sein. Die Sache ist lediglich aufgeschoben.“
„Wie ist Ihr Name?“, fragte Williams.
„Warum wollen Sie ihn wissen?“
„Damit ich weiß, an wen sich die Armee wenden muss, wenn Sie Ihre Drohung in die Tat umsetzen.“
„Mein Name geht Sie nichts an.“ Der Bursche zerrte sein Pferd um die rechte Hand und trieb es an, als die Nase des Tieres nach Westen ausgerichtet war. Die anderen folgten ihm. Bei der Reiterhorde fand eine kurze Debatte statt, dann wendeten sie alle ihre Pferde und ritten in die Berge zurück.
McQuade schaute ihnen hinterher, ebenso folgten ihnen die Blicke der Soldaten. Der Kopfgeldjäger konnte ein ungutes Gefühl nicht unterdrücken. Und als die Reiter aus Tucson in der Wildnis verschwunden waren und nur noch dünne Staubfahnen, die sich langsam auf den Boden senkten, ihren Weg markierten, trieb er den Falben neben das Tier des Captains und sagte: „Sie werden in den Bergen warten, bis Sie Ihre Leute abgezogen haben, Captain. Und dann setzen sie ihren Weg fort.“