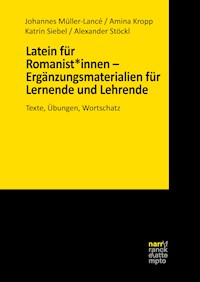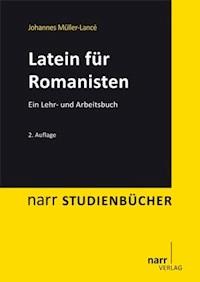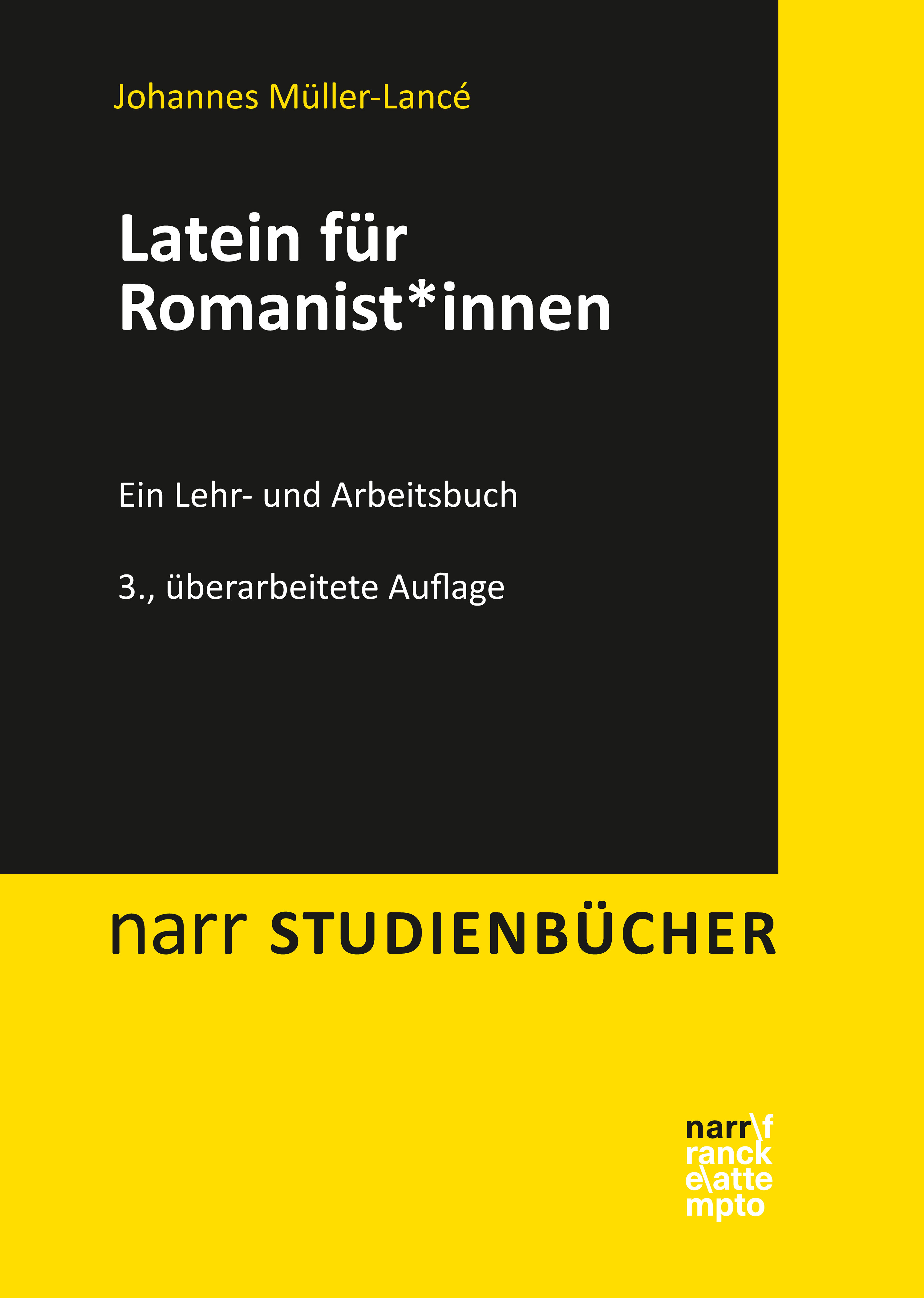
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: narr STUDIENBÜCHER
- Sprache: Deutsch
Das bewährte Lehr- und Arbeitsbuch Latein für Romanisten erscheint in der dritten Auflage mit leicht verändertem Titel, neu eingearbeiteter Fachliteratur und aktualisierten Internet-Adressen. Der Schwerpunkt des Buches liegt weiterhin auf dem Einblick in das Funktionieren des lateinischen Sprachsystems und auf der Vermittlung der Zusammenhänge zwischen dem Lateinischen und den daraus entstandenen romanischen Sprachen. Latein wird dabei konsequent als Tertiärsprache behandelt, d. h. bei der Vermittlung wird auf den Kompetenzen in früher erworbenen Fremdsprachen aufgebaut. Dem Autor ist es durchaus gelungen, trotz der Dichte des Stoffes ein überraschend durchsichtiges und überschaubares Lehrwerk zu schreiben, das keine der [...] Zielgruppen in irgendeiner Hinsicht enttäuschen dürfte: [...]. Summa summarum darf das Werk also sowohl aus altphilologischer als auch aus romanistischer Sicht als uneingeschränkt empfehlenswert gelten [...] Zeitschrift für Romanische Sprachen und ihre Didaktik 7,2 (2013)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johannes Müller-Lancé
Latein für Romanist*innen
Ein Lehr- und Arbeitsbuch
© 2020 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.narr.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-8233-8405-2 (Print)
ISBN 978-3-8233-0213-1 (ePub)
Inhalt
Vorwort zur dritten Auflage
Acht Jahre nach Erscheinen der Zweitauflage war es an der Zeit, das vorliegende Lehrbuch, das sich trotz digitaler Lernplattformen weiterhin großer Beliebtheit erfreut, erneut zu überarbeiten. Die vorgenommenen Änderungen betreffen insbesondere die weiterführenden Lektürehinweise und die Darstellungsform des Buchs.
Zunächst einmal wurde der Titel des Buchs verändert: Aus „Romanisten“ sind „Romanist*innen“ geworden. Marketingtechnisch ist es zwar gefährlich, einen gut eingeführten Markennamen zu verändern, aber ein Buch, das historischen Sprachwandel zum Thema hat, kann sich m. E. aktuellem Sprachwandel nicht verschließen, erst recht nicht, wenn er mit gesellschaftlichem Wandel einhergeht. Wir müssen einsehen, dass sich große Teile der Bevölkerung heute von dem – wenn auch sehr bequemen – generischen Maskulinum nicht mehr angesprochen fühlen oder das noch nie getan haben. Wie anachronistisch das generische Maskulinum, speziell im Singular, aber gerade im universitären Kontext bereits geworden ist, wurde mir deutlich, als ich im Oktober 2018 an einer deutschen Universität vor einem Schaukasten mit der Beschriftung „Student und Arbeitsmarkt“ stand und diesen nur sehr schwer mit unserem romanistischen Kontext, wo viele Studiengänge bis zu 90 % Frauenanteil aufweisen, in Verbindung bringen konnte. Das war der Moment, in dem ich beschloss, das vorliegende Buch umzutaufen. In gewisser Weise ist dadurch allerdings eine Mogelpackung entstanden: Der neue Titel „Latein für Romanist*innen“ suggeriert ein politisch korrektes Gendern, das im Buchtext selbst nur teilweise stattfindet. Diese Diskrepanz ist, wie könnte es anders sein, ein Kompromiss. Er entstand aus dem Bestreben, einerseits dem gendertechnischen Sprachwandel gerecht zu werden, insbesondere da sich das Studium der Romanistik immer mehr zu einer Frauendomäne entwickelt. Andererseits sollte aber die Lesbarkeit nicht zu sehr leiden, und eine Formulierung wie „Nachdem Augustus die Asturer*innen und Kantabrer*innen im Norden der Iberischen Halbinsel besiegt hatte“ (vgl. S. 42) hätte vielleicht doch eher für Heiterkeitseffekte gesorgt als für die Sicherung historischer Hintergründe. In geschichtlichen Kontexten haben wir uns an das Gendern einfach noch nicht gewöhnt. In sprachbeschreibenden und historischen Kontexten bleibe ich daher beim generischen Maskulinum.
Die zweite große Änderung betrifft die mediale Darstellungsform: Das Buch erscheint jetzt zusätzlich als e-book, und es erhält gewissermaßen ein Beibuch. Dieser Begleitband, ebenfalls auf Papier und digital erhältlich, ist unmittelbar aus den Erfahrungen erwachsen, die wir am Romanischen Seminar der Universität Mannheim beim Einsatz von Latein für Romanisten im Unterricht gemacht haben. Er enthält kommentierte Beispieltexte aus der lateinisch-romanischen Sprachgeschichte, weitere Übungen, Handreichungen für Lehrkräfte sowie einen lateinischen Minimalwortschatz, der sich an der Transferierbarkeit in die romanischen Sprachen ausrichtet. Dieser Begleitband, an dem neben meiner Mannheimer Kollegin Amina Kropp auch KollegInnen aus der Schulpraxis (Alexander Stöckl und Wolfgang Reumuth) und der Lateindidaktik (Katrin Siebel) mitgearbeitet haben, erscheint in Kürze ebenfalls im Gunter Narr-Verlag.
Die inhaltlichen Änderungen der Drittauflage betreffen in erster Linie die Einarbeitung neu erschienener oder überarbeiteter Fachliteratur, die Aktualisierung von Internetquellen sowie einzelne kleinere Korrekturen. An gewichtigen deutschsprachigen Neuerscheinungen seit der Zweitauflage sind beispielsweise das Grundlagenwerk Klassische Philologie und Sprachwissenschaft von Lothar Wilms (2013), die Romanische Sprachgeschichte von Georg Kaiser (2014), die Aufsatzsammlung Lateinische Linguistik von Roland Hoffmann (2018) und die von Volker Noll bearbeitete Neuauflage der Einführung in die Problematik des Vulgärlateins von Reinhard Kiesler (2018) zu nennen. International hat sich die Latinistik in den letzten zehn Jahren stark für moderne Linguistiktheorien geöffnet. Hinweise zu den wichtigsten Werken dieser Strömung sind ebenfalls in das Buch eingearbeitet.
Natürlich haben noch weitere Menschen zur Entstehung der Drittauflage beigetragen, denen ich Dank schulde: Zu nennen sind Tim Diaubalick, Georg Kaiser und Elias Köhler für ihre Korrekturhinweise nach penibler Lektüre der zweiten Auflage, meine Kollegin Amina Kropp, unsere Hilfskräfte Luisa Bauder, Melissa Berndt, Malina Kroffl und Viola Renner-Motz sowie Kathrin Heyng und Tina Kaiser vom Gunter Narr-Verlag.
Denzlingen, im Dezember 2019 Johannes Müller-Lancé
Vorwort zur zweiten Auflage
Die erste Auflage des vorliegenden Buches hatte noch kein Vorwort. Der Text, der 2006 zunächst als Vorwort gedacht war, geriet so ausführlich, dass er zur Einleitung aufgewertet wurde. Trotz aller in dieser Einleitung formulierten Vorbehalte darüber, was das Buch leistet und was nicht, hat es sich so gut verkauft, dass nach fünf Jahren eine Neuauflage ansteht.
Die Zweitauflage macht aber nun einige Angaben nötig, die sinnvollerweise gleich an den Anfang eines Buches gehören, nämlich Angaben zu Änderungen im Vergleich zur Erstauflage sowie Hinweise zur parallelen Verwendung verschiedener Auflagen im Unterricht. Entsprechend wird nun ein Vorwort eingefügt, das zwar die Seitenzählung beeinflusst, nicht jedoch die Nummerierung der Kapitel.
Hiermit ist das Wichtigste bereits gesagt: Die Kapitelgliederung und ihre Nummerierung ist im Vergleich zur Erstauflage unverändert geblieben. Dasselbe gilt für die Aufgaben und die Lösungen (bis auf kleine Optimierungen bei manchen Formulierungen). Auf diese Weise können Erst- und Zweitauflage parallel im Unterricht verwendet werden, wenngleich sich die Seitenzählung verändert hat.
Dennoch bietet die Zweitauflage einige Neuerungen: Das Literaturverzeichnis und die Lektüreempfehlungen wurden ergänzt und aktualisiert. Dabei wurde besonders darauf geachtet, dass die von Studierenden gerne verwendeten romanistischen Einführungswerke jeweils in ihrer neuesten Auflage zitiert werden. Die Quellenangaben aus wissenschaftlichen Klassikern bzw. Nachschlagewerken wurden hingegen in der ursprünglichen Form belassen, da nicht davon auszugehen ist, dass die Bibliotheken hier immer wieder die neueste Auflage anschaffen. Eingearbeitet wurden einige Neuerscheinungen zum Vulgärlatein, zum Sprachwandel und zur Geschichte der Romanischen Sprachen, allen voran die postume Publikation bisher unveröffentlichter Vorlesungen von Coseriu (2008) zum Lateinischen und Romanischen, herausgegeben und auf dem neuesten Forschungsstand annotiert von Hansbert Bertsch. Ebenfalls eingearbeitet wurde die bahnbrechende kontrastive Grammatik Latein-Deutsch von Kienpointner (2010). Weiterhin ist der Text an manchen Stellen, an denen er inhaltlich und formal zu komprimiert schien, durch zusätzliche Tabellen und andere Layout-Hilfen aufgelockert worden, die die Memorierung von bestimmten Sachverhalten unterstützen. Und nicht zuletzt wurden auch einige missverständliche Formulierungen verbessert. Erweiterungen erfuhr das Kapitel zu Latinismen im akademischen Kontext (Kap. 6.4.2), komplett überarbeitet werden mussten – naturgemäß – die Angaben zu den Internetquellen im Literaturverzeichnis: Einige Websites existierten nicht mehr, andere haben die Adresse geändert, und viele interessante Lateinportale sind hinzugekommen (s.S. 327ff).
Hinzugekommen sind auch Personen, die zu diesem Buch beigetragen haben und denen mein Dank gilt: Viele Kolleginnen und Kollegen gaben mir positives Feedback, konkrete Anregungen habe ich aber besonders von Bettina Boettcher, Michael Frings, Alexander Stöckl, Frédéric Trinques und Anna Zotova bekommen. Bei den Aktualisierungsarbeiten wurde ich von unseren studentischen Hilfskräften Coline Baechler, Heike Hettmann, Inga Reich, Johannes Renner, Elisabeth Walther und Luisa Zeltner tatkräftig unterstützt. Für die gute Zusammenarbeit bei der Fertigstellung der Druckfassung danke ich Kathrin Heyng vom Gunter Narr Verlag.
Denzlingen, im Dezember 2011 Johannes Müller-Lancé
1Einleitung
Warum sollen Romanist*innen überhaupt Latein lernen?
Studierende der Romanistik wären auch ohne Latein zeitlich ausgelastet: Von ihnen wird in den meisten Studiengängen erwartet, dass sie sich nicht nur mit einer einzigen, sondern mit mindestens zwei romanischen Sprachen befassen. Sie heißen also nicht umsonst „Romanist*innen“ (man möge mir nachsehen, dass ich in den deskriptiven Teilen dieses Buchs aus stilistischen Gründen weiter das generische Maskulinum verwende). Da obendrein die zielsprachliche Kompetenz der Romanistikstudierenden am Beginn des Studiums aus schulcurricularen Gründen meist geringer ausfällt als z. B. die von Anglist*innen, hätten sie bereits genug damit zu tun, sich die nötigen Kenntnisse in den verlangten romanischen Sprachen anzueignen.
Dennoch gibt es gute Gründe für Romanist*innen (und andere Neuphilolog*innen), zusätzlich zu den eigentlichen Zielsprachen auch das Lateinische in Grundzügen kennenzulernen:
Als „Mutter“ aller romanischen Sprachen bietet das Lateinische den Zugang zur frühen Sprachgeschichte der romanischen Sprachen. Diese frühe Sprachgeschichte – also die lateinische Periode – ist außerordentlich gut dokumentiert und gibt damit der Romanistik sprachhistorische Forschungsmöglichkeiten, die anderen Neuphilologien verwehrt sind.
Auch als das Lateinische schon längst nicht mehr im Alltag gesprochen wurde, hat es in schriftlicher Form noch viele Jahrhunderte lang (bis tief ins 19. Jh.) große Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in den romanischen und anderen Ländern geprägt (Verwaltung, Justiz, Kirche, Wissenschaft). Der direkte Zugang zu diesen Dokumenten bleibt dem Lateinunkundigen verwehrt.
Lateinkenntnisse sind der Schlüssel zum Verständnis der Eigenheiten der modernen romanischen Orthographien – ganz besonders gilt dies für das Französische.
Kenntnisse der römischen Literatur, Rhetorik, Philosophie und Mythologie sind unumgänglich für das Verständnis eines Großteils der europäischen Literatur.
Bis heute ist das Lateinische eine der produktivsten Quellen für die Neuschöpfung von Wortschatz in den romanischen Sprachen (und auch im Deutschen und Englischen; vgl. hierzu Mackowiak 2012 und Weeber 2016).
Kenntnisse des Lateinischen bieten ein verbessertes Verständnis von Fremdwörtern im Deutschen1 sowie von unbekanntem romanischem Vokabular.
Lateinkenntnisse erleichtern das Zurechtfinden im deutschen Universitätswesen, das trotz in den letzten Jahren einreißender Anglomanie (z. B. Ranking, Workshop, Staff-Meeting…) nach wie vor ganz wesentlich von lateinischer Terminologie geprägt ist (vgl. Kap. 6.4.2).
Über die Kenntnis lateinischer Vokabeln kann neu gelernter verwandter Wortschatz verschiedener romanischer Sprachen miteinander verknüpft und damit leichter memoriert werden (hierzu ausführlich Siebel 2017 und knapper Siebel 2018). Der zusätzlich erworbene lateinische Wortschatz ist also eine kognitive Investition und zahlt sich umso stärker aus, je mehr romanischer Wortschatz hinzugelernt wird.2
Aus der Perspektive der indogermanischen Sprachen kann das Lateinische als eine Art default-Sprache angesehen werden: Es bietet nahezu alle für deren Beschreibung notwendigen grammatischen Kategorien und wird daher gerne als tertium comparationis genutzt (also als ‚Vergleichsparameter’), wenn es darum geht, moderne Sprachen zu vergleichen. Aus diesem Grund ist die Grammatikterminologie aller modernen Schulsprachen (und sogar des Altgriechischen!) von den lateinischen Fachausdrücken geprägt, und aus diesem Grund wird auch Anglist*innen und Germanist*innen häufig das Latinum abverlangt, vor allem dann, wenn sie das Berufsziel „Lehramt“ verfolgen und später einmal Grammatik erklären sollen.3
Bei der Übersetzung aus dem Lateinischen ist man – anders als bei der Übersetzung aus kasusarmen Idiomen wie dem Englischen oder den romanischen Sprachen – gezwungen, sich der Kasusvielfalt des Deutschen bewusst zu werden. Speziell im Bereich der Pronomina neigt hier unsere Umgangssprache zur Verarmung, vgl. neuerdings toleriertes wegen ihm mit den korrekteren genitivischen Formen seinetwegen oder gar um seiner willen.
Die bei der lateinischen Übersetzung geübte morphosyntaktische Analyse ist die Basis jeder linguistischen Analyse. Wenn Anhänger*innen unterschiedlicher Schulen der modernen Syntaxtheorie miteinander diskutieren und das gegenseitige Verstehen gefährdet ist, dann kommen sie gerne auf die Kategorien der lateinischen Schulgrammatik als kleinsten gemeinsamen Nenner zurück. Jedes Latinum ist damit zugleich ein linguistisches Propädeutikum, und jede Linguist*in ohne Lateinkenntnisse trägt schwer an diesem Handicap.
Der Lateinunterricht kann im schulischen Kontext ein Ort sein, an dem Lernende unterschiedlichster Herkunft auf einen Gegenstand treffen, der sie zugleich verbindet und gleich stellt. Latein ist nämlich gewissermaßen (wenn man einmal den Bildungswortschatz beiseite lässt) eine „neutrale“ Sprache, die niemand als Muttersprache hat, und kann auf diese Weise eine Brücke zwischen Kulturen bilden (vgl. Kipf/Frings 2014). Vor allem aber können über den Erwerb von Lateinkenntnissen sozial bedingte Unterschiede bezüglich bildungssprachlicher Kompetenz effektiv ausgeglichen werden (vgl. Beyer 2017, Große 2014, 2017, Kipf 2018).
Zusammenfassend kann man sagen, dass Lateinkenntnisse für romanistische Literaturwissenschaftler*innen sehr hilfreich sind; für romanistische Sprachwissenschaftler*innen sind sie schlichtweg unverzichtbar.
Warum ein spezielles Buch „Latein für Romanist*innen“?
Noch vor 50 Jahren hätte ein Programm mit dem Titel „Latein für Romanist*innen“ nichts anderes bedeutet, als Eulen nach Athen zu tragen. Schließlich waren es in Deutschland vor allem Romanist*innen, die sich für das Lateinische aus sprachwissenschaftlicher Sicht interessierten, während die Klassische Philologie selbst sich überwiegend als Literaturwissenschaft verstand. Studierende der Romanistik aber brachten damals ihre Lateinkenntnisse bereits aus dem Gymnasium mit in die Universität, hätten also kein solches „Nachhilfe-Programm“ gebraucht.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ging der Anteil der Abiturient*innen mit Lateinkenntnissen stark zurück. Entsprechend forderten viele universitäre Fachdisziplinen, dass ihre Studierenden das sog. „Latinum“ während der ersten Studiensemester an der Universität nachholen. Diese Latinumskurse gehören bis heute zu den unbeliebtesten universitären Veranstaltungen überhaupt. Hierfür gibt es mehrere Gründe:
Um möglichst wenig Zeit von den Inhalten der eigentlich gewählten Studienfächer abzuziehen, beschränken sich diese Kurse auf das rein Sprachliche, d. h. vor allem auf Formenlehre und Syntax. Die römische Geisteswelt bleibt weitgehend ausgeklammert. Einziges Ziel ist das Bestehen der Latinumsprüfung, die fast ausschließlich Übersetzungskompetenz voraussetzt.
Wegen der Heterogenität der Lerngruppen (Theolog*innen, Jurist*innen, Historiker*innen, Philolog*innen…) kann nicht auf die speziellen Bedürfnisse der Fächer eingegangen werden. Verweise auf Zusammenhänge mit der Entwicklung der romanischen Sprachen bleiben z. B. außen vor.
Die Größe der Lerngruppen legt meist eine vorlesungsähnliche Unterrichtsform nahe.
Um zeitliche Kompatibilität mit den übrigen Lehrveranstaltungen zu gewährleisten, finden die Latinumskurse meist in unattraktiven Randlagen des Stundenplans statt, also am frühen Morgen oder am späten Abend.
Die Motivation der Lehrenden hält sich oft in Grenzen, weil sich das Programm ständig wiederholt und als Pflichtübung zum Broterwerb angesehen wird, die nicht zum wissenschaftlichen Renommé beiträgt.
Die Motivation der Lernenden ist gleichfalls gering, weil sie zur Teilnahme am Kurs gezwungen sind und sehen, wie ihre mit einem gymnasialen Latinum ausgestatteten Kommiliton*innen studientechnisch davonziehen.
All diese Faktoren haben NICHTS mit der Sprache Latein an sich zu tun. Sie führen aber zu dem bekannten Effekt, dass die Halbwertszeit des in Latinumskursen angepaukten Wissens extrem kurz ist. Schon nach wenigen Semestern stehen die Kenntnisse nur noch in sehr eingeschränktem Maße zur Verfügung – ganz anders als bei den Kommiliton*innen mit gymnasialem Latinum, deren Lateinkenntnisse oft noch nachwirken, ohne dass sie sich selbst dessen bewusst sind (vgl. hierzu Müller-Lancé 2006:467ff). Was bei den Absolvent*innen von universitären (oder kommerziellen) Latinumskursen hingegen deutlich länger anhält, ist eine ebenso unbegründete wie abgrundtiefe Abneigung gegen die Sprache Latein.
Diese unglückliche Situation ist in den Fächern schon lange bekannt. Dass man nichts daran geändert hat, liegt an interdisziplinären Koalitionen und Traditionen: Die Romanischen Seminare waren froh, dass sie die Latinumskurse nicht selbst halten mussten, die Seminare für Klassische Philologie konnten ihren wissenschaftlichen Nachwuchs mit Latinumskursen ernähren oder ihren Lehrkörper in einer Größe erhalten, die von den eigenen Studierendenzahlen her nicht zu rechtfertigen gewesen wäre.
Der sog. „Bologna-Prozess“, also die europaweite Umstellung auf gestufte BA- und MA-Studiengänge, hat die Situation schlagartig geändert: In einem auf sechs Semester verkürzten Studiengang ist nicht mehr viel Platz für das Nachlernen von Sprachen. Entsprechend verzichten jetzt Fächer, die in ihren alten Langstudiengängen noch das Latinum zur Eingangsvoraussetzung gemacht hatten, im BA auf diese Hürde. Dies gilt auch für romanistische Studiengänge. In letzter Zeit wurden in vielen Bundesländern sogar die romanistischen Lehramtsstudiengänge an diesen Trend angepasst, indem man die Forderung nach Lateinkenntnissen ganz aufgab oder den Universitäten frei stellte.
Hieraus ergibt sich ein neues Problem: Fachlich werden Lateinkenntnisse in der Romanistik nach wie vor gebraucht (s. o.), nur eben jetzt nicht mehr obligatorisch abverlangt. Es wird also künftig Romanist*innen zweiter Klasse geben, die bei jeder historischen Fragestellung aus Mangel an Lateinkenntnissen passen müssen. Um das zu verhindern, muss man diesen Studierenden einen knappen Lateinlehrgang bieten, den sie zur Not auch im Selbststudium durchlaufen können, und der genau die Lateinkenntnisse vermittelt, die sie als Romanist*innen benötigen. Ähnlich wie Mediziner*innen ihren latein-griechischen Terminologie-Schein machen,4 benötigen Romanist*innen also ein lateinisches Propädeutikum, das weniger auf Übersetzungskompetenz abzielt, sondern viel mehr auf Sprachreflexion,5 auf Einblick in den Ablauf von Sprachwandelprozessen und in die Zusammenhänge mit der Entwicklung der romanischen Sprachen. Dabei muss Latein als Tertiärsprache unterrichtet werden, d. h. die Vorkenntnisse der Romanist*innen in anderen Sprachen müssen gezielt für die Bewusstmachung und Memorierung lateinischer Formen eingesetzt werden (vgl. Müller-Lancé 2001a). Genau dies ist die Zielsetzung dieses Buches.
Was bietet das vorliegende Buch?
Dieses Buch hat drei Zielgruppen: zunächst einmal Romanist*innen, dann Neuphilolog*innen, die mindestens eine romanische Sprache beherrschen, und schließlich auch Klassische Philolog*innen, die Romanist*innen Latein beibringen. Erstere erhalten Informationen, die es ihnen erlauben, ohne zu erröten an sprachwissenschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen, und letztere erfahren, was ihre Kundschaft eigentlich für einen Bedarf hat. Das Buch ist also auch für Lateinlehrer*innen interessant, die an Lehrplänen und Lehrbüchern mitarbeiten und so als Multiplikator*innen dienen können. Was die Berücksichtigung der romanischen Sprachen angeht, so habe ich mich auf die drei in Deutschland meiststudierten und im Schulbetrieb etablierten Sprachen konzentriert, also auf das Französische, das Spanische und das Italienische. An einzelnen Stellen wird auch auf das Katalanische und das Portugiesische eingegangen, aber eben nicht systematisch.
Dieses Buch ist aus wissenschaftlicher Sicht so aktuell, wie man es von einer Einführung erwartet, erhebt aber nicht den Anspruch, die Forschung voran zu bringen. Neu ist vor allem die komprimierte Zusammenstellung von Standardwissen der Klassischen Philologie und der Romanischen Philologie in einem einzigen Buch.6 Neu sind aber auch einige Anwendungen aktueller sprachwissenschaftlicher Erkenntnisse und Terminologien auf das Latein als Objektsprache. Schließlich stammen die wichtigsten Darstellungen zur lateinischen Sprach- und Varietätengeschichte bereits aus der Mitte des letzten Jahrhunderts – immer wieder neu aufgelegt. Sie haben aber in den letzten Jahren Gesellschaft durch einige aus romanistischer Sicht gewichtige Neuerscheinungen bekommen: Müller 2001, Adams 2003, Poccetti et al. 2005, Euler 2005, Kiesler 2006 (neu aufgelegt: 2018), Janson 2006, Pinkster/Croon 2006, Coseriu 2008,7 Leonhardt 2009, Willms 2013, Adams 2013 und, systemlinguistisch ausgerichtet, Kienpointner 2010, Weddigen 2014, Oniga 2014, Ledgeway 2015, Danckaert 2017 und Hoffmann 2018. Sie alle sind in diese Einführung eingearbeitet.
Ich hoffe, dass diesem Buch kein tragisches Schicksal beschieden ist, und zwar tragisch im antiken Sinne: Es könnte nämlich passieren, dass ein Buch, das geschrieben wurde, um die Position des Lateinischen im Wissenschaftsbetrieb zu stärken, genau das Gegenteil erreicht (vgl. das abschreckende Beispiel der sog. „Karolingischen Renaissance“, hierzu Kap. 2.1.5). Würde nämlich das Beispiel vieler BA-Studiengänge Schule machen und überließe man die Aneignung von Lateinkenntnissen grundsätzlich der freiwilligen Eigeninitiative der Studierenden (z. B. auf der Basis des vorliegenden Buches), dann bedeutete dies das Ende universitärer Latinumskurse und damit eine erhebliche Schwächung der Seminare für Klassische Philologie, ganz zu schweigen von den möglichen Auswirkungen für den gymnasialen Lateinunterricht.
Daher möchte ich betonen: Dieses Lehrwerk ist ein Notprogramm. Wer es durchgearbeitet hat, weiß in etwa, wie die Sprache Latein entstanden ist, wo sie typologisch anzusiedeln ist, wie sie funktioniert, wie sie sich romanisch weiterentwickelt und welche Präsenz sie bis heute hat. Er ist aber weit von echter Übersetzungskompetenz entfernt (dazu fehlt es v. a. an Wortschatzkenntnissen und an der Memorierung unregelmäßiger Formen – deshalb wird es ab 2020 einen Ergänzungsband mit entsprechenden Materialien geben) und hat schon gar nichts von der ästhetischen Seite des Lateinischen mitbekommen. Von den üblicherweise im gymnasialen Oberstufenunterricht vermittelten Kenntnissen der lateinischen Literatur und Philosophie will ich gar nicht erst reden.8 Da diese Dimensionen nicht in ein Lehrwerk von 332 Seiten zu pressen sind, hoffe ich, dass dieses Buch zur Initialzündung für eine weitergehende Beschäftigung mit dem Idiom wird, das sich von der Sprache Roms zu einer kulturellen Weltsprache entwickelt hat.
In anderen Bereichen aber – und hier wird die Not zur Tugend – enthält dieses Buch viel mehr Informationen, als in einem üblichen Latinumskurs an der Hochschule vermittelt werden, und zwar genau die Informationen, die Linguist*innen in Bezug auf das Lateinische benötigen. Vor allem werden diese Informationen in Vernetzung mit bekannten Elementen der romanischen Sprachen präsentiert und berücksichtigen auf diese Weise die berechtigten Forderungen der Mehrsprachigkeitsdidaktik (vgl. Müller-Lancé 2004 und Siebel 2017).
Der deutlichen Abgrenzung dessen, was dieses Buch im Vergleich zu einem traditionellen Lateinkurs leisten kann und will, dient die folgende Abbildung:
Im vorliegenden Buch berührte Aspekte des Lateinischen
Wie soll dieses Buch genutzt werden?
Dieses Buch ist als Lehrbuch gedacht, und zwar sowohl für das Selbststudium als auch für den akademischen Unterricht. Es soll zum einen konkrete Lateinkenntnisse vermitteln, zum anderen aber Einblicke in das Funktionieren von Sprache allgemein und in den Zusammenhang zwischen Lateinisch und Romanisch im Besonderen.
Lehrbücher für Fremdsprachenlerner*innen gehen üblicherweise in Lektionen vor und servieren Wortschatz, Morphologie und Syntax gemischt, aber häppchenweise. Dies ist sinnvoll, wenn in einem Lehrgang, der sich über längere Zeit hinzieht, die Motivation hochgehalten werden soll. Vor allem ist dieses Vorgehen bei der ersten Fremdsprache einer Lerner*in von Vorteil. Wenn es sich hingegen um die zweite, dritte oder gar vierte Fremdsprache eines Individuums handelt, diese vorherigen Sprachen mit der neuen Zielsprache typologisch verwandt sind und obendrein keine zielsprachliche Übersetzungskompetenz, sondern lediglich ein struktureller Einblick angestrebt wird, dann ist es deutlich ökonomischer, nach Art einer Grammatik vorzugehen. Entsprechend wurde dieses Vorgehen für die vorliegende Einführung gewählt. Gleichzeitig hat diese Art der Darstellung den Vorteil, dass sie über das kleinschrittige Inhaltsverzeichnis gezielte Informationssuche erlaubt und damit sogar als Nachschlagewerk taugt.
Nach einem ausführlichen Kapitel zu den Varietäten des Lateinischen wird in den einzelnen systembezogenen Kapiteln jeweils separat der Bestand des Klassischen Lateins und des Vulgär- und Spätlateins dargestellt. Wo immer möglich und sinnvoll, wird dabei auf den Erhalt der entsprechenden Elemente in den romanischen Sprachen verwiesen. Die romanischen Sprachen sind also bewusst in die Darstellung des lateinischen Systems integriert.
An jedes größere Kapitel schließen sich Aufgaben an. Diese Aufgaben gliedern sich einerseits in reine Übungs- und Wiederholungsaufgaben und andererseits in weiterführende Aufgaben, die zur wissenschaftlichen Vertiefung anregen sollen. Nach Möglichkeit sind die Anwendungsübungen nach ihrem Schwierigkeitsgrad gestaffelt (vom Leichten zum Schweren). Zu allen Übungen finden sich Lösungsvorschläge in Kap. 9.
Man kann dieses Buch in unterschiedlicher Intensität rezipieren. Wer einfach nur einen Überblick über das lateinische Sprachsystem benötigt, kann sich darauf beschränken, die relativ ausführlichen Kapitel zu Morphologie und Syntax nur kursorisch zu lesen. Dann werden allerdings die entsprechenden Übungen deutlich schwerer fallen. Falls aber echte Lateinkompetenz das Ziel sein sollte, dann sind auch diese Kapitel zur intensiven Durcharbeitung empfohlen.
Wer zielsprachliche Übersetzungskompetenz anstrebt, der kommt um systematische Wortschatzarbeit nicht herum. In diesem Falle sollte eine der gängigen Wortkunden hinzugezogen werden, z. B. die auf Studierende der Romanistik und Anglistik abgestimmte Lateinische Wortkunde von Mader (2008) oder die für die gymnasiale Oberstufe konzipierte und ebenfalls die Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch berücksichtigende adeo-Wörterliste von Utz (2001). Tendenziell orientiert sich Mader eher an den romanistischen Bedürfnissen (hier sind also v. a. lateinische Wörter aufgeführt, die sich in allen romanischen Sprachen erhalten haben), Utz hingegen eher an den latinistischen Bedürfnissen (hier sind die wichtigsten lateinischen Wörter aufgeführt und gegebenenfalls durch romanische Entsprechungen ergänzt). Einen Minimalwortschatz, der beide Zielsetzungen berücksichtigt, offeriert Siebel (2017). Dieser Wortschatz ist in unseren neuen Ergänzungsband zu Latein für Romanist*innen integriert
Seltenere linguistische Fachbegriffe werden bei ihrem Erstauftreten in den Fußnoten erklärt. Ansonsten wird vorausgesetzt, dass die Leser*innen entweder eine linguistische Einführung besucht haben oder gerade an einer solchen teilnehmen.
Ein dem Lateinischen gewidmetes Buch kommt selten ohne captatio benevolentiae9 aus – aber hier ist sie besonders angebracht:
Natürlich kann das vorliegende Buch nicht die komplette lateinische Grammatik darstellen. Es geht hier also ausschließlich um Grundsätzliches, Regelmäßiges und Beispielhaftes. Die Unregelmäßigkeiten der lateinischen Formenlehre und die Feinheiten der lateinischen Syntax können lediglich angedeutet werden.
Ebenfalls unvollständig sind die Verweise auf die romanischen Sprachen. Aufgrund der sinnvollen räumlichen Beschränkung dieses Buches stand der Verfasser bei jeder Tabelle, bei jedem morphologischen oder lexikalischen Phänomen vor der Frage, ob er nach Möglichkeit alle romanischen Entsprechungen mit einbeziehen solle, oder sich eher für eine möglichst genaue Darstellung der lateinischen Verhältnisse entscheiden solle. Hier wurde in dubio pro lingua latina (‚im Zweifel für das Lateinische’) entschieden. Eine Auflistung der Entsprechungen in jeweils 10 bis 13 (je nach Zählung) romanischen Idiomen hätte das Buch zu unübersichtlich gemacht. Außerdem eint alle Leser dieses Buches das Interesse am Lateinischen – welche romanische Sprache jedoch dieses Interesse ausgelöst hat, wird von Leser zu Leser sehr unterschiedlich sein.
Ein Buch, das zugleich das lateinische Sprachsystem darstellen, einen Einblick in die romanische Sprachgeschichte geben und auch noch Erkenntnisse unterschiedlicher Richtungen der modernen Sprachwissenschaft anwenden will, wird zwangsläufig eine „eierlegende Wollmilchsau“: Den einen wird die Wolle kratzen, dem anderen die Milch sauer und das Schnitzel zäh erscheinen, und von den Eiern wollen wir eingedenk der Vogelgrippe gar nicht erst reden.
Dass schon die Erstauflage trotz dieser Zielkonflikte so erfolgreich war, verdanke ich auch folgenden Personen:
den Teilnehmer*innen meines Mannheimer Proseminars „Lateinisch-Romanisch“ aus dem Sommersemester 2006, die mit ihrer kritischen Testlektüre und als „Beta-Tester“ der Aufgaben viel zur Verständlichkeit des Buches beigetragen haben: Melanie Dalforno, Melanie Frank, Beate Friesen, Christine Fuchs, Iris Glasstetter, Carolin Graßmuck, Seven Gürpüz, Heiko Luithardt, Tetyana Muchnikova, Ulrike Mühlhäuser, Stefan Pfadt, Julia Poh, Sandra Pohland, Vanessa Rademacher, Bianca Rötzel, Miriana Schanz, Florian Schirmer, Carola Tulke, Nora Zencke;
den Kolleg*innen und Freund*innen, die mir historischen und sprachpraktischen Beistand geleistet haben: Kai Brodersen, Marilene Gueli Alletti, Francisco García, Caroline Mary, Pedro Molina Campos, Alessandra Volpe;
denjenigen, die hilfreich an der Endredaktion des Buches mitgewirkt haben: Jürgen Freudl vom Gunter Narr Verlag und unseren Hilfskräften vom Lehrstuhl Romanistik II: Nadine Bradt, Iris Glasstetter, Andreas G. Jacob, Vanessa Rademacher, Dominique Scharping, Natalie Suchan, Eva Volkwein, Hannah Weiß.
1.1Zeichenlegende
[a]
phonetische Umschrift
/a/
phonologische Umschrift
<a>
graphemische Umschrift
‚a’
Bedeutung
„a“
Zitat, direkte Rede oder feststehender Ausdruck
[…]
Auslassung in einem zitierten Text
a>A
‚wird zu’ (aus dem frühen Stadium einer Form entsteht ein späteres Stadium)
a=>b
‚wird ersetzt durch’ (eine Form wird durch eine andere ersetzt)
*a
rekonstruierte (und nicht belegte) Form
a, 3
dreiendiges Adjektiv (Endungen -us, -a, -um)
1.2Abkürzungsverzeichnis
Abkürzung
Auflösung
Abb.
Abbildung
abgek.
Abgekürzt
Abl(.)
Ablativ
Abl.Abs.
ablativus absolutus
AcI
accusativus cum infinitivo
adv. (Best.)
adverbiale (Bestimmung)
afrz./afr.
altfranzösisch
Akk(.)
Akkusativ
Akt.
Aktiv
AL
Altlatein
altlat.
altlateinisch
asp.
altspanisch
Aufl.
Auflage
BA-Studiengang
Bachelor of Arts-Studiengang
Bd./Bde.
Band/Bände
bearb.
bearbeitet
Bsp.
Beispiel
bspw.
beispielsweise
BWL
Betriebswirtschaftslehre
bzw.
beziehungsweise
C.
Gaius
ca.
circa
CIL
Corpus Inscriptionum Latinarum
Cn.
Gnaeus
c.t.
cum tempore
Dat.
Dativ
d.Ä.
der Ältere
Dekl.
Deklination
Det.
Determinante
Dez.
Dezember
d.Gr.
der Große
d.h.
das heißt
dir. (Obj.)
direktes (Objekt)
d.J.
der Jüngere
dt.
deutsch
dtv
Deutscher Taschenbuchverlag
engl.
englisch
Ep.
Epigramm
ep.
Epistel (‚Brief’)
ersch.
erschienen
et al.
et alii (‚und andere’)
etc.
et cetera
evtl.
eventuell
f /fem.
femininum
f (nach Ziffer)
folgende
FEW
Französisches Etymologisches Wörterbuch
ff
(fort) folgende
FN
Fußnote
fränk.
fränkisch
frz./fr.
französisch
Fut.
Futur
gal.
galizisch
Gen(.)
Genitiv
ggf.
gegebenenfalls
gr./griech.
griechisch
H.
Hälfte
histor.
historisch
Hor.
Horaz
hrsg./Hrsg.
herausgegeben/ Herausgeber
i.Allg.
im Allgemeinen
Iber.
Iberisch
IC(-Analyse)
immediate constituents (‚unmittelbare Konstituenten‘)
idg.
indogermanisch
Impf./Imperf.
Imperfekt
incl.
inclusive (‚einschliesslich’)
Ind./Indikat.
Indikativ
indir. (Obj.)
indirektes (Objekt)
Inf.
Infinitiv
it./ital.
italienisch
IR
Imperium Romanum (Römisches Reich)
J.C.
Jesus Christus
Jh.
Jahrhundert (ausgeschrieben UND als Abk. im Text)
JML
Johannes Müller-Lancé
Kap.
Kapitel
karoling.
karolingisch
kat.
katalanisch
KL
Klassisches Latein
Klass./ klass.
Klassisch
klat. /klass. lat.
klassisch lateinisch
km
Kilometer
km2
Quadratkilometer
KNG(-Kongruenz)
Kasus-, Numerus- und Genus- (Übereinstimmung)
Konj./ Konjunkt.
Konjunktiv
Konjug.
Konjugation
kons.
konsonantisch
korr.
korrigiert(e)
kurzvokal.
kurzvokalisch
lat.
lateinisch
ling.
linguistisch
LRL
Lexikon der Romanistischen Linguistik
masc./Mask./m
masculinum/Maskulinum
MA-Studiengang
Master of Arts-Studiengang
Mittelfrz./Mfrz.
Mittelfranzösisch
Mk
Markus-Evangelium
Mod.
Modifikator(en)
Mt
Matthäus-Evangelium
N
Nomen
n(.)/neutr.
neutrum
Nachdr.
Nachdruck
n.Chr.
nach Christi Geburt
NcI
nominativus cum infinitivo
Nom(.)
Nominativ
NP
Nominalphrase
Nr.
Nummer
nsp.
neuspanisch
Obj.
Objekt
okz.
okzitanisch
ostgerm.
ostgermanisch
Part.
Partizip
Pass.
Passiv
PC
participium coniunctum
Pf./Perf.
Perfekt
PFA
Partizip Futur Aktiv
Plpf(.)
Plusquamperfekt
Pl(.)/Plur.
Plural
port.
portugiesisch
PPA
Partizip Präsens Aktiv
PPP
Partizip Perfekt Passiv
praef.
praefatio (‚Vorrede, Einleitung’)
Prs.
Präsens
Pers.
Person
PUF
Presses Universitaires de France
Repr.
Reprint (Nachdruck)
röm.
römisch
roman.
romanisch
rr.
rätoromanisch (hier: Rumantsch Grischun)
RS
romanische Sprache
Rum./rum.
rumänisch
S.
Seite(n)
S
Satz
s.
siehe
sard.
sardisch
Sat./sat.
Satire; bei Petron: Satyrica
sc.
scilicet (‚ergänze’)
Sg./Sing.
Singular
sic!
wirklich so! (lateinisch) – keine Abkürzung!
SL
Spätlatein
s.o.
siehe oben
sog.
sogenannte(r/s/n)
SOV
Subjekt – Objekt – Verb
sp./span.
spanisch
spätlat./slat.
Spätlateinisch
SPQR
Senatus Populusque Romanus (‚der Senat und das römische Volk’)
s.t.
sine tempore
s.u.
siehe unten
SVO
Subjekt – Verb – Objekt
tosk.
toskanisch
u.
und
u.a.
unter anderem
u.ä.
und ähnliches
Übersetzg.
Übersetzung
Übers.
übersetzt
ugs.
umgangssprachlich
undekl.
undekliniert
uridg.
urindogermanisch
ursprüngl.
ursprünglich
u.U.
unter Umständen
usw.
und so weiter
UTB
Uni-Taschenbücher
v.
von
V
Verb
V.
Vers
v.a.
vor allem
v.Chr.
vor Christi Geburt
verb.
verbessert
vgl.
vergleiche
VL
Vulgärlatein
vlat./vulg.lat.
vulgärlateinisch
Vok.
Vokativ
VP
Verbalphrase
vs.
versus
WBG
Wissenschaftliche Buchgesellschaft
westgerm.
westgermanisch
wörtl.
wörtlich
z.B.
zum Beispiel
zit.
zitiert
z.T.
zum Teil
zw.
zwischen
1.3Verzeichnis der abgedruckten Originaltextauszüge
Textauszug
Seite
Appendix Probi
101
Bembo: Rerum Venetarum Historiae VI
162f
Caesar: Commentarii Belli Gallici I,1
240
Cicero: Catilinarische Reden I,1
295
Glosas Emilianenses
290f
Graffiti aus Pompeji
175
Itinerarium Egeriae II,1
176
Konzil v. Tours: Artikel 17
51
Martial: Epigramm 5,43
164
Petronius: Satyrica 46,5-7
275
Plautus: Miles Gloriosus, V.1-4
98
Straßburger Eide
211
Plinius: Epistel VI,20,13
198f
Vergil: Aeneis I,1ff
214f
Vulgata: Mt 4,1-3
260
Vulgata: Genesis 11,1-4
263
2Varietäten des Lateinischen
DAS Lateinische gibt es nicht. Wie bei allen uns bekannten Sprachen müssen wir auch beim Lateinischen von einem Bündel verschiedener Varietäten ausgehen.1 Dies leuchtet schon theoretisch ein: Eine Sprache, die über einen Zeitraum von ca. 2600 Jahren in einem Gebiet verwendet wurde, das phasenweise den gesamten Mittelmeerraum einschließlich Nordafrikas umschloss, kann nicht homogen und stabil gewesen sein. Aber auch handfeste sprachliche Belege dokumentieren uns die Vielförmigkeit des Lateinischen. In der Tradition italienischer Linguisten ist es sogar üblich, selbst die heutigen romanischen Sprachen noch als „lingue neolatine“ zu bezeichnen, also ebenfalls dem Lateinischen zuzurechnen. Umgekehrt könnte man mit dem gleichen Recht das Lateinische als ein bloßes Übergangsstadium zwischen dem Indogermanischen und dem Romanischen bezeichnen, wie dies Väänänen (1981:4) getan hat: „En effet, le latin, sous tous ses aspects, n’est qu’une transition entre deux états de langue, l’indo-européen et le roman“. Das Lateinische, das im (hoch-) schulüblichen Latinum abgeprüft wird, ist dagegen beschränkt auf die römische Literatursprache zu Lebzeiten von Cicero, Caesar und Augustus. Dieses sogenannte „Klassische Latein“ ist zwar von allen Varietäten am besten dokumentiert, umfasst aber nur einen winzigen Ausschnitt von etwa 100 Jahren und ist sowohl geographisch als auch pragmatisch, d. h. im Hinblick auf seine Verwendung, stark eingegrenzt.
Im Folgenden sollen die unterschiedlichen Varietäten des Lateinischen anhand der von Coseriu (z. B. 1980 oder 2008/1961:106ff) bekannt gemachten Diasystematik kurz außersprachlich charakterisiert werden. Coseriu unterscheidet diachronische (zeitliche), diatopische (räumliche), diastratische (gesellschaftliche) und diaphasische (stilistische) Varietäten.2 Die innersprachliche Perspektive folgt in den Kapiteln 3-6.
2.1Diachronische Varietäten des Lateinischen
Im Abschnitt über die diachronischen Varietäten des Lateinischen wird auch auf die jeweilige Ausbreitung des Römischen Reiches eingegangen, vor allem dann, wenn sie für die Romania von Belang ist.1 Weitere historische Informationen finden sich in der Zeittafel am Ende des Buches. Sodann ist vorauszuschicken, dass die üblichen Periodisierungen des Lateinischen aus dem 19. Jh. stammen (zu antiken Periodisierungsmodellen vgl. Müller 2005) und sich ausschließlich an der Literatursprache orientieren – einer Literatursprache übrigens, die uns fast nie in Originalmanuskripten des Autors (sog. „Autographen“), sondern in häufig deutlich später entstandenen Abschriften vorliegt.2 Die hier vorliegende Periodisierung berücksichtigt auch die Relevanz der jeweiligen Latein-Epoche für die Herausbildung der romanischen Sprachen.
Analog zur Periodisierung des Italienischen durch Krefeld (1988) und des Spanischen durch Bollée/Neumann-Holzschuh (2013:8) möchte ich bei meiner Periodisierung die auf Kloss (1978) zurückgehende Terminologie von „Sprachausbau“, „-abstand“ und „-überdachung“ auf die Epochen der lateinischen Sprache anwenden. Mit „Ausbau“ ist dabei die Entwicklung einer Schriftsprache und der Ausbau von Wortschatz, Morphologie und Syntax zu einem konsistenten System gemeint. „Abstand“ spricht den typologischen Unterschied zwischen parallel existierenden Idiomen an, und „Überdachung“ bezeichnet das Phänomen, dass ein im Ausbau befindlicher Dialekt andere Dialekte überlagert und selbst zur Hoch- oder Standardsprache wird.
Auf das Lateinische bezogen entspricht das Archaische Latein der Phase des Vorausbaus, die Ausbauphase beginnt mit dem Altlatein, und spätestens mit der Klassischen Epoche haben wir eine Sprache vorliegen, die wegen ihres Prestiges und wegen der dahinter stehenden politischen Macht, aber auch wegen der kommunikativen Vorteile, die in der Existenz einer gemeinsamen Verkehrssprache bestehen, die anderen zeitgenössischen Dialekte überdacht. Dass mit Überdachung keinesfalls völlige Verdrängung gemeint ist, sieht man an der bis heute für romanische Verhältnisse extrem lebendigen Dialektvielfalt Italiens.
In den folgenden Abschnitten wird bewusst darauf verzichtet, exemplarische Textauszüge zur Veranschaulichung der Epochen zu präsentieren. Dieser Verzicht basiert auf der Überlegung, dass ein Lateinanfänger in diesem frühen Lernstadium die Besonderheiten der entsprechenden Texte noch nicht erkennen kann. Solche Textauszüge werden daher erst in den sprachsystematischen Kapiteln angeführt und dort, entsprechend der Thematik des jeweiligen Kapitels, analysiert. Am Ende der folgenden diachronischen Abschnitte wird aber jeweils ein Verweis zu der Seite dieses Lehrwerks gegeben, an der sich ein passender Textauszug befindet.
2.1.1Archaisches oder vorliterarisches Latein (ca. 600- 240 v. Chr.)1
Schon relativ kurz nach der sagenhaften Gründung Roms (753 v. Chr.), die durch die Ausgrabung eisenzeitlicher Hütten auf dem Palatinshügel (9.-6. Jh. v. Chr.) zumindest zeitlich nachgewiesen werden kann (Coarelli 1989:137-140), sind die ersten sprachlichen Belege des Lateinischen dokumentiert.2 Der üblicherweise angeführte älteste Beleg ist eventuell eine Fälschung aus dem 19. Jh.3 Es handelt sich dabei um eine Inschrift auf einer Kleiderspange (fibula) aus dem 6. Jh. v. Chr., die nach ihrem Fundort Praeneste (heutiges Palestrina, 30 km süd-östlich von Rom) als Fibula Praenestina bekannt wurde. Die Inschrift ist von rechts nach links geschrieben und enthält in griechischen Buchstaben folgende Widmung: MANIOS MED VHEVHAKED NOUMASIOI. Im Klassischen Latein entspräche dies Manius me fecit Numerio (‚Manius hat mich für Numerius gemacht’).4
An dieser Inschrift lassen sich mehrere Dinge zeigen: Zunächst einmal die Tatsache, dass das lateinische Alphabet auf das griechische Alphabet zurückgeht (vgl. Kap. 3.1.1). Dann finden sich auch noch morphologische Parallelen zum Altgriechischen: Wie die Form Manios zeigt, lautete der Vorläufer der klassisch-lateinischen Nominativendung -us noch auf -os, hatte also dieselbe Form wie im Griechischen (vgl. die griechisch Matthaios und Markos genannten Evangelisten mit ihren lateinischen Entsprechungen Matthaeus und Marcus). Auch das archaische Reduplikationsperfekt vhevhaked, bei dem zur Perfektmarkierung eine Silbe vorangestellt wird, die schon im Präsensstamm enthalten ist (daher „Reduplikation“), ist im Griechischen häufiger als im Latein. So heißt es eben im Klassischen Latein nur noch fecit und nicht mehr *fefacit.5 Die Schreibungen <vh> für /f/ erinnern an die im Urindogermanischen verbreitete Aspiration (‚Behauchung’) der anlautenden Konsonanten, die sich im Griechischen länger erhalten hat als im Lateinischen (vgl. die deutsche Schreibung des Gräzismus Theologie).6 Im Lateinischen ist diese Aspiration bei den Verschlusslauten schon früh weggefallen, weshalb sie auch in den romanischen Sprachen fehlt. Im Deutschen und Englischen hingegen ist die Aspiration lautlich noch spürbar: vgl. die phonetische Realisierung des /t/ in dt. Tisch, engl. table und auf der anderen Seite frz. table. Das aspirierte [th] ist daher typisch für einen deutschen oder englischen Akzent beim Sprechen romanischer Fremdsprachen.
An den oben genannten und weiteren Phänomenen lässt sich fest machen, dass das Lateinische und das Altgriechische nicht nur einander benachbart (ab 800 v. Chr. siedeln Griechen in Süditalien und auf Sizilien), sondern auch miteinander verwandt sind. Beide gehören zu den indogermanischen Sprachen, wobei dem Griechischen üblicherweise ein eigener Ast im Stammbaum zugewiesen wird, während das Lateinische (bzw. die Dialektgruppe Latino-Faliskisch) nur einen Unterast am Zweig der italischen Sprachen darstellt; einen weiteren Unterast bilden die zeitgleich existierenden osko-umbrischen Sprachen. Die wichtigste nicht-indogermanische Sprache auf italienischem Boden war das Etruskische, das nördlich von Rom, vor allem im Gebiet der heutigen Toscana (Etrusker = lat. Tusci) gesprochen wurde.
In Abbildung 2 sind die wichtigsten indogermanischen Sprachengruppen von West nach Ost sortiert (nur die italische Gruppe ist in der Darstellung komplett ausgeführt). Einige Sprachen sind wohl isolierte Entwicklungen und daher keiner der Gruppen zugeordnet.7 Unsere heutigen romanischen Sprachen entstanden erst durch die spätere Vermischung des Lateinischen mit keltischen, germanischen und slavischen Sprachen.
Aus der frühen Periode des Lateinischen sind bis ca. 250 v. Chr. nur längere und kürzere Inschriften erhalten, so z. B. aus dem frühen 6. Jh. die sog. Duenos-Inschrift (Abb. 3) auf einem Drillingsgefäß, gefunden auf dem Quirinal in Rom, oder aus dem späten 6. Jh. v. Chr. die Inschrift auf einem Steinpfeiler – lat. cippus – neben dem sog. lapis niger – ‚schwarzer Stein’ –, gefunden auf dem Forum Romanum.8 Literarische Texte sind jedoch nicht erhalten, weshalb diese Periode auch als „vorliterarisches Latein“ bezeichnet wird. Viele Inschriften aus dieser Zeit sind noch nicht vollständig entziffert oder verstanden. Dies gilt auch für die Duenos-Inschrift, die folgendermaßen beginnt: IOVE/SATDEIVOSQOIMEDMITAT […], was üblicherweise wie folgt segmentiert wird: iovesat deiuos qoi med mitat. Ins Klassische Latein transformiert ergäbe dies iurat deos qui me mittit, also: ‚bei den Göttern schwört der, der mich übergibt’. Das Gefäß spricht also, genau wie die Fibula, in der 1. Person. Genannt ist auch der Hersteller, Duenos (> klat. Bonus), beim Rest der Inschrift bleibt aber vieles im Dunkeln (Baldi 1999:197ff).
Stammbaum der indogermanischen Sprachen (modifiziert nach Geckeler/Kattenbusch 1992:1 und Steinbauer 2003:504f)9
Duenos-Inschrift, 6. Jh.v. Chr. (aus Baldi 1999:198)
Was die Ausdehnung des lateinischen Sprachraums angeht, so deckt sich diese frühe Phase in etwa mit der Eroberung der italienischen Halbinsel (außer dem von Kelten besiedelten Oberitalien) sowie der Inseln Sizilien, Sardinien und Korsika durch die Römer. Verdrängt wurde in dieser Phase das Etruskische im Norden sowie das Griechische im Süden (Übergabe Tarents 272 v. Chr.).
Die folgende Karte gibt einen Überblick über die Sprachensituation Italiens im 5. Jh. v. Chr.:
Sprachen Italiens im 5. Jh. v. Chr. (aus Baldi 1999:119)
Nachzutragen bleibt, dass die Etrusker der Legende nach bis 510 v. Chr. (Entmachtung von Tarquinius Superbus und Gründung der Röm. Republik) den römischen König stellten, also sprachlich, kulturell und politisch mächtiger waren als die Latiner. Entsprechendes hatte für die Griechen im Süden gegolten. Nun aber war das Lateinische die Sprache Italiens geworden und hatte Etruskisch und Griechisch zu Substratsprachen10 degradiert. Der einzig verbliebene Rivale war die nordafrikanische Seemacht Karthago.
2.1.2Altlatein (ca. 240 v. Chr.–80 v. Chr.)
Das früheste literarische Schaffen lässt sich ab 240 v. Chr. nachweisen: Für dieses Jahr ist die erste Aufführung eines Dramas in lateinischer Sprache (es handelt sich um eine lat. Bearbeitung einer griechischen Vorlage) durch Livius Andronicus belegt.1 Livius war ein griechischer Kriegsgefangener, der nach der Übergabe Tarents nach Rom kam. Der früheste italische Dichter war Cn. Naevius, ein Veteran aus den sog. „Punischen Kriegen“,2 die das junge Rom mit dem nordafrikanischen Stadtstaat Karthago3 führte. Seine ersten Aufführungen sind auf 235 datiert. Die Werke beider Dichter sind aber nur sehr fragmentarisch oder in Aussagen von Zeitzeugen belegt.
Deutlich besser erhalten ist das Werk der beiden größten römischen Komödiendichter: Titus Maccius Plautus (ca. 250-184 v.Chr) werden etwa 130 Komödien zugeschrieben, von denen 21 fast vollständig erhalten sind (z. B. Miles gloriosus, Pseudolus, Stichus). Auf den in Karthago geborenen Publius Terentius Afer (‚der Afrikaner’; ca. 190-159 v. Chr.) gehen sechs Komödien zurück (z. B. Andria, Eunuchus, Adelphoe). Beide Autoren geben in ihren Komödien Einblick in das umgangssprachliche Latein jener Zeit: Plautus etwas derber, Terenz etwas feiner. Als weitere wichtige Autoren sind zu nennen: der Historiker und Satiriker Quintus Ennius (239-169) sowie der Historiker und Landwirtschaftsautor M. Porcius Cato (234-149), dem der berühmte Spruch „Ceterum censeo Carthaginem esse delendam“ (‚im Übrigen bin ich der Ansicht, dass Karthago zerstört werden sollte’) zugeschrieben wird.
Diese frühe Phase ist charakterisiert durch eine sprachlich sehr ursprüngliche, stark zweckgebundene Literatur (z. B. Aufführungen zu religiösen Festen), die häufig nur in Fragmenten erhalten ist. Da die lateinische Standardsprache noch nicht vollständig ausgebaut ist, finden sich relativ häufig Niederschläge der primären Nachbardialekte (vgl. Kap. 2.2). Phonetische Innovationen, die wohl bereits auf diese frühe Zeit zurückgehen, sind das Verstummen von /n/ vor /s/ (daher die Abkürzung „COS“ für consul) und das Verstummen von Auslaut-/m/ (lat. illustrem ,berühmt’ > frz. illustre, it. illustre, sp. ilustre). Nur in einsilbigen Wörtern bleibt es erhalten und macht erst beim Übergang zu den romanischen Sprachen einen lautlichen Wandel zu /n/ durch, z. B. lat. rem ‚Sache’ > frz. rien; lat. quem ‚wen’ > sp. quién (Seidl 2003:520). Syntaktisch gesehen zeigt sich bereits eine Hinwendung zur Hypotaxe, während die Satzperioden4 des archaischen Lateins eher von parataktischen Verknüpfungen gekennzeichnet waren (Devoto 1968:92ff und 110ff).
Politisch ist diese Zeit gekennzeichnet durch die Hochphase der römischen Republik mit einem mächtigen Senat und regelmäßig wechselnden Consuln (besonders berühmt die verschiedenen Träger des Namens Scipio und der sie umgebende Philosophenkreis), durch die ständigen Auseinandersetzungen mit dem Erzrivalen Karthago (die bereits angesprochenen Punischen Kriege) und durch die Expansion des Römischen Reiches in alle Himmelsrichtungen: nach Norden bis an die Alpen und Südfrankreich, nach Westen bis Spanien und Portugal, nach Süden bis Nordafrika und nach Osten bis Kleinasien (zu den einzelnen Eroberungsdaten und Provinzgründungen vgl. die Zeittafel S. 297ff).
Aus romanistischer Sicht werden hier also die süd-westlichen Grenzen der Randromania festgelegt, die ältere lateinische Sprachstufen konserviert als die Zentralromania. In diese Phase fällt auch das Zusammentreffen des Lateinischen mit weiteren Substratsprachen: dem Keltischen in Oberitalien, dem Ligurischen in Südfrankreich, dem Keltiberischen in Spanien und dem Lusitanischen in Portugal.
Zu beachten ist weiterhin, dass es sich bei der Ausdehnung nach Osten um ein vorwiegend politisches und weniger um ein sprachliches Phänomen handelte. Das Lateinische wurde nur bis an die Grenzen Griechenlands getragen (z. B. bei der Eroberung der Küste Dalmatiens 168 v. Chr.), der übrige Osten sprach weiterhin als Verkehrssprache Griechisch. Auch in Rom waren Griechischkenntnisse für gebildete Römer ein Muss, da man das militärisch unterlegene Griechenland als überlegene Kultur anerkannte. Lüdtke (2005:26) geht sogar so weit, für das spätrepublikanische Italien eine Diglossie-Situation im Sinne von Fishman (1967) anzunehmen, in dem das Griechische den Status des Akrolekts (bzw. high variety) und das Lateinische lediglich den Status des Basilekts (low variety) innehatte.
[Textbeispiel:
Plautus: Miles Gloriosus I,1,
s. S. 98]
2.1.3Klassisches und Nachklassisches Latein (ca. 80 v. Chr.- 180 n. Chr.)
Klassisches Latein (ca. 80 v. Chr.-117 n. Chr.):
Der Beginn des Klassischen Lateins wird üblicherweise mit den ersten öffentlichen Auftritten des berühmtesten römischen Redners, Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.), angesetzt. Seine ersten großen Gerichtsreden, die uns weitgehend erhalten sind, finden gegen 80 v. Chr. statt.
Dass die Rhetorik in dieser Epoche entscheidende Bedeutung erlangt, ist kein Zufall: Die Zeit ist charakterisiert durch Bürgerkriege, Triumvirate,1 Sklavenaufstände, Amtsmissbräuche hoher Staatsbeamter, den Verfall des Senatswesens und ständige Diskussionen um die ideale Staatsform – perfekte Karrierevoraussetzungen für einen gewieften Rhetoriker.
Die Republik, deren Verfechter Cicero (auch als Consul) stets gewesen ist, endet 49 v. Chr. mit der Machtübernahme des Diktators C. Julius Caesar (100-44 v. Chr.), dessen Kriegsberichte aus Gallien (Commentarii Belli Gallici) im Latinumskanon üblicherweise vor Ciceros Reden gelesen werden.
Auf Caesars Ermordung folgte ein zweites Triumvirat (das erste hatten Caesar, Pompeius und Crassus gebildet), aus dem dann, nach erneutem Bürgerkrieg, 31 v. Chr. Caesars Großneffe Octavianus als Alleinherrscher mit dem Ehrentitel Augustus (‚der Erhabene’) hervorging. Sein sogenannter „Prinzipat“ (v. princeps – ‚der Erste’), der bis zu seinem natürlichen (!) Tode 14 n. Chr. andauerte, markierte einen zweiten Höhepunkt der römischen Geschichte und läutete die Phase der Kaiserzeit ein.
Die (innenpolitische) Friedenszeit unter Augustus führte zu einer solchen literarischen Blüte, dass man für die Zeitspanne von der späten Republik bis zum ausgehenden Prinzipat (also 80 v. Chr. bis 14 n. Chr.) auch von der „Goldenen Latinität“ spricht. Während die erste Phase durch Ciceros Reden2 und philosophische Schriften (z. B. De re publica: ‚über den Staat’, De officiis: ‚über die Pflichten’, De natura deorum: ‚über das Wesen der Götter’), durch die Geschichtsschreibung Caesars und Sallusts (86-35 v. Chr.) sowie die Lehrgedichte von Lukrez (97-55 v. Chr.) und z.T. von Catull (84-54 v. Chr., bekannt auch für Schimpf- und Liebesgedichte) geprägt ist, erblüht unter Augustus die unterhaltende Dichtung, häufig gefördert durch den sprichwörtlich gewordenen Maecenas (vgl. dt. Mäzen). Politische Intentionen rücken in den Hintergrund, die sprachliche Ästhetik und private Moral in den Vordergrund. Zu nennen sind Autoren wie Vergil (70-19 v. Chr.; verfasste das röm. Nationalepos Aeneis sowie die Landgedichtsammlungen Georgica und Bucolica) und Horaz (65-8 v. Chr.: Satiren, Oden und Epoden) sowie die Liebeselegiker Tibull († 19 v. Chr.), Properz († nach 16 v. Chr.) und Ovid (43 v. Chr. - nach 16 n. Chr.), die bis heute – vor allem in den romanischen Literaturen – vorbildhaft wirken. Als herausragender Prosaschriftsteller der augusteischen Epoche ist lediglich der Historiker Titus Livius (59 v. - 17 n. Chr.) zu nennen.
Die literarische Epoche von Augustus’ Tod (14 n. Chr.) bis zum Regierungsantritt Hadrians (117 n. Chr.) wird in der Literaturwissenschaft als „Silberne Latinität“ bezeichnet und gelegentlich bereits dem nachklassischen Latein zugerechnet.3 Die Form der Dichtung rückt jetzt mehr und mehr in den Vordergrund, und die literarische Produktion geht eher in die Breite als in die Spitze. Entsprechend kommen berühmte Autoren zunehmend aus den eroberten Provinzen: so z. B. aus Spanien der Philosoph Seneca († 65 n. Chr.), der Rhetoriker Quintilian (ca. 35-95 n. Chr.) und der für seine Epigramme bekannte Martial († um 102). Als Historiker sind der jüngere Plinius, dem wir Berichte über den Vesuv-Ausbruch von 79 n. Chr. verdanken, und vor allem Tacitus († nach 115) zu nennen. Aus linguistischer Sicht aber handelt es sich bei der Sprache dieser Autoren zweifelsohne noch um Klassisches Latein. Eine Ausnahme bildet das Petronius († 66) zugeschriebene Satyricon (auch: Satyrica), von dem noch die Rede sein wird, weil hier die Volkssprache Eingang in die Literatur findet.
Mit dem Übergang von dem aus Spanien stammenden und damit ersten provinzialrömischen Kaiser Trajan zum gleichfalls in Spanien geborenen Hadrian (117 n. Chr.) wird üblicherweise das Ende der klassischen Epoche angesetzt. Der Grund für die Grenzziehung ist außersprachlicher Natur und liegt in der maximalen Ausdehnung, die das römische Weltreich in diesem Jahr erreicht hat.
Die folgende Karte zeigt die Dimensionen dieser Ausdehnung im Vergleich zur heutigen Ausdehnung der europäischen Romania. Eingezeichnet sind außerdem die wichtigsten Verbindungsstraßen des Imperiums.
Ausdehnung des Römischen Reiches unter Augustus und Trajan verglichen mit der europäischen Romania (aus Bertram et al.1995: Umschlag)
Nachklassisches Latein (117-180):
Die 117 n. Chr. einsetzende Periode der sog. „Adoptivkaiser“4 Hadrian († 138), Antoninus Pius († 161) und Marc Aurel († 180) gilt zwar als eine der glücklichsten Epochen im Inneren des Römischen Reiches, aber es mehren sich doch die Grenzkonflikte, und man führt zunehmend Rückzugsgefechte. Die genannten Kaiser beschäftigen sich mit Philosophie und Menschenrechten, und zunehmende Kreise der Bevölkerung erhalten Zugang zur Bildung, aber die literarische Spitzenproduktion bleibt aus. Das Kunstideal ist bereits rückwärts zur augusteischen Epoche hin gewandt (man spricht daher auch von der „archaisierenden Periode“), die damalige sprachlich-formale Perfektion wird jedoch nicht mehr erreicht. Entsprechend gilt die Literatursprache aus der Zeit der Adoptivkaiser heute als „Nachklassisches Latein“. Wichtigste Autoren sind der Kaiserbiograph Sueton († zw. 130-140) und der um 170 gestorbene Romancier Apuleius (seine Metamorphoses sind bekannter unter dem Titel „der goldene Esel“), beide aus Afrika stammend.
Zur romanistischen Sicht auf die Epoche des Klassischen und Nachklassischen Lateins: Zunächst einmal ist wieder zu betonen, dass es sich beim Klassischen Latein um eine geschriebene Literatursprache handelt (zum gesprochenen Latein vgl. Kap. 2.4). Es verwundert daher nicht, dass sich nur wenige Besonderheiten des Klassischen Lateins direkt bis in die romanischen Volkssprachen erhalten haben. Dennoch ist die Epoche des Klassischen Lateins von entscheidender Bedeutung für die romanische Philologie: Spätestens seit der Renaissance sind die klassisch lateinischen Autoren Vorbild für die literarische Produktion der romanischen Kulturen. Auch der lateinische Lehnwortschatz in den romanischen Sprachen geht in erster Linie auf das klassische Latein zurück (vgl. Stefenelli 1991, 1992 und 2003) – allerdings vermittelt über das Neulatein. Was den romanischen Erbwortschatz angeht, so existiert er zu großen Teilen ebenfalls schon in der klassischen Epoche, aber nicht speziell in der Literatursprache, sondern eher in anderen zeitgenössischen Varietäten (vgl. die Abschnitte zur Diastratik und Diaphasik: 2.3 und 2.4).
Auch die heute übliche Einteilung der romanischen Sprachen ist geprägt von der klassischen Epoche: Nachdem Augustus die Asturer und Kantabrer im Norden der Iberischen Halbinsel besiegt hatte, ordnete er 15 v. Chr. die iberischen Provinzen neu: Aus der Hispania citerior5 im Nordosten wurde die Provincia Tarraconensis (Hauptstadt Tarraco > Tarragona), aus der Hispania ulterior6 im Süden wurde die nach dem Fluß Baetis (später arab. Guadalquivir) benannte Provincia Baetica (Hauptstadt Corduba > Cordoba) und im Südwesten wurde die Lusitania als neue Provinz geschaffen (Hauptstadt Emerita Augusta > Mérida). Erstmalig wurde also eine eigenständige Verwaltungseinheit auf dem Gebiet des späteren Portugal begründet. Es kristallisierte sich auch bereits heraus, dass die Baetica und der Küstenbereich der Tarraconensis wegen ihrer geographischen Lage besonders guten Kontakt zu Rom hatten. Dies betraf nicht nur den Seeweg, sondern auch die Lage an der Via Herculea, die von den Säulen des Hercules bei Gibraltar über Carthago Nova (> Cartagena), Tarraco, Emporiae (>Ampurias) und Narbo (Narbonne7) bis zur Mündung der Rhône führte (vgl. Abb. 5, sowie Dietrich/Noll 2019:177ff und Lüdtke 1978). Entsprechend werden diese Gebiete besonders intensiv romanisiert, während die keltiberischen Dialekte im Norden und Nordwesten weniger häufig von neuen lateinischen Formen überlagert werden.
Eine ähnliche Zweiteilung ergibt sich in Gallien: Caesar hatte von 58-51 v. Chr. den westlichen und nördlichen Rest des Landes erobert und dadurch, dass er die damals unter Ariovist bereits in Gallien eingefallenen Germanenstämme wieder aus Gallien vertrieben hatte, bewirkt, dass Frankreich heute zum romanischen und nicht zum germanischen Sprachgebiet gehört (Lauffer 1983:185). Augustus ordnete dann von 27-22 v. Chr. die Provinzen neu und benannte sie teilweise um: Die ehemalige Gallia transalpina8 wurde zur Provincia Narbonensis. Von hier bezieht die heutige Provence ihren Namen, wenngleich ihr Gebiet deutlich kleiner geworden ist. Diese Provinz war schon in vorklassischer Zeit romanisiert worden und erfuhr jetzt noch einen intensiveren Kontakt mit Rom: Die römischen Bauwerke in Orange, Nîmes, Arles und Vaison la Romaine machen dies bis heute deutlich. Die von Caesar eroberten tres Galliae, nämlich die Provinzen Aquitania im Westen (Hauptstadt Burdigala > Bordeaux), Lugdunensis in der Mitte (Hauptstadt: Lugdunum > Lyon) und Belgica im Norden Galliens (Hauptstadt Durocortorum in Remis > Reims) hingegen blieben für römische Siedler unattraktiv. Diese unterschiedlichen Romanisierungszeitpunkte und -intensitäten führten in der Folge (in Kombination mit den schon angesprochenen Substratsprachen) zu unterschiedlichen Varietäten des Lateinischen im Norden und Süden des Landes und damit zur Grundlage der heutigen Trennung zwischen okzitanischem und französischem Stammgebiet, eventuell auch schon zu einer Sondervarietät, die dem späteren Frankoprovenzalisch vorausging.
Selbst das Gebiet Italiens wurde noch in dieser Epoche erweitert: Unter Augustus wurde von 25-15 v. Chr. die römische Herrschaft auf das Alpengebiet sowie auf das nördliche Alpenvorland, also die heutige Schweiz, ausgedehnt (Provinzen Noricum und Raetia). Hier sind also die Ursprünge der unter dem Sammelbegriff „Rätoromanisch“ zusammengefassten Varietäten Bündnerromanisch, Ladinisch und Friaulisch zu suchen.
Mehr als 100 Jahre später, nämlich 107 n. Chr., wird Dakien, das heutige Rumänien, unter Trajan erobert und als Provinz Dacia dem Römischen Reich einverleibt. Damit ist die heutige Romania (von der „neuen Romania“ einmal abgesehen) komplett. Die Eroberungen in Britannien und Germanien, von denen u. a. Tacitus berichtet, waren nur von kurzer Dauer und werden daher, wie die anderen eingebüßten Territorien (z. B. auf dem Balkan), als „verlorene Romania“ bezeichnet. Eine sprachliche Eroberung dauert eben deutlich länger als ihr militärisches Pendant. Dass eine sprachliche Eroberung ohnehin nicht das Ziel der Römer war, sieht man daran, dass der Osten des römischen Weltreichs auch in klassischer und nachklassischer Zeit weiterhin Griechisch sprach.
Bei all dem Gesagten muss betont werden, dass die römischen Truppen seit der Heeresreform des Marius (104-100v. Chr.) nicht mehr aus Wehrpflichtigen, sondern aus Söldnern bestanden, die nach dem Feldzug nicht in ihre alten Berufe zurückkehrten, sondern Berufssoldaten blieben (Lauffer 1983:180). Dieses Söldnerdasein war wegen der finanziellen Versorgung (Veteranenentschädigungen in Form von Landschenkungen) vor allem für Verbündete Roms interessant. So wurden beispielsweise von Trajan Römer aus allen Gebieten des Römischen Reiches in Dakien angesiedelt, die das Lateinische als einzige gemeinsame Verkehrssprache hatten (Marouzeau 1970:109). Das Lateinische wurde also zunehmend von Personengruppen exportiert, die es selbst nur als Zweitsprache gelernt hatten. Damit war es in weiten Teilen des Römischen Reiches eher eine Verkehrs- (lingua franca) als eine Muttersprache.9
[Textbeispiele:
Cicero: Oratio prima in Catilinam habita I,1
s. S. 295
Caesar: Commentarii Belli Gallici I,1
s. S. 240
Vergil: Aeneis I,1 ff
s. S. 214f
Petron: Satyrica 46,5-7
s. S. 275
Martial: Epigramm 5,43
s. S. 164
Plinius: Epistel VI,20,13
s. S. 198f]
2.1.4Spätlatein (ca. 180–650 n. Chr.)
Mit dem Spätlatein enden die klaren zeitlichen Grenzen, weil es keine großen literarischen Eckpunkte mehr gibt, an denen man sich orientieren könnte.1 Wir haben es also mit einer typischen Übergangsepoche zu tun. Der wesentliche Unterschied zum Klassischen und Nachklassischen Latein besteht im Aufkommen christlicher Literatur. Da das Christentum aus Osten, also aus dem griechischen Sprachraum, nach Rom drang, häufen sich in dieser Literatur die Gräzismen. Wir können damit insgesamt drei Wellen griechischen Einflusses auf das Latein festhalten (nicht umsonst werden von Lateinstudierenden üblicherweise auch Altgriechischkenntnisse verlangt):
im archaischen und im Altlatein, wo Gräzismen über Kontakte zu griechischen Kolonien in Süditalien vermittelt wurden;
im klassischen Latein, wo gehobenes Griechisch als Prestigesprache der gebildeten römischen Schichten wirkte;
und im Spätlatein, wo christliches Gedankengut über ein sehr volksnahes Griechisch ins Lateinische transportiert wurde.
Aber auch das Latein an sich ändert sich in der spätlateinischen Phase: Schwierigere Regeln des Klassischen Lateins, vor allem im Bereich der Morphosyntax (z. B. Kasus- und Modusgebrauch), werden nicht mehr durchweg beherrscht. Die Literatursprache wird dadurch volksnäher, und zwar sowohl im sprachlichen wie auch im inhaltlichen Sinn (Heiligenerzählungen, moralische Unterweisung z. B. in Form von Predigten). Die Bevölkerung des Römischen Reiches spricht nach wie vor überwiegend Latein oder Griechisch, allerdings in einer einfacheren Form (vgl. Kap. 2.4 zur Diaphasik – hier v. a. Vulgärlatein).
Wichtige Autoren der spätlateinischen Epoche sind die Historiker Ammianus Marcellinus (ca. 330-395; eifert Tacitus nach) und Jordanes († wohl 552, aus Ostrom stammend; bekannt für seine Getica, eine Geschichte der Goten), die durchweg in Afrika geborenen Kirchenväter Tertullian (ca. 150-230), Minucius Felix (um 200), Cyprian († 258) und Augustinus (354-430; z. B. De civitate dei/Vom Gottesstaat und Confessiones/Bekenntnisse) und der aus dem heutigen Kroatien stammende Bibelübersetzer Hieronymus († 420). Seine aus dem Griechischen und Hebräischen ins Lateinische übersetzte Vulgata ist vielleicht der einflussreichste lateinische Text überhaupt. Eine Brücke von griechisch-römischer Bildung zum christlichen Glauben schlägt vor allem Boethius (ca.480-ca.525), der deswegen häufig als „der letzte römische Philosoph“ bezeichnet wird. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht hervorzuheben sind die Grammatiker Donat (um 350, ein Lehrer des Hieronymus) und Priscian (um 500), deren Werke bis weit ins Mittelalter hinein den Lateinunterricht dominierten.
Nebenbei wird auch deutlich, dass die großen lateinischen Autoren zunehmend aus den Provinzen kommen. Die folgende Karte veranschaulicht dieses Faktum (nach Poccetti et al. 2005:498)2
Herkunft lateinischer Autoren (nach Poccetti et al. 2005:498)
Das größte Datierungsproblem der gesamten lateinischen Sprachgeschichte stellt der Übergang vom Spätlatein zum Mittellatein dar. Orientiert man sich an der Zeitgeschichte, dann kommen die Jahre 476 n. Chr. (Ende des Weströmischen Reiches), 751 (Sturz von Childerich III und damit Ende der 450 begonnenen Merowingerdynastie) oder sogar erst das Jahr 800 (Kaiserkrönung Karls des Großen) für eine Grenzziehung in Frage. Orientiert man sich hingegen an der sprachlich-kulturellen Situation, so ist das sog. „Merowingerlatein“ mit Autoren wie Gregor von Tours (538-594), dem Dichter Venantius Fortunatus († nach 600 in Poitiers) und dem westgotischen Philologen und Kirchenvater Isidor von Sevilla († 636) sicher noch dem Spätlatein zuzurechnen.3 Das Interesse galt hier fast ausschließlich christlichen Texten, die „heidnischen“ Dokumente der Antike wurden mit Vorsicht behandelt. Die schon recht deutlichen Abweichungen von der klassischen Morphologie und Syntax sind ein Indiz dafür, dass die Texte dieser Autoren als Zeugnisse für das allmählich aussterbende gesprochene Latein gelten können.4 Aus streng innersprachlicher Sicht tritt erst ab etwa 750 n. Chr. mit der sog. „karolingischen Renaissance“ eine deutliche Veränderung des Lateinischen ein (s. u.) – man hätte also auch hier die Grenze zum Mittellatein ziehen können.
Betrachtet man die sprachliche Situation aber gesamtheitlich, dann ändert sich spätestens im 6./7. Jh. Entscheidendes: Die gesprochene Sprache im ehemaligen Imperium Romanum hat sich so stark weiter- und auseinanderentwickelt, dass wir neben dem Lateinischen von der Existenz romanischer Volkssprachen ausgehen können, auch wenn dafür noch keine schriftlichen Zeugnisse vorliegen. Ab jetzt liegt demnach die Diglossiesituation aus romanischem Basilekt und lateinischem Akrolekt vor, die charakteristisch für das Mittellatein ist (s. u.).5