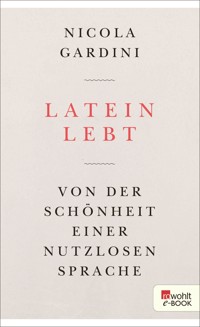
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als Kind dachte Nicola Gardini, seine Mutter spräche perfekt Latein, weil er sie das «Ave Maria» und das «Pater noster» beten hörte. Erst viel später hat sie ihm gebeichtet, dass sie sonst kein Wort Latein kann. Gardini beschreibt seinen Zugang zur lateinischen Literatur als persönliches Erweckungserlebnis, das ihm schon früh eine neue Welt erschlossen hat. Sein unterhaltsames Buch liefert kein verzweifeltes Plädoyer für das Schulfach Latein und die Bedeutung seiner Grammatik. Gardini zeigt vielmehr, dass wir nie aufgehört haben, Latein zu sprechen. Dass wir unsere Gegenwart kulturell und literarisch nur verstehen können, wenn wir wissen, wo wir herkommen: Er geht Metaphern auf den Grund, er erklärt anhand eines Textes von Cato über das Pökeln das Futur oder analysiert ein Gedicht von Catull über den Tod eines Spatzen. Und so vermittelt er auf literarische Weise seine These: Latein ist nicht nützlich, Latein ist schön.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Nicola Gardini
Latein lebt!
Von der Schönheit einer nutzlosen Sprache
Über dieses Buch
Als Kind dachte Nicola Gardini, seine Mutter spräche perfekt Latein, weil er sie das «Ave Maria» und das «Pater noster» beten hörte. Erst viel später hat sie ihm gebeichtet, dass sie sonst kein Wort Latein kann. Gardini beschreibt seinen Zugang zur lateinischen Literatur als persönliches Erweckungserlebnis, das ihm schon früh eine neue Welt erschlossen hat. Sein unterhaltsames Buch liefert kein verzweifeltes Plädoyer für das Schulfach Latein und die Bedeutung seiner Grammatik. Gardini zeigt vielmehr, dass wir nie aufgehört haben, Latein zu sprechen. Dass wir unsere Gegenwart kulturell und literarisch nur verstehen können, wenn wir wissen, wo wir herkommen: Er geht Metaphern auf den Grund, er erklärt anhand eines Textes von Cato über das Pökeln das Futur oder analysiert ein Gedicht von Catull über den Tod eines Spatzen. Und so vermittelt er auf literarische Weise seine These: Latein ist nicht nützlich, Latein ist schön.
Vita
Nicola Gardini, geboren 1965 in Italien, ist Professor für Italienisch und Vergleichende Literaturwissenschaften in Oxford. Er hat in Mailand und an der New-York University studiert und ist Experte für die Literatur der Renaissance. Neben seiner akademischen Tätigkeit schreibt Nicola Gardini Romane und Gedichte.
Impressum
Die italienische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel «Viva il Latino. Storie e bellezza di una lingua inutile» bei Garzanti.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Viva il Latino. Storie e bellezza di una lingua inutile» Copyright © 2016 by Nicola Gardini
Published by Arrangement with The Italian Literary Agency
Lektorat Kristian Wachinger
Recherche der lateinischen Zitate Kurt Pichler
Mitarbeit bei den Kapiteln 11, 16 und 17 Karl Schott
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-00127-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Federico Maviglia
Wenn ich diese treffliche Ausdrucksweise betrachte, so lebendig, so tief, sage ich nicht, das sei gut geschrieben – ich sage: «Das ist gut gedacht!» Die Kühnheit der Vorstellung ist es, welche der Alten Worte schwellen und in die Höhe schweben lässt.
Michel de Montaigne
Wenn man von der Liebe zur Vergangenheit spricht, heißt es vorsichtig sein – es ist die Liebe zum Leben, um die es geht; das Leben ist viel mehr in der Vergangenheit als in der Gegenwart.
Marguerite Yourcenar
Wenn du dich in Schwierigkeiten befindest, so sprich Latein, und man wird dich in Ruhe lassen.
Paolo Poli
Die köstliche Perfektion der lateinischen Sprache …
Giacomo Leopardi
1.Ein Haus
Nicht ohne Eitelkeit hatte ich zu jener Zeit mit dem methodischen Studium des Latein begonnen.
Jorge Luis Borges
Wie entsteht die Liebe zu einer Sprache? Um genau zu sein, die Liebe zum Latein?
Ich habe bereits als Kind mein Herz ans Latein verloren, und bis heute kann ich nicht sicher sagen, warum. Wenn ich darüber nachdenke, kommt mir höchstens die eine oder andere bruchstückhafte Erinnerung in den Sinn, die aber kaum als Begründung ausreicht. Wie lässt sich ein Instinkt, eine Berufung erklären? Am besten erzähle ich eine Geschichte.
Latein hat mir geholfen, mich von meiner Familie zu lösen, den Weg zur Poesie und zum literarischen Schreiben zu finden, im Studium voranzukommen, mich fürs Übersetzen zu begeistern, meine vielfältigen Interessen auf ein gemeinsames Ziel hin auszurichten und schließlich auch, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich habe Latein an der New School in New York, am Gymnasium Verri in Lodi und am Gymnasium Manzoni in Mailand unterrichtet, und auch heute noch, als Dozent für die Literatur der Renaissance in Oxford, benutze ich es Tag für Tag, denn ohne Latein keine Renaissance. In meiner Jugend wurde es mir zum Amulett und zu einem magischen Schild, ein wenig wie bei Julien Sorel, dem Protagonisten aus Stendhals Rot und Schwarz. In den Häusern reicher Freunde wurde ich vor allem deshalb akzeptiert, weil alle wussten, dass ich gut in Latein war. Auch als ich direkt nach meinem Hochschulabschluss in Altphilologie meine Promotion in Komparatistik an der New York University begann, waren es von Anfang an meine Lateinkenntnisse, die von den amerikanischen Professoren besonders geschätzt wurden. Erst dort, in dieser Welt des amerikanischen Geistes, in der die Persönlichkeit mehr zählt als das Elternhaus, wurde mir wirklich klar, welch großes Glück ich hatte. Dank Latein war ich nie allein. Mein Leben hat sich um Jahrhunderte verlängert und über mehrere Kontinente ausgedehnt.
Das Studium der lateinischen Sprache hat mir vom ersten Moment an beigebracht, auch meine eigene Sprache als Silben und leise Töne wahrzunehmen. Es hat mich gelehrt, wie wichtig die Musik der Worte ist – die ureigene Seele der Poesie. Die Wörter, die ich seit jeher benutzt hatte, begannen sich mit einem Mal in meinem Kopf in ihre Einzelteile aufzulösen und wie Blütenblätter im Wind durcheinanderzuwirbeln. Dank Latein wog ein italienisches Wort plötzlich mindestens ein Zweifaches. Unter dem blühenden Garten der Alltagssprache wucherte das Wurzelwerk der Antike. Zu entdecken (ich erinnere mich noch lebhaft an jenen Oktobermorgen in meinem ersten Jahr Latein), dass «giorno» und «dì», die italienischen Synonyme für «Tag», miteinander verwandt sind, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so scheinen mag, zu erfahren, dass ebenjenes «giorno» sich aus diurnus – dem Adjektiv zum lateinischen dies («Tag») – ableitet, von dem wiederum «dì» abstammt: Es war, als hätte ich eine geheime Tür entdeckt, als könnte ich mit einem Mal durch Wände gehen … Und kaum war ich auf der anderen Seite angelangt, sah ich auch schon, dass «oggi» («heute») etwas mit «giorno» und «diurno», mit dem lateinischen dies also, zu tun hatte: Es lässt sich in der Tat auf hodie zurückführen, das sich aus ho (einer Form des Demonstrativpronomens hic, «dieser») und die zusammensetzt und somit wörtlich «an diesem Tag» bedeutet. Ähnliches schien für den Namen des Göttervaters selbst zu gelten, für «Jupiter», den Dies-piter, wie er zum Beispiel in den Oden des Horaz (Carmina I, 34, 5) zu finden ist: den «Vater des Tages» – wobei im Übrigen lateinisch dies etymologisch verwandt ist mit Zeus. Einmal erkannt, erlaubte mir diese unscheinbare Wurzel di- ebendieses Alltägliche mit der Mythologie, die Gegenwart mit der archaischsten und heiligsten Antike zu verweben. (Nein, so leid es mir tut, das englische «day» ist kein direkter Verwandter, sondern ein Paradebeispiel einer irreführenden Ähnlichkeit. Wie übrigens etliche «falsche Freunde» – denken wir nur an das aus lateinisch calidus entstandene italienische «caldo», «warm», das nicht das Geringste mit dem aus dem Germanischen stammenden «kalt» zu tun hat.)
Natürlich verlangte dieser Zuwachs an Bedeutungen auf der einen Seite Präzision, geschichtliches Verständnis und Glaube an den verborgenen Sinn, an die Macht der Etymologie, doch verhalf er mir gleichzeitig dazu, mich an die tückischen Zwischentöne, an den Glanz der Bilder und damit auch an die Mehrdeutigkeit, an die Verschwommenheit, an die Aureole zu gewöhnen, daran, zwei oder gar drei Dinge in einem zu sagen. Das war es, das Ideal, das mir, wenngleich noch etwas schemenhaft, bereits vorschwebte, während ich noch die Schulbank drückte: in einer glasklaren und zugleich doch «abgründigen» Sprache zu schreiben.
Schon in meiner Kindheit übte Latein eine ungeheure Anziehungskraft auf mich aus, stammte es doch aus der Antike, die es mir von klein auf angetan hatte. Vor allem waren es bestimmte Vorstellungen von Antike wie die Pyramiden, die Säulen der griechischen Tempel oder die Mumien des Ägyptischen Museums in Turin, das wir während eines Schulausflugs besucht hatten, die mir regelrecht Herzklopfen verursachten. Ich kann mich noch gut erinnern, dass in meinem Lesebuch in der dritten Klasse von domus, den Stadthäusern der Patrizier, und insulae, den Wohnungen des gewöhnlichen Volkes, die Rede war. Meine Familie und ich, wurde mir klar, wohnten also in einer insula.
Ein richtiges Lateinbuch hielt ich allerdings erstmals in der siebten Klasse in der Hand. Dort wurde die Bauweise der domus ausführlich beschrieben. So lernte ich auch den einen oder anderen architektonischen Begriff, meine ersten lateinischen Vokabeln: impluvium, atrium, triclinium, tablinum, vestibulum, fauces (damals wusste ich noch nicht, dass diese Terminologie einem der einflussreichsten Werke der Architekturgeschichte, den Büchern Vitruvs, entstammte). Was für ein unglaubliches Haus, das den Regen durch ein Loch im Dach fallen ließ und in einem Becken sammelte, das Säulengänge und Zimmer über Zimmer hatte, ein Haus, in dem einen niemand finden konnte, so weitläufig war es! Voilà: Latein zu lernen wurde für mich gleichbedeutend mit der Sehnsucht nach sozialem Aufstieg, mit dem Traum von einem großartigen Haus. Genauer gesagt: Latein wurde in meiner Phantasie zu einem Raum, in dem es sich voller Glück leben ließ, es wurde der Raum des Glücks überhaupt. Und dieser Raum befand sich nicht nur in meinem Inneren: Unbezähmbar drängte er als Zeichnung nach draußen, überall malte ich – unter den konsternierten Blicken meiner Familie (die mein Verhalten rechtfertigte, indem sie sich sagte, dass ich eines Tages wohl Architekt werden würde) – Grundrisse diverser domus auf, und versah jedes Feld mit dem passenden Begriff seiner Bestimmung, und ich war sicher, dass auch ich eines Tages wahrhaftig meine eigene domus haben würde.
Genau im Jahr 1977, als ich aufs Gymnasium kam, war Latein als Pflichtfach abgeschafft worden. Unsere tüchtige Lehrerin, Signora Zanframundo, hatte – wohl eher aus Gewohnheit denn aus Treue – nach wie vor ein knappes Stündchen für Latein reserviert, verlangte den Schülern aber kaum noch etwas ab. Ich brachte mir die erste und zweite Deklination selbst bei, einzig aus Begeisterung, ohne mich jedoch allzu sehr darum zu bemühen, die logische Funktion der verschiedenen Endungen zu verstehen. Aber welch Glück, allein schon die Bezeichnungen der Fälle zu kennen: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Vokativ, Ablativ!
Noch etwas anderes beflügelte meine Phantasie, wenn ich heute darüber nachdenke: das Vorbild meiner Mutter. Im Grunde kann ich sagen, dass ich Latein schon ehe ich direkt damit in Kontakt kam, wenn auch nicht als Muttersprache (wie im Falle Montaignes, der es nach seinen eigenen Worten noch vor dem Französischen sprach), so doch als vertrauten Klang empfunden hatte. Als Mädchen hatte meine Mutter, bevor sie nach Deutschland ging, einige Zeit bei den Nonnen von Aquila in den Abruzzen verbracht, wo sie auch das eine oder andere lateinische Gebet gelernt hatte – das Requiem aeternam (von dem ich während meiner ganzen Kindheit glaubte, es würde «requie meterna» geschrieben), das Pater noster, das Ave Maria … Mehr brauchte ich nicht, um zur Überzeugung zu gelangen, sie sei des Lateinischen mächtig. Sie selbst indes erhob niemals den Anspruch, Latein zu können, sondern beharrte im Gegenteil darauf, es nicht zu verstehen. Nicht anders als ihre Freundinnen, meinte sie, habe sie nur wie ein Papagei das nachzuplappern gelernt, was sie Tag für Tag morgens und abends im Gottesdienst gehört habe, und Gott allein wisse, wie viele versehentliche Flüche ihr dabei über die Lippen gegangen seien! («Die Ungebildeten», darauf macht uns auch Gian Luigi Beccaria aufmerksam, «haben das Latein der Messe stets falsch verstanden. Priester eingeschlossen.»)[1] Was mich betraf, musste sie allerdings auch nicht mehr können als dieses papageienhafte Herunterbeten; so unverständlich und deformiert es auch sein mochte, für mich war sie die Lateinexpertin. Dank dieser bizarren Klänge wurde sie in meinen Augen zur großartigen Mutter des ebenso großartigen Hauses, das ich nach und nach mit den einfachen Worten Vitruvs errichten würde.
Richtig gelernt habe ich Latein erst im Humanistischen Gymnasium, wo ich mich schließlich nach einem erbitterten Kampf gegen das Verbot meines Vaters einschrieb. Später dann an der Universität verschlang ich unzählige Werke. Ich hatte immer hervorragende und überaus fähige Lehrer. Trotzdem habe ich Latein, das kann ich ohne Anmaßung sagen, allein gelernt: durch Leidenschaft, Hingabe und Neugierde. Wenn unsere Lehrerin uns einen Text aufgab, übersetzte ich darüber hinaus drei oder vier weitere. Es verging kein Tag, an dem ich nicht irgendetwas übersetzte, selbst wenn wir keine Hausaufgaben aufbekommen hatten. Zusätzlich zum jeweils aktuellen Text versorgte ich mich in der Lehrerbibliothek mit zwei oder drei anderen Übungsbüchern, aus denen ich mit vollen Händen schöpfte. Eine gute Zeit zum Übersetzen war der Abend, kurz bevor ich zu Bett ging. Ich suchte mir die schwierigsten Texte aus, die mit den drei Sternchen. Nachts im Traum sprach ich Lateinisch. Das erzählte zumindest mein Vater, den meine Stimme angelockt hatte.
Niemals hätte ich meine Übersetzungen in ein Heft geschrieben: Ich machte eine jede im Kopf und konnte sie auswendig. Der Gedanke, auf Papier nur eine Version festzuhalten, behagte mir ganz und gar nicht. Ich spürte, dass die Schriftform nur dazu diente, die Unvollkommenheit der Herausforderung in Stein zu meißeln, mögliche Fehler festzuhalten. Besser also alles dem Gedächtnis anvertrauen. Dort konnte die Version reifen, ja sie wurde besser und besser, ihr Sinn ergänzte sich mit der Erinnerung, indem sich die Nebel lichteten und die Lücken sich schlossen, denn die Erinnerung verabscheut das Hässliche, und erst recht das Unvollständige.
Und so sitze ich nun heute hier und schreibe tatsächlich ein Buch, um meine Liebe zum Latein weiterzugeben oder es zumindest zu versuchen und ein wenig dieses freudige Herzklopfen, dieses Gefühl eines sich stetig weitenden Horizonts zu vermitteln, das mich trotz meiner wachsenden Erfahrung noch immer begleitet, sobald ich etwas in dieser Sprache lese. Es soll keine Grammatik werden, kein sprachwissenschaftliches oder literaturgeschichtliches Werk, sondern ein Buch über die Schönheit der lateinischen Sprache.[2]
Ich habe mich ziemlich lange und gründlich mit Originaltexten und zahlreichen wissenschaftlichen Studien neueren wie auch älteren Datums beschäftigt und kann daher auf ein solides Wissen bauen, und doch verdankt dieses Buch, wie die folgenden Seiten zeigen werden, seine Entstehung ganz entscheidend einem neuen Schub geistiger Durchdringung und Eingebung, einer Art Drang, sich nochmals zu verlieben.
Ich werde mich, um meine Ausführungen in thematische Einheiten zu unterteilen, auf bestimmte Autoren und exemplarische Textausschnitte konzentrieren, wobei ich weitgehend auf Fachausdrücke verzichten und – der Linearität wegen – auch nicht weiter auf das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Latein und Griechisch eingehen werde. Autoren und Textpassagen, so viel sei klar, sind hier definitiv anders zu verstehen, als wenn sie Gegenstand einer literaturgeschichtlichen Betrachtung wären: In diesem Buch stellen sie gewissermaßen «Episoden» aus dem Leben des Latein dar und werden daher auch nicht unbedingt in chronologischer Abfolge auftauchen; sie sind Zeugnisse dessen, was das Latein in einem bestimmten Moment, unter bestimmten Umständen und Bedingungen vollbringt und womit es eine lange Tradition begründet, die bis in unsere Zeit lebendig ist. Somit tritt auch der einzelne Autor weniger als individuelle Persönlichkeit in Erscheinung denn als sprachliche Momentaufnahme. Wenn wir Cicero oder Vergil begegnen, handelt es sich dabei im Grunde weder um das Latein Ciceros noch um das Latein Vergils. Es handelt sich vielmehr um all das, wozu Latein in der Lage ist, sobald es aus der Feder Ciceros oder Vergils fließt (auch hier gilt es klar zu trennen, ist Vergil doch nicht als Person, sondern als eine Vielzahl linguistischer Phänomene gemeint, die je nach Text variieren). Andererseits bin ich seit jeher – nicht nur im Hinblick auf die klassischen lateinischen Schriften – der Überzeugung, dass jeder einzelne Schriftsteller nur die empirischen Bedingungen verkörpert, aufgrund deren Sprachen neue Wege einschlagen und sich verwandeln können. Es ist mir durchaus bewusst, dass man vom persönlichen Stil spricht, davon, dass der Stil diesen von jenem Autor unterscheide: Doch letzten Endes ist der Stil nur eine Option im Leben einer Sprache.
Dieses Buch wendet sich in erster Linie an all die jungen Leute – Mädchen wie Jungen – in den Schulen, die mehr als jeder andere einen Sinn hinter dem suchen, was sie tun und vorgesetzt bekommen. Gleichzeitig wünsche ich mir jedoch, mit diesen Seiten auch die nicht mehr ganz so Jungen zu erreichen, seien sie fachkundig oder nicht. Ich hoffe, vielleicht den einen oder anderen ehemaligen Gymnasiasten erneut für ein im Dämmer der Vergangenheit versunkenes Fach begeistern zu können, an das er oder sie manchmal zurückdenkt und das, aus welchem Grund auch immer, brachliegt. Es wäre schön, wenn diese Seiten nicht nur Politikern und Lehrern, Steuerberatern und Ärzten, Rechtsanwälten und Schriftstellern etwas Wesentliches und Unerlässliches vermitteln, sondern auch all denen, die sich niemals mit Latein auseinandergesetzt haben und die heute, frei von Vorurteilen, frei von Berührungsängsten oder instinktiver Abneigung, mehr darüber erfahren möchten, einfach so – aus Neugier.
Ich würde mich bereits glücklich schätzen, wenn ich auch nur einer Handvoll Lesern nahebringen könnte, warum Latein eine solch wichtige Sprache ist und warum die Kenntnis des Latein oder zumindest ein Gespür für seine Eigenschaften – nicht anders als die Kenntnisse in anderen wichtigen Bereichen unserer Welt, seien es Musik, Kunst, Wissenschaft oder ein Naturschauspiel – tatsächlich frischen Wind in unsere Tage zu bringen vermag.
2.Was ist Latein?
Latein ist die Sprache des antiken Rom und seiner Zivilisation. Im Lauf mehrerer Jahrhunderte eroberte es ein riesiges Gebiet, das sogenannte Römische Reich, und avancierte zum schriftlichen und mündlichen Kommunikationsinstrument eines Großteils der Menschheit. Selbst im Zeitalter der Moderne, nachdem es schon längst unterschiedlichen Idiomen (den sogenannten romanischen Sprachen) gewichen war, diente Latein noch immer Schriftstellern, Literaten und Gelehrten verschiedenster Disziplinen als Verständigungsmittel.
Latein ist die Sprache des Rechts, der Architektur und der Ingenieurskunst, des Militärs, der Wissenschaften, der Philosophie, der Religion und – an dieser Stelle von besonderem Interesse – die Sprache einer blühenden Literatur, die über Jahrhunderte hinweg der gesamten Literatur des Abendlandes als Vorbild diente. Es gibt kein Gebiet der sprachlichen Kreativität und des Wissens, für das sich auf Latein nicht hervorragende und meisterhafte Beispiele finden ließen: die Dichtung (Epik, Elegie, Epigramm usw.), die Rhetorik, die Komödie, die Satire, der vertrauliche und der förmliche Brief, der Roman, die Geschichte, der Dialog, nicht zu vergessen die Moralphilosophie, die Physik, die Jurisprudenz, die Kochkunst, die Landwirtschaft, die Meteorologie, die Kunsttheorie, die Altertumswissenschaften, die Medizin, die Technik, die Vermessungstechnik, die Religion.
Das Latein der Literatur spricht in Hunderten von Meisterwerken von Liebe und Krieg, denkt über den Leib und die Seele nach, entwirft Theorien über den Sinn des Lebens und die Aufgaben des Menschen, über das Schicksal der Seele und die Beschaffenheit der Materie, besingt die Schönheit der Natur, die Bedeutung der Freundschaft, den Schmerz über den Verlust all dessen, was einem lieb und teuer ist; und es kritisiert die Verderbtheit, sinniert über den Tod, über die Willkür der Macht, über die Gewalt und die Grausamkeit. Es erschafft innere Bilder, kleidet Emotionen in Worte, formuliert Ideen über die Welt und das gesellschaftliche Leben. Latein ist die Sprache der Beziehung zwischen dem Einen und allem; die Sprache der komplexen Gegenüberstellung von Freiheit und Zwang, von Privatheit und Öffentlichkeit, kontemplativem und tätigem Leben, von Hauptstadt und Provinz, von Stadt und Land … Und es ist die Sprache der Verantwortung und der persönlichen Pflicht; die Sprache der inneren Kraft; die Sprache des Anstands und des Willens; die Sprache der Subjektivität, die sich angesichts des Unrechts zu Wort meldet; die Sprache der Erinnerung. Die Absicht spricht Latein; der Protest spricht Latein; die Beichte spricht Latein; die Zugehörigkeit spricht Latein; das Exil spricht Latein; das Gedenken spricht Latein.
Latein ist das großartigste Denkmal, das der Kultur des menschlichen Wortes und dem Glauben an die Möglichkeiten der Sprache je gesetzt worden ist. Hierbei kommt mir ein Brief Plinius des Jüngeren in den Sinn (ca. 61–112 n. Chr.), der die Vielseitigkeit und die sprachliche Kunst eines gewissen Pompeius Saturninus rühmt. Plinius spricht von ingenium […] varium, flexibile, quam multiplex, wobei mit ingenium nicht der willentlich gesteuerte Intellekt gemeint ist, sondern eine natürliche Veranlagung (ingenium enthält nämlich die Wurzel gen-, die Geburt bedeutet), die wir – mit einem Wort, das ebenfalls vom Latein abstammt – als «Talent» bezeichnen.[1] Pompeius Saturninus ist also zu jeder Form der sprachlichen Ausdrucksweise berufen: zur Klageschrift, zur Geschichtsschreibung, zur Dichtung, zur Briefkunst. Und es fehlt ihm an nichts: Er schreibt flüssig und erhaben, leicht und schwer, süß und herb, ganz nach Bedarf. Plinius kann nicht aufhören, ihn zu lesen und zu bewundern, wie einen der ganz Großen der Antike. Es ist zutiefst bedauerlich, dass uns von ihm – wie von vielen anderen großartigen Talenten – nichts erhalten geblieben ist.
Von Latein zu sprechen bedeutet vor allem, von der unabdingbaren Pflicht zu sprechen, die Gedanken in ausgewogenen und tiefgründigen Gesprächen zu ordnen, die Bedeutungen aufs sorgfältigste auszuwählen, die Wörter harmonisch aufeinander abzustimmen, auch die flüchtigsten Zustände des Inneren in Worte zu fassen, dem Ausdruck und der Beweisführung zu trauen, das Zufällige und das Vergängliche wahrzunehmen, das die Sprache überdauert.
3.Welches Latein?
Von welchem Latein sprechen wir überhaupt? Schließlich gibt es nicht nur ein Latein, sondern viele, und in jedem liegt uns eine kaum überschaubare Menge an unterschiedlichsten und vielfältigsten Texten vor: Es gibt das Latein der Literatur, das Latein der Kirche, das Latein der Scholastik, das Latein der Marmorinschriften. Die Lateinforschung bewegt sich in die verschiedensten Richtungen. Die einen untersuchen das Verhältnis zwischen Latein und den romanischen Sprachen; andere versuchen, ausgehend vom schriftlichen Latein, ob literarisch oder nicht, die gesprochene Variante, das Vulgärlatein, zu rekonstruieren; wieder andere konzentrieren sich auf das Latein des Mittelalters oder auf das Latein bestimmter Fachgebiete. Auch die Plädoyers zugunsten des Latein – Lobeshymnen auf seine geschichtliche Bedeutung, seine Aktualität, seine gestaltende Kraft, die allerorts ertönen – gründen auf unterschiedlichen, manchmal gar widersprüchlichen Sichtweisen, werden vom persönlichen Geschmack, von konkreten Zielsetzungen oder von kulturellen Besonderheiten des Landes bestimmt, an das sie gerichtet sind.[1] Denken wir nur, um in Italien zu bleiben, an die ideologische Vereinnahmung, der Latein und die Idee eines imperialen Roms im Faschismus unterlagen.[2] Je nach Ort und Zeit kommt dem Studium des Lateinischen ganz unterschiedliches pädagogisches Gewicht zu. Latein in Italien zu unterrichten und zu lernen ist eine Sache, doch in Amerika sieht es schon wieder ganz anders aus; es ist eine Sache, es heute zu lernen, doch was ist mit gestern oder mit dem fünfzehnten Jahrhundert? Nebenbei bemerkt stellt sich auch beim Erlernen einer modernen Sprache wie beispielsweise Englisch dieselbe Frage wie zu Beginn dieses Kapitels: Welches Englisch? Das Englisch von Shakespeare oder das Englisch von Virginia Woolf? Das Englisch, das man in Manhattan spricht oder das Englisch von Manchester? Die sprachlichen Experimente von Joyce, vom frühen Beckett (der vor Latein nur so strotzt) oder die Songtexte der Popmusik? Oder etwa das rudimentäre Englisch der Last-Minute-Touristen?
Jedes kulturelle Phänomen birgt einen eigenen Zauber in sich, etwas, das weit über das reine Prestige hinausgeht. Der dem Latein innewohnende Zauber ist äußerst fragil. Stetigem Wandel und Schwund unterworfen, scheint er sich in unseren Tagen endgültig in Luft aufgelöst zu haben, weil heute – so meinen wir zumindest – andere Dinge mehr zählen: das Technologische, Improvisierte, Einfache, Kurzlebige – das Neue um jeden Preis und in jedem Moment. Nur wenige – leider nicht diejenigen, die im Besitz der politischen und wirtschaftlichen Macht sind – glauben, dass das Neue und die Erneuerung einzig in dem Maße errungen werden können und dürfen, wie das Bestehende bewahrt wird.
Ich möchte hier, anders als all die nichtitalienischen Verfechter des Latein, die ich kenne, von jenem literarischen Latein sprechen, das mich als Mensch und Schriftsteller geprägt hat, von dem Latein, auf das ich heute noch zurückgreife und das meiner Meinung nach immer noch den Kern jeder ernsthaften und geschichtsbewussten Pädagogik darstellen sollte: das Latein von Autoren wie Cicero, Sallust, Lukrez, Catull, Vergil, Livius, Ovid, Horaz, Properz, Seneca, Tacitus, Augustinus, Hieronymus und vielen anderen aus späteren Jahrhunderten, als die romanischen Sprachen sich bereits durchgesetzt hatten und Latein dennoch auf Grundlage der antiken Klassiker weithin als Sprache der Literatur erhalten blieb – allen voran Francesco Petrarca (allein schon durch seine Familiares und die anderen Briefsammlungen unsterblich), Leon Battista Alberti, Enea Silvio Piccolomini, Agnolo Poliziano, Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, Giovanni Pontano, Girolamo Fracastoro, Jacopo Sannazaro, nicht zu vergessen Pietro Bembo, der große Theoretiker des Renaissance-Petrarkismus mit seinen Prose della volgar lingua, sowie im neunzehnten Jahrhundert Giovanni Pascoli; und in der jüngsten Vergangenheit (um in Italien zu bleiben) Ferdinando Bandini, der sogar ein Gedicht von Montale, La bufera, ins Lateinische übertragen hat. Dabei handelt es sich keineswegs nur um gelehrte, ausgefeilte, abgehobene Schriften. Nein, wir haben es hier vielmehr mit höchster Wortkunst zu tun, in der sich technisches Können und Leidenschaft gegenseitig befruchten.
Selbst Ariost – wie Petrarca ein Meister auf dem Gebiet des Volgare, der frühen italienischen Volkssprache – verfasste zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts das eine oder andere lateinische Gedicht (und in Anbetracht der damaligen Zeit wäre es auch keineswegs verwunderlich gewesen, wenn er gleich ein ganzes Epos auf Latein geschrieben hätte). Auch außerhalb Italiens lassen sich zahlreiche ähnliche Beispiele finden. So griffen in Frankreich du Bellay (ebenjener Autor, der mit seiner Schrift Défence et illustration de la langue française ein glühendes Plädoyer für die Nationalsprache schrieb) und in England Milton (auch er ein Titan der volkssprachlichen Dichtung) gerne, ob Prosa oder Lyrik, auf Latein zurück, um nur diese beiden stellvertretend für die große Schar anderer Dichter in ganz Europa zu nennen. Selbst einige der Werke, die für uns gemeinhin den Beginn der Neuzeit verkörpern, wurden in Latein verfasst, wie die Satire Laus stultitiae (Lob der Torheit) von Erasmus von Rotterdam oder Utopia von Thomas Morus.
Seit Jahren haftet dem Latein (wie auch dem Altgriechischen) das hässliche Etikett einer toten Sprache an. Dabei ist es im Gegenteil lebendig wie eh und je: weil es in Texten von außergewöhnlicher Strahlkraft überdauert, die über Jahrhunderte hinweg ihre Wirkung entfaltet haben. Latein hat die Gesellschaft, in der wir leben, durch seine Werte geprägt. Ohne Latein wäre unsere Welt eine völlig andere.
In den komplexen Kosmos der lateinischen Sprache einzudringen, den Widerhall ihres Ursprungs (sowohl aus linguistischer als auch begrifflicher Sicht) zu erlauschen, ihre Strukturen zu entwirren und sich an ihrer stilistischen Pracht zu erfreuen – all das sind Mittel und Wege, um uns selbst besser kennenzulernen, um Lösungen für Probleme zu finden, bevor sie überhaupt auftauchen, und dabei gleichzeitig ein ganz eigenes Glück zu erfahren, jenes Glück, das – um es mit Aristoteles zu sagen – aus dem Wunsch nach Erkenntnis geboren wird, daraus, die Grenzen des Offensichtlichen zu überschreiten. Wie soll es enden, wenn wir unser Wissen nur noch aus schnell verfügbaren Quellen schöpfen oder auf den Nutzwert schematischer Antworten reduzieren, wenn wir darauf verzichten, eingehend über etwas nachzudenken und uns auf gedankliche Experimente einzulassen? Wie soll es enden, wenn wir glauben, unser Dasein werde vom Jetzt bestimmt und die Antike gehöre in die Rumpelkammer der Vergangenheit? Wohin führt es, wenn wir nicht erkennen, dass unser Leben nur ein Mosaiksteinchen der Geschichte ist, dass unser Leben bereits weit vor unserer Geburt begonnen hat und die Existenz eines jeden von uns viel authentischer ist, wenn sie sich als Bestandteil eines großen Ganzen begreift, das über die aktuelle Einwohnerstatistik hinausgeht?
4.Ein göttliches Alphabet
Wie schon im sechzehnten Jahrhundert von Baldassare Castiglione vermutet, gilt es seit einigen hundert Jahren als ausgemacht, dass das gesprochene «Vulgärlatein» die Wurzel etlicher moderner «romanischer» Sprachen wie Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch oder Rumänisch ist, um nur die meistverbreiteten zu nennen.
Aber aus welcher Quelle ist das Latein selbst entsprungen? Folgen wir der Aeneis Vergils, so steht die Wiege des römischen Volks in Latium, wo sich eine Gruppe von Trojanern unter der Führung von Aeneas nach ihrer Flucht mit der ansässigen Bevölkerung verband. Bevor die Trojaner dem anfänglichen Widerstand der Einheimischen siegreich begegnen, verlangt die Göttin Juno von Jupiter, dass die Sprache der neuen Stadt Rom die der Urbevölkerung, der Italiker beziehungsweise der Ausonen, bleiben solle, der indigenas Latinos (Aeneis XII, 823). Dem Mythos nach liegen die Wurzeln der lateinischen Sprache also in heimischem Boden, was unzählige sprachwissenschaftliche Untersuchungen auch bestätigt haben. Ursprünglich Idiom dieser kleinen, überschaubaren Gemeinschaft, entwickelte sich Latein im Lauf der Jahre und Jahrhunderte parallel zur zunehmenden Macht und dem wachsenden Ansehen der Stadt Rom zur Sprache eines riesigen Imperiums, das sich im Moment seiner größten Ausdehnung unter Kaiser Trajan (zu Beginn des zweiten Jahrhunderts n. Chr.) vom Atlantik bis nach Mesopotamien, von Britannien bis zur Küste Nordafrikas erstreckte.
Wenngleich sich seine Anfänge auf einen klar definierten Ort und eine bestimmte Gruppe von Menschen zurückführen lassen, ist Latein dennoch keine einsame Wüstenblume, sondern gehört einer weitverzweigten Sprachfamilie an, die mehr als achtzig Mitglieder zählt, darunter Griechisch, Slawisch, Sanskrit und Germanisch. Zudem wurde Latein anfangs wohl nicht ohne weiteres als vorherrschende Sprache akzeptiert, wie sich aus zahlreichen Inschriften ersehen lässt, sondern musste sich erst gegen etliche regionale Konkurrenten durchsetzen: das Etruskische, das Oskische und Umbrische (oft auch «Sabellische Sprachen» genannt und in verschiedenen Varianten regionaler Minderheiten belegt), das Faliskische (das dem Lateinischen am nächsten steht), das Messapische, das Venetische, das bereits erwähnte Griechisch und vermutlich viele andere, die keine Spuren hinterlassen haben.
In diesen Urzeiten, als es – wie Varro in De lingua latina (V, I, 3) sagt – keinen verlässlichen Pfad gab und der Weg sich in der Dunkelheit verlor und der Schritt unsicher wurde, tobte zwischen einer Meute gegensätzlicher Kräfte, Instinkte und verzweifelter Begierden ein Kampf um die Vorherrschaft, wie in einem brodelnden Hexenkessel. Doch Chaos strebt nach Ordnung. Aus wirbelnden Strudeln bilden sich Formen, lösen sich wieder auf, und zurück bleibt etwas völlig anderes – bis schließlich ein neuer Organismus entsteht, der zunehmend Gestalt annimmt und mehr und mehr Energie sammelt, um zu überdauern.[1]
Irgendwann zwischen dem achten und siebten Jahrhundert vor Christus entwickelte sich auch – möglicherweise über die Etrusker als Bindeglied – das lateinische Alphabet, das sich am griechischen orientierte (dem wiederum jenes der Phönizier zugrunde lag). Die letzte der Fabulae des Hyginus erzählt, dass Euandros, Sohn der Nymphe Carmenta, nach seiner Verbannung aus Arkadien die griechische Schrift nach Italien brachte, aus der seine Mutter fünfzehn lateinische Buchstaben formte. Die restlichen habe Apoll hinzugefügt. In den Fasti Ovids (I, 461–586) erfahren wir außerdem, dass Carmenta die Gabe der Prophetie besaß und zu den Göttern erhoben wurde, während sie von Vergil in der Aeneis (VIII, 336) nicht mehr erwähnt wird, als er von der Regentschaft des Euandros berichtet. Giovanni Boccaccio, der Verfasser des Decamerone, greift über dreizehn Jahrhunderte später den Mythos des Alphabets in seinem lateinischen Werk De mulieribus claris – ein Verzeichnis der berühmtesten historischen und mythischen Frauengestalten aller Epochen, angefangen bei Eva, aber mit einem besonderen Augenmerk auf die Antike (wobei die Berühmtheit hier eindeutig mehr den Lastern als den Verdiensten gilt) – erneut auf, um ihn noch zusätzlich auszuschmücken. Demnach konnte Carmenta, die den Aufstieg und die Größe des zukünftigen römischen Volkes voraussah, den Gedanken nicht ertragen, dass es fremden Zeichen unterworfen sein sollte. Und so erschuf sie mit all ihrem Können und dem Beistand Gottes ein völlig neues und einzigartiges Alphabet. Der Erfolg bescherte ihr einen eigenen Kult und machte sie unsterblich.
Boccaccios Erzählung ist nicht nur um einiges detaillierter und üppiger als die antiken Quellen, sondern stellt zugleich eine leidenschaftlich-stolze und flammende Lobeshymne auf das lateinische Alphabet dar, eine Verneigung vor der Macht und dem Ruhm der Buchstaben, die in der Literatur der Neuzeit – abgesehen vielleicht von den Schlussworten im ersten Teil des Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo von Galileo Galilei – ihresgleichen sucht:
Gott war den Entdeckungen Carmentas solchermaßen gnädig gesinnt, dass, nachdem den hebräischen und griechischen Buchstaben fast aller Ruhm genommen, nunmehr beinahe das ganze Europa, über einen ausgedehnten Teil der Erde, die unseren gebraucht. Geschrieben mit diesen, erstrahlen unzählige Bücher zu allen Gelegenheiten, menschliche Heldentaten und göttliche Unterfangen werden der ewigen Erinnerung anheimgegeben, so dass wir, mit ihrer Hilfe, auch jene Dinge erfahren, die wir nicht mit eigenen Augen sehen konnten. Durch sie übermitteln wir unsere Wünsche und erhalten vertrauensvoll fremde, durch sie schließen wir Freundschaften in der Ferne und halten sie durch wechselseitige Antworten am Leben. Sie beschreiben uns – soweit das denn möglich ist – Gott; sie schildern uns den Himmel und die Erde und die Ozeane und alle Lebewesen; und es gibt nichts, das du nicht durch ihr aufmerksames Studium erkunden könntest. Kurzum, alles, was du in der Weite deines Geistes nicht zu umschlingen und festzuhalten vermagst, kann ihrer sicheren Obhut anvertraut werden […] weder die germanische Raubgier noch die gallische Raserei, noch die anglische List, noch die hispanische Grausamkeit, noch die ungehobelte Barbarei und die Angriffe manch anderer Völker konnten dem lateinischen Namen jemals solch großen, solch ansehnlichen, solch wohlangebrachten Ruhm entreißen …
Offensichtliche lexikalische und grammatikalische Ähnlichkeiten, die sich nicht auf Zufälle oder Entlehnungen zurückführen lassen, beweisen, dass sämtliche oben genannten Sprachen, seien es die italischen – abgesehen vom berühmten Beispiel des Etruskischen – wie auch die weiter entfernten, einer gemeinsamen Quelle entsprungen sind, die heute zwar nicht mehr belegbar ist, aber dank der komparativen Linguistik rekonstruiert werden kann und die von den Sprachforschern als «indoeuropäisch»[2] bezeichnet wird. Wie es sich mit der Abstammung genau verhält, darüber wird bis heute spekuliert. Nur eines lässt sich mit Sicherheit sagen: Es wird niemals gelingen, etwas anderes als Hypothesen über die Entwicklung der indoeuropäischen Sprachen aufzustellen.
Es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, an dieser Stelle die indoeuropäischen Wurzeln des Latein im Detail nachzuzeichnen. Für unsere Zwecke genügt es zu wissen, dass eines der zentralen Charakteristika des Latein seinen Ursprung im Indoeuropäischen hat – das Kasussystem. Die Endung eines lateinischen Wortes markiert nicht nur den Numerus, also Singular oder Plural, sondern auch die logische Funktion, die das Wort innerhalb des Satzgefüges hat. Insgesamt gibt es sechs logische syntaktische Funktionen und damit auch sechs Fälle mit verschiedenen Endungen: Den Nominativ (Kennzeichnung des Subjekts), den Genitiv (Attributmarkierung), den Dativ (Markierung des indirekten Objekts), den Akkusativ (Markierung des direkten Objekts), den Vokativ (Anredemarkierung) sowie den Ablativ (verschiedene Markierungen wie Ortsangabe, Zeit, Mittel, Begleitung u.a.). Jedes Wort kann daher grundsätzlich zwölf verschiedene Endungen haben, jeweils sechs im Singular und im Plural. Alle Endungen zusammen ergeben die Deklination. Das Indoeuropäische besaß noch zwei Fälle mehr: den Lokativ und den Instrumentalis, die allerdings im Lateinischen im Ablativ aufgegangen sind (wobei auch diese uralten Fälle durchaus noch an der einen oder anderen Stelle aufscheinen).
Das archaische Latein ist durch Hunderte von Inschriften belegt, die Kriegsgeschehnissen, Verwaltungsmaßnahmen, religiösen Riten oder Verstorbenen gewidmet sind. Die Sprache ist ungeschliffen und birgt nicht den Hauch einer literarischen Qualität: Die Orthographie ist bunt durcheinandergewürfelt, die Grammatik völlig uneinheitlich. Um auf Beispiele etwas gehobenerer Schriftzeugnisse zu stoßen, muss man sich in die Mitte des dritten Jahrhunderts v. Chr. begeben. Zu dieser Zeit beginnen sich eine Art sprachlicher Ordnung und sogar erste Anzeichen eines gewissen ästhetischen Anspruchs bemerkbar zu machen. Die Zeugnisse sind fragmentarisch, aber das Bild bestimmter Personen lässt sich ohne weiteres anhand einer bemerkenswerten Zahl an Überlieferungen rekonstruieren, allen voran das von Cato (234–149 v. Chr.) und dem Komödienschreiber Plautus (ca. 250–184 v. Chr.). Ihr Leben deckt sich mit dem Aufstieg Roms als Beherrscherin des Mittelmeerraums. Nur drei Jahre nach dem Tod Catos fallen 146 v. Chr. sowohl Karthago als auch Korinth. Der gefürchtete nordafrikanische Feind ist vernichtet, und Griechenland wird zum römischen Protektorat (bis es 27 v. Chr. den Status einer römischen Provinz erlangt).
Aus dem umfangreichen Schaffen Catos, des berühmten Zensors, Vorzeigegegner der Aristokratie und Erzfeind Karthagos, ist uns nur ein einziges Werk erhalten geblieben: De agri cultura, das eine neue Gattung begründet, die in Rom zahlreiche Meister finden wird (von Varro über Columella bis hin zu einem der ganz Großen wie Vergil). Man kann sagen, dass dies für uns den Beginn der lateinischen Literatur darstellt, jener Latinitas, die über so viele Jahrhunderte lebendig sein und sich zum Sinnbild einer ganzen Sprach- und Denkschule entwickeln wird. Cicero selbst, dem wir uns bald zuwenden wollen, sah in Cato den ersten wahren Prosaisten der Geschichte: Alles, was zuvor geschrieben worden sei, verdiene es nicht, gelesen zu werden (BrutusXVII, 69). Cicero bezieht sich vor allem auf die leider fast vollständig verlorengegangenen Reden Catos, die uns nur durch das eine oder andere indirekte Zitat erhalten geblieben sind.
Auch das überlieferte Traktat Catos zur Landwirtschaft weist noch immer primitive Züge auf, es ist eine reine Auflistung, die nicht nur auf den präskriptiven Charakter der Gattung zurückzuführen ist (tu dieses, tu jenes; lass dieses, lass jenes; dies macht man so und nicht so, …): Die Syntax beschränkt sich auf einige wenige, wiederkehrende Strukturen und tendiert zu einer gewissen Formelhaftigkeit. Dennoch wohnt Catos Prosa unübersehbar eine künstlerische Kraft inne. Sie ist klar, positiv, eindringlich, kurz und bündig.
Schauen wir uns hierzu ein Beispiel an – die Anweisung über das Einsalzen von Schinken, die den Text beschließt:
In fundo dolii aut seriae sale sternito, deinde pernam ponito, cutis deosum spectet, sale obruito totam. Deinde alteram insuper ponito, eodem modo obruito. Caveto ne caro carnem tangat. Ita omnes obruito. Ubi iam omnes conposueris, sale insuper obrue, ne caro appareat; aequale facito. Ubi iam dies quinque in sale fuerint, eximito omnis cum suo sale. Quae tum summae fuerint, imas facito eodemque modo obruito et conponito. Post dies omnino XII pernas eximito et salem omnem detergeto et suspendito in vento biduum. Die tertio extergeto spongea bene, perunguito oleo, suspendito in fumo biduum. Tertio die demito, perunguito oleo et aceto conmixto, suspendito in carnario. Nec tinia nec vermes tangent.
(De agri cultura, 162, 1–3)
Der Text besteht größtenteils aus einer Reihe von Imperativen im Futur mit der Endung -ito; zudem kehren bestimmte Verben (obruo, compono) und syntaktische Konstruktionen (ubi …) regelmäßig wieder. Auffällig sind darüber hinaus die Vorliebe des Autors für das Homöoteleuton, bei dem aufeinanderfolgende Wörter lautgleich enden (sternito/ponito etc.), und die Alliteration, bei der sich der Anlaut der betonten Silbe aufeinanderfolgender Wörter wiederholt (caveto/caro/carnem; fuerint/facito), sowie seine glückliche Hand bei der stringenten Abhandlung des Themas, so banal es auch sein mag. Die Übersetzung lautet:
Auf den Boden des Fasses oder der Tonne streue Salz; dann lege einen Schinken hinein; die Schwarte soll nach unten schauen! Bedecke ihn ganz mit Salz. Dann lege den zweiten Schinken darüber; überschütte ihn auf gleiche Art, gib acht, dass nicht Fleisch und Fleisch sich berührt. So überschütte alle. Wenn du dann alle eingelegt hast, überstreue sie noch mit Salz, damit kein Fleisch zum Vorschein kommt; mache es eben. Wenn sie dann fünf Tage im Salz gewesen sind, nimm alle mit dem Salz heraus; die dabei ganz oben gewesen sind, mache zu den untersten und überschütte sie auf gleiche Weise [mit Salz] und lege sie ein. Nach insgesamt zwölf Tagen nimm die Schinken heraus und wische alles Salz ab und hänge sie in den Wind zwei Tage lang; am dritten Tag wische sie mit einem Schwamm gut ab, bestreiche sie gründlich mit Öl, hänge sie in den Rauch zwei Tage lang. Am dritten Tag nimm sie herab, bestreiche sie gut mit einer Mischung von Öl und Essig, hänge sie in der Fleischkammer auf; weder Maden noch Würmer werden an sie gehen.
5.Rätsel und Staunen
Eine meiner größten Überraschungen im ersten Lateinjahr war die Entdeckung Catulls. Es war, daran erinnere ich mich noch ganz genau, kurz nach Weihnachten, als ich ohne fremde Hilfe fündig wurde. Ich hatte wieder einmal im Tantucci, der damals gängigsten Schulgrammatik, geschmökert und war dabei auf eine Einführung gestoßen, die unsere Lehrerin wohl absichtlich übersprungen hatte. Dort ging es nämlich um Metrik, die Silbenquantität also, ein für uns Anfänger völlig abwegiges Konzept. Wir mussten erst noch ganz andere Dinge lernen, bevor wir uns auf die Regeln des lateinischen Verses stürzen konnten: Endungen über Endungen, ob von Substantiven oder Verben – und endlose Listen von Ausnahmen. Die Metrik kam erst danach, wenn überhaupt.





























