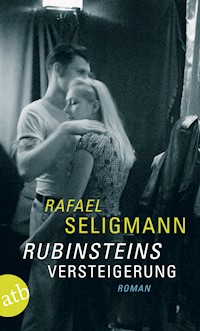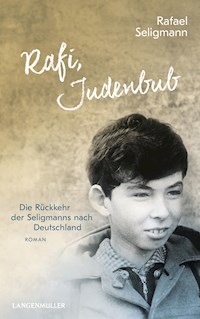18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist eine glückliche Kindheit, gefolgt von erfüllten Jugendjahren. Sein Vater ist ein wohl situierter Kaufmann, Glaube und Tradition bestimmen das Leben der Familie. Als einziger der Geschwister darf Ludwig das Gymnasium besuchen. Er trainiert die Fußballmannschaft und singt im Synagogenchor. Es sind die letzten goldenen Jahre des deutsch-jüdischen Miteinanders, die 1930 mit dem Aufstieg der Nazis ein grausames Ende finden. "Lauft weg, so weit ihr könnt!", mahnt der Ortspfarrer die beiden Brüder Ludwig und Heinrich Seligmann. Kurz darauf, im März 1933, fliehen die jungen Männer aus Nazi-Deutschland nach Frankreich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ludwig Seligmann
Rafael Seligmann
Lauf, Ludwig, lauf!
Eine Jugend zwischen Synagoge und Fußball
Roman
LangenMüller
Ludwig Seligmann, seine Eltern Klara und Isaak Raphael sowie die Geschwister Heinrich, Thea und Kurt haben das Beschriebene erlebt. Die Rabbiner Aron Cohn und Emanuel Neuwirth, Hauptlehrer Isaak Brader sowie Ludwigs Freunde Siegfried Herrligkoffer und Karl Seiff waren reale Personen. Alle übrigen Protagonisten sind Fiktion.
© für die Originalausgabe und das eBook: 2019 LangenMüller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten.
F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: STUDIO LZ, Stuttgart
Umschlagmotiv: Football in Street, © Haywood Magee, gettyimages
Lektorat: Boris Heczko
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-7844-8350-4
www.langen-mueller-verlag.de
Für meinen Vater Ludwig
und dessen Urenkel Hannah,
Eviatar und Zadok
Inhalt
Glück
Synagoge
Lüge
Krieg
Gymnasium
Revolution
Heimkehr
Fußball
Bar Mizwa
Lehre
Inflation
Elternhaus
Kaufmann
Lauf, Ludwig, lauf!
Heilige Gesellschaft
Verliebt
Aufbruch
Zions-Sänger
Erbarmen
Leidenschaft
Geschäfte
Berlin
Heimat
Zeitenwende
Geborgenheit
Bankrott
Misshandlung
Ohnmacht
Jom Kippur
Hitler
Flucht
Epilog
Glossar
Danksagung
Glück
Frisch gekämmt und neu eingekleidet stand ich mit meinem Bruder Heinrich auf dem Perron des Günzburger Bahnhofs. Wir warteten an Mutters Seite auf Vater. Er hatte Mama per Feldpostkarte wissen lassen, dass er eine Woche Fronturlaub erhalten habe.
Endlich stampfte der Zug in den zweigleisigen Bahnhof. Als die Lokomotive fauchend zum Stehen kam, lief Heiner zum Halteabschnitt der Sergeanten. Denn die Militärzüge waren in Wagen für Mannschaften, Unteroffiziere und Offiziere unterteilt.
Uniformierte stiegen aus. Heinrich umkreiste sie. Die Unteroffiziere gingen zu ihren wartenden Frauen und Kindern. Vater erschien nicht. Mutter erstarrte. Was war passiert?
Da sah ich aus dem Waggon hinter der Lokomotive, der am weitesten von uns entfernt war, einen groß gewachsenen breitschultrigen Mann mit einem kleinen Tornister auf dem Rücken die Stufen herabsteigen. Mit weit ausholenden Schritten ging er auf uns zu, während der Säbel an seiner Seite schwang. Mein Herz schlug bis zum Hals.
»Vater!«, rief ich. »Lauf zu ihm, Ludl!«, erlaubte mir Mutter. Ich sauste los. Da entdeckte auch Heiner Papa und rannte in dessen Richtung. Doch ich war schneller, obgleich ich kleiner war als mein Bruder.
Vater erschien mir in seinem offenen grauen Militärmantel, dem straffen Uniformrock und seinen groben Schaftstiefeln riesig. Seine Augen hinter den runden Brillengläsern sahen uns liebevoll an, als er Heinrich und mir seine Hände auf die Schultern legte: »Gott sei Dank, Kinder.«
Nun lenkte Papa seine Schritte zu Mutter, die noch immer wie angewurzelt dastand. Er machte vor ihr halt, legte sein Gepäck ab. Wortlos blickten die beiden einander an. Schließlich nahm Vater die Hand meiner Mutter, die einen Kopf kleiner war als er. Er sprach leise, doch so deutlich zu ihr, dass ich es hören konnte: »Baruch ha Schem, Gesegnet sei der Ewige!«
Heinrich ergriff den am Boden liegenden Ranzen und stemmte ihn hoch. »Das ist ja ein Offizierstornister, Vater!«. Seine Stimme überschlug sich. »Du bist aus dem Offiziersabteil ausgestiegen … Bist du jetzt Offizier?«
»Ja. Ich bin Feldwebelleutnant«, lautete die ruhige Antwort.
Als wir die Bahnhofshalle durchquerten, salutierten alle Soldaten vor ihm, dem einzigen Offizier. Vater erwiderte die Ehrbezeugung knapp.
Auf dem Bahnhofsvorplatz wartete unser Hausknecht Maximilian Lechner. Sobald er uns sah, stieg der ältere Mann so rasch er konnte vom Kutschbock der halb geschlossenen Chaise und kam uns entgegen. »Grüß Gott, Herr Seligmann, äh … Herr Leutnant …« Papa ergriff die Hand seines Knechts. »Danke, Max.«
Nachdem Herr Lechner meinem Bruder den Tornister abgenommen hatte, half Vater Mutter auf die Rückbank. Heinrich und ich kletterten auf den Kutschbock, wo auch Maximilian Lechner Platz nahm. Er ergriff die Zügel. »Hüah!« Sogleich zog unser Gaul Fritz an und fiel bald in raschen Trab. Der kalte Fahrtwind schlug mir ins Gesicht.
Vater! Mein Vater war der oberste Soldat. Ein Held, dem alle die Ehre erwiesen! Und er war endlich aus dem Krieg zu uns gekommen.
Ich war unendlich stolz. Es war der schönste Augenblick meines Lebens. Das Glück flog dahin wie unsere Kutsche auf dem Weg nach Ichenhausen zu unserem Heim im Dezember 1914.
Synagoge
Am Abend gingen wir an der Seite unserer Eltern zum Chanukka-Gottesdienst. Vater wollte sich, wie stets, wenn er das Gotteshaus besuchte, in seinen dreiteiligen Anzug samt Zylinder kleiden. Doch Heinrich und ich bettelten so lange, bis er stattdessen seine Uniform anlegte. Den Säbel jedoch ließ er trotz unseres inständigen Drängens zu Hause. »Kriegsgerät hat im Gotteshaus nichts zu suchen. Es dient dazu, Menschen zu töten.«
Unsere Familie zog durch die kalte Dunkelheit zur Synagoge. Auf dem kurzen Weg dorthin kamen uns mehrere Fronturlauber entgegen, die Vater – auch ohne Säbel – zackig grüßten. Heiner strahlte.
Nach wenigen Minuten erreichten wir unsere Synagoge. Mir war damals noch nicht bekannt, dass der Barockbau 1781 nach Plänen des Kirchenbaumeisters Joseph Dossenberger errichtet worden war. Aber ich wusste ebenso wie mein Bruder, wie meine Eltern, wie jeder Jude bei uns in Ichenhausen, dass wir die schönste Synagoge der Welt hatten.
Wir traten durch die zweiflügelige Tür. Darüber prangte in weißen hebräischen Lettern auf blauem Feld der Spruch: »Dies ist das Tor, durch das die Gerechten einziehen werden.«
Die Synagoge erstrahlte in goldgelbem Licht. Zahllose Kerzen aller Größe und Form brannten und strahlten Wärme aus. Zudem war die elektrische Beleuchtung eingeschaltet. Während Mutter die Holztreppe zur Frauengalerie hinaufstieg, gingen Heiner und ich in unseren guten Anzügen dicht hinter Vater inmitten des den Männern vorbehaltenen Parketts über den roten Teppich auf dem hölzernem Boden des breiten Mittelgangs, vorbei an der Bima, der Bühne, auf der aus der Thora gelesen wurde.
In der zweiten Reihe wies ein kleines schwarzes Schild mit silberner Frakturschrift und hebräischen Buchstaben darauf hin, dass dies der Platz von »Isaak Raphael Seligmann« war. Vater legte seine Gebetstasche aus blauem Samt, auf die ein gelber Davidstern gestickt war, am Pult ab und zog seinen Gebetsschal, den Tallit, hervor. Danach ergriff er sein dickes deutsch-hebräisches Gebetbuch und reichte Heiner und mir unsere kleinen Kinderbände, die wir neben Vaters Kompendium legten.
Ich konnte bereits einige Gebete lesen, vor allem das »Höre Israel«. Denn seit Anbeginn lernten wir in der siebenklassigen Israelitischen Schule auch Hebräisch lesen und schreiben. Ich war schon sieben Jahre alt und besuchte die zweite Klasse, Heiner die vierte. Mein Lieblingsgebet aber kannte ich bereits, ehe ich zur Schule durfte. Vater hatte Heiner und mir das Nachtgebet für Kinder beigebracht: »Beschützender Engel, der mich vor allem Bösen bewahrt, segne die Knaben und bewahre meinen Namen sowie jenen unserer Väter Abraham und Isaak, auf dass wir uns mehren.«
Ich hatte mir die Worte sogleich eingeprägt. Heiner hingegen waren sie verflogen, sodass Vater sie ihm am folgenden Abend noch einmal vorsagen musste. Streng ermahnte er seinen Erstgeborenen, sich den Text des Gebets zu merken. Mein zwei Jahre älterer Bruder besuchte damals bereits die Schule, ich aber hatte den Wortlaut des Segens behalten.
Sobald wir allein waren, verabreichte mir Heiner eine Kopfnuss. Dass ich ihm von Vater als Vorbild vorgehalten wurde, war meinem Bruder unerträglich. Er übte so lange, bis auch er das Gebet hersagen konnte. Danach haute er mich kräftig durch. Abends brannte Heiner darauf, Vater zu zeigen, dass er seine Erwartung erfüllte.
In der Synagoge standen wir einträchtig an Papas Seite. Auch andere Männer trugen Uniformen. Als sich die Beter vollständig versammelt hatten, begab sich Rabbiner Dr. Cohn in Begleitung von Kantor Abraham Loew, gefolgt vom Synagogendiener Moritz Meinfelder, zur Bima, wo der mächtige neunarmige Chanukka-Leuchter aufgestellt war.
Vater mochte Moritz Meinfelder gern. Sobald er den Schammes sah, erhellte ein Lächeln seine gesammelte Miene. Meinfelder war Mitte siebzig, sein gepflegter Bart schlohweiß. Doch der Synagogendiener hielt sich aufrecht, und seine Gesichtszüge waren fröhlich. Von Vater wusste ich, dass Meinfelder schon seit mehr als vierzig Jahren Synagogendiener in Ichenhausen war. Nach der Trauung meiner Eltern hatte der Schammes das Paar unter der von vier Männern getragenen Chuppa, dem Hochzeitsbaldachin, durch das Städtchen geführt. Dabei spielte er auf seiner Klarinette religiöse Weisen, die der Gesangsverein Zion begleitete. Zu den Klängen von »Kol sason u kol simcha, kol chatan u kol kala« – Alles Glück und alle Freude jedem Hochzeiter und jeder Braut – bewegte sich der Zug durch die Gassen.
Angeführt von unserer Mischpoche folgten die singenden Synagogenbesucher. Die christlichen Ichenhauser hatten Teil an der Freude. Sie riefen »Hoch die Brautleut’! Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen!« Ichenhausen hatte meine Eltern gefeiert. Jedes Mal, wenn Vater davon erzählte, leuchtete sein Gesicht auf.
Nachdem der Kantor den Segensspruch zum Lichterfest gesungen hatte, bat der Rabbiner die Fronturlauber zu sich auf die Bühne. Vater hatte wie alle verheirateten Männer den weißen, an den Enden schwarz gestreiften Tallit um die Schultern gelegt. Anstelle ihrer Uniformmützen trugen die Herren eine schwarze Kippa.
Als die Handvoll Soldaten ihn umstanden, legte Dr. Cohn nacheinander jedem segnend die Hand auf die Stirn. Er dankte den Eingezogenen, dass sie ihre Pflicht erfüllten wie jeder Soldat des Reiches. »Damit wir wieder in Frieden mit allen Völkern leben können.«
Der Rabbiner besah die Männer. Mit einem Mal richtete er seinen Blick zu den Frauen auf der Galerie, was er nie zuvor getan hatte. »Liebe Brüder, liebe Schwestern! Der eine oder andere von euch mag sich gefragt haben, warum ich im Krieg über den Frieden spreche.« Der Rabbiner legte eine Pause ein. »Weil Krieg nicht nur aus Schlachten und Siegen besteht. Krieg bedeutet auch Opfer. So wollen wir denn heute unserer Brüder Isaak und Max Gerstle gedenken, die im Dienste unseres Vaterlandes ihr Leben ließen. Möge der Ewige ihren Seelen gnädig sein.« Der Rabbiner rief die Männer zum Kaddisch-Totengebet auf. Gemeinsam sprachen sie die Worte der Preisung Gottes.
Unser Hauptlehrer Isaak Brader hatte uns den Tod der Soldaten verheimlicht. Als er erfuhr, dass Max Kochmann dennoch davon erzählte, hatte ihn der Schulleiter aus der Klasse geholt. Später war Max verweint zurückgekommen. Er wollte nicht mehr darüber sprechen.
Am Abend hatten Heiner und ich Mutter gefragt. Sie mahnte uns, diese schlimme Sache schnell zu vergessen. Aber jetzt hatte der Rabbiner die traurige Nachricht bestätigt: Männer aus Ichenhausen, die mit uns in der Synagoge gebetet hatten, waren tot. Mir kamen die Tränen, und auch in Heinrichs Augen glänzte es. Selbst erwachsene Männer senkten die Köpfe, damit man sie nicht weinen sah.
Dr. Cohn war in ein langes dunkles Gewand gekleidet. Er sprach zu den Betern über die Bedeutung von Chanukka als Fest des Lichts und der Freiheit, die von den Makkabäern einst für die Juden erkämpft worden war. »So wie jetzt unsere deutschen Grenadiere für unser Land und seine Freiheit fechten, das sich einer Welt von Feinden erwehren muss.« Danach reichte der Rabbiner Vater die Diener-Kerze, damit er das erste Chanukka-Licht entzünde. Papa sprach den Segen, und die übrigen Soldaten fielen in seine Worte ein.
Nach dem Gebet kehrten die Männer an ihre Plätze zurück. Wie immer, wenn er sich verlegen fühlte, rückte Vater seinen Tallit zurecht. Isaak Raphael Seligmann war trotz seiner kräftigen Statur ein scheuer Mann. Er floh jegliche Aufmerksamkeit.
Ich dagegen war gar nicht schüchtern. Nur ganz selten, wie jetzt, als der Rabbiner von den toten Männern sprach, war ich traurig. Ansonsten erwachte ich jeden Morgen mit froher Laune, und dabei blieb es. Ich liebte meine Mutter und meinen Vater, Heiner und meine einjährige Schwester Thea. Ich mochte Menschen gern und hatte Zutrauen zu ihnen. Nur den strengen Hauptlehrer Brader konnte ich nicht leiden.
Während Vater und die Gemeinde die Gebete sprachen, sah ich nach oben zur Frauengalerie. Papa hatte Heiner und mich wiederholt ermahnt, »in der Synagoge nur zu Gott zu beten. Nicht zu träumen, zu schwätzen oder die Frauen anzugaffen«. Während des Gottesdienstes blickte Vater nie nach oben – nicht einmal zu seiner Frau.
Ich aber konnte mich nicht satt sehen an den schönen Ichenhausener Damen, die ihre eleganten Kleider, Mäntel und Hüte mit dem wippenden Federschmuck vorführten. Die Schönste war natürlich Mutter. Anders als viele jüdische Frauen hatte sie keine dicken schwarzen Haare, dunkle Augen und volle Lippen. Mama war rötlich-blond, ihre Haut hell. Wie stets las sie aufmerksam in ihrem Gebetbuch. Ihr Ernst strahlte eine Kraft aus, die sie zum Mittelpunkt der Frauen auf der Galerie machte. Manche von ihnen schwatzten und blickten zu den Männern hinunter.
Mutter spürte wie immer, dass ich sie ansah. Ein zartes Lächeln legte sich auf ihre Lippen, und sie hob kaum merklich ihre großen blauen Augen – dann vertiefte sie sich wieder in ihr Gebet. Ich sah weiter zu ihr, ehe mein Blick zum Himmel strebte. Himmel! Die Decke der Synagoge war als blaues Firmament voller gelber Sterne gestaltet. Das Himmelszelt und die Sterne leuchteten zu jeder Tageszeit in anderen Farben. Im Sommer schimmerte der Synagogenhimmel am Schabbatvormittag so hell, dass die Sterne verblassten – wie im Freien. An regnerischen Tagen dagegen nahm er die grünliche Farbe unserer Günz an.
Jetzt am Abend war die Decke ins Zwielicht getaucht. Die Helle der Kerzen und des elektrischen Lichts ließen das blaue Zelt dunkel erscheinen, während die Deckensterne blinkten. Der Zauber unseres Synagogenhimmels blieb mein Leben lang ungebrochen.
Nach dem Gottesdienst gingen mein Bruder und ich mit unseren Eltern zügig heim. Der Duft der von unserer Köchin Margreth frisch gebackenen Chanukka-Krapfen zog durch das Haus. Auf dem Salontisch wartete das süße Gebäck in einer blau-weißen Porzellanschüssel darauf, von uns genossen zu werden. Neben den Leckereien stand Vaters großer Chanukka-Leuchter aus massivem Silber. Wenn man ihn drehte, wurde eine Spieluhr aufgezogen, und die Chanukka-Weise »Maos Zur«, Fels meiner Zuversicht, ertönte.
Nachdem Heiner und ich gemeinsam die erste Kerze unseres Kinderleuchters entzündet und mit den Eltern die Liedstrophen gesungen hatten, durften wir endlich die Krapfen verspeisen. Dann reichte Mutter Heiner und mir unsere Dreidel, die sie das Jahr über in ihrem Zimmer aufbewahrte. Vater sah zu, wie wir die bunten Holzkreisel wirbeln ließen. Er hatte seine Uniform abgelegt und trug nun seinen schlichten grauen Hausanzug mit Krawatte.
Mit der Militärkleidung war die Anspannung von Vater abgefallen. Er hockte sich zu uns auf den Boden, was er lange nicht mehr getan hatte. Dann ließ er sich Heiners Dreidel geben und betrachtete den vierseitigen Kreisel. Wie so oft kehrte sich sein Blick nach innen. Erinnerte er sich an seine eigenen Kindertage?
Doch dann wandte Vater sich wieder Heiner und mir zu. »Was haben die hebräischen Buchstaben zu bedeuten?«, fragte er. »Pe. Nun. Schin. Gimmel«, ratterte Heiner herunter. Ständig lauerte er darauf, sich vor Vater auszuzeichnen. Der nickte. »Ja. So heißen die Lettern. Doch wisst ihr auch, warum sie auf den Kreiseln stehen?«
Hauptlehrer Brader hatte es letzte Woche mit seiner Löwenstimme verkündet. Doch Heiner schwieg. Wahrscheinlich hatte er dem Lehrer nicht zugehört. Wenn ich es jetzt erzählte, würde mein Bruder wütig werden. Natürlich würde er nicht wagen, mich vor den Eltern zu hauen. Erst danach. Ich würde es ihm zurückgeben. Aber nun konnte ich Mutter zeigen, wie gut ich lernte.
Papa musterte uns mit stummem Tadel und erklärte: »Weil die griechischen Besatzer den Juden verboten hatten, ihre Sprache zu lehren, malten die Rabbiner auf das Spielzeug der Kinder das hebräische Alef, Bet. Auf diese Weise lernten die Buben unsere Sprache spielend.«
Warum hatte ich mich nicht getraut zu antworten? Nicht nur wegen Heiner. Gegenüber Vater empfand ich immer eine gewisse Scheu, weil ich nur der Zweitgeborene war. Er sprach dies nie aus, aber ich wusste es.
Mutter hielt unsere kleine Schwester Thea auf dem Schoß. »Ludl, Heiner, ihr seid sicher müd’ nach diesem gesegneten Tag … Jetzt sollt ihr zu Bett.« Ich gab Mutter einen Kuss, obgleich mir nicht gefiel, was sie verlangte. Heinrich reichte Vater die Hand. Unser Kindermädchen Lieserl nahm Thea auf den Arm, und wir folgten ihr zur Wendeltreppe, die zu unserem Bubenzimmer im zweiten Stock führte.
Die Aufregung hielt Heiner und mich noch lange wach. Statt zu spielen oder zu raufen, schmiedeten wir Pläne, wie wir Vater dazu bringen konnten, in voller Uniform mit Säbel im Ort aufzutreten. Schließlich schlief Heiner ein. Ich lag im Dunkeln und durchlebte in Gedanken noch einmal jede Minute dieses wunderbaren Tages.
Lüge
Ich liebte meinen Vater, doch zugleich fürchtete ich ihn. Papa ließ uns keine Zweideutigkeit durchgehen. Auf Unehrlichkeit reagierte er gnadenlos streng.
Das bekam ich noch während meines ersten Schuljahres zu spüren. Seit jeher liebe ich Süßes, vor allem Schokolade und Kuchen. Sobald ich an der Auslage der »Konditorei Werner« vorbeikam und dort die frisch gebackenen Kuchen und Torten erblickte, lief mir das Wasser im Munde zusammen. Wenn ich Taschengeld bekam, gab ich alles innerhalb von zwei Tagen beim Kuchenbäcker aus. Doch die Woche hat sieben Tage. Mit jedem wuchs mein Heißhunger. Am ärgsten wurde es am Freitag. Dem im Schaufenster präsentierten Zwetschgendatschi konnte ich nicht widerstehen. Wegen des bevorstehenden Schabbats hatte es nur ein knappes Mittagbrot und zwei Äpfel gegeben. Beim Gedanken an das opulente abendliche Mahl und die süßen Nachspeisen packte mich die Gier. Ich musste ein Stück Kuchen haben – jetzt gleich!
Also ging ich zu Vater, der eben von einer Geschäftsfahrt mit Max heimgekehrt war und sich, nach dem Entzünden einer Zigarre, in seinem Kontor daran machte, die Wochenzeitung »Der Israelit« zu lesen. Ich wartete, bis er aufblickte, und erbat ein paar Pfennige. Papa wollte wissen, wofür ich das Geld bräuchte. »Für Brezn am Wochenmarkt«, erwiderte ich nach kurzem Zögern. Vater legte Wert darauf, dass wir nie hungrig waren. Er fischte in seiner Geldbörse nach Kupfermünzen und übergab sie mir. Ich bedankte mich und lief schnurstracks zum Konditor Werner.
Mit dem Auspacken des Kuchens wollte ich bis daheim warten und ihn dann allein in unserem Zimmer genussvoll verspeisen. Doch der Duft des Datschi berauschte mich, sobald ich die Tüte in Händen hielt. Noch im Laden riss ich das Wachspapier auf, zupfte mir ein Stück Mürbteig ab und steckte es zwischen die Lippen. Der Geschmack überwältigte meine Sinne. Ich wusste, das Beste kam noch, die gesüßten Pflaumen. Doch ich beherrschte mich, bis ich auf der Straße war. Ich setzte mich auf die Steinstufen des Stadtbrunnens und aß einen ersten Zwetschgenbissen. Meine Augen schlossen sich. Es gab nichts auf der Welt, das so gut schmeckte.
»Ludwig!« Vaters Stimme platzte in meinen Sinnesrausch. Ich riss die Augen auf. Papa näherte sich von unserem Haus. Mit dem Kuchen in Händen stand ich auf.
»Komm her!«
Ich trat zu ihm.
»Was tust du?«
Ich musste mich zwingen, ihm zu sagen, was er ohnehin sah.
»Woher hast du das Geld für den Kuchen?«
»Du hast es mir gegeben, Vater.«
»Nein! Du hast um Geld für Brezn gefragt. Aber du hast dafür Kuchen gekauft. Du hast gelogen!« Seine Stimme schnitt mir in die Seele. »Lügen ist Sünde! Als dein Vater habe ich die Pflicht, dich zu bestrafen, damit du nie wieder die Unwahrheit sagst.«
Mir schossen die Tränen in die Augen. Vater wies mich an, ihm ins Haus zu folgen. Dort musste ich zunächst den Kuchen, der mit einem Mal seinen Duft eingebüßt hatte, in der Küche abstellen. »Komm in mein Kontor, Ludwig.« Vater setzte sich vor seinen Schreibtisch. Er befahl mir, ihm sein schweres Holzlineal zu reichen. Ich musste mich über sein Knie legen. Vater atmete hörbar zwischen seinen Worten: »Ich will keinen Laut von dir hören! Niemand soll Zeuge deiner Schande sein. Hast du verstanden?«
»Ja, Vater.«
Da sauste bereits der erste Hieb auf mein Gesäß. Weitere folgten. Ich biss die Zähne zusammen.
Endlich hielt Vater inne. Er hieß mich aufstehen und erhob sich ebenfalls. Durch meine vertränten Augen sah ich sein gerötetes Gesicht. Vater wies mich an, so lange in seinem Kontor zu verharren, bis ich mich »wieder in der Gewalt« hätte. Ehe er den Raum verließ, erneuerte Vater seine Mahnung, niemandem von meiner Untat zu erzählen.
Ich folgte seiner Weisung und bin mein Lebtag bei der Wahrheit geblieben. Das brachte zunächst manchen Nachteil mit sich. Doch als ehrlicher Mann fühlte ich mich frei.
Das Geheimnis meiner Lüge und Vaters Züchtigung habe ich länger als ein halbes Jahrhundert für mich behalten, ehe ich es meinem Sohn anvertraute. Der mochte keine Süßigkeiten. Stattdessen übte er sich in anderen Sünden – die meiner Bestrafung harrten.
Krieg
Ich lag in meinem Bett neben meinem schlafenden Bruder und musste an die toten Brüder Gerstle denken. Jetzt verstand ich Mutters Aufregung im Sommer, als der Krieg begonnen hatte. Vater hatte sich freiwillig als Soldat an die Front gemeldet. Obwohl Mama ihn anflehte: »Wenn dir im Feld etwas zustößt, bin ich mit den Kindern allein.«
Papa mühte sich, die Beherrschung zu bewahren. Aber ich hörte seine Stimme beben, als er Mutter entgegnete: »Wenn das Vaterland in Gefahr ist und uns ruft, dann muss jeder Mann es verteidigen. Besonders wir Juden. Gerade jetzt, wo wir in Deutschlands Krieg endlich genauso viel zählen wie unsere christlichen Kameraden.«
Mutter verstummte. Für gewöhnlich wies sie Lieserl an, uns Kinder auf unser Zimmer zu bringen. Denn sie wollte nicht, dass wir Zank oder auch nur laute Worte unserer Eltern mitbekamen. Doch an diesem warmen Abend war nichts wie sonst.
Es brauchte eine Weile, ehe Mutter die Sprache wiederfand. »Ja, Isaak. Wir müssen unsere Pflicht für das Vaterland erfüllen genau wie alle. Unsere Männer ziehen ins Feld. Jeder bis vierzig. Aber du bist schon 41 Jahre alt. Du trägst auch Verantwortung für deine Familie. Du musst für das Geschäft sorgen, für unser Haus und die Menschen, die bei uns arbeiten. Wir brauchen dich! Du musst hier deine Pflicht erfüllen, während die anderen im Feld die ihre tun.« Ich sah, dass Mutter die Hände ineinanderpresste, dass die Finger weiß wurden.
Vater blickte seine Frau eindringlich an. »Ich bin nach meiner Einjährigen Reife zu den Ulanen gegangen – obwohl ich am liebsten weitergelernt und studiert hätte. Mein Vater selig hat es anders gewollt. Zuerst haben sie sich im Militär über mich lustig gemacht. ›Ein Jud’ und ein Brillenträger obendrein …‹ Aber ich war kräftig, stärker als die meisten, und konnte gut reiten. So haben sie mich bald anerkannt und zum Wachtmeister befördert. Später habe ich alle Reserveübungen mitgemacht. ›Der Seligmann ist ein guter Soldat, obwohl er nur ein Jud’ ist‹.« Ein Lächeln huschte über Vaters Züge, ehe er fortfuhr »›Der springt mit seinem Gaul glatt über die Bundeslade.‹« Vater ahmte den schnarrenden Ton des Feldwebels nach. »Seit knapp zwei Dutzend Jahren bin ich Reservist. Jetzt muss und will ich tun, wofür ich ausgebildet wurde.«
Mutter schwieg. Sie verstand, dass es sinnlos war, ihrem Mann zu widersprechen. Da wurde sie gewahr, dass wir Kinder immer noch im Zimmer waren. Sie fuhr uns flüchtig übers Haar. Anders als sonst waren ihre Hände heute kalt.
Eine Woche später war Vater mit den anderen Männern Ichenhausens in die Armee eingerückt. Einträchtig zogen Christen und Juden durch die Hauptstraße, vorbei an unserem Haus in der Marktstraße 302 zum Bahnhof. Dort spielte die Feuerwehrkapelle den Bayerischen Defiliermarsch. Prälat Sinsheimer betete für die katholischen Soldaten. Die jüdischen Grenadiere wurden von Rabbiner Dr. Cohn gesegnet: »Möge der Herr euch erleuchten und beschützen auf all euren Wegen und bei all euren Taten. Es ist die Glaubenspflicht jedes Juden, seinem Vaterland und dessen Herrscher treu zu dienen.« Danach marschierten die Männer wiederum mit Musikbegleitung zum Zug und kletterten unter Jubelrufen in die grünen Waggons. Kurz darauf setzte sich die Dampflokomotive mit lautem Pfeifen in Bewegung. Vater rückte zu seinem Landsturmbataillon ein, das zum Ulanen-Regiment in Dillingen gehörte.
Unser Haus schien uns nunmehr verödet, und wir fühlten uns verlassen. Beim Abendbrot fiel mein Blick auf das Gedeck meines Vaters, das Mutter auch in seiner Abwesenheit auflegen ließ. Mir stiegen die Tränen in die Augen. Nach dem Essen schlich ich mich in Mutters Salon. Wir Kinder durften das Zimmer nicht ohne ihre Erlaubnis betreten. Der Raum mit den zarten Biedermeiermöbeln ihrer Aussteuer war Mamas Reich. Dort führte sie ihre Haushaltsbücher, las und pflegte die Korrespondenz mit Freundinnen aus ihrer Zeit im Institut für Hauswirtschaft in Nürnberg. Nur Vater und besondere Gäste waren in Mutters Refugium willkommen – und ganz selten Heiner und ich.
Als ich zaghaft an die Tür klopfte, antwortete Mutter sogleich: »Komm herein!« Sie saß an ihrem aufgeklappten hellbraunen Sekretär. Als ich zu ihr trat, leuchtete ihr Gesicht auf. Bei Mutter ging es mir so gut wie nirgends – nicht bei Vater, der ebenso wie Heiner am 1. Mai Geburtstag hatte und ihm zudem seine dunkelbraunen Augen vererbt hatte, nicht in der Synagoge, nicht einmal beim Fußball. »Ludl, mein Sohn. Du bist mein Gottesgeschenk! … Heiner und Thea natürlich auch …«, beeilte sie sich hinzuzufügen. Doch sie und ich wussten, dass ich ihr liebstes Kind war.
Mutter wies zum aufgeschlagenen Gebetsbuch auf dem Sekretär. »Ich habe gerade auf den freien Seiten eingetragen, dass Vater heute ins Feld gezogen ist, und den lieben Gott gebeten, dass er Isaak Raphael allzeit beschützen und beschirmen soll.«
»Amen!«, entschlüpfte es mir.
»Du weißt immer das richtige Wort, mein Ludl.« Mutter drückte mir einen Kuss auf die Stirn.
Während seines Urlaubs im Dezember des ersten Kriegsjahres vermied Vater eine »Salutierparade«. Selbst wir Buben spürten, dass er sich danach sehnte, im Kreis seiner Familie, besonders bei seiner Frau, zu verweilen. Er ging lediglich in die Synagoge. Allabendlich versammelte er sich dort mit den anderen Gemeindemitgliedern, um die weiteren Chanukka-Lichter zu entzünden.
Im Schabbatgottesdienst erfuhren die Soldaten die größte Ehre. Sie wurden von Kantor Loew zur Thora aufgerufen und sprachen im Angesicht der Heiligen Schrift ihren Segen. Nach dem abschließenden Achtzehner-Gebet versammelten sich die Gottesdienstbesucher im Gemeindesaal zu einem Kiddusch.
Bei dem feierlichen Beisammensein saßen Männer und Frauen getrennt, während wir Kinder uns frei bewegen durften. Der Rabbiner, der in der Mitte der Tafel Platz genommen hatte, erhob sich und erklärte, die Gemeinde flehe Gott an, die Krieger weiterhin zu beschirmen, bis wieder Frieden herrsche. Der Geistliche hob seinen silbernen Becher und rief »Le Chaim! Diese Bitte um Leben drückt besser als lange Reden unser aller Gebete und Gefühle aus.« Er führte das Gefäß an seine Lippen. Die Anwesenden folgten seinem Beispiel. Die Männer wiederholten das »Le Chaim!« des Rabbiners. Die Frauen nippten an ihren Likörgläsern. Wir Kinder bekamen Limonade.
Sodann wurden Kuchen und Süßigkeiten gereicht. Heiner und ich ließen es uns schmecken.
Auf dem Heimweg begleiteten uns zwei Männer. Vater hatte die Angewohnheit, ärmere Menschen nach der Synagoge zum Mittagessen bei uns einzuladen. Es wurde Tscholent serviert. Das Rindfleisch, die Kartoffeln, Bohnen und Graupen waren bereits am Freitagmittag, also vor Beginn des Schabbats, von Margreth in unserer Küche aufgesetzt und dann von Lieserl zum Bäcker gebracht worden, wo der Topf in der verlöschenden Glut des riesigen Ofens garte, bis er am Samstagmittag wieder nach Hause geschafft wurde.
Nachdem Vater den Segen über die Challah, den mit Mohn bestreuten Hefezopf, gesprochen hatte, wurde endlich in einer weißen Terrine der dampfende Tscholent aufgetragen. Die zarten Fleischwürfel inmitten der weich gekochten Gemüse zergingen auf der Zunge. Der Tscholent schmeckte köstlich und vertraut, derweil der große Kachelofen im Speisezimmer gleichmäßige Wärme ausstrahlte. Alle aßen mit großem Appetit. Mir war damals nicht bewusst, wie sehr insbesondere Vater das gute Essen genoss. Ich ahnte nicht, dass er mit seinen Kameraden seit Monaten in engen Schützengräben und feuchten Unterständen hauste. Die Soldaten waren froh, wenn sie eine warme Mahlzeit am Tag zu sich nehmen konnten. Da Vater auch im Krieg die koscheren Speisegebote beachtete, um die sich die Feldküche nicht scherte, war er gezwungen, sich von Brot und koscherer Wurst zu ernähren, die ihm von den Schwiegereltern aus dem fränkischen Markt Berolzheim ins Feld geschickt wurde.
Anders als sonst verzichtete Mutter heute darauf, Heiner und mich nach dem Essen zur Mittagsruhe zu schicken. Erst als sich unsere Gäste dankend verabschiedeten und Vater aufstand, um sie zur Haustüre zu begleiten, sagte Mutter uns, wir sollten jetzt auf unser Zimmer gehen. Als ich an ihr vorbeilief, streichelte sie kurz meine Wange.
Heiner und ich waren bedrückt. Der Schabbat erinnerte uns daran, dass Vater nur eine Woche bei uns bleiben durfte. Nächsten Schabbat würde er wieder im Krieg sein.
Papa wollte uns nicht erzählen, was an der Front geschah. Aber Heinrich hatte mitbekommen wie er zu Mutter gesagt hatte: »Der Krieg hat nur einen Zweck: Menschen zu töten. Wer mehr umbringt, hat gewonnen.«
Das war etwas ganz anderes als die Soldatenspiele, die Herr Moritz Frank, in Zivil Lebensmittelgeschäftsmann und Erster Tenor des Gesangsvereins Zion und des Synagogenchors, mit uns Kindern in den Wäldern rings um Ichenhausen an Sonntagvormittagen vor dem Fußballspiel veranstaltete.
Ich legte mich auf mein Bett und tat, als ob ich schliefe. Bald hörte ich meinen Bruder leise schluchzen. Ich traute mich nicht, ihn zu trösten.
Zwei Tage später musste Vater wieder ins Feld. Er bestand darauf, sich zu Hause von uns Kindern zu verabschieden. Nur Mutter durfte ihn nach Günzburg begleiten.
Jetzt musste auch ich weinen. Ich erinnerte mich an den jubelnden Auszug der Soldaten im Sommer. Und an das Versprechen des Hauptlehrers Brader, dass der Krieg ganz schnell mit einem Sieg der deutschen Fahnen enden würde.
Nach gut einem Vierteljahr Krieg aber verzichtete Herr Brader darauf, den Grenadieren Münzen mitzugeben, die sie nach dem Sieg an Bedürftige in Frankreich verteilen sollten. Glaubte er nicht mehr an einen Sieg in diesem Jahr? Kein Schüler traute sich, Isaak Brader diese Frage zu stellen, die uns allen auf dem Herzen lag.
Der Hauptlehrer galt in der jüdischen Gemeinde als Autorität in weltlichen Dingen. Wie unumschränkt seine Gewalt war, hatte ich schon in der ersten Klasse erfahren müssen. Der Herrscher des jüdischen Lehrhauses hatte mir von Anbeginn den Namen »Galgenkasper« verpasst. Als ich wagte zu fragen, warum er mich so nannte, brüllte der Lehrer: »Die Antwort bekommst du auf der Stelle. Und zwar so kräftig, dass du nie wieder wagen wirst, solch’ freche Fragen zu stellen.«
Isaak Brader rief mich zum Katheder. Er wählte sorgfältig eine seiner Weidenruten, in Bayern Tatzenstecken gerufen, aus dem Wassergefäß, in dem sie eingeweicht wurden, und haute mein Gesäß mit der Rute hart durch. Mir liefen die Tränen herunter, ich beherrschte mich mit aller Kraft, um nicht vor Schmerz zu schreien. Auch nicht später, als ich mich wieder setzen durfte oder eher musste.
Unterdessen tauchte Brader den Stock wieder ins Wasser und erklärte grimmig: »Wer sonst noch unverfrorene Fragen stellen will, wird nicht weniger leiden als der Galgenkasper Seligmann!« Er sah sich im Klassenzimmer um. Dann blitzten seine grünen Augen auf. »Und die jungen Damen sollen sich ja nicht einbilden, dass sie ungestraft davonkommen, wenn sie ungezogen sind. Meine Tatzenstecken tanzen auch gern auf Fingerspitzen. Das ist nicht minder schmerzhaft wie die rückwärtige Bestrafung der Herren!«
Als ich abends Vater aufgebracht vom Verhalten Isaak Braders berichtete, nickte er. »Ich war selbst Schüler beim Hauptlehrer. Er war sehr streng und ist es wohl geblieben. Ich habe mich manches Mal ungerecht behandelt gefühlt. Aber heute weiß ich, Herr Brader ist ein ausgezeichneter Lehrer. Manchmal ist er hart, aber ich glaube, seine Strenge hat dazu beigetragen, dass alle seine Schüler rechtschaffene Menschen geworden sind. Dass es in unserer jüdischen Gemeinde keine Lumpen und Tunichtgute gibt, haben wir auch unserer Erziehung durch Herrn Brader zu verdanken.« Vater hielt kurz inne, ehe er fortfuhr. »Die Regierung hat im Jahr deiner Geburt Herrn Brader zum Hauptlehrer befördert. Das ist eine Ehre, die nur wenige Pädagogen erfahren. Erst recht unter Juden.«
Dennoch konnte ich den hauenden Lehrer nicht leiden. Und mit dem kurzen Krieg hatte er sich geirrt.
Mutter war zunehmend bedrückt. Denn Vaters Kriegsrente war ungenügend. So musste sie die Familie weitgehend von unseren Ersparnissen ernähren. Unser Essen wurde eintönig – wie bei den meisten Familien in Ichenhausen. Mutters Brüder in Markt Berolzheim hatten als Viehhändler mit Metzgern zu tun. Doch jetzt waren sie wie Vater Soldaten. Daher kamen kaum mehr Fleischsendungen zu uns.
Sehnsüchtig erwarteten wir Vaters nächsten Heimataufenthalt. Inzwischen waren andere Männer zu höheren Offizieren befördert worden, während Vater Feldwebelleutnant blieb. Heinrich und ich wagten nicht zu fragen, warum. Erst nach dem Krieg erfuhren wir, dass Juden nur in Ausnahmefällen weiter aufsteigen konnten.
Vater verlor darüber kein Wort. Doch während seines Fronturlaubs 1916 war er aufgebracht. Nachdem Rabbiner Dr. Cohn in seiner Schabbatansprache den Mut und die Vaterlandsliebe unserer Krieger hervorgehoben hatte, die sich in nichts von jener ihrer christlichen Kameraden unterschieden, wurde bekannt, dass im Heer eine »Judenzählung« stattgefunden hatte. Mit ihrer Hilfe sollte festgestellt werden, dass sich unsere Leute vor dem Frontdienst drückten. Selbst wir Kinder bekamen mit, dass Vater und seine jüdischen Kameraden deshalb tief verletzt waren.
Als Papas Freund Moritz Levy uns am Schabbatnachmittag besuchte, gab es für die beiden Männer nur dieses Gesprächsthema. Vater blieb zunächst ruhig, doch bald verlor er die Beherrschung. »Ich bin gut genug, unsere Kompanie zu führen und Tag und Nacht für mein Vaterland an der Front zu kämpfen«, brüllte er. »Nach zwei Jahren befehlen mir nichtsnutzige Kriegsbürokraten in Berlin, die nie die Front gesehen oder einen Schuss abgefeuert haben, zu rapportieren, was ich als jüdischer Soldat leiste. Ob ich mich, anders als die Gojim, vor der Front drücke! Nur wir Juden! Kein Katholik, kein Protestant wird so erniedrigt.«
Es war das einzige Mal, dass Vater den Ausdruck Goj gebrauchte. Bis dahin hatte er sich wie alle Juden Ichenhausens als Bayer und Deutscher gefühlt. Nun hatte ihm die Armee gezeigt, dass er als Jude weniger zählte als die christlichen Soldaten.
Nach einer Woche musste Vater wieder an die Front. Immer mehr Männer aus Ichenhausen fielen. Wir Kinder spürten, dass Mutter von Furcht geplagt wurde. Anders als vor dem Krieg besuchte sie nun auch jeden Freitagabend die Synagoge, um für die Unversehrtheit ihres Mannes zu beten.
Die Angst vor Mutters Traurigkeit brachte Heiner und mich dazu, ihren Anweisungen ohne Murren zu folgen. Ich versuchte ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen.
Wir Buben glaubten, dass Gott unseren Vater besonders gut schützen würde, wenn wir ihn und Mutter ehrten, wie es das Vierte Gebot forderte. Gott erhörte unsere Gebete. Vater blieb unversehrt, obgleich er seit Kriegsbeginn mit seinem Bataillon an der Front stand.
In der vierten Klasse nahm mich Hauptlehrer Brader öfter dran als andere Schüler. Er blieb streng mit mir und zögerte nicht, mir eine Kopfnuss zu verpassen, wenn ich mich nicht auf seinen Unterricht konzentrierte. Doch wenn ich wieder einmal als Erster die Rechenaufgabe gelöst hatte, nahm er mein kariertes Heft, schob seine Brille hoch, studierte die Zahlen und rief: »Richtig! Nehmt euch alle ein Beispiel an Ludwig. Er rechnet schnell und richtig! Wie es sich für einen Juden gehört. Und ihr Deppen zählt zusammen wie die Blindschleichen. Langsam und ohne Hirn!« Ich beherrschte mich, um nicht zu loszulachen, und vermied es, Heiner anzusehen.
Unvermittelt hob der Hauptlehrer wieder seine Stimme. »Aber bilde dir nichts darauf ein, kleiner Seligmann. Übe lieber Diktate. Denn bei der Rechtschreibung bist du ein flüchtiger Galgenkasper.«
Ich dachte nicht daran, nach der Schule Rechtschreiben zu üben. Sobald wir zu Hause angelangt waren, warfen Heiner und ich unsere Ranzen in die Ecke, schlangen den grässlichen Zuckerrübenbrei hinunter und liefen zum Fußballplatz. Unser Trainer, Herr Korbinian Sauter, lobte meine schnellen Beine und mein Ballgefühl. »Aber du musst trainieren, Wiggerl, dass du beides zusammenbekommst. Wenn du fix den Ball führen lernst, wirst du ein richtig Guter.«
Anders als in der Schule konnte ich beim Kicken nie genug üben. Wenn das Wetter es erlaubte, trainierte ich bis zur Dunkelheit. Es bereitete mir Freude, mit dem Ball am Fuß von Torlinie zu Torlinie zu laufen. Ich wurde nie müde. Und je besser ich den Ball beherrschte, desto mehr Spaß hatte ich dabei.
»Als Nächstes musst du an deiner Schusstechnik feilen«, wies mich Herr Sauter an. Er versprach, mich ab Herbst als Stürmer in die erste Jugendmannschaft aufzunehmen, wenn ich bis dahin gut ins Tor treffen konnte.
Ab sofort übte ich unentwegt, den Ball aus allen Lagen im Tor zu versenken. Und zwar nicht nur mit dem rechten Fuß, sondern auch mit der Stirn. Was anfangs schwierig war, weil ich unwillkürlich die Augen zukniff.
Doch nach einigen Tagen war ich so weit, im richtigen Moment hochzuspringen und sehenden Auges die Lederkugel in den Kasten zu drücken.
Gymnasium
Als ich eines Abends heimkehrte, forderte mich Mutter auf, nach dem Waschen zu ihr zu kommen. Da sie sah, dass mich ihre Worte beunruhigten, lächelte sie. »Hab’ keine Angst, Ludl! Freu’ dich.«
In ihrem Salon offerierte mir Mutter ein Glas Tee wie einem Erwachsenen. »Ich bin stolz auf dich, mein Sohn.« Ihre Augen leuchteten. »Heute Nachmittag war Herr Hauptlehrer Brader bei mir. Er hat mir gesagt, was ich sowieso schon weiß: dass du ein gescheiter Bub bist.«
Der Lehrer war mir wurscht, aber dass Mutter so über mich sprach, gab mir ein herrliches Gefühl. Während ich mich in ihrer Liebe und Anerkennung sonnte, erläuterte sie mir, der Hauptlehrer habe verlangt, dass ich im kommenden Jahr auf das Oberrealgymnasium nach Günzburg wechselte. Er habe darauf gedrängt, obgleich er wusste, wie schwer uns zusätzliche Ausgaben im Krieg fielen.
»Ich will gerne dem Rat von Hauptlehrer Brader folgen. Weil mein Ludl mich nicht enttäuschen wird. Du darfst weiter Fußball spielen. Aber ich erwarte, dass du genauso fleißig für das Gymnasium lernst.« Sie wusste, dass ich tun würde, was sie von mir erwartete.
Unvermittelt wurden Mutters Züge ernst. »Auch Heinrich ist ein kluger Junge. Ich hätte ihn ebenfalls gern aufs Gymnasium geschickt. Doch das ist wegen der Kriegsnot nicht möglich. Ich weiß, wie sehr ihr beide aneinander hängt, auch wenn ihr euch gelegentlich tratzt, wie es sich für Buben gehört. Du musst jetzt recht gut zu deinem Bruder sein, damit er nicht traurig ist.«
Mutter wollte immer das Beste für mich und Heinrich. Aber ich wusste genau, dass mein Bruder nicht nur traurig sein würde, wenn ich zur Oberschule durfte, während er weiter von Brader mit dem Tatzenstecken durchgehauen wurde. Er würde furchtbar zornig auf mich werden, weil er nicht so gescheit war wie ich. Darum wollte der Herr Hauptlehrer, dass ich und nicht Heiner aufs Gymnasium ging. Mein Bruder würde sich vor Vater schämen und mich verhauen – egal, ob ich gut zu ihm war oder nicht.
Ich hatte wenig geschlafen. Seit es hell war, wälzte ich mich in meinem Bett. Leise. Denn ich wollte Heinrich nicht wecken. Als Lieserl endlich die Tür unseres Bubenzimmers öffnete, packte ich meine Sachen und lief in den Waschraum. Draußen lagen mein frisch gebügeltes Hemd, mein Anzug und die auf Hochglanz gewichsten Schuhe. Mutter wartete schon am Frühstückstisch.
Heute schmeckte mir die Grütze nicht. Am liebsten hätte ich nichts gegessen.
»Ludl, du bist klug und schaffst alles«, machte Mutter mir Mut. Lieserl trat an den Tisch und reichte mir meinen Pausenbeutel. »Heute sind zwei Butterbrote drin«, sagte sie scheu. Mama hatte dafür gesorgt, dass heute sogar Butter da war!
Sie begleitete mich zur Haustüre. Dort blieb sie stehen, legte ihre warmen Hände auf meine Stirn und sprach mit klarer Stimme: »Der Herr erleuchte dich und beschirme dich, Jehuda.« Wie beim Lichterzünden am Freitagabend benutzte sie jetzt meinen jüdischen Namen.
Max Lechner brachte mich mit der Chaise nach Günzburg. Unter anderen Umständen hätte ich den kühlen Fahrtwind des strahlenden Frühsommermorgens genossen. Doch heute musste ich an die Prüfung denken.
In unserer Schule verstand ich den Unterrichtsstoff immer. Aber im fremden Gymnasium wusste ich nicht, was von mir erwartet wurde.
Ich saß zusammen mit zwei Dutzend Jungen in einem großen Klassenzimmer mit hohen Wänden und großen Fenstern. Jeder hockte an einem Pult und hatte einen weißen Doppelbogen liniertes Papier vor sich. Ein fremder Herr in dunklem Anzug und Binder stand unnahbar am Katheder und diktierte uns mit klarer Stimme einen Text über die »tapferen deutschen Krieger«.
Mir war elend. Nur weglaufen wollte ich. Aber ich zwang mich, sitzen zu bleiben. Ich hatte Angst vor allen. Vater erwartete sicher, dass ich aufs Gymnasium ging wie früher er! Ich stellte mir vor, dass Heinrich mich auslachen würde, wenn ich heute alles vermasselte, ebenso wie meine Mitschüler. Und Hauptlehrer Brader! Er würde mich grausam bestrafen, nachdem er sich bei Mutter für mich eingesetzt hatte.
Aber Mutter glaubte an mich. Beim Gedanken an sie wurde ich ruhig. Jetzt verstand ich die Worte des Lehrers und schrieb sie nieder.
Nach einer Pause erhielten wir unsere Rechenaufgaben, die hier »Mathematik« hießen. Beim Durchlesen sah ich, dass ich alles konnte, sogar im Kopf. Ich fing sogleich an, ein Ergebnis nach dem anderen hinzuschreiben.
Als ich nach kurzer Zeit wie in unserer Schule als Erster fertig war und abgeben wollte, kam mir die Mahnung unseres Hauptlehrers von gestern in den Sinn. »Ludwig, du kannst schnell rechnen, aber du bist leichtsinnig! Darum darfst du deine Arbeit unter keinen Umständen sofort abgeben! Drehe das Blatt um und zähle bis zwanzig. Dann liest du jede Aufgabe erneut sorgfältig durch. Anschließend rechnest du alles nochmals nach. Wie ich dich kenne, hast du vor lauter Eile einen Fehler gemacht.«
Es drängte mich, meine Blätter einzureichen und vor die Türe zu gehen. Doch meine Angst, die Prüfung nicht zu schaffen, war größer. Darum folgte ich der Anweisung des Hauptlehrers. Tatsächlich hatte ich mich bei den beiden letzten Aufgaben verrechnet. Nur ein bisschen, aber eben doch! Ich verbesserte die Fehler und las alles wieder durch. Jetzt stimmte es.
Die letzten zwei Stunden mussten wir einen Aufsatz schreiben. Thema: »Was ich für den Sieg des Deutschen Reiches tun kann«.
Das hatte ich mir noch nicht überlegt. Ich war kein Soldat. Heiner und ich benahmen uns so gut und folgsam, dass Vater bei seinem Fronturlaub an uns seine Freude hatte. Und wir taten jeden Tag alles, um Mutter zu helfen. Wir gingen auch jeden Schabbat in die Synagoge. Aber wer wusste, ob das christlichen Lehrern gefiel? Also ließ ich es weg. Außerdem half ich meinem Ichenhausener Banknachbarn, dem Max Kochmann, dessen Vater auch an der Front war, seine Rechenaufgaben zu machen. Und Heiner und ich setzten immer unsere Grüße unter Mutters Zeilen, wenn sie einen Brief an Vater schickte. Das musste ich ein wenig ausschmücken.
Ich schrieb, dass ich jedem Brief von Mutter ein eigenes Blatt beigab. Darin notierte ich, dass ich mir wünschte, mein Vater würde als Feldwebelleutnant weiter tapfer mit seinen Untergebenen für einen schnellen Sieg des Deutschen Reiches kämpfen. Und dass ich auch dafür betete, damit er und alle deutschen Soldaten bald nach dem Sieg als Helden heimkommen würden.
Zu Hause sagte ich, dass alles gut gegangen war. Mutter spürte meine Angst und drang nicht weiter in mich. Selbst Hauptlehrer Brader bemerkte meine Unsicherheit. Er fragte mich täglich, ob ich mich bei der Prüfung wie ein Kasper benommen habe. Der Schulleiter wollte sich nicht durch mich blamieren. »Wenn du wegen deines Leichtsinns durchgefallen bist, wirst du das schmerzlich zu spüren bekommen!«, rief er vor der ganzen Klasse.
Auf dem Fußballplatz lief ich meine Runden, bis ich nicht mehr schnaufen konnte. Dann übte ich mit Herrn Sauter Kopfball. Ich hatte gelernt, hoch genug zu springen, um den Ball mit der Stirn von oben zu treffen und ihn so in Richtung Tor zu lenken. Ich köpfelte so lange, bis sich meine Beinmuskeln verkrampften. Daher wies mich der Trainer an, eine Pause zu machen.
So hockte ich mich an den Rand des Fußballfelds und sah den Kameraden, unter ihnen mein Bruder, beim Kicken zu. Schnell hatte ich mich erholt und machte bei einem Übungsspiel mit. Obwohl ich zu den Jüngsten zählte und klein war, wollten mich die Mannschaftsführer haben. Denn ich war fixer als die anderen und verstand es, den Ball beim Laufen mitzunehmen, zu dribbeln und, wenn ich vorne angespielt wurde, auch aufs Tor zu schießen. Heiner ließ sich beim Dribbeln oft die Kugel abnehmen.
Wir spielten und trainierten, bis die Helligkeit verging. Herr Sauter war schon längst gegangen, als wir endlich nach Hause liefen. Nachdem wir uns gewaschen hatten, sagten wir Mutter Gute Nacht.
An diesem Tag hatte sie wieder eine Feldpostkarte bekommen. Vater schrieb wie immer, dass es ihm gut gehe. Wir sollten uns keine Sorgen um ihn machen. Der liebe Gott werde ihn beschützen, und er hoffe, dass wir gesund und artig seien.
Bevor ich einschlief, musste ich an Vater denken. Wie würde er sich freuen, wenn Mutter ihm schreiben konnte, dass ich aufs Gymnasium durfte!
Hauptlehrer Brader betrat mit einem Lächeln das Klassenzimmer. Das geschah fast nie. Er sah mich zufrieden an. »Nehmt euch ein Beispiel an Ludwig, ihr Faulpelze!«
Heinrich tat mir leid, weil er nicht aufs Gymnasium konnte. Das würde er mir wohl nicht verzeihen.
Auf dem Nachhauseweg schwieg ich. Sobald wir außer Sichtweite des Lehrhauses waren, erwartete ich, dass Heinrich anfangen würde, mich zu schlagen. Doch er ging stumm neben mir her.
Plötzlich blieb Heiner stehen »Ich bin stolz auf dich, Ludwig.« Seine Stimme piepste.
Ich liebte meinen Bruder. Auch wenn wir nicht weniger als zuvor rauften.
In der Schule war in den letzten vier Wochen vor den großen Ferien nicht mehr viel los. Der Hauptlehrer drohte und schrie, gelegentlich haute er einem Buben den Hintern durch, und manchmal bekam ein Mädchen einige Tatzen auf die Finger, jedoch seltener als zu Beginn des Schuljahrs.
Mich ließ Brader jetzt in Ruhe, bis er mich ohne Hausaufgaben erwischte. Ich war nach dem Fußball einfach zu müde dafür gewesen.
»Du bildest dir wohl ein, dass du jetzt etwas Besseres bist, Seligmann! Nur weil du mit Ach und Krach die Aufnahmeprüfung für die Oberschul’ geschafft hast, du Nichtsnutz! Da kommst du mir gerade recht! Wenn du Galgenkasper nicht parierst, versohle ich dich so, dass du hier nicht mehr sitzen und nachts nicht mehr schlafen kannst.«
Zu meiner Verwunderung verzichtete der Hauptlehrer aber darauf, seine Drohung wahr zu machen. Stattdessen gab er mir als Strafarbeit auf, bis morgen hundert Mal zu schreiben »Ich muss stets meine Hausaufgaben machen.« Damit raubte er mir den Nachmittag auf dem Fußballplatz.
Eines Tages nach Unterrichtsschluss forderte mich der Herr Hauptlehrer auf, mit ihm zu kommen. Aus seiner Wohnung im zweiten Stockwerk des Schulgebäudes strömte Bohnerwachs- und Tabakgeruch. Die Holzdielen waren auf Hochglanz poliert. Auf einer Anrichte im Wohnzimmer prangte seine beachtliche Pfeifensammlung.
Herr Brader hieß mich, am Tisch Platz zu nehmen. Dann wies er seine Frau an, mir ein Glas Limonade zu bringen. Mit ihren weißen Haaren erschien sie mir noch älter als unser Lehrer. Als wir wieder allein waren, stand er auf. Erst hier, außerhalb des Klassenzimmers, fiel mir auf, wie klein der Lehrer war – er maß gut einen Kopf weniger als Vater und war fast schmächtig.
»Du bist ein gescheiter Bub, Ludwig. Und ich sehe, dass du auch fleißig die Synagoge besuchst. Du kannst es weit bringen im Leben. Aber nur, wenn du dich zusammenreißt und deinen elendiglichen Leichtsinn überwindest! Du musst eiserne Disziplin üben, Ludwig, sonst wirst du scheitern und all die Talente, die dir der Herrgott geschenkt hat, vergeuden.« Brader setzte sich mir gegenüber. »Nimm dir ein Beispiel an deinem Bruder.« Seine Stimme dröhnte. »Heinrich ist nicht der Gescheiteste. Aber er besitzt Disziplin. Er ist immer pünktlich. Stets wie aus dem Ei gepellt – nie ein Stäubchen an seinem Gewand. Er macht seine Hausaufgaben alleweil.« Der Hauptlehrer seufzte. »Wenn der Heiner deinen Kopf hätte – oder du seine Disziplin … Sei’s drum, der Herrgott gibt jedem seinen Teil, damit soll man zufrieden sein. Und dankbar.«
Herr Brader ging zum Bücherbord, nahm ein ledergebundenes Album heraus und legte es auf den Tisch. Dann ergriff er eine lange Pfeife mit weißem Porzellankopf, stopfte sie umständlich, entzündete den Tabak und stieß Dampfwolken aus. Als er wieder zu sprechen anfing, bekam seine Stimme einen sanften Klang, den ich bei ihm nicht kannte.
Er berichtete, dass er im letzten Friedenssommer eine Reise ins Heilige Land unternommen und sich damit einen Lebenstraum erfüllt habe. »Zuerst ging es mit dem Dampfer von Triest nach Jaffa und von dort mit der Eisenbahn ins erhabene Jerusalem. Eine Fahrt in die Zeit der Bibel.«
Der Hauptlehrer schwärmte von den braunen Farbtönen des vertrockneten Bodens und den langen dunklen Gewändern der arabischen Frauen, die auf dem Land tönerne Krüge auf dem Kopf trugen wie wohl in den Tagen der Propheten. Die Männer in orientalischer Tracht saßen in der Altstadt Jerusalems zumeist in Cafés und rauchten ihre Wasserpfeifen. Überall liefen Kinder umher. Sie waren nicht besonders sauber.
Die Juden ließen sich entsprechend der Gebote unseres Glaubens Schläfenlocken und Bärte wachsen. Selbst bei großer Hitze trugen sie gemäß osteuropäischer Tradition schwarze Kaftane und hohe Pelzmützen. Sie eilten durch die Gassen der Stadt zu ihren Betstuben und zur Klagemauer. Deren riesige Quader seien die einzigen Überbleibsel des jüdischen Tempels, der im Jahr 70 von den Römern zerstört worden war. Am Fuß der Mauer beteten die orthodoxen Juden mit wilden Schaukelbewegungen um die Ankunft des Messias – andere hatten ihn angeschnorrt.
Gebannt lauschte ich der Erzählung des Hauptlehrers. »Von der Klagemauer schweift der Blick auf den Tempelberg mit dem Felsendom, einem mohammedanischen Heiligtum mit goldener Kuppel, die der Stadt ihren Stempel aufprägt.« Jerusalem sei umrahmt von Hügeln. »Der schönste von ihnen ist der Ölberg mit dem jüdischen Friedhof. In Terrassen erstrecken sich die Gräber von oben herab zur Stadt. Dort werden fromme und ehrenwerte Juden aus dem ganzen Erdkreis begraben.«
Nachdem Herr Brader ausführlich von seinem Aufenthalt in Jerusalem erzählt hatte, berichtete er von einer neuen Stadt am Meer mit dem Namen Tel Aviv, was Frühlingshügel bedeute. Der Ort sei erst vor einigen Jahren gegründet worden; moderne Juden wollten ihn zum Zentrum eines neuen Judenstaates aufbauen.
Unser Hauptlehrer hielt nichts von derartigen Hirngespinsten. »Wir deutschen Juden gehören in unsere Heimat«, stellte er klar. Doch die Reise ins Land der Bibel habe ihn in seinem Glauben bestärkt.
Ehe ich ging, forderte Herr Brader mich auf, mir eine Postkarte aus seinem Album auszusuchen. Aufnahmen von Jerusalem kannte ich bereits, also wählte ich eine Ansicht von Tel Aviv, die eine Reihe weißer einstöckiger Häuser zeigte. Sie führten zu einem runden Platz, auf welchem sich Menschen in legerer Kleidung aufhielten.
Ich ahnte nicht, dass mich die Umstände der Zeit in wenigen Jahren zum Bürger dieser Stadt machen würden.
Die Sommerferien schienen nie zu Ende zu gehen. Vormittags plantschten Heiner und ich mit den Nachbarsbuben in der Günz. Um die Badehäuschen, die die Erwachsenen benutzten, scherten wir uns nicht.
Schwimmen konnten wir in dem Flüsschen selten, dazu war es in Ichenhausen in den heißen Monaten zu flach. Dafür konnte man in den Flussauen hervorragend Fußball spielen, und zum Kühlen der Füße war uns das Wasser gerade recht. Bald spritzten wir uns gegenseitig an, und es kam zur allgemeinen Wasserschlacht, bei der Heinrich und ich fast immer zusammenhielten.
Mittags wurden Margarinebrote ausgepackt, die uns Lieserl mitgegeben hatte. Wir schlangen sie herunter, spülten mit Limonade nach, und weiter ging’s auf den »richtigen« Fußballplatz, wo uns Herr Sauter bereits erwartete.
Der Übungsleiter sah es nicht gern, wenn wir uns vor dem eigentlichen Training schon »verausgabt« hatten. Um uns »diesen Schmarrn« auszutreiben, ließ er uns eingangs sechsmal um den Platz laufen, sodass wir alle ins Schwitzen kamen. Aber ich fühlte mich noch voller Kraft, und so fiel mir das folgende Übungskicken fünf gegen fünf nicht schwer. Ich schoss sogar zwei Tore gegen den Siegl. Der Keeper war recht stämmig, aber ein bisschen langsam – vor allem war Siegfried Herrligkoffer ein zuverlässiger Freund.
»Wiggerl, du hast eine Lunge wie ein Ackergaul«, staunte Herr Sauter. Später übte er mit uns Schusstechnik und Dribbeln. Nachdem er die Kameraden entlassen hatte, kümmerte sich der Übungsleiter um mich. Mehrmals hieß er mich, mit dem Ball aufs Tor zu laufen, so schnell ich konnte. »Wenn du das mal so beherrschst, dass dir keiner mehr folgen kann, bist du der König der Stürmer … mindestens in Ichenhausen. Und jetzt verzupf dich.«
Ob der Trainer ahnte, dass ich und meine Spezis gar nicht daran dachten, nach Hause zu gehen? Zu schön war es, gemeinsam mit Heiner, Moritz Gerstle, Thomas Schmidt, Karl Seiff, Siegl und anderen in den Günzauen zu kicken oder uns Geschichten zu erzählen.
Anfangs zogen mich die Freunde damit auf, dass ich mich jetzt als künftiger Gymnasiast wohl als etwas Besseres fühlte. Dass der Siegl als Arztbub ebenfalls ab Herbst auf die Oberschule gehen würde, war für sie selbstverständlich. Sie merkten aber bald, dass ich meine Nase nicht hochtrug und den gleichen Spaß mit ihnen hatte wie früher. Wenn sie mich aber einfingen, sich auf mich warfen, um auf meinen Muskeln zu reiten, wenn sie versuchten, mich in den Schwitzkasten zu nehmen, dann konnte ich mich auf Heinrich verlassen. Wir waren die Seligmann-Buben.