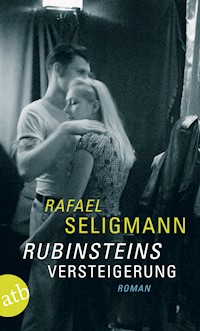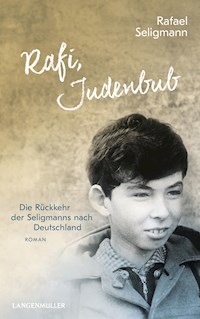
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1957 kehren Ludwig und Hannah Seligmann mit dem 10-jährigen Rafael nach Deutschland zurück. Es fällt ihnen schwer, in der alten Heimat Fuß zu fassen. Rafi und sein Vater leiden zunehmend unter Vorurteilen. Die Familie übersiedelt schließlich nach München, wo sie sich allmählich einlebt. Trotz aller Hindernisse macht der verträumte Schulversager Rafael das Abitur, studiert Geschichte und hat – gegen den erbitterten Widerstand der Mutter – eine Beziehung mit Ingrid, einer "Schickse". Ebenso einfühlsam wie unsentimental erzählt Rafael Seligmann im dritten Teil seiner Familiensaga von der schwierigen Suche nach der verlorenen Heimat des Vaters. Sein Roman ist zugleich ein Stück Zeitgeschichte aus einem Deutschland, in dem die Verantwortung für die Vergangenheit noch kaum im öffentlichen Bewusstsein verankert war. "Wie die Geschichte des 20. Jahrhunderts Familiengeschichten bestimmt, das hat der Historiker und Schriftsteller Rafael Seligmann auf einzigartige Weise sichtbar gemacht." Deutschlandfunk
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Rafael Seligmann
Rafi, Judenbub
Die Rückkehr der Seligmanns nach Deutschland
Roman
Ich habe mich bemüht, meine Eltern, mich sowie namentlich erwähnte Freunde und Bekannte authentisch darzustellen. Die übrigen Personen sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit Lebenden oder Toten bestehen nicht.
„Distanzierungserklärung:
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.“
© 2022 Langen Müller Verlag GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Sabine Schröder, München
Umschlagmotiv: Rafael Seligmann/Privat
Lektorat: Boris Heczko
Satz und Ebook-Konvertierung: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-7844-8428-0
www.langenmueller.de
Ein Jude ohne Chuzpe ist wie ein Himmel ohne Sterne
Meiner Frau Elisabeth
Inhalt
Deutschland
Judenbuben
Hausierer
Heim
Mut
Untergang
Arbeit
Anerkennung
Rentner und Lehrling
Raufen
Weiterbildung
Kuppelei
Junge Liebe
Student
Alte Liebe
Epilog
Glossar
Mein Sternenhimmel
Deutschland
Ludwig
Mit der Kraft meiner Schulter drücke ich den Flügel des verrosteten schmiedeeisernen Tores in den Gottesacker. Ich schlüpfe hindurch. Während ich durch das kniehohe Gras stapfe, setze ich meine schwarze Kippa auf und ziehe das kleine Gebetbuch aus der Jackentasche.
Zu meiner Linken erhebt sich der Rundbau des Aussegnungshauses. Die Leichenhalle war im Frühsommer 1934 eingeweiht worden. Vater hatte die Errichtung des Baus als Symbol für die Ignoranz der deutschen Juden empfunden. »Sie wollen nicht wahrhaben, dass unsere Zeit in diesem Land für immer vorbei ist.« Ich selbst war ein Jahr zuvor nach einer Warnung meines Fußballkameraden Karl Seiff gemeinsam mit meinem Bruder Heinrich vor den Nazis geflohen.
Der Friedhof ist mir seit meiner Jugend vertraut. Als Mitglied der Chewra Kadischa, der Beerdigungsgesellschaft, sorgte auch ich für die Beisetzungen. Das war nun zwei Dutzend Jahre her. Vor einem Monat bin ich mit Hannah und unserem Sohn Rafael nach Deutschland zurückgekehrt. Wir sind in einer Münchner Pension untergekommen.
In Ichenhausen stehen mein Elternhaus und unsere Barocksynagoge mit ihrer prächtigen Himmelsdecke. Der einstige Tempel dient jetzt als Feuerwehrstation, und im Seligmann-Haus wohnen fremde Leute. Die jüdische Gemeinde unserer Stadt ist ausgelöscht. 1942 deportierten die Nazis alle verbliebenen Juden Ichenhausens nach Osteuropa. Keiner überlebte.
Gemeinsam mit Hannah und Rafi war ich im neu erworbenen, gebrauchten VW Standard mit geteiltem Rückfenster nach Schwaben gefahren. Wir stiegen im Weißen Ross ab. Der mächtige Gasthof lag im Herzen des Ortes zwischen Kirche, Stadtbrunnen und unserem Haus. Sobald ich mit Frau und Kind den Schankraum betrat, tönte mir die Löwenstimme Georg Abts entgegen.
»Ludwig! Lebsch allweil noch?!«
Der Gastwirt thronte inmitten einer Handvoll älterer Männer an einem gedunkelten Eichenstammtisch. Vor ihm stand ein Weißbierglas. Schorsch hatte eine enorme Körperfülle angenommen. Sein gerötetes Gesicht war kreisrund. Die hellblauen Augen beobachteten uns flink.
»Ja, ich leb no, Schorsch. Auch wenn’s manchen ned passd.«
»Lass mer den alten Schmarrn ruhen!« Abt winkte mit feister Hand ab. »Des isch alles vergessen, vergeben und vorbei, Ludwig.« Die Männerrunde nickte zustimmend. Ich wollte mich nicht auf einen Zwist mit dem Dicken und seiner Corona einlassen – gar vor Hannah. Abt mochte es ahnen. Er besah meine Familie. »Grüß Gott, Madam. Ich nehm an, Sie sind Frau Seligmann. Willkommen in Ichenhausen.« Der Wirt deutete mit leichtem Kopfnicken eine Verbeugung an. Hannah reagierte nicht, worauf Schorsch rief: »Und des isch wohl dei Bub, Ludwig?! Wie heißt du, junger Mann?«
»Rafael«, antwortete mein Junge prompt.
»Den hosch nach deim Vader Isaak Raphael genannt. Man sieht ihm den Judenbub an.«
Schritt für Schritt steige ich hügelan durch das Gras, nach dessen tiefem Grün ich mich in Israel stets gesehnt hatte. Zu meiner Linken ziehen sich lange Reihen schwarzer Granitsteine mit verblasster goldener Namensprägung. Ich trampele das unberührte Gras nieder, ehe ich an das Grab meines Großvaters Heinrich Naphtali Seligmann gelange. Er war 1902 gestorben. Hier ruht der gerechte, barmherzige Mann …
Ich hatte Großvater nicht kennengelernt. Doch seine Fotografie über Vaters Schreibtisch hatte sich mir eingeprägt. Heinrichs Züge waren markant, entschlossen. Vater pries ihn als erfolgreichen Kaufmann. Ich bücke mich, spähe zwischen den aufschießenden Halmen nach einem Stein. Als ich ihn gefunden habe, lege ich ihn nach altem Brauch auf die Granitstele und spreche das Kaddisch.
Nach einem Augenblick der Besinnung gehe ich weiter bergan. Entlang des löchrigen Zauns schiebe ich mich vorwärts. Dichtes Gestrüpp verdeckt fast vollständig die ältesten Grabstätten. Daran schließt sich eine Stelenreihe aus dem 19. Jahrhundert an. Darunter auch der graue Grabstein meines Urgroßvaters. Isaak Raphael Seligmann hatte als Geldverleiher ein Vermögen erworben. Von den Erträgen hatte er auf der Parzelle Marktstraße 302 das größte Wohnhaus der Stadt errichten lassen. Fast 120 Jahre bot das Gebäude unserer Familie Obdach. In guten Tagen wie in harten Zeiten. Doch nachdem die Nazis 1933 ans Ruder gelangten, waren meine Eltern gezwungen, das Anwesen aufzugeben.
Das Gelände flacht ab. Die Inschriften der Grabsteine sind jüngeren Datums. Manche der hier Beerdigten hatte ich als Mitglied der Beerdigungsgesellschaft zur letzten Ruhe begleitet.
Am Ende der Stelenreihe stehen wenige Grabsteine der Jahre 1941 und 1942. Sie sind lateinisch beschriftet. Hebräische Lettern waren von den Nazis selbst auf Gräbern verboten worden.
Gegenüber zwei Grabtafeln, die ausschließlich mit Iwrith-Buchstaben beschrieben sind – zwischen roten KZ-Winkeln sind mehrere Namen in den Stein gehauen. Die Häftlinge des Außenlagers Burgau stammten aus Budapest. Ich kann lediglich den Namen Julia Engel entziffern. Die hier Begrabenen waren in den letzten Kriegswochen umgebracht worden oder verhungert. Mögen ihre Mörder verflucht werden, lautet die Schrift.
Erstmals stehe ich am Grab eines Naziopfers. Tränen schießen mir in die Augen. Die Anspannung der letzten Monate, die der Einsicht gefolgt war, dass nur die Rückkehr nach Deutschland meiner Familie und mir eine Weiterführung unserer Existenz ermöglichen würde, die Aufgabe meines Geschäfts, der Verkauf unseres Heims – all das hatte mich zunehmend geplagt.
Es dauert eine Weile, ehe ich meine Gefühle wieder in die Gewalt bekomme. Angesichts des Massenmord-Zeugnisses erscheint es mir unmöglich, das Lob des Herren zu sprechen, wie es das Kaddisch gebietet. Ich will mich zum Ausgang wenden. Doch ich darf nicht auf das Totengebet verzichten. Damit würde ich den Triumph der Nazis vervollständigen. Selbst nach der Zerstörung ihres Reiches und seiner Mordmaschine hätten sie mich vom Glauben abgebracht. Deshalb spreche ich, mit Gott hadernd, das Kaddisch: Erhoben und geheiligt werde sein großer Name auf der Welt, die nach seinem Willen erschaffen wurde. Sein Reich soll in eurem Leben in euren Tagen und im Leben des ganzen Hauses Israel schnell in nächster Zeit entstehen.
Nach Auschwitz dürfen wir nicht einhalten zu beten. Ich zwinge mich, den Text vollständig zu rezitieren. Nun erst mag ich mir weiter meinen Weg durch das dichte Gestrüpp bahnen.
Vor dem Ausgang war einst in der Friedhofsmauer ein Waschbecken eingelassen. Davor stand ein Kupfergefäß, mit dessen Wasser man sich die Gesellschaft der Totenwelt abzuwaschen hatte, ehe man wieder die Sphäre des Lebens betreten durfte. Der Wasserhahn ist abmontiert. So reibe ich meine Hände an dem aufragenden Gras, ehe ich durch den Flügel des Tors nach draußen trete und das Eisengatter zuziehe. Ich atme mehrmals tief durch, wie einst nach einem Fußballspiel, und wische mir sorgfältig mein Gesicht ab. Niemand soll meine Trauer erkennen. Ich muss stark sein, zumindest so erscheinen, um das Leben in Deutschland zu bestehen.
Hannah
Ich hatte Ludwig vor dieser Gehenom-Reise eindringlich gewarnt – aber er hatte wieder nicht auf mich gehört. Ich verstand sein Bedürfnis, Kaddisch an den Gräbern seiner Vorfahren zu sagen. Auch der Wunsch, sein Elternhaus zu sehen, war naheliegend. Aber dass er bereit war, die Nazis aus seinem Ort zu treffen, die seiner Familie ihr Hab und Gut geraubt und alle Juden, derer sie habhaft werden konnten, vergast hatten, war meschugge. Warum musste er vor diesen gojischen Verbrechern kriechen? Meine Worte waren vergebens. Ludwig rannte wie ein alter Hund seinem Herrn hinterher – auch wenn dieser sein Peiniger war. Obendrein hatte er darauf bestanden, dass Rafi und ich ihn auf dieser Reise begleiteten.
Sobald ich beim Betreten des Gasthauses die dumpfen Visagen mit dem selbstgerechten Ausdruck erblickt hatte, wollte ich wieder wegfahren. Aber mein Gemahl beharrte auf seinem Besuch.
Er wollte sogar mich und Rafi dazu nötigen, mit ihm auf den Friedhof zu gehen. Das kam nicht infrage. Rafi war noch keine zehn Jahre alt und hatte meine zarte Seele geerbt. Er war noch nie auf einem Gottesacker gewesen. Die vielen Gräber hätten ihn ebenso erschüttert wie einst mich die Friedhofsbesuche nach dem Tod meiner Mutter in Berlin. So war Ludwig alleine zu der Grabstätte gepilgert und hatte Rafi und mich unter einem Dach mit den Deutschen gelassen. Zerschmettert kehrte er zu uns zurück.
»Es gibt in Ichenhausen nur noch Gräber. Alle Juden wurden umgebracht oder sind geflohen. Nur ich ehrloser Geselle bin nach Deutschland zurückgekehrt …« Die letzten Worte hatte Ludwig mit brechender Stimme ausgerufen.
»Bitte beherrsche dich, Ludwig! Rafi darf seinen Vater nicht schwach erleben!« Meine deutliche Haltung bewirkte, dass er sich zusammennahm und ein Weinen unterdrückte. Ich verlangte, dass wir auf der Stelle aus diesem verfluchten Ort abreisen sollten. Doch Ludwig bestand darauf, in Ichenhausen zu bleiben. Das habe er seinen Fußballkameraden versprochen.
»Was scherst du dich um diese Nazis?! Im Krieg haben sie meine Familie und sechs Millionen Juden vergast und erschossen.«
»Mit dieser Einstellung können wir nicht in Deutschland leben, Hanni!« Seine Stimme gewann wieder an Festigkeit. Er ließ sich nicht davon abbringen, seine Gojim zu treffen, statt den schlechten Ort zu verlassen und seine Aufmerksamkeit auf mich und unser Kind zu richten.
Ludwig
»Liebe Fußballkameraden! Als Kapitän der Altherrenmannschaft habe ich euch heute zu einem besonderen Abend eingeladen. Wie ihr euch alle erinnert, waren die späten zwanziger Jahre für unseren FC eine goldene Zeit. Wir waren ein hervorragender Verein in der bayerisch-schwäbischen Landesliga. Dann brach das Unglück über unser Land herein, das auch den Fußball schwer getroffen hat: Not, Arbeitslosigkeit, politischer Zank. Zunächst sah es so aus, als ob unter dem Hitler wieder Ordnung herrschen würde, doch dann hat er sich auch als Bazi entpuppt. Wir haben in den Krieg ziehen müssen – und wieder sind die Besten von uns gefallen. Vier Kameraden haben ihr Leben im Feld gegeben, zwei Freunde sind in der Kriegsgefangenschaft umgekommen. Das war besonders grausam – da Deutschland schon kapituliert hatte und kein Leben mehr hätte geopfert werden dürfen. Als Arzt kämpfe ich um jeden Menschen, aber Politiker treiben Millionen in den Tod.«
Siegfried Herrligkoffer war sichtbar von den eigenen Worten bewegt. Mein ehemaliger Freund stand im kleinen Gastraum vor dem breiten Tisch. Wir waren zwei Handvoll Männer um die fünfzig. Jeder hatte ein Bier vor sich stehen.
Unserem einstigen Torwart Siegfried war im Laufe der Jahre ein mächtiger Bauch gewachsen. Sein runder Bariton und seine stämmige Figur hatten Siegl bereits während der Jugendjahre Autorität unter uns Burschen verschafft. Sein Ansehen hatte sich gefestigt, als er nach Kriegsende die Nachfolge seines Vaters als einziger Arzt Ichenhausens angetreten hatte. So waren die meisten Fußballkameraden unseres Jahrgangs sowie einige Jüngere der Einladung des Doktors gefolgt.
Die in die Jahre gekommenen Kicker begrüßten mich zurückhaltend. Sie wirkten befangen. Siegfried gab sich Mühe, das Eis zwischen den alten Fußballern und mir zu brechen. Aber seine Worte zeigten, dass ihm vor allem das Leid, von dem er und seine Patienten betroffen waren, naheging, während er die jüdischen Opfer nicht einmal erwähnte. Am Ende seiner kurzen Ansprache hob der Arzt sein Glas und forderte uns auf, ihm zu folgen, was alle taten. Zögernd ergriff ich meine Halbe. Siegl wandte mir sein Gesicht zu. Die Lippen des Arztes verzogen sich lächelnd. In seine von einer dicken Hornbrille umrundeten Augen trat Rührung, während er sprach.
»Auf unseren alten Fußballfreund Ludwig! Jetzt bleibst gefälligst im Bayernland und bei uns! Prosit!« Der Ruf schallte von uns Kickern zurück. Die Kameraden setzten ihre Gläser an die Lippen. Noch während der kühle Gerstensaft durch meine Kehle rann, begann der Alkohol seine wohltuende Wirkung zu entfalten. Meine Muskeln und mein Gemüt lösten sich.
Ich hatte mich vor der Begegnung mit den Fußballern gefürchtet, weil die Männer meines Alters Nazis geworden waren. Sie waren in den Krieg gezogen und hatten Banditen wie Josef Mengele, der nur sechs Kilometer von hier in Günzburg aufgewachsen war, gehorcht und gemordet. Die KZ-Grabsteine auf dem Friedhof zeugten von den Verbrechen. Doch das Elend des Krieges, die Zerstörung und der Tod, der auch ihre Familien ereilt hatte, mussten sie gelehrt haben, dass es sinnlos war, Juden zu hassen. Durch ihren Fleiß hatte Deutschland seinen Wohlstand wiedererlangt. Ich dagegen kam als ein Gescheiterter zu ihnen. Uns hier eine Existenz aufzubauen konnte nur gelingen, wenn ich mit den alten Gefährten und den anderen Deutschen meinen Frieden machte.
Bereits kurz nach Kriegsende hatte ich den Herrligkoffers ein Fresspaket für ihre unterernährten Kinder geschickt. Damals lebte ich in Palästina, wo wir im Gegensatz zu Deutschland genug zum Essen hatten. Jetzt, ein Jahrzehnt später, litt ich Not und brauchte ihn.
Von Bier zu Bier wurde die Stimmung fröhlicher und freier. Die Kumpane lachten und hatten ihre Scheu, mir auf die Schulter zu schlagen, abgelegt. Dennoch verlor, anders als ich nach Siegls einleitenden Worten befürchtet hatte, niemand ein Wort über den Krieg. Stattdessen wandte sich Korbinian Hufner mir zu.
»Gud, dasch wieder hier bisch, Ludwig. Da kannscht endlich erfahre, dass i dem Gerschtle Theo g’holfa hab, nach d’r Krischdallnacht abzuhaue. Du bisch ja viel z’früh wegglaufa. Im 33er Jahr war noch nix los …«
»Für di ned. Für mi scho’.«
Karl Seiff, der mich zur sofortigen Flucht gedrängt hatte, lebte jetzt in München und arbeitete als Inspektor im Einwohnermeldeamt. Er hatte kein Bedürfnis, nach Ichenhausen zu reisen, als ich ihm anbot, ihn in unsere Geburtsstadt mitzunehmen.
»I weiß, du musch auf euren Friedhof. Aber nimm di’ in Acht vor unseren Kameraden …« Nun verstand ich Karls Warnung.
»I hab dem Gerschtle Theo sei Lebe g’rettet«, beharrte Hufner, rief »Proschd« und genehmigte sich einen kräftigen Zug. Seine Erzählung gab das Signal für einen Reigen weiterer Berichte. Bald darauf prahlte Michael Lang: »I hab noch im Jahr 39 dem Levy Berthold und seiner Frau Lea im Allgäu an Pfad zeigt, wo sie sicher nach Tirol und dann in die Schweiz käma san.«
Das Schwadronieren wurde mir unerträglich. Ich suchte nach einem Anlass, das Treffen zu verlassen, ohne Siegfried und die anderen vor den Kopf zu stoßen. Die Kameraden scherten sich nicht um meine Seelenpein. Soeben tönte Kraus Anton, er habe für die Familie Mainfelder Passierscheine ins Ausland besorgt, da wurde ein vernehmliches »Naaaa!« hörbar. Es kam von einem älteren Herrn, der bis dahin mit geschlossenen Augen in einer Ecke gesessen hatte, sodass wir ihn schlafend wähnten.
»Naaaa!«, wiederholte der Mann mit geöffneten Augen und klarem Blick. Er wandte mir sein Gesicht zu und sprach: »Darfsch ned alles glaube, was die Kerle dir weismachen wolled, Ludwig Seligmann.«
Er hatte die Stimme nicht erhoben, doch seine Worte ließen die Mienen der Männer gefrieren. Alles Gerede erstarb. Die Situation ließ mich unwillkürlich an »die Schrift an der Wand« aus Heines »Belsazar« denken.
Die Männer brauchten eine Weile, um sich von ihrer plötzlichen Entlarvung zu erholen. Wortlos verließen sie nacheinander die Stube. Am Ende blieb ich allein mit dem älteren Herrn. Er erhob sich, kam auf mich zu. Auf Augenhöhe sprach er:
»Gib Obachd, Ludwig! Ihr Jud’n habt’s nie einfach g’habt. Aber jetzt ist’s für euch hier besonders hart.«
Hannah
Ludwig zog sich leise im dunklen Hotelzimmer aus, wusch sich rasch am Waschbecken, ehe er sich in seine Betthälfte grub und das Gesicht von mir abwandte. Seine angespannte Haltung verriet mir, dass er wach war.
»Ich schlafe nicht«, flüsterte ich, um Rafi, der auf einem Sofa vor uns ruhte, nicht zu wecken. Ludwig brummte, er habe mich verstanden. Wir lagen schweigend nebeneinander. Alle Viertelstunde schlug die Kirchenuhr mit heller Glocke, ein, zwei, drei, vier Mal an, sodann mit dunklerem Ton die Stunden, elf Klänge, schließlich zwölf Schläge, Mitternacht. Die Begegnung mit den Nazis ließ ihn offenbar keinen Schlaf finden.
»Was treibt dich um, Ludwig?«
Er wandte sich mir zu, stützte seinen Kopf auf.
»Die Menschen hier … Ich weiß nicht, wie ich mit ihnen auskommen soll …«
»Du darfst nicht versuchen, mit den Nazis auskommen zu wollen, Ludwig.«
»Wir leben jetzt in Deutschland, Hannah! Du bist aus eigenem Willen mit hierhergekommen. Darum verlange ich, dass du zu mir stehst.«
»Ich habe immer zu dir gestanden, Ludwig, und werde es weiter tun. Aber fordere nicht von mir, dass ich mich mit den Nazis einlasse.«
»Du wirst dich mit den Menschen in Deutschland arrangieren müssen, Hannah. Sonst gehst du hier zugrunde und reißt mich und unser Kind mit.«
Judenbuben
Rafael
Ich freute mich auf die Schule. Dann konnte ich endlich aus dem Zimmer in der Pension »Sonnenschein« in der Klenzestraße herauskommen, in dem ich seit unserer Ankunft in München mit meinen Eltern wohnte. Das war vor einigen Wochen gewesen. Gelegentlich ging Vater mit mir an der Isar spazieren. Der weite Grasstreifen am grünen Fluss war toll. So etwas Schönes kannte ich in Israel nicht.
Aba war selten zu Hause, und Ima verbrachte den ganzen Tag im Zimmer und las Zeitung. Obwohl ich Deutsch konnte, verstand ich die Zeitung nicht, denn in Israel hatte ich in der Schule nur Iwrith lesen und schreiben gelernt. Deshalb hatte ich ein bisschen Angst. Aber irgendwie würde es schon klappen. Ich sprach schon immer Deutsch. Da werde ich auch schnell deutsch schreiben und lesen können.
Das hatte auch der Schuldirektor gesagt, der sich mit mir unterhalten hatte.
»Der Junge spricht tadellos Deutsch. Er besitzt jüdische Intelligenz. Wir stecken ihn in die vierte Klasse, wo er altersmäßig hingehört.« Der Leiter der Schule trug einen weißen Kittel wie ein Arzt und eine randlose Brille auf der Nase. Er machte einen strengen Eindruck, nicht wie unser Direktor in Herzliya, der sagte, er sei unser »bester Freund«.
Auch das Schulgebäude war ganz anders als in Israel, wenig Licht, dicke Mauern, hohe Decken. Ich wartete mit einer Reihe von Jungen auf dem Gang. Anders als in unserer Schule in Herzliya gab es hier keine Mädchen. Aber die Buben tobten wie in Israel.
»Obacht, der Pauker!«
»Was ist Pauker?«, fragte ich einen Jungen neben mir.
»Der Lehrer, Herr Walk.«
Es erschien ein dicker Mann mit Schnauzer in Motorradkleidung. Sofort drosch er mit seinen schweren Handschuhen wahllos in unsere Reihe und schrie dabei »Ruhe! Saubande.« Augenblicklich wurde es still. Wir folgten dem Lehrer ins Klassenzimmer, wo wir so lange zu stehen hatten, bis Herr Walk seine Lederkluft ablegte, um wie der Direktor in einen weißen Kittel zu schlüpfen. Erst als er hinter seinem Pult Platz genommen und uns genau gemustert hatte, gab er das Kommando: »Setzen!«
Ehe wir Israel verließen, hatte mir Mutter die deutschen Buchstaben beigebracht. Doch diese zu Wörtern zusammenzustellen, sie flüssig auszusprechen und zu begreifen, konnte ich noch nicht. Darum war ich nicht einmal in der Lage, Rechenaufgaben zu verstehen. Um meine Fähigkeiten hier zu testen, ließ mich Herr Walk zusammenzählen, abziehen, malnehmen, teilen.
»Du kannst gut rechnen, wie sich’s für einen Judenbub gehört.«
Gelegentlich benutzte Herr Walk auch den Tatzenstecken. Dann musste der Schüler vor ihn hintreten. Der Lehrer nahm dessen Hand, mit der anderen hielt er den Rohrstock, zielte und kreischte dabei:
»Sakra, Sakra, Sakrament!« Beim letzten Wort sauste der Stock nieder. Einmal, dreimal oder fünfmal. Daraufhin ließ Walk die Hand des Jungen mit angewidertem Gesichtsausdruck los und tönte:
»Wenn ich dich noch einmal beim Schwätzen oder beim Spicken erwisch, leg ich dich übers Knie und hau dir die Seele aus dem Leib. Hundskrüppl, verreckter!«
In der 4b gab es noch einen anderen jüdischen Schüler, der wie ich nicht den katholischen Religionsunterricht mitmachen musste. Ich mochte Edwin nicht, denn wenn mich seine Mutter einlud, ließ er mich nicht mit seinen tollen Spielsachen, auch nicht mit dem fernlenkbaren Feuerwehrauto spielen. In der Schule rief Herr Walk Edwin, der schlecht im Rechnen war, an die Tafel und führte uns seine Blödheit vor, bis der Junge zu weinen begann. Dann lächelte der Lehrer.
»Du wirst es schwer haben im Leben, Berg, wenn du nicht mal imstande bist zu rechnen, um deine deutschen Kunden zu übervorteilen. Nimm dir ein Beispiel am Seligmann, der kann zwar nicht schreiben und lesen, aber rechnen kann er.« Die Schüler lachten. Das ließ Edwin noch mehr heulen, und ich war wütend. Denn durch seine Flennerei machte er auch mich lächerlich.
Nach dem Unterricht fingen einige Mitschüler »die Heulsuse« ab und brachten Edwin durch Schläge wieder zum Weinen. Ich half ihm, weil er mir leidtat, als er die Hände vors Gesicht hielt, statt sich zu wehren.
Da tauchte Frau Berg auf, mahnte die Schläger, Edwin loszulassen, und machte sich mit ihm flugs davon. Jetzt waren die Buben zornig auf mich. Mir wurde ein Taschentuch in den Mund gesteckt, dann wurde ich verprügelt. Als ich am Boden lag, bekam ich noch einige Tritte ab. Endlich hatten die Raufbolde genug.
Hannah
Die Nazibrut hatte Rafi zugerichtet wie ihre SA-Väter einst die Juden. Aber die Zeiten waren vorbei, in denen ich die Pogrome des Antisemitenpacks wehrlos hinzunehmen bereit war! Da Ludwig nicht da war, ging ich sogleich alleine zum Schulleiter. Der Goj wollte mich nicht außerhalb seiner Sprechstunde empfangen. Doch ich bestand darauf, mit ihm auf der Stelle zu reden. Er bot mir nicht einmal einen Stuhl an.
»Herr Petzold. Ich erlaube nicht, dass mein Kind von Ihrer antisemitischen Horde malträtiert wird! Wenn Rafael noch einmal ein Haar gekrümmt wird, dann melde ich Sie den Behörden und werde nicht ruhen, bis man Sie bestraft.«
Sein Teint lief violett an, als er mich anbrüllte:
»Hinaus! Nehmen Sie Ihren Judenbuben und verschwinden Sie nach Palästina! Auf der Stelle!«
Nachdem ich mich in der Israelitischen Kultusgemeinde nach dem Leiter der Münchner Schulen erkundigt hatte, begab ich mich ins Stadtschulreferat. Dass Dr. Fingerles Terminkalender belegt war, wie mir seine Sekretärin versicherte, hinderte mich nicht daran, in das Büro des Schulchefs zu gehen.
Der blasse Mann mit streng gescheiteltem grauem Haar saß hinter einem mit Akten überladenen Schreibtisch. Er sah mich durch dicke Brillengläser überrascht an, als ich ohne Aufforderung sprach.
»Herr Dr. Fingerle, mein Name ist Seligmann. Wir sind vor Wochen aus Israel nach München gekommen. Mein Sohn Rafael geht hier zur Schule. Er ist dort brutal geschlagen worden. Als ich mich darüber beschwert habe, hat mich der Direktor hinausgeworfen und gesagt, ich solle mit meinem Kind nach Palästina verschwinden.« Ich sprach mit ruhiger Stimme, doch mein Herz schlug mir bis zum Hals. Fingerle bot mir einen Stuhl an.
»Danke, dass Sie zu mir gekommen sind, Frau Seligmann. Unsere jüdischen Mitbürger sind uns hoch willkommen. Ich dulde derartige üble Vorfälle nicht! Das Verhalten des Schulleiters ist empörend und wird strenge Konsequenzen zeitigen. Um welche Schule handelt es sich bitte?« Herr Doktor Fingerle ließ sich umgehend mit dem Mann verbinden und gab ihm ordentlich Bescheid.
»Sie haben wohl nicht begriffen, dass wir in einem demokratischen Staat leben, in dem Menschenwürde gilt?! Sollte mir noch das kleinste Vergehen aus Ihrer Anstalt gemeldet werden, stelle ich Sie umgehend vom Dienst frei. Ich verlange, dass Sie sich bei Frau Seligmann entschuldigen und die Schläger gehörig bestrafen!«
Dr. Fingerle versicherte mir, dass mein Rafi fortan unbesorgt die Schule besuchen könne. Ich solle nicht zögern, ihn persönlich zu unterrichten, falls ich Grund zur Beschwerde hätte.
Als ich meinem Sohn nach der Schule von meinem Besuch beim Stadtschulrat und von dessen Worten erzählte, machte er ein betretenes Gesicht. Warum?
»Weil man Petzer hasst. In Israel und sicher auch hier.«
»Sollen sie dich ruhig hassen, Rafi. Auf Antisemiten darf man keine Rücksicht nehmen!«
Rafael
Wir hatten kaum Platz genommen, als energisch an die Tür gepocht wurde. Unser Türöffner Fritzi eilte nach vorn. Doch noch ehe er aufmachen konnte, wurde die Tür aufgerissen. Fritzi rief dem ins Zimmer stürmenden Direktor ein »Grüß Gott, Herr …« entgegen, da gab dieser ihm eine Backpfeife. Der Lehrer befahl uns: »Aufstehen!«
Der Schulleiter raunzte ihn sofort an.
»Nach zwanzig Jahren im Schuldienst kennen Sie Ihre Pflichten noch immer nicht. Als Klassenlehrer tragen Sie Verantwortung für Ihre Schüler. Stattdessen lassen Sie zu, dass die Judenbuben von ihren Mitschülern durchgehauen werden! Sie glauben wohl, wir leben noch im Dritten Reich? Die Zeiten sind vorbei! Eine Mutter hat Sie denunziert. Kommt so was nochmals vor, entferne ich Sie unverzüglich aus dem Amt! Haben Sie verstanden, Walk?!«
»Jawohl, Herr Direktor!«
»Das will ich für Sie hoffen!« Der Schulleiter machte auf dem Absatz kehrt und jagte davon, ohne sich um Fritzi zu kümmern, der sich die Wange hielt.
»Wer von euch hat die Judenknaben angefasst? Sagt’s lieber gleich, ich krieg’s ja doch raus! Dann hilft euch kein Gott. Dem brech ich das Genick!«, brüllte Walk. Die Jungen schwiegen. »Setzen!« Walk ging langsam durch die Bänke. Da niemand schwach wurde, trat der Lehrer zu Edwin und sprach mit einschmeichelnder Stimme:
»Berg, wer von deinen garstigen Klassenkameraden hat euch geschunden?«
Edwin schwieg.
»Wer, verflucht noch mal?«, fuhr Walk auf. »Ich mache das, um dich zu schützen! Und du schweigst verstockt!« Edwin konnte zwar nicht mit Zahlen rechnen, doch mit Rache.
»Ich weiß es nicht genau …«
»Dann sag’s ungenau!«
»Ich … kann mich an nichts mehr erinnern.«
»Zehn und schon verkalkt und vertrottelt.« Mit einem »Maul halten!« brachte Walk das aufglucksende Gelächter zum Schweigen und wandte sich mir zu.
»Und du, Seligmann, du israelischer Held, hast auch alles vergessen, was?«
»Nein! Es waren der Girgl, der Schober und der Vogel.« Stille. Auch ich hatte den Mund halten wollen. Doch als Walk mich als israelischen Helden lächerlich machte, war mir alles egal. Unser Pauker lachte auf.
»Du traust dich was, Seligmann.« Er wandte sich brüllend an die Klasse.
»Lumpenpack! Ich habe euch gewarnt! Erst die Judenjungen versohlen und dann zu feige sein, zu euren Taten zu stehen. Und zu blöd. Denn jede Kette reißt am schwächsten Glied. Das war heute der Seligmann. Dank seines Verrats werde ich die drei Verbrecher so durchhauen, dass sie es ihr Leben lang nicht vergessen werden.« Walk besah die übrigen Schüler. »Ihr Deppen müsst ned so dumm grinsen. Beim nächsten Mal … es darf kein nächstes Mal geben, Himmelsakrament! … schlag ich euch kaputt!«
Der Unterricht ging zu Ende, ohne dass etwas geschah. Als die Schüler das Klassenzimmer verließen, befahl Walk den Schlägern, dazubleiben. Ich verharrte auf meinem Platz.
»Geh nach Hause, Seligmann!«
»Ich bleibe noch. Ich will sehen, wie Sie die Buben schlagen.«
»Eines muss man dir Israelbengel lassen, du bist aus anderem Holz geschnitzt als der Edwin und die anderen Judenbuben, die hier leben.«
Ludwig
Ich war nach Deutschland gekommen, um endlich geschäftlich Erfolg zu haben. Hier herrschte ein Wirtschaftswunder. Die Menschen verfügten wieder über gutes Geld und gaben es freudig aus. Eine ideale Situation für jeden Kaufmann. Zudem verfügte ich durch die Rückkehrprämie nach Deutschland über ein kleines Startkapital. Anders als in Israel hätte ich schuldenfrei einen Laden eröffnen und Ware erwerben können. Doch Hannah war strikt dagegen.
»Du taugst nicht zum Geschäftsmann, Ludwig! Dir fehlen die Härte und das notwendige Durchsetzungsvermögen!«
Dennoch hörte und sah ich mich fortwährend nach Geschäftsmöglichkeiten um. In einem Inserat in der »Süddeutschen Zeitung« wurde ein eingeführtes Textilgeschäft in der Wörthstraße unweit des Ostbahnhofes angeboten. Die Lage war hervorragend. Ich wollte bereits um sieben Uhr morgens das Geschäft öffnen, was mir nicht schwerfiele. Als früher Vogel würde ich auf diese Weise der Konkurrenz durch günstige Offerten potenzielle Käufer auf dem Weg zur Arbeit abfischen. Ich erwog, meinen Laden »Früher Vogel« zu nennen. Ein Schild mit einem roten Vogel über dem Schaufenster würde meinem Geschäft Aufmerksamkeit verschaffen.
Doch Hannah blieb stur.
»Du hast zweimal mit einem Geschäft Schiffbruch erlitten, Ludwig. Ein drittes Mal darf ich nicht zulassen. Zunächst müssen wir ein menschenwürdiges Zuhause finden. Wir können nicht ewig zu dritt in einem Pensionszimmer hausen. So kann Rafi keine Hausaufgaben machen. Suche dir eine sichere Stelle als Angestellter, statt Luftgeschäften hinterherzulaufen.«
Ich besorgte uns eine möblierte Wohnung in der Liebherrstraße unweit des Isartors. Rafi schenkte ich eine elektrische Eisenbahn. Der Junge war ganz aus dem Häuschen. Das machte mir Mut, an meinen Geschäftsplänen festzuhalten.
Ich erwog, ins Risiko zu gehen und die Ware auf Wechsel oder per Kommission zu erwerben. Doch das Unterfangen scheiterte, denn die hiesigen Grossisten gewährten mir keinen Kredit, weil sie mich nicht kannten. Es war absurd: In Israel, wo ich ein Fremder geblieben war, kannte man mich und räumte mir Kredit ein, in meiner deutschen Heimat dagegen hatte ich nach Hitler meine Kreditwürdigkeit eingebüßt.
Damit war ich vom Wohlwollen Hannahs abhängig. Geduldig erklärte ich ihr, dass die Mittel aus ihrer Rückkehrprämie für den Aufbau eines soliden Geschäfts unentbehrlich wären. Doch sie beharrte auf ihrer steinernen Ablehnung. Erstmals seit unserer Abreise aus Israel stritten wir wieder.
»Durch dein Verhalten zwingst du mich, meinen Freund Siegfried Herrligkoffer um einen Kredit anzugehen.«
»Das wirst du nicht tun, Ludwig! Du wirst dich nicht vor einem Nazi erniedrigen, ihn anzuschnorren!«
»Dann investiere du in unser Geschäft. Ich werde dich beteiligen.«
»Nein! Ich muss einen Notpfennig haben. Wenn du scheiterst, muss ich uns durchbringen!«
Ihr fehlendes Zutrauen trieb mich aus dem Haus. Es dunkelte bereits. Die frische Luft beruhigte mich ein wenig. Ich war fähig, einigermaßen klar zu denken. Hannah hatte Siegl als Nazi beschimpft. Jetzt wollte ich von ihm erfahren, ob er bereit wäre, mir beizustehen.
In der Fraunhoferstraße betrat ich eine Telefonzelle. Es roch nach Hundepisse. Herrligkoffers Arztnummer kannte ich noch aus meiner Kindheit.
»Schön, von dir zu hören, Ludwig«, vernahm ich die vertraute Stimme. »Bischd wieder in Ichenhausen?«
»Nein, Siegl. Ich ruf dich an, weil ich in Not bin …«
»Was fehlt dir?«
»Geld!« Ich schilderte ihm meine Lage.
»Wie viel brauchsch du?«
»Viertausend Mark. Als Kredit. Ich zahl dir den banküblichen Zins …«
»Kommt ned infrag! Des Geld kannsch habe … komm morga Mittag hier vorbei. Du bisch doch mei Freund.«
Als ich aus der Zelle trat, liefen mir Tränen über die Wangen. Was Siegl nach 1933 getan hatte, wusste ich nicht. Aber anders als meine Frau war er jetzt willens, mir zu vertrauen und zu helfen.
Ehe ich am nächsten Morgen nach Ichenhausen aufbrach, fuhr ich am Textilgeschäft in der Wörthstraße vorbei, das sich bald als mein »Früher Vogel« in die Lüfte erheben sollte. Der Pächter erklärte mir, dass er gestern eine Ablösevereinbarung abgeschlossen habe, da ich mich noch nicht entschieden hätte … Hannah hatte meinen Plan kaputt gemacht.
Ich rief Siegl an, dankte ihm für sein Vertrauen und teilte ihm mit, dass ich den Kredit nicht mehr benötigte, da sich mein Geschäftsvorhaben zerschlagen hätte.
»Ich hör dir an, dass du Zuspruch brauchsch, Ludwig. Komm her!«
Am frühen Abend erschien ich bei Siegfried. Zuvor war ich ins nächstgelegene Dorf, nach Waldstetten, gewandert. Der Gang durch die vertraute hügelige Landschaft, die sich rötlich-herbstlich zu färben begann, tat meiner Seele wohl. Dieser Flecken Erde war meine Heimat.
Siegfried freute sich über mein Erscheinen.
»Jetzt, am Abend, können mir uns ungestört unterhalten und dabei an guden Tropfen genießen.«
Wir nahmen im Salon mit seinen tiefen Ledermöbeln Platz, den ich noch aus meiner Jugendzeit kannte. Frau Erika, eine elegante Rheinländerin mit lachenden Grünaugen, begrüßte mich und dankte mir ob meiner einstigen Hilfe für ihre Kinder, ehe sie sich zurückzog.
Siegl öffnete eine Flasche Rotwein und schenkte uns zwei Gläser ein. Wir prosteten einander zu. Der Freund betrachtete mich aufmerksam.
»Ludwig, i hab am Telefon g’spürt, dass es dir schlecht geht. Sag’s mir, was di plagt, dann wird’s dir leichter. Du woisch, dass i als Arzt nix weiterschwätze derf. Aber no wichtiger isch, i bin dein Freund.«
Ungeordnete Gedanken und Gefühle schossen mir durch den Kopf. Siegl ließ mir Zeit, mich zu sammeln.
»Ich weiß nicht, was ich tun soll, Siegl.«
Er sah mich ruhig an. Schwieg. Schließlich hob er an.
»Ludl, i kann mir vorstellen, dass du nach allem, was hier passiert isch, ned ganz freiwillig zurück nach Deutschland komme bisch. Es läuft im Leben ned allweil so, wie mir wolled.Aber dann geht’s doch weiter. Dafür hat man sei Freunde und sei Familie …«
»Des isch’s, was mir so wehtut!«, fuhr ich auf und erzählte Siegl, zunächst stockend, dann immer hastiger, von meinem geschäftlichen Schiffbruch in Israel. Von der Weigerung meiner Geschwister, die ich einst durch die Aufnahme in Palästina vor den Nazis gerettet hatte, mir jetzt beizustehen. Und nun von der Unmöglichkeit, in Deutschland einen Kredit zu erlangen, um ein Geschäft starten zu können.
Siegl hörte mir aufmerksam zu, ohne mich zu unterbrechen. Dann nickte er. »Ludwig, vielleicht hat dei Frau ned so unrecht. Vielleicht bisch du koi harter G’schäftsmann, des bin i au ned …«
»Ich hab mich in Israel vom Milchboten zum Prokuristen hochgeschuftet, Siegl …«
»Dass du g’scheit und tüchtig bisch, weiß i …«
»Aber?«
»Ludl, i muss dir ned sage, dass man als Geschäftsmann auch ein Bazi sein muss. Und des bisch du so wenig wie dei seliger Vater.«
»Zum Angestellten bin i mit einundfünfzig zu alt. Soll i mi erschießen?«
»Schmarrn!«, donnerte Siegfried. »Und hab koi Mitleid mit dir selbschd.«
»Was soll i tun, um Himmels willen?«
»Des liegt doch auf der Hand, Ludl.« Mit der Vertrauen einflößenden Sprechweise des Arztes versuchte Siegl, meiner Verzweiflung zu begegnen. »Komm zurück nach Ichenhausen und nimm euer altes Familiengeschäft wieder auf!«
»Du meinsch, ich soll wieder hausieren?«
»Ja, freilich! Du kennsch des Land, du kennsch die Leit’, du kennsch des G’schäft …«
»Hier lebt koi Jud mehr, Siegl …«
»Du wirsch der erschde sei, dann kommed die andern au …«
»Nein, Siegl! Die Zeit isch rum! Ihr habt des jüdische Lebe ausg’löscht. Die Juden erschlagen. Die Synagoge geschändet …«
»In München gibt’s wieder Judn, in Augschburg … wennscht herkommsch, au bei uns …«
»Noi, Siegl! Mir würd’s des Herz zerreiße. Fremde in unserm Haus …« Ich riss die Hände hoch, versuchte meine Tränen zu verbergen.
»Musch ned weine, Ludl. I wollt dir bloß helfa …«
Ich konnte mich nicht länger beherrschen. Es schüttelte mich. Siegfried wartete, bis ich mich beruhigt hatte, und reichte mir ein Glas Wasser. Später ermutigte er mich, noch zwei Schoppen Wein zu trinken, und bestand darauf, dass ich in seinem Haus übernachtete.
Während die Wälder auf der Autobahn nach München an mir vorbeiflogen, beschäftigte mich das Gespräch des Vorabends. Dass Siegfried Hannahs Meinung teilte, ich sei zum Kaufmann nicht geeignet, schmerzte mich – weil ich mir eingestehen musste, dass sie nicht unrecht hatten. Mir fehlte die Skrupellosigkeit eines erfolgreichen Geschäftsmanns, einerlei ob in Israel oder hier. Zugleich fühlte ich, dass es mir unmöglich war, im Totenhaus meiner jüdischen Heimatgemeinde zu leben.
Ich sah keinen Ausweg. Dennoch durfte ich nicht aufgeben. Das war ich meiner Frau und meinem Sohn schuldig, die ich in meine deutsche Heimat geführt hatte.
Rabbiner Doktor Cohn und Vater hatten mich neben den Religionsgesetzen den unbedingten Glauben an Gott gelehrt. Ich bin dein Gott, lautet das Erste Gebot. Wenn Vater niedergeschlagen war, hatte er im Buch Josua stets den Passus gelesen: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei mutig und stark. Mit diesem bedingungslosen Gottvertrauen hatte er Krieg und Flucht überlebt.
Auch ich musste dem Ewigen unbedingt vertrauen. Er würde mir meinen Weg weisen.
Hannah
Ich hatte die Nacht nicht schlafen können. Ludwig war nicht heimgekommen und hatte mir auch nicht Bescheid gegeben. Er war gekränkt, weil ich ihm nicht mein Geld für ein Geschäft gegeben hatte, von dessen Misserfolg ich überzeugt war. Endlich graute der Morgen. Es war noch zu früh, um Rafi zu wecken. So fuhr ich fort, mir über Ludwig den Kopf zu zerbrechen. Durch sein Versagen waren wir als Einzige in unseren Familien gezwungen gewesen, nach Naziland zurückzukehren – mitsamt unserem in Israel geborenen Kind. Wir lebten hier in einem Zimmer plus Küche, ohne eigenes Bad und Toilette. Die Heizkohle musste ich aus dem Keller hochschleppen.
Ludwig kümmerte sich um nichts. Jetzt war er ganz weggeblieben. Er war wohl wieder in sein Heimatkaff gepilgert, wo ihn keiner wollte. Niemand wollte uns in diesem Land – weil wir die Deutschen an ihre Verbrechen erinnerten. Das konnten sie uns nicht vergeben.
Es half nicht zu grübeln. Beim Frühstück fragte Rafi nach seinem Vater. Ich musste ihn anlügen und erzählen, Ludwig sei bereits in der Arbeit.
»Hast du ihm doch das Geld für sein Geschäft gegeben?«
Der Junge bekam alles mit. Deshalb durfte ich ihn nicht wissen lassen, dass sein Vater ein Versager ist. Er war klug genug, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Nachdem ich Rafi auf den Schulweg gebracht und die Wohnung aufgeräumt hatte, kochte ich mit dem Tauchsieder Wasser auf und bereitete mir ein Kännchen Kamillentee zu. In Israel war das ein Luxusartikel, hier dagegen bekam man für Pfennige getrocknete Kamillenblüten oder Fenchelsamen.
Eigentlich wollte ich ins Stadtschulreferat. Doch zunächst musste ich wegen Ludwig zu einer Entscheidung kommen. Es genügte nicht, ihm stetig vorzuhalten, dass er als Geschäftsmann nichts taugte. Das erbitterte ihn. Mein Mann brauchte eine Perspektive als kaufmännischer Angestellter. Eine deutsche Firma würde heute keinen Juden in einer gehobenen Position mehr einstellen, das hatten sie schon vor den Nazis kaum getan. Also kam nur ein jüdischer Betrieb infrage. Ich kannte lediglich die kleine Textilfabrikation von Israel Langer am Isartorplatz, dem Mann meiner Bekannten Berta Enoch aus Berliner Tagen. Alle Angestellten dort waren Gojim. Aber vielleicht kannte Langer einen jüdischen Betrieb, der einen Juden suchte, dem er wirklich vertrauen konnte, einen unserer Leute, die sie hier »Amchu«, »unserem Volk« zugehörig, nannten. Wenn Langer niemanden wusste, musste ich mich in der Israelitischen Kultusgemeinde umhören. Das war eigentlich Ludwigs Aufgabe. Doch er war zu stolz. Wenn ich ihm nicht weiterhalf, würde er uns wieder zugrunde richten.
Nachdem ich den Kamillentee und einen mit Quark bestrichenen Zwieback genossen hatte, zog ich mein bestes Kleid an und schminkte die Lippen, um mich ausgehfertig zu machen. Als ich aus dem Zimmer wollte, trat Ludwig ein. Er war blass. Ich verkniff mir die Frage, wo er die Nacht verbracht hatte.
»Ich war bei meinem Freund Siegl in Ichenhausen.«
»Hättest du mir nicht Bescheid geben können?«
»Nein! Weil Siegl sofort ohne Zögern bereit war, mir die Mittel für das Geschäft zu leihen!«
»Du bist hingefahren, dir das Geld zu holen, um es in dieses Himmelfahrtskommando zu stecken? Damit treibt dich dieser Nazi in den Ruin!«
»Wenn dir nichts mehr einfällt, zauberst du den Nazi aus dem Zylinder!«
»Ludwig, versteh mich bitte ein einziges Mal im Leben. Ich kenne dich. Ich will dich und uns vor einem Unglück bewahren. Während dieser Herrligkoffer dir nur schaden will …«
Ludwig lachte auf.
»Du wirst dich wundern! Auch der Siegl hat mich vor einem Geschäft gewarnt …«
»Ich dachte, er wollte dir das Geld geben?«
»Dennoch hat er mich gewarnt … Siegl meint wie du, dass ich zu ehrlich und zu wenig rücksichtslos für einen Kaufmann bin.«
»Also sagt dir sogar dieser … Herrligkoffer, dass du als Angestellter arbeiten musst.«
»Nein! Siegl legt mir ans Herz, wieder das zu machen, was unsere Familie seit je getan hat. Und was ich von der Pike auf gelernt hab! Hausieren.«
»Das darfst du hier nicht tun, Ludwig!«
»Ein Geschäft aufzumachen, willst du mir verbieten«, schrie er auf. »Zum Angestellten bin ich zu alt. Also bleibt mir nichts übrig, als zu hausieren.«
»Ich werde nicht zulassen, dass sich mein Mann vor den Nazis erniedrigt und sie anbettelt, seine Schmattes zu kaufen.«
»Dann musst du arbeiten und Geld verdienen. Aber das wirst du nicht tun. Nur schwatzen. Also halt deinen Mund!« Ludwig sah mich verächtlich an, ehe er die Tür zuschlug.
Hausierer
Ludwig
Im Franziskanerkeller am Westende der Maximilianstraße skizzierte ich nach Weißwürsten, Kaffee und einer Zigarette auf einem blanken Block einen vorläufigen Geschäftsplan. Von meinen sechstausend Mark Rückkehrprämie hatte ich knapp die Hälfte für meinen VW Standard, für Haushaltsgeld, Miete und Kleidung ausgegeben. Hausieren hätte den Vorteil, dass es außer dem Unterhalt meines Autos kaum laufende Kosten verursachte. So könnte ich, bis auf eine Notreserve, meine Barschaft in Ware investieren. Ich würde mit Arbeitshosen und Hemden für die Bauern im Umland von Ichenhausen beginnen. Mit der Produktion und dem Vertrieb von Hosen kannte ich mich seit meiner Lehre im Kaufhaus Bodenheimer in Ulm aus. Der Kaffee beflügelte mich, machte mir Mut. Für zweitausendfünfhundert Mark konnte ich mehrere Dutzend Arbeitshosen und Hemden erwerben. Da ich noch keinen Kredit besaß, würde ich bar zahlen und daher drei Prozent Skonto erhalten.
Ich bestellte einen weiteren Kaffee und zündete mir eine neue Zigarette an. Zu meiner Zeit waren fast alle Textilfabrikationen jüdisch gewesen. Jetzt musste ich die Annoncen im Wirtschaftsteil der Zeitung studieren, um geeignete Großhandlungen auszumachen.
Die Firma Brüggelmann und Co Arbeitskleidung in der Schwanthalerstraße kannte ich noch aus den Jahren vor Hitler. Sie galt als solides Handelshaus, das hochwertige Ware preiswert anbot. Um mir ein Bild des deutschen Preisniveaus zu machen, hatte ich die Warenhäuser in der Kaufinger- und Neuhauser Straße sowie rund um den Hauptbahnhof in der Bayer- und Paul-Heyse-Straße besucht und die Schmattes besehen. Oberpollinger, Hertie, einst Hermann Tietz, Wertheim … kein Haus war mehr in jüdischer Hand – selbst die Namen hatte man arisiert.
»Sentimentalität hat im Geschäftsleben nichts zu suchen!«, hatte mir mein erster Lehrherr Lazarus Bodenheimer eingetrichtert. Das war Anfang der 20er-Jahre. Umso mehr galt diese Regel seit Hitler.
Zwei Stunden später hatte ich zweitausendsechshundert Mark in blaue Arbeitshosen hervorragender Qualität sowie in Hemden und Kittel investiert. Mit einem Rollwagen trug ich mein neues Geschäftskapital zu meinem VW, wo ich die Ware auf der Ablage hinter dem Rücksitz sowie über dem Tank unter der Bugklappe verstaute.
Mit dem Einkauf hatte ich den ersten Schritt getan. Jetzt entflammte die Verkaufslust des Hausierers in mir, die über Generationen die Juden Europas während ihrer nicht enden wollenden Touren angetrieben hatte. Ich blickte auf meine Armbanduhr. Es war halb zwei. Wenn ich sogleich losfuhr, würde ich knapp vor vier in Ichenhausen sein.
Während der Fahrt auf der Autobahn empfand ich erstmals, seit ich in Deutschland war, ein Gefühl der Befreiung, das meinen Brustkorb weitete und mich tief durchatmen ließ. Mein Vorhaben, in München ein Geschäft zu eröffnen, dessen Risiken mir auch ohne Hannahs Kassandrarufe durchaus bewusst waren, musste ich fallen lassen. Vorläufig. Nun besaß ich ein Auto voller Ware, die ich verkaufen musste. Es gab kein Zurück.
Knapp zwei Kilometer vor Ichenhausen verlangsamte ich in Großkötz die Fahrt, um den Wagen über einen Feldweg zum Mostler-Hof zu steuern. Kaum war ich durch die unverschlossene Haustür in die Wohnstube getreten, kam mir ein stattlicher Mann entgegen.
»Der Ludwig!«, rief er mit sattem Bariton. »Woiß scho, dass’d wieder do bisch in Deutschland. Hosch di mit deine Fußballkameraden im Weißen Roß beim Abt troffa.«
»Und jetzt bin i bei dir.«
»Was willsch von mir, Ludwig?«
»Dir wieder Sach verkaufa wie früher.«
Mostler sah mich einen Moment erstaunt an.
»Ja, wieso bisch denn z’rückkomma nach all dem Unglück mit deine Leit, Ludwig?«
Mit allem hatte ich gerechnet – nur nicht mit dieser naheliegenden Frage.
»I bin z’rückkomma, weil hier mei Heimat isch.«
»Scho. Aber …«
»Albrecht, i bin ned do, um üb’r mei Gründe zu schwätza, sondern weil i dir mei Ware verkaufe will …«
Mostler hob den Blick und sah mir in die Augen, wobei seine Mundwinkel sich zu einem Lächeln kräuselten.
»Wennsd’ mir was andreh’n willsch, Ludwig, dann musch scho freundlich zu mir sei. Weil sonschd bestell i mei Zeig beim Neckermann. So dumm wie früher san mir Bauern nimmer.«
»Du warsch nie dumm, Mostler, und andreht hab i dir nie was, sondern dir allweil gude Ware verkauft.«
»Brauchsch fei ned glei beleidigt sei, Ludwig.« Er wies mit dem Kopf in Richtung des Tisches. »Jetzt hock di erschd amol no und trink mit mir a Glas aufs Wiedersehe. Dann red mr weiter.«
Der klare Birnenschnaps brannte in der Kehle, wärmte den Magen und hellte meine Stimmung auf. Mostler schmeckte es auch. Er schenkte sogleich nach. Unsere Laune verbesserte sich weiter. Der Bauer wiegte sein Haupt.
»Der Schnaps tut einem scho guad … I muss dir nämlich a Sach sage, Ludwig. Alle redn, dass man so garschdig zu de Judn war. Aber was mir Deutsche g’litta hen, des darfsch ned erwähne.« Erneut glomm sein schiefes Lächeln auf.
»Du sagsch es ja grad, Albrecht.«
»Ja. Nach dem zweiten Schnaps. Nach dem vierte, fünfte könnt i dir no ganz andre Sach verzähle.«
»Bitte nicht.«
»Siehscht! Des wolleds’ ned höre.«
»Noi. Und i verzähl dir au nix, was ihr mit unsrem Volk g’macht habt, Mostler!«
»I hab nix mit euch g’macht.«
»Millionen Juden sind vergast worra.«
»Und genau so viel von unsre Leit sen au um’bracht worra!«
»Mostler, i bin ned hier, um dir Vorwürfe zu mache …«
»Wos hosch dann wieder mit de Millionen tote Judn ang’fange?«
Dagegen half kein Schnaps. Ich wollte weg, doch der Bauer drückte mich mit kräftigem Griff wieder in den Stuhl.
»Bleib, Ludwig! Des muss raus! Lass uns noch einen auf d’ Versöhnung heba. Sonschd werd’ mer in diesm Leba koine Freind mehr werda, und i ko dir nix abkaufa.«
Aus der Ahnung wurde Gewissheit, dass der Preis des Hausierens als Jude in Deutschland nach den Nazis allzu hoch war. Nicht umsonst hatte ich ein anonymes Geschäft in München gewollt. Jetzt musste ich mir das Geheul der Wölfe anhören. Die Rechtfertigungen der Kunden über mich ergehen lassen, damit sie meine Schmattes abnahmen. Ich stieß mit dem Bauern an. Er kaufte mir als Gegenleistung vier Arbeitshosen und zwei Hemden ab.
Der Ablass betrug nicht dreißig Silberlinge, sondern zweihundert Mark. Und ich hatte keinen Lebenden verraten – nur meine Selbstachtung.
Das Wissen um den Preis des Verkaufens raubte mir die folgenden Nächte den Schlaf. Heinrich Heine hatte bei dem Gedicht »Nachtgedanken«: Denk ich an Deutschland in der Nacht … die Sehnsucht nach seiner Mutter beklagt. Ich und meine Glaubensgenossen, nicht nur in Deutschland, mussten mit dem Andenken an die unzähligen Opfer von Auschwitz leben.
Da sprang mich ein passender Vers Heines aus dem »Buch der Lieder« an: Anfangs wollt ich fast verzagen, und ich glaubt, ich trüg’ es nie, und ich hab’ es doch getragen – Aber fragt mich nur nicht, wie?
Ich musste und ich wollte in meine Heimat zurückkehren. Dafür hatte ich die Bürde der ständigen Erinnerung an meine vernichtete Gemeinde, an mein verlorenes Heim zu ertragen. Dabei durfte ich meinen Lebensmut unter keinen Umständen verlieren.
Rafael
Im November besuchte ich erstmals die Herrnschule. Anders als im düsteren Bau in der Klenzestraße drang durch die großen Fenster meiner neuen Schule viel Licht ins Klassenzimmer. Die Schüler hier waren offensichtlich fröhlicher. Und es gab Mädchen in der Klasse. Unser Lehrer hieß Benedikt Hirschbold. Er trug Anzug und Krawatte, aber keinen weißen Kittel, und er schlug seine Schüler nicht. Hin und wieder schrie er, aber jeder spürte, dass der Direx, denn Herr Hirschbold leitete die Schule, uns gernhatte. In meiner Klasse hatte ich zwei jüdische Mitschüler, Herschi Braun und Abi Pitum. Niemand hänselte uns, weil wir Juden waren. Oder fast niemand. Als der Direx mitbekam, dass Karli Baumann Herschi einen Saujuden nannte, gab er ihm eine Watschn.
»In meiner Klasse gibt es keine Katholiken, keine Protestanten oder Juden, nur Menschen. Merk dir des, du damischer Hirsch.« Es war das einzige Mal, dass dem Direx die Hand ausrutschte. Niemand nahm es ihm übel. Auch nicht Karli Baumann.
Ich fühlte mich wohl in der Klasse. Jeden Morgen um halb acht machte ich mich auf den Schulweg. Von der Liebherr- über die Kanalstraße, von der ich in die Knöbelstraße kam, um schließlich rechts in die Herrnstraße abzubiegen, an deren Ende ich durch eine schwere Holztüre ins Schulhaus gelangte.
Überall waren noch die Schäden des Krieges sichtbar. Die Kanalstraße bestand größtenteils aus Trümmergrundstücken, zusammengestöpselten ehemaligen Ruinen, die auf ein bis zwei Stockwerke ausgebaut worden waren, und zwei nüchternen Neubauten. Ein einziger Altbau war übrig geblieben.
Auch in der Herrnstraße waren nur wenige Gebäude unbeschädigt. Sie ragten auf wie einzelne Zähne eines kaputten Gebisses. An manchen Hauseingängen wiesen breite weiße Markierungen zu Luftschutzkellern. Doch am Anfang der Herrnstraße erhob sich ein modernes Wohn- und Bürohaus. Gegenüber unserer Schule wurde ein beschädigtes Haus wieder instand gesetzt. Der Direx sagte, dass drei Viertel der Münchner Innenstadt während des Krieges durch britische und amerikanische Bomber zerstört worden war.
Noch immer fiel es mir schwer, flüssig Deutsch zu lesen. Und die Rechtschreibung beherrschte ich nicht. In Iwrith gab es keine Groß- und Kleinschreibung, keine doppelten Buchstaben, kein ie, kein ck, kein tz und gar keine Umlaute. Der Direx, der im Heimatkundeunterricht so schön über die alten Zeiten in München erzählen konnte, am liebsten aber aus dem Buch über München vorlas, das er selbst geschrieben hatte, war im Deutschunterricht sehr streng mit mir.
»Wennsd’ bis zum Sommer ned richtig Deutsch schreiben und lesen lernst, muss i dir einen Sechser geben, und dann bleibst sitzen. So ist die Regel. Streng dich an, du fauler Hund. Deutsch reden kannst ja, und dumm bist a ned. Lass dir von deinen Freunden, dem Abi und dem Herschi, helfen. Ihr Juden haltet doch zusammen wie Pech und Schwefel.«
Doch Herschi paukte für seine Aufnahmeprüfung ans Gymnasium, und Abi wurde gleich nach dem Unterricht von einem Chauffeur im Opel Kapitän abgeholt.
Allmählich konnte ich ausreichend lesen, um die Rechenaufgaben zu verstehen. In den Prüfungen kam ich auf eine Zwei.
»Lern endlich g’scheit Deutsch, dann kriegst an Einser!«, mahnte mich der Direx.
Auf Hirschbolds Empfehlung schickte mich Ima zur Nachhilfestunde bei Lorenz Lichtl. Der unterrichtete die zweite Klasse. Er ging am Stock, und als einziger Lehrer an der Herrnschule trug er einen Schnurrbart wie Charlie Chaplin.
Herr Lichtl wohnte in einem Hinterhaus in der Mannhardtstraße. Als sich die Tür öffnete, stand ein einbeiniger Mann mit aufgestecktem Hosenbein vor mir. Meinen entsetzten Blick beantwortete er mit einem nüchternen »Kriegsverwundung«. Dann forderte er mich auf, ihm zu folgen, und sprang einbeinig in weiten Sätzen voraus. Er hüpfte in ein kleines Zimmer, das lediglich mit einem Tisch und zwei Stühlen möbliert war. Dort ließ er sich auf seinen Stuhl fallen, bedeutete mir, ebenfalls Platz zu nehmen, und meinte: »Jetzt wollen wir mal sehen, wo dich der Schuh drückt, Seligmann.« Als er bemerkte, dass ich den Ausdruck nicht verstand, erläuterte er ihn mir.
Ich wollte zunächst flüssig lesen lernen, damit ich die Aufgaben in Rechnen und Heimatkunde verstand. Herr Lichtl benutzte kein Buch, sondern schrieb einfache Sätze auf ein Blatt Papier: »Ich gehe zur Schule«, »Mutter kocht in der Küche«, »Vater arbeitet im Geschäft«. Nebenbei zerteilte er eine Zigarette, steckte eine Hälfte in ein Mundstück und rauchte. Erstmals machte mir der Deutschunterricht Spaß, weil ich meine Aufgaben verstand und sie erledigen konnte.
Die Zeit verging wie im Fluge. Nach einer Weile legte Herr Lichtl seinen Bleistift beiseite und blickte mich lächelnd an.
»Ich merke, dass dich meine Kriegsverwundung interessiert.« Ich nickte. Der Lehrer entzündete die zweite Zigarettenhälfte, inhalierte und stieß den Rauch aus. »Es war 1941, ich war neunzehn und hatte meinen Pilotenkurs gerade mit Bravour bestanden. Ich dachte, jetzt gehört die Welt mir. Ich war Co-Pilot eines leichten Heinkel-Bombers. Beim zweiten Einsatz hat uns ein britischer Spitfire-Jäger getroffen. Wir mussten notlanden. Dann wurde es schwarz um mich. Als ich wieder erwachte, lag ich in einem Lazarett und hatte furchtbare Schmerzen. Bald entdeckte ich, dass mein rechtes Bein fehlte. Es war amputiert worden. Ich war sehr traurig, denn ich begriff, dass ich mein Lebtag ein Versehrter bleiben würde und dass jeder Schritt eine Anstrengung wäre. Aber der Mensch gewöhnt sich an alles, und so wurde ich nach meiner Genesung und einem Studium Lehrer.«
Herr Lichtl hatte seine Geschichte ohne Selbstmitleid und ohne Verwünschungen erzählt, anders als Mutter es immer tat, wenn sie von den Nazis sprach. Deshalb bewegte mich sein Schicksal. Die wöchentliche Nachhilfestunde erfüllte ihren Zweck, ich lernte rasch besser lesen. Die richtige Rechtschreibung würde folgen, meinte der Lehrer. Doch die meisten Regeln interessierten mich nicht. Neugier dagegen empfand ich für seine Kriegsgeschichten. Herr Lichtl erklärte, sein Abschuss habe ihm die Augen geöffnet. Die britischen Spitfire-Jagdflugzeuge seien den deutschen Maschinen überlegen gewesen.
»Unsere viel gerühmten Stukas machten viel Lärm. Das mochte gegen die Polen taugen. Gegen die Engländer waren die deutschen Maschinen chancenlos. Die haben uns abgeschossen wie die Fasanen.«
Ich wollte wissen, warum das deutsche Militär den Krieg gegen Frankreich so schnell gewonnen hatte.
»Weil die Franzosen genug vom Kämpfen hatten. Die wollten lieber ihren Rotwein trinken und ihre gute Küche genießen. Aber nicht ihren Kopf im Krieg gegen einen Verrückten wie Adolf Hitler verlieren.«
Lichtl war überzeugt, dass die Wehrmacht auch den Krieg gegen Russland hätte gewinnen können.
»Wir hätten den russischen Bauern ihr Land zurückgeben müssen, dann wären die Iwans alle nach Hause gerannt, und wir wären bis Moskau durchmarschiert. Aber der Hitler war größenwahnsinnig. So haben wir den Krieg verloren wie ich mein Bein.«
In einer anderen Stunde fragte ich nach dem Schicksal der Juden. Lichtl lobte seine jüdischen Mitschüler.
»Sie waren gescheit. Nicht so dumm wie wir, die wir Fußball gespielt haben und den Mädchen nachgelaufen sind …«
»Auch mein Vater hat Fußball gespielt …«
»… sicher nur gelegentlich. Denn kluge Juden haben lieber Schach gespielt und gelernt. So ist etwas aus ihnen geworden. Nimm dir daran ein Beispiel.«
Vater hatte ständig Fußball gespielt. Schach dagegen nicht. Statt weiter zur Schule zu gehen und zu lernen, musste er arbeiten und Geld verdienen.
Herr Lichtl aber hatte Abitur gemacht und studiert. Was aus seinen klugen jüdischen Schulkameraden während der Nazizeit geworden war, traute ich mich nicht zu fragen. Er erwähnte es auch nicht. Beim nächsten Mal unterhielten wir uns wieder über den Krieg.
Als ich Mutter bat, wöchentlich zweimal zu Herrn Lichtl gehen zu dürfen, lehnte sie ab. Das sei zu teuer. Die Stunde koste fünf Mark, und Vater verdiene unser Geld nur mühsam. Stattdessen forderte mich Ima auf, mit meinen jüdischen Mitschülern zu lernen. Da dies nicht infrage kam, fragte ich Gabi Reu. Die Rothaarige mit den Sommersprossen war die beste Schülerin in unserer Klasse.
Schon am gleichen Nachmittag kam sie bei uns in der Liebherrstraße vorbei. Statt Lesen mit mir zu üben, bat mich Gabi, ihr die »israelische Schrift« zu zeigen. Endlich konnte ich beweisen, dass auch ich etwas gut konnte. Gabi malte die Iwrith-Buchstaben nach, die ich ihr vorschrieb. Wir lachten viel. Als Mutter uns Kamillentee offerieren wollte und mitbekam, dass wir uns mit Iwrith beschäftigten, wurde sie ungehalten.
»Gabi! Ich bin enttäuscht von dir! Du sollst mit Rafi Deutsch lernen, sonst bleibt er sitzen. Stattdessen macht ihr Unsinn. Das geht nicht!« Ima blieb im Zimmer und passte auf, dass Gabi mit mir Deutsch übte. Durch Mutters Strenge wurde meine Freundin unsicher und brachte kaum etwas heraus. Auch mir hatte Mutter die Lust verdorben, Deutsch zu lernen.
Kaum hatte sich Gabi verabschiedet, urteilte Mutter: »Eine dumme Schickse, die dich nicht weiterbringt.«
»Was heißt Schickse?«
»Eine Christin. Sie taugen alle nichts und können uns Juden nicht ausstehen.«
»Gabi ist die beste Schülerin. Sie mag mich, und sie hat mit mir gelernt, anders als Herschi und Abi.«
»Schickse bleibt Schickse!«
Ich hasste dieses Gerede. Einmal besuchte ich Gabi. Ihre Mutter war freundlich zu mir, aber ich fühlte mich nicht wohl bei den Reus. Es war alles so ordentlich. Die Fußböden rochen nach Wachs, und aus der Küche strömte ein Duft von Bratkartoffeln. Gabi wollte mich aus ihrem Lesebuch vorlesen lassen, aber da sie spürte, dass ich mich schämte herumzustottern, bat sie mich, ihr wieder Iwrith-Buchstaben zu zeigen. Ich tat es, doch bald langweilte es uns, und nach einer Weile ging ich heim.
Deutsch lernte ich am besten bei Herrn Lichtl. Auch wenn mich seine Kriegsberichte nicht mehr so fesselten wie anfangs, weil ich fühlte, dass seinen Bemerkungen über seine jüdischen Schulkameraden etwas fehlte. Herr Lichtl mochte das spüren. Er wurde reserviert, blieb aber ein toller Lehrer, der mir besser als alle anderen half, Deutsch schreiben und lesen zu lernen. Doch Lichtls Schnurrbart erinnerte mich nun nicht mehr nur an Charlie Chaplin, sondern an Adolf Hitler.
In der Klasse freundete ich mich mit Hans Schlagintweit an. Er lud mich in die große Wohnung seiner Mutter in der Adelgundenstraße ein. Hans besaß viele Spielsachen. Fast alles Kriegsspielzeug: Zinnsoldaten, Blechkanonen, Panzer und Plastikflugzeuge. Alles grau. »Feldgrau ist die Farbe der deutschen Wehrmacht«, erklärte Hans. Panzer und Flieger waren mit Eisernen Kreuzen bemalt. Das durfte ich Ima nicht erzählen.
Anders als Edwin Berg ließ mich Hans nach Herzenslust mit seinen Sachen spielen. Wir veranstalteten Schlachten. Hans besaß sogar Kanonenfürze. Man steckte diese roten Röllchen in einen Kanonenlauf und entzündete dann ihre Zündschnur. Sekunden später flog das Stück mit einem lauten Knall aus dem Geschützrohr. Wir jauchzten vor Freude. Das war ein lustiger Krieg – bei dem niemand ein Bein verlor.
Hans bedauerte, dass ich keine israelischen Soldaten besaß, »sonst könnten wir einen echten Krieg veranstalten. Ihr habt ja den berühmten General mit der Augenklappe. Dann machst du den Dajan und ich unseren Feldmarschall Rommel. Das wird eine Gaudi!«
So begann ich, mir von den fünfzig Pfennig Taschengeld, die ich wöchentlich bekam, Plastiksoldaten zu kaufen. Es waren aber nur Amerikaner, denn israelische Spielzeugsoldaten gab es keine, nicht einmal in Israel.