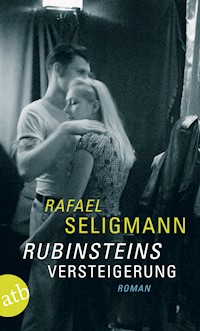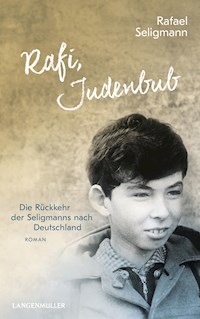19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Transit
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vorgezogene Bundestagswahl 2019. Die Konservativen um die ewige Bundeskanzlerin Hedwig Kleinert verlieren, die Freien Sozialisten ebenfalls und auch die Umweltpartei. Gewaltig zugelegt hat dank einer innovativen Wählermobilisierung die Deutsch-Nationale Mehrheits-Partei unter ihrem rechtsradikalen Führer Urban Hansen. Bei deren Siegesfeier im Ernst-Jünger-Haus in Berlin lässt Hansen alle Masken fallen; unter dem Jubel seiner Anhänger feiert er die »faschistische Revolution«. Paul Levite, der populäre jüdische Landesvorsitzende Hessens und liberales Aushängeschild der Partei, sorgt handstreichartig für den Sturz Hansens und verspricht Koalitionsverhandlungen mit allen Fraktionen, um eine nationalkonservative Politik gegen den Flüchtlingszustrom, gegen die NATO, für patriotische Gesinnung und deutsche Werte durchzusetzen. Ein neues Kapitel der deutschen Politik beginnt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Für Paula Levite (1909-1990) und ihrein der Schoah ermordeten Angehörigen
© 2017 by :TRANSIT Buchverlag
Postfach 121111 | 10605 Berlin
www.transit-verlag.de
Umschlaggestaltung, unter Verwendung
einer Abbildung © plainpicture/whatapicture –
aus der Kollektion Rauschen, und
Layout: Gudrun Fröba
Druck und Bindung: CPI Group Deutschland
ISBN 978-3-88747-347-1
eISBN 978-3-88747-350-1
Rafael Seligmann
Deutsch
MESCHUGGE
Inhalt
PROLOG
Deutsch meschugge
PROLOG
Paul Levite ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wenn man ihn sticht, blutet er, und wenn man ihn beleidigt, will er sich rächen. Wie jeder Politiker giert Levite nach Macht. Um ihretwillen ist er bereit, seine Seele zu verkaufen. Paul Levite setzt sein Judentum als Alibi der eigenen moralischen Unfehlbarkeit ein. Die Deutschen wollen ihm glauben und folgen ihm. Denn trotz der zunächst verordneten und später freiwilligen Läuterungsbemühungen in Folge des Krieges und der Schoah bleiben die Deutschen fehlbar – wie alle Völker.
Der politische Werdegang Paul Levites erzählt von der Versuchung der Macht und der Verführbarkeit der Menschen.
»DEUTSCHLAND WIRD WEITERHIN eine stabile Demokratie bleiben. Soviel vorweg. Willkommen im Ersten bei der Sondersendung zu den vorgezogenen Wahlen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Am heutigen 15. September 2019 haben die Bundesbürger über die Zusammensetzung des 20. Bundestages abgestimmt. Eine Prognose liegt bereits vor. Die Deutschen haben sich mit eindeutiger Mehrheit entschieden: Hedwig Kleinert soll wie seit nunmehr 14 Jahren weiterhin die Geschicke unseres Landes lenken. Die Bundeskanzlerin und ihre konservative Partei sowie ihre bayerische Schwesterpartei haben knapp dreißig Prozent der Wählerstimmen erhalten. Also lediglich geringe Verluste im Vergleich zur letzten Bundestagswahl vor zwei Jahren.
Gleichzeitig aber bestätigt der Urnengang den internationalen Trend zum National-Populismus. Ähnlich wie in den Vereinigten Staaten, in Frankreich, Holland, Österreich, Ungarn, Polen und vielen anderen Ländern hat sich diese politische Bewegung auch bei uns durchgesetzt. Die Deutsch-Nationale Mehrheits-Partei konnte ihren Stimmenanteil gegenüber der letzten Bundestagswahl von 9,1 auf annähernd 27 Prozent verdreifachen. Damit ist die DNMP die eigentliche Gewinnerin dieser Wahl. Die Deutschnationalen werden fortan die Opposition dominieren und die Bundesregierung von Hedwig Kleinert und ihres Freien Sozialistischen Koalitionspartners, der eine gravierende Niederlage erlitten hat, schonungslos ins Visier nehmen.
Die kommunistischen Deutschen Demokratischen Real-Sozialisten, DDR, legen deutlich auf über 15 Prozent zu. Zu den Wahlverlierern hingegen gehören die Bunten und die Liberalen… Ich höre gerade, wir schalten in die Parteizentrale der Deutschnationalen in Berlin-Hohenschönhausen.«
Auf dem Monitor im Studio erschien eine Live-Aufnahme aus dem Versammlungssaal im Ernst-Jünger-Haus. Die Kamera blieb zunächst in der Totalen. Die Anhänger schwenkten rote Fahnen, in deren Mitte auf weißem Feld ein schwarzer Reichsadler prangte. Die Bühne an der Stirnseite war vollständig mit rotem Tuch ausgekleidet. Aus dem Pulk seiner Parteigenossen löste sich ein zierlicher Mann und eilte wie ein Box-Star, umringt von vierschrötigen Ordnern, die ihm einen Weg durch die euphorische Menge bahnten, nach vorne. An der seitlichen Treppe angelangt, federte Urban Hansen die wenigen Stufen hoch, schritt rasch zum weiß drapierten Rednerpult, wo er abrupt Halt machte und mit erhobenen Armen den anschwellenden Jubel weiter anfachte. Mit einem Mal bewegte der von mehreren Scheinwerfern angestrahlte Politiker seine Hände nach unten. Die Menge verstand die herrische Geste und hielt inne. Augenblicklich wurde es still. Der Parteichef nestelte an den Mikrofonen. Dann schloss er seine Augen und atmete mehrmals durch.
»Parteigenossen und Freunde…«, Hansens Stimme war rau. Er musste sich räuspern, ehe er den Kopf reckte und »den Millionen deutschen Männern und Frauen, die sich nicht haben beirren lassen und die nicht auf die Lügen und dummdreisten Verleumdungen gehört haben, sondern mit fester Hand ihre Stimme unserer Bewegung gegeben und sie zur stärksten politischen Kraft in Deutschland gemacht haben«, dankte. Mit klarer Stimme fuhr Hansen fort: »In dieser Stunde beginnt für Deutschland eine neue Zeitrechnung. Wir werden unser Vaterland wieder deutsch machen! Deutschland gehört den Deutschen – nicht den Ausländern und schon gar nicht religiösen Radikalen, die uns die grausamen Gesetze der Scharia aufzwingen wollen. Wir werden verhindern, dass deutsche Männer und Frauen in unserer Heimat von Ausländern gesteinigt werden! Ab jetzt wird in Deutschland wieder Deutsch gesprochen und mit deutschem Anstand und deutscher Disziplin gelebt und gearbeitet. Wem das nicht passt, der soll wieder gehen, sonst entfernen wir ihn aus unserem Heimatland. Deutschland hat gesiegt! Seine Feinde haben ausgespielt! Sie sollen endlich verschwinden. Gott mit uns!«
Die Rede rief Brechreiz bei Paul Levite hervor. Ihm kamen die Worte Max Liebermanns beim Anblick der SA in den Sinn. Als der Berliner Maler die braunen Kolonnen 1933 nach der Machtübernahme der Nazis durch das Brandenburger Tor marschieren sah, rief Liebermann aus: »Ick kann gar nicht so viel fressen, wie ick kotzen möchte.«
In seinem Frankfurter Büro in der hessischen Landeszentrale der DNMP wandte sich Levite vom Fernsehschirm ab. Warum hatte er sein Schicksal mit diesem Kerl verbunden? Urban Hansen, der Möchtegern-Führer der Deutschnationalen, war ein Homunkulus, der in Nazi-Nostalgie schwelgte und auf diese Weise sein schwaches Selbstwertgefühl zu stählen trachtete. Hansens Äußeres ähnelte dem von Joseph Goebbels. Er war kleingewachsen, hatte dunkle Haare sowie ein fliehendes Kinn. Allein das Hinkebein ging ihm ab. Paul Levite überragte Hansen um Haupteslänge und wog wohl einen Zentner mehr. Soviel zu nordischer Anmutung und körperlicher Überlegenheit der Arier… Levite und Hansen hatten sich vor Jahren als Drücker für Zeitschriften in einer Werbekolonne kennengelernt. Sie verstanden sich auf Anhieb. Das Bindemittel ihres Einvernehmens war der gemeinsame Hass auf die bürgerliche Leistungsgesellschaft. Levite war Studienabbrecher, Hansen musste das Gymnasium bereits in der elften Klasse verlassen. Seither hatte er jedes Buch gelesen, dessen er habhaft werden konnte. Auf diese Weise hatte er sich ein gediegenes Halbwissen angeeignet. Da das Zeitschriftengeschäft im Internetzeitalter stetig weniger abwarf, versuchte sich Hansen als Verkäufer von Mobilfunkgeräten. Doch der »Technikkram« interessierte ihn wenig. Zudem gab er seinen Kollegen zu verstehen, dass er sie für Idioten hielt. Diese zahlten es Hansen heim, indem sie ihn körperlich bedrohten oder als »deutschen Zwerg« verhöhnten. Diese Beleidigungen der meist türkischen oder arabischen Mitarbeiter verbitterten Hansen. Statt dankbar zu sein, dass sie in Deutschland geduldet waren, dass es ihnen sogar erlaubt war, hier zu arbeiten und Sozialleistungen einzuheimsen, maßten sie sich an, ihn als Deutschen zu erniedrigen.
In der Folge suchte Hansen Schutz und Halt bei der NPD. Doch die Neonazis verlachten ihn wechselweise als »Zigeunerjungen« oder »Schrumpfgermanen«. Diese Beleidigungen gebaren bei ihm unversöhnlichen Hass. Adolf Hitler blieb Hansens Idol, doch dessen heutige Epigonen waren Schwachköpfe, die im Dritten Reich ausgemerzt worden wären – suggerierte er sich. Fortan gab sich der ungediente Hansen als Bewunderer des Weltkrieg-I-Helden Ernst Jünger. Er schloss sich einer Reihe rechtslastiger Parteien und Bewegungen an. Doch nirgends fand er eine politische Heimat oder gar Anerkennung. Die Kontakte mit rechtsextremen Gruppen, vor allem aber die Lektüre von Hitlers »Mein Kampf«, Houston Stewart Chamberlains »Grundlagen des 19. Jahrhunderts« und Alfred Rosenbergs »Der Mythus des 20. Jahrhunderts« machten Hansen zum Antisemiten. Allerdings richtete sich sein Hass gegen Moslems und Zuwanderer aus dem Orient. Also Semiten! Die ideologische Schulung durch seine Lektüre, besonders aber das Lesen mehrerer Hitler-Biografien, allen voran Joachim Fests »Hitler. Eine Karriere«, bestätigten Hansens Überzeugung, dass die heutigen Häuptlinge der Rechtsextremen nichts taugten. Die Männer waren allesamt unfähig. Sie versäumten es, blitzschnell und eiskalt eine schlagkräftige Parteiorganisation aus dem Boden zu stampfen, die die Massen im Sinne der Führung organisierte. Fatal war ihre Missachtung der Medien. Statt die Journaille für ihre Zwecke zu benutzen, beschimpften sie die schreibende Zunft pauschal als Lügenpresse. Damit mobilisierten sie alle Journalisten von »Focus« bis »taz« gegen sich.
Deutschland fehlte ein Mann, der die Geschicke der Nation in seine feste Hand nahm. Also beschloss Urban Hansen, Politiker zu werden. Er ersann den Parteinamen: »Deutsch-Nationale Mehrheits-Partei«. Das Wort »Mehrheit« hatte die Aufgabe, jedem Schwachkopf aufzuzeigen, dass Ausländer, Asylanten und Flüchtlinge hier unerwünscht waren. Dazu kam ein entsprechendes 18-Punkte-Parteiprogramm, das den Schutz der deutschen Bevölkerung vor ausländischer Überflutung, Ausbeutung und Kriminalität verhieß.
Bald entwickelte sich eine Verbindung zu der Rechtsrockband »A-Z weg!«. Hansen hatte zunächst Angst vor den kreischenden Schlägern. Doch das Selbstwertgefühl des Neopolitikers nahm durch sein Amt als Parteichef stetig zu. Als Führer zwang er sich, jedwede undeutsche Furcht zu überwinden. Hansens Schneidigkeit und seine Zielstrebigkeit wiederum imponierten der Band. Deren Songs hetzten unverhohlen gegen »Araber und Zigeuner«, A-Z. Die Symbiose zwischen Deutschnationaler Parteipropaganda und Hassrock erwies sich als Erfolgsformel. Die Masse der Frustrierten strömte in die Parteiversammlungen, dort wurde die Stimmung von »A-Z weg!« aufgepeitscht, ehe Hansen seine wohlkalkulierten Tiraden und Provokationen platzierte. Gegendemonstrationen von Bürgerrechtlern und Antifaschisten dienten den gewaltwilligen Rockern und nicht wenigen Parteigenossen als Alibi, die »Volksverräter«, »Maurenfreunde« und »Zigeunerbüttel« zu misshandeln. Die Polizei musste eingreifen. Das verschaffte den Deutschnationalen willkommene Publicity, die Hansen über Pressegespräche noch verstärkte. Die breite Medienberichterstattung, einschließlich der Nutzung sozialer Netzwerke – auch wenn diese in den Händen der jüdischen Plutokratie waren –, verstärkte den Zulauf zur neuen Bewegung.
Bei Lokalwahlen erreichten die Deutschnationalen auf Anhieb zweistellige Ergebnisse, was ihre Bekanntheit steigerte. Die Wahlerfolge beschränkten sich jedoch zunächst auf ostdeutsche Ortschaften und Kleinstädte. Um einen landesweiten Durchbruch zu erzielen, mussten die Deutschnationalen in westdeutschen Großstädten nachhaltige Erfolge erringen. Dafür waren Charismatiker nötig. Neonazi-Schläger und Heavy Metaller stießen Spießer ab. Denn die Kleinbürger in den Städten gaben sich weltoffen. Um sie für sich zu gewinnen, suchte Hansen nach einer Alibifigur. Der Parteichef spielte zunächst mit dem Gedanken an einen assimilierten Moslem – oder zumindest jemand mit einem islamischen Namen. Mehmet Scholl? Der Ex-Fußballer war deutschlandweit beliebt – außer bei Rassisten, den potenziellen Wählern der Deutschnationalen. Für sie war jeder Hinweis auf den Islam ein grünes Tuch, das sie augenblicklich zerreißen wollten. Also kein Türke! Mit Schwulen, Lesben und Behinderten war es ähnlich – selbst wenn sie Deutsche waren.
Blieb nur noch ein Jude. Hansen brauchte einen Itzig! Die überkommenen Bewertungen blieben gültig: Ausbeuter, Geizhälse, Geldsäcke, Betrüger, und nicht zuletzt Gottesmörder. Dem Antisemitismus hatte Hitler seine anfängliche Popularität zu verdanken. Nur aufgrund der Arisierungen konnten die deutschen Handwerker, Unternehmer und Kaufleute zurückbekommen, was ihnen die Juden zuvor abgegaunert hatten. Danach hatten es Himmler und Heydrich, von dem es hieß, er sei selbst ein halber Jude gewesen, allerdings übertrieben. Auch wenn es nicht sechs Millionen Juden waren, sondern erheblich weniger. Dennoch wollte kein deutscher Spießer heutzutage etwas mit dem Holocaust zu tun haben. Selbst die Nazis nicht. Da nicht nur die Rechten, sondern auch viele Bürger Angst vor den Mauren hatten, wäre ein Jude für die Deutschnationalen ein ideales Signal.
Nur wer? Welcher Jude mochte sich dafür hergeben? Der einzige Jude, den er kannte, war Paul Levite. Doch der war nicht berühmt. Er war ein Versager. Levite hatte alles probiert. Er hatte sich als Rugbyspieler, Tennislehrer, Callcenter-Verticker und was der Teufel noch versucht. Allenthalben war er gescheitert. Selbst als Drücker für Finanzmodelle. Und das als Jude!
Levite verachtete Geld, ebenso wie Urban Hansen. Jedenfalls gab er dies vor: »Der ganze Mammon kann mir gestohlen bleiben. Diese Gier ist widerwärtig. Kein Wunder, dass man allenthalben die Jidn hasst … Aber ihr Gojim seid auch nicht besser, Ihr habt den vergasten Juden die Goldzähne aus dem Kiefer gebrochen…«, hatte der Angetrunkene einst in einer Hotelbar in Winsen an der Luhe gebrüllt. Kurz darauf hatten sich ihre Wege getrennt. Levite hatte seinen Job als Zeitschriftenwerber hingeschmissen und sein Glück in Israel versucht. Auch dort war er gescheitert. »Die sind knallharte Militaristen. Machen die Arabs fertig wie eure Väter uns Juden«, tönte Levite, als er Urban Hansen zufällig in der Münchner Maximilianstraße über den Weg lief. Der Jude war noch fetter als vor einigen Jahren. Bei einem Cappuccino in der »Kulisse« vor den Kammerspielen bramarbasierte Levite von seinen neuen Plänen, eine Zeitschrift für »Soziale Vernunft« ins Leben zu rufen. Hansen ahnte, dass auch diese Gedankenblase Levites platzen würde. Der Jude konnte nicht flüssig schreiben, wie er einst aus Levites mangelhaften Arbeitsberichten ersehen hatte. Doch labern konnte der Paul wie ein Radiomoderator. Wenn er wollte, drehte er einer Oma ein Kindermagazin an und einem Halbstarken ein Seniorenjournal. Also genau das, was ein Politiker können musste – doch mehr nicht. Zudem wäre er als Jude bei den Parteigenossen verhasst und würde daher auf die Protektion seines Patrons angewiesen bleiben. Dass Paul Levite konsequent denken konnte und einen Sinn für Politik und Geschichte besaß, war Hansen nie aufgefallen.
Urban Hansen ließ also einen Termin mit Levite in Berlin vereinbaren. Er wollte ihn im »Einstein Unter den Linden« treffen. Sollten alle sehen, dass er als Führer der Deutschnationalen keine Scheu besaß, sich mit einem Juden in aller Öffentlichkeit zu zeigen. Das würde den Politisch-Korrekten, die Hansen als Neonazi verleumdeten, den Wind aus den Segeln nehmen. Doch Levite ahnte sogleich, dass Hansen ihn benutzen wollte. Er bestand auf einen diskreteren Ort. So traf man sich in der Bar des Luxushotels »Adlon« am Brandenburger Tor.
Hansen lud seinen Gast zu einem Glas Champagner ein und erkundigte sich nach dessen Situation. Levite plante, einen Clip über Arbeitslose zu drehen und das Video auf YouTube zu präsentieren. Eine neue Schnapsidee! Der Parteiführer dagegen erklärte sich bereit, dem Hebräer eine »realistische Lebensperspektive« zu vermitteln. Er bot Levite die Position als Beisitzer im Vorstand der DNMP-Berlin an. Doch statt Dankbarkeit für Urbans Vertrauen zu zeigen und dessen Angebot anzunehmen, stellte Levite sogleich maßlose Forderungen. »Du brauchst mich als deinen Musterjuden, Urbanchen. Ich soll deine Bewegung vom Modergeruch des Nazismus befreien. Für dieses Koschermachen verlange ich mindestens ein Bundestagsmandat, mein Freund.«
Diese Respektlosigkeit empörte Hansen. Doch da Levite für ihn momentan unersetzbar war, schien es Hansen taktisch vernünftig, sich mit dem Juden zum Wohl der Bewegung zu einigen. Als dieser allerdings die größenwahnsinnige Forderung nach dem stellvertretenden Bundesvorsitz erhob, wurde es dem Parteiführer zu bunt: Ein Jud durfte nicht seinen Rudolf Hess geben! Auch die verbesserte Offerte des Chefs, ihn zum Kassenwart der Berliner zu machen, wo er am besten sichtbar wäre, schlug Levite aus: »Ich hasse Zahlen! Einerlei, ob eine Rune darübersteht oder ein Davidstern. Und wenn etwas nicht stimmt, habt Ihr einen jüdischen Sündenbock! Nein, mein Lieber! Such dir einen Anderen. Du wirst schon deinen Hjalmar Schacht finden, der dich mit seinen Mefo-Wechseln zur Machtübernahme aufrüstet. Heute sind’s wohl Hedgefonds oder ähnliche Gaunereien!«
Hansen wollte den Schacherer unter keinen Umständen in der Führung des Reichsvorstands dulden. Levite aber war von seiner Forderung nicht abzubringen. Am liebsten hätte ihn Hansen vernichten lassen wie der Führer es 1934 mit Ernst Röhm gemacht hatte. Doch momentan benötigte er den Juden ebenso wie Hitler 1932 den schwulen SA-Kommandeur. Durch diese Reminiszenz mental gestählt, kam Hansen Levite entgegen. Dessen ursprüngliche Forderung, ihm ein Bundestagsmandat zu überlassen, war bei genauerer Überlegung im Interesse der Deutschnationalen. Auf diese Weise würde das jüdische Feigenblatt der Bewegung allenthalben sichtbar. Genial! Das Bewusstsein seiner geistigen Überlegenheit erlaubte es Hansen endlich, Levite einen Reichstagssitz zuzusagen. Doch statt sich damit zu bescheiden, fühlte sich der ermuntert, auf der Leitung Nordrhein-Westfalens zu bestehen. Dem Juden den größten Gau der Bewegung zu überlassen, war für Hansen ausgeschlossen. Das hätte die Partei nicht geduldet. Da Hansen das Gefeilsche aber nicht länger aushielt, unterbreitete er Levite ein »letztes Angebot«: Hessen. Levite kam aus der jüdischen Bankenstadt. Mochte sich der Semit mit den ungestümen Kerlen seiner Bewegung inmitten der roten Geldcity Frankfurt herumschlagen.
Levite spürte, dass Hansen lieber auf seine Hilfsdienste verzichten würde, als ihm weiter nachzugeben. Die Offerte verhieß die Aussicht, vier Jahre ein regelmäßiges Einkommen als Bundestagsabgeordneter zu beziehen plus freier Fahrt zu Lande und in der Luft – falls der Auftrieb der Neonazis anhielt. Daher stimmte er dem miesen Angebot des Möchtegern-Führers schließlich mit der Formel »Masl tov!« zu und schlug dabei mit seiner feisten Hand Hansen dermaßen kräftig auf dessen schmächtigen Rücken, dass dieser husten musste.
ANDERS ALS HANSEN erwartet hatte, kam Levite in der hessischen Schlangengrube nach einer kurzen Anlaufphase immer besser zurecht. Er erteilte den Parteigenossen klare Befehle, ohne sich auf Diskussionen einzulassen. Levites bestimmtes Auftreten imponierte den autoritären Männern ebenso wie dessen betonte Körperlichkeit. Dass der Politnovize sich zu herrenmenschlichen Allüren zwingen musste, ihn die widerspruchslose Gefolgschaft abstieß, aber zugleich seine Arbeit erleichterte, ahnte niemand. Die Parteigenossen vergaßen im Alltag bald, dass Levite Jude war – obgleich der Name sie ständig hätte warnen müssen – und parierten ihrem Gauleiter widerspruchslos. Hansen zeigte sich gegenüber seinem Untergebenen – er zögerte, das Wort »Führer« bei einem Juden zu gebrauchen – äußerlich zuvorkommend. Das war nötig, denn bei innerparteilichen Treffen nannten die ungeschliffenen Parteigenossen aus dem Osten Levite gelegentlich Itzig oder beschimpften ihn gar als Saujuden. Einmal wurde es Levite zu dumm. Er schlug dem Maulhelden mit der Faust mitten ins Gesicht. Das verschaffte ihm Respekt. In der Öffentlichkeit dagegen gab sich Levite konziliant und förderte das Interesse der Presse nach dem Muster seines Chefs bei jeder Gelegenheit. Er ließ sich selbst durch Anwürfe wie »Kapo« oder »Nazi-Jude« nicht provozieren, sondern benutzte die Beschimpfungen als Gelegenheit zur eigenen Attacke und bezeichnete sich selbst als »unerschrockenen deutsch-jüdischen Patrioten«, dem »das Wohl des Vaterlandes über allem steht«, selbst über die »Verleumdungen von Kommunisten, deutschen Masochisten und Kollaborateuren der Islamisten«. Levites Propaganda verfing bei den potenziellen DNMP-Wählern. Ein Deutschnationaler brachte dessen Wirkung auf folgende Erfolgsformel: »Wenn selbst ein Jude uns Vaterlandsliebe predigt, dann haben wir sie bitter nötig.«
Anders als im von Levite befriedeten Hessen stritten sich die Parteigenossen in Nordrhein-Westfalen fortwährend. Neonazis, Antikapitalisten und Anarchisten bekämpften sich unversöhnlich. Manche nutzten gar Stichwaffen in internen Auseinandersetzungen. Hansen versuchte als Führer der Bewegung zumindest in der Öffentlichkeit das Bild von Geschlossenheit aufrecht zu erhalten. Er drohte, er belobigte, er kehrte den Streit unter den Teppich. Als der Zank die Glaubwürdigkeit und damit die Existenz seines rheinisch-westfälischen Partei-Gaus massiv gefährdete, wollte Hansen den Landesverband auflösen und eine neue Führung installieren. Hätte er doch damals Levite mit der Leitung dieses Chaotenhaufens betraut! Doch schließlich wurden die Parteigenossen vom Zwang des Faktischen zur scheinbaren Einigkeit gezwungen. Es galt, den Wahlkampf zu organisieren.
ZUNÄCHST HERRSCHTE BEI den etablierten Parteien Erleichterung, dass man die Populisten auf den zweiten Platz verwiesen hatte. Bei den Konservativen kam sogar gedämpfte Jubelstimmung über ihren knappen Sieg auf. Doch diese Freude wich rasch, als das Ausmaß der Verluste der Freien Sozialisten deutlich wurde. Das bedeutete das unweigerliche Ende der Großen Koalition. Verzweiflung kam auf, als die Wahlanalysten nachwiesen, dass die Deutschnationalen mit Ausnahme Nordrhein-Westfalens und Bayerns im übrigen Deutschland die dominierende politische Kraft geworden waren.
Urban Hansen dagegen sah sich dadurch in seinem Anspruch bestätigt. Er klammerte sich an das weiße Rednerpult. Hansen labte sich am Beifall, ehe er in die Mikrofone rief: »Deutsche! Männer und Frauen, seit einem Jahr habe ich unentwegt gepredigt, dass unsere Deutsch-Nationale Mehrheits-Partei die Wahlen gewinnen wird. Ich sagte: ›Wir werden die stärkste politische Bewegung Deutschlands‹. Ich bin dafür verlacht worden. Noch heute, als ich nach Wahlschluss, als alles bereits entschieden war, wieder festgestellt habe: Die DNMP hat gesiegt! Wir haben die Wahlen gewonnen! – da hat man mich nicht ernst genommen. Erst jetzt, nachdem hundertprozentig und unerschütterlich feststeht, dass wir die Sieger sind, beginnen die Systemparteien zu begreifen: Ja, es könnte so sein, dass die DNMP ein wenig zugelegt hat.« Hansen zwang sich zu einer Kunstpause, ehe er brüllend fortfuhr: »Nein, Frau Kleinert! Nein, meine Herrschaften! Wir Deutschnationalen haben…«, er senkte seine Tonlage, »… nicht ein wenig zugelegt…«, Hansen schrie auf, »Nein! Wir haben die Wahl klar gewonnen! Und daher erhebe ich als Vorsitzender der Partei, als Führer unserer politischen Bewegung, den Anspruch, unverzüglich mit der Führung der Staatsgeschäfte betraut zu werden!«
Der frenetische Beifall stachelte den Redner an. Er wippte auf und ab, als er seine Ansprache laut, doch klar artikulierend fortsetzte: »Die Zeit des Hinhaltens ist vorbei! Jetzt bleibt den sogenannten Demokraten nur noch übrig, uns die Macht zu übertragen und nach Hause zu gehen. Wehe ihnen, wenn sie versuchen, die Stimme des deutschen Volkes zu missachten und sich uns entgegenzustellen. Wer das probiert, den machen wir unschädlich. Den löschen wir aus. Ein für alle Mal!«
Die Worte des Parteiführers wurden mit donnerndem Applaus belohnt. Viele Feiernde ignorierten die Aufforderung des Parteiordnungsdienstes, nicht »Heil!« zu rufen. Sie brüllten dennoch den altbekannten Gruß, manche wichen auf »Salve!« aus. Danach stimmte das Publikum geschlossen die erste Strophe des Deutschlandlieds an: »Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt«. Andere rissen den rechten Arm hoch und kreischten die Parole »Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt!«
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten beendeten daraufhin die Übertragung aus dem Ernst-Jünger-Haus. Die meisten privaten Stationen dagegen blieben auf Sendung, um die neonazistischen Ausbrüche festzuhalten. »Denn es ist unsere Pflicht als Sender, Sie, liebe Zuschauer, nicht im Unklaren über das Geschehen zu lassen«, betonte der Reporter eines privaten TV-Nachrichtenkanals. Der Chefredakteur einer staatlichen Station hingegen reagierte empört angesichts der »skrupellosen Quotenhörigkeit der privaten Kommerzkanäle, die für ein paar Prozent Zuschaueranteil bereit sind, die Republik an die Nazis zu verschachern.« Die öffentlich-rechtlichen Sender hatten als Gegenwaffe die altbewährten Diskussionsrunden. Hierzu aber ließen sie Hansen wegen der »erneut sichtbar gewordenen rechtsradikalen und menschenverachtenden Tendenzen seiner Partei« nicht zu.
PAUL LEVITES VORAUSSICHT hatte ihn davor bewahrt, zur Siegesfeier der Partei nach Berlin zu reisen. Denn dass die Deutschnationalen ein famoses Ergebnis bei den Wahlen erringen würden, stand für ihn seit Anbeginn seines Engagements fest. Er hatte sich auf die Nazibande nur eingelassen, »um das Schlimmste zu verhindern!« Das gab er zumindest gegenüber seiner Mischpoche vor, was seine deutsche Mutter erst recht aufbrachte. Sein jüdischer Vater Herschl war bereits vor der politischen Karriere seines Sohnes verstorben.
PAUL LEVITE MACHTE sich nichts vor. Er kannte Hansen gut genug, um zu ahnen, dass der labile Goj sich im Moment des Triumphs von seinen Gefühlen und Sehnsüchten überwältigen – und die Gebote der Vernunft unbeachtet lassen würde. Dass der Parteiführer allerdings so meschugge sein würde, die Wahlparty in eine Nazi-Show ausarten zu lassen, war selbst dem Skeptiker Levite nicht in den Sinn gekommen. Auf diese Weise beraubte sich der Idiot aller Chancen, sich an einer Koalitionsregierung zu beteiligen. Denn mit unverstellten Nazis konnte und wollte kein Politiker mit einem Funken Verstand paktieren. Deutschland würde augenblicklich als Wiedergeburt des Dritten Reiches abgestempelt werden und zum internationalen Paria degenerieren. Deutsche Exportgüter würden zur Nazi-Konterbande geraten. Das Qualitätssiegel »Made in Germany« würde mit einer braunen Schlinge und dem Siegel »Zyklon B« versehen werden. Niemand mehr würde deutsche Produkte importieren. Die Moslems wiederum würden durch den Antiislamismus von Hansens DNMP vor den Kopf gestoßen werden. Alle Exportnationen würden sich als Antifaschisten aufspielen, um die Geschäfte zu tätigen, die bis dahin die Deutschen gemacht hatten, und so ihre minderwertigen Maschinen doch noch verhökern. Noch schlimmer wäre es an den Geldmärkten: Die jüdischen Banken an der Wall Street und in der Londoner City von Goldman Sachs bis Rothschild würden deutsche Unternehmensanteile abstoßen wie syrische Aktien…
Levite erschrak über seine Gedanken. Ich räsoniere wie ein Antisemit! Kack auf den Tinnef! Der Politiker verbot sich die Abschweifung und zwang sich zurück in die Wirklichkeit. Die Folgen des Auftritts von Dumm-Hansen und seiner hirnlosen Nazigefolgsleute standen für ihn fest: Die Deutschnationalen schenkten den übrigen Parteien ein Alibi für eine bunte Not-Koalition von den Realsozialisten hin zu den Bayerischen Konservativen. Abgesehen von einigen kosmetischen Kinkerlitzchen würde alles beim Alten bleiben, Kleinert Kanzlerin, Freie Sozialisten, Realsozialisten und eventuell Umweltler als ohnmächtige Juniorpartner. Die Bundesregierung würde sich durchwursteln wie eh und je. Die Kanzlerin wäre weiterhin bereit, jede beliebige Position überzeugend zu vertreten. Hauptsache, sie saß am Steuer und übertrumpfte damit die Kanzlerschaft Helmut Kohls – zumindest an Regierungszeit.
Die meisten Beobachter waren sich einig, dass weitere vier Jahre Kleinert eine Zementierung des gesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen und politischen Stillstandes bedeuteten. Paul Levite verstand, dass diese Einschätzung ungenügend war. Eine paralysierende Regierungspolitik würde nicht zum Stillstand, sondern zu zunehmenden sozialen Unruhen führen. Davon aber würden nicht die Deutschnationalen profitieren, wie Hansen und seine Kamarilla glaubten. Der Parteiführer mochte ein geschickter Aufwiegler sein, doch als Oppositionschef wäre der Chaot überfordert. Zudem ermangelte es Hansen an jeglichem organisatorischen Talent – die Voraussetzung zur straffen Führung einer jeden Partei. Da hatte ihm Adolf einiges voraus, gestand sich Levite ein. Auch Hitler war ein unsystematischer Möchtegern-Bohemien, doch er verstand es, Furcht und Schrecken unter den Nazis zu verbreiten. Und er besaß in Martin Bormann einen begabten Administrator, der ihm blind ergeben war.
Vor Hansen dagegen hatte niemand Angst, und er war unfähig, die Führung der Verwaltung einem Profi zu überlassen, weil er niemandem traute. Die Folge war, dass bei den Deutschnationalen jeder tat, was ihm beliebte. Die Kämpfe zwischen Chaoten und Nazis in Nordrhein-Westfalen waren in Levites Augen nur ein Vorspiel für das, was der ganzen Partei in der Opposition bevorstand. Man würde sich gegenseitig zerfleischen, während die Regierung mit sozialen Wohltaten das Kleinbürgertum bestach. In dieser Situation würde es nicht lange dauern, bis die Unzufriedenen innerhalb und außerhalb der DNMP eine andere, noch radikalere Gestalt als Hansen zu ihrem neuen Führer küren würden. Der Oberbayer Otto Schlögel und der Sachse Maik Nützel versuchten sich bereits als Neu-Adolfs zu profilieren. Dann hätte Levite als Vorzeigejude ausgedient.
Man musste sich jetzt an der Regierung beteiligen oder der ganze Kessel voller Narren würde bersten, war Levite überzeugt. Hansen hatte sich heute Abend disqualifiziert. Der Einzige, dem Levite zutraute, die Bewegung intakt zu halten und zu vermarkten, war er selbst. In Hessen hatte er bewiesen, dass er es verstand, seine Horde zu zähmen und sie zu einer schlagkräftigen Truppe zu formen. Er war der geborene Anführer. Doch noch stand Hansen über ihm. Daher musste er den Versager zum Wohl der Partei und der eigenen Karriere opfern. Aber wie? Ausgerechnet ihm war es unmöglich, als heilandsmeuchelnder Judas aufzutreten.
Die Zusammensetzung der Elefantenrunde und anderer Polit-Talk-Formate ohne Beteiligung der neonazistischen DNMP bestätigte Levites Einschätzung, dass Hansens Zeit abgelaufen war. Der hirnlose Goj musste weg, sonst riss er die ganze Bewegung mit sich in den Abgrund.
RALPH BRÖKER HATTE das Desaster kommen sehen. Der Leiter der Abteilung Wähleranalyse und Wahlkampfstrategie der Konservativen wertete mit seinen Mitarbeitern und einem Meinungsforschungsinstitut seit Jahren systematisch die Entwicklung der politischen Einstellung der Bevölkerung aus. An dem drastischen Vertrauensschwund in die etablierten Parteien bei gleichzeitig steigendem Zuspruch für die Radikalen konnte es spätestens seit der Flüchtlingswelle 2015 keinen Zweifel geben. Bröker hatte alle Entscheidungsträger der Konservativen eindringlich gewarnt: den Bundesgeschäftsführer, den Generalsekretär, den Leiter des Kanzleramts. Endlich durfte Bröker der Kanzlerin persönlich vortragen.
Er riet Frau Kleinert nachdrücklich zu einer Revision ihrer Wahlkampfstrategie: »Die politische Mitte existiert nicht mehr, Frau Bundeskanzlerin. Stattdessen haben wir eine mit 1932 vergleichbare Situation. Damals sind die Parteien der politischen Mitte ebenfalls reihenweise eingegangen… « Daraufhin fragte Kleinert mit ruhiger Stimme, was er sich als Alternative zu ihrem »Kurs der Vernunft« vorstelle.
Die direkte Ansprache durch die allmächtige Partei- und Regierungschefin ängstigte den Soziologen. Dennoch versuchte Bröker, sachlich zu argumentieren. »Wir müssen klar Kante zeigen. Unsere christlich-konservativen Werte hervorheben und die Populisten direkt angreifen.« Die Kanzlerin schüttelte den Kopf: »Wir gehen niemanden an. Damit machen wir nur Propaganda für die Rechten.« Die Konservativen seien eine Partei der Mitte, also der Vernunft. Mit dieser Strategie habe sie vier Bundestagswahlen gewonnen. »Und jetzt hole ich die fünfte.«
Damit war die Debatte beendet. Das Präsidium der Konservativen billigte anderntags einstimmig den Beschluss des Parteivorstandes, die Kampagne mit dem Wahlkampfmotto »Unsere Kanzlerin. Die Gewähr für Wohlstand und Sicherheit« zu starten.
Alle diskret unternommenen Umfragen bestätigten indessen, dass die Parole nicht verfing. Die Bevölkerung hatte angesichts steigender Arbeitslosenzahlen bei gleichzeitig fallenden Aktienkursen und einer stetigen Entwertung des Euro den Glauben an die Befähigung Hedwig Kleinerts eingebüßt. Diesen Wutbürgern mit Appellen zum »Weiter-So mit der Kanzlerin« zu kommen, war aussichtslos. Auf diese Weise überließ man den Deutschnationalen das Monopol auf das wachsende Lager der Verängstigten und Unzufriedenen. Gegen die Hetze Hansens und seiner Spießgesellen war mit einem »Kurs der Vernunft« und der Beschwichtigung nichts zu holen. Eine entschlossene Konfrontation, Strafverfahren wegen Volksverhetzung und ein Verbotsantrag wegen Verfassungsfeindlichkeit, wäre das einzige Mittel, die wahren Intentionen der Weißen aufzudecken.
Aufmerksam beobachtete Bröker, wie die anderen demokratischen Parteien sich verzweifelt abmühten, die Deutschnationale Welle zu brechen. Die Bunten setzten verstärkt auf Wähler mit islamischen Wurzeln. So forderten sie unter anderem, dass die Schulspeisen Halal-Vorschriften genügen sollten, ebenso das Essen in den Zügen der Bahn. Eine Initiative zur Verankerung der islamischen Feiertage wurde von den Gewerkschaften einhellig begrüßt, stieß jedoch bei den Arbeitgebern auf vehemente Ablehnung. Das Ansinnen nach einer Trennung von Mädchen und Buben beim Schwimmunterricht und der Abschaffung von Sportstunden für Mädchen wurde von feministischen Verbänden und Zeitschriften als reaktionäre Macho-Maßnahme harsch bekämpft. Als eine frühere Parteichefin, die für ihre Emotionalität bekannt war, obendrein die Übernahme der Scharia als eine Rechtsquelle in die Diskussion warf, stürzten die Umfragewerte der Bunten. Dieser Trend ließ sich nicht umkehren, selbst als die Politikerin auf innerparteilichen Druck hin erklärte, sie beziehe sich lediglich auf die humanistischen Vorschriften der Scharia, wie die Pflicht zur Sorge für die Armen und das Gebot der Barmherzigkeit.
Die größte Sorge bereitete Bröker die Entwicklung der Freien Sozialisten. Der permanente Niedergang der FS schien sich in sein Gegenteil zu verkehren, als der langjährige Duisburger Bürgermeister Henryk Szymaniak 2017 überraschend an die Spitze der Freien Sozialisten trat. Der national wenig bekannte Politiker küsste die schlafende Partei wach. Seit an Seit schritten die Genossen auf der Beliebtheitsskala rasch nach oben. Szymaniak verkündete, er wolle Kanzler werden. Das beflügelte die Zuversicht der FS. Doch noch vor der Bundestagswahl wurde zunehmend deutlich, dass ein einzelner Mann an der Mammutaufgabe scheitern musste, eine vergreiste Partei im Schnelldurchgang zu verjüngen. Alle Fehler wurden dem biederen Szymaniak in die Schuhe geschoben. Das machte ihn zunehmend unsicher. Er verlor seine Strahlkraft und die Partei blieb unter dem Ergebnis der letzten Bundestagswahlen.
Danach wurde Sozialministerin Petra Kubier Parteivorsitzende. Erstmals stand den FS eine Frau vor. Das, sowie die Führungskraft der Chefin, stabilisierte eine Weile die ehemalige Arbeiterpartei. Doch die Prognosen sowie die Ergebnisse der letzten Landtags- und Kommunalwahlen ließen keinen Zweifel an einem erneuten Fall der Partei. Die Freien Sozialisten rutschten unter 15 Prozent.
Kubier sah sich gezwungen, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, um rasch die Imagekrise der Freien Sozialisten zu beheben. Sie entschied sich für Professor Neumarck. Der Politologe hatte eine eingängige Erklärung für den Abstieg der Freien Sozialisten. Die FS hätten ein altbackenes Image, weil es ihnen nicht gelungen sei, die Anmutung einer Arbeiterpartei abzulegen, obgleich sich mittlerweile lediglich ein Zehntel der Beschäftigten als Arbeiter begriffen. »Wir sind eine Bildungs-, Verwaltungs- und Rentnergesellschaft. Die diffuse Mitte ist von den Konservativen besetzt, die gebildeten Grauschöpfe wählen bunt. Das größte Potential stellt heute das patriotische Bürgertum dar.« Dies erkläre die Erfolge der Deutschnationalen. »Wenn es uns gelingt, die bewährte soziale Kompetenz der Freien Sozialisten mit der Liebe zu Deutschland zu verbinden, sind wir unschlagbar!«, erläuterte der Professor. Neumarck empfahl nachdrücklich ein Ende der Koalition und Neuwahlen. »Der Rücktritt der FS-Bundesminister von ihren Regierungsämtern ist eine für jedermann sichtbare Demonstration, dass wir es ernst meinen. Denn wer sich im Kabinett der Kanzlerin unterwirft, ist als Konkurrent um die Macht unglaubwürdig.« Die Parteichefin folgte dem Ratschlag.
Hedwig Kleinert akzeptierte den Rücktritt der Freisozialistischen Minister. Die Bundeskanzlerin bat die FS-Kollegen jedoch, bis zu den von ihnen geforderten Neuwahlen im Amt zu bleiben. Die Genossen folgten dem Appell an ihr Pflichtgefühl. Damit tappten sie in eine Falle Kleinerts. Fortan denunzierten die Konservativen den patriotischen Dienst der FS-Minister als Beweis ihrer Unglaubwürdigkeit. Während die Kanzlerin den Wahlkampfslogan der Freien Sozialisten »Deutsch und gerecht« als Anbiederung an die Deutschnationalen verleumdete.
DAS MISERABLE WAHLRESULTAT der Freien Sozialisten empfand Kubier als Ergebnis der rufschädigenden Kampagne des bisherigen Koalitionspartners. Die Forderung des linken Flügels nach ihrem sofortigen Rücktritt traf die Parteichefin hart.
Bei der Elefantenrunde in ARD und ZDF ließ sich Kubier von Generalsekretär Omar Abdali vertreten. Er schloss sich der Feststellung der Bundeskanzlerin an: »In dieser kritischen Situation kommt es darauf an, Ruhe und Stabilität zu bewahren. Alle demokratischen Parteien müssen zusammenstehen. Alle!« Hedwig Kleinert erklärte, sie sei bereit, mit gutem Beispiel voranzugehen und sich erneut in die Pflicht nehmen zu lassen, um Deutschland aus der Krise zu führen.
Dagegen forderte Nadja Hauser, die Vorsitzende der Deutschen Demokratischen Real-Sozialisten, DDR, Konsequenzen. Ein Weiter-so dürfe es nicht geben. Ihre gestärkte Partei war für die Regierungsbildung nunmehr unverzichtbar. Eine Kostprobe ihrer neuen Machtstellung war die Forderung Hausers, die Voraussetzung für eine Mitarbeit ihrer Partei bei der Bewältigung der Staatskrise sei die ausdrückliche Bereitschaft der Bundeskanzlerin zu einer gesellschaftlichen Wende. Das lehnte Kleinert rundweg ab.
Die Kanzlerin warf Hauser vor, den fatalen Fehler der Kommunisten in der Endphase der Weimarer Republik zu wiederholen: Die Demokraten zu unterminieren und auf diese Weise die Nazis zu stärken. Hauser nannte dies »Geschichtsklitterung«. Die DDR-Vorsitzende forderte nun als Bedingung für Gespräche über die Duldung einer Minderheitsregierung der »Kleinen Koalition der Verlierer« eine verpflichtende Erklärung der Kanzlerin, in Zukunft eine Politik zugunsten der gesellschaftlich Schwachen, »also für Frauen, sexuelle Minderheiten und Friedensaktivisten« zu gestalten.
»Wenn Sie glauben, mit Ihren zehn Prozent …« »15, Frau Kleinert. Sie werden den Unterschied zu spüren bekommen!« Die Kanzlerin fuhr ungerührt fort: »… den übrigen 85 Prozent der Wähler und unseren demokratischen Parteien Ihre unrealistische Politik aufzwingen zu können, liegen Sie falsch, Frau Hauser. Entweder Sie koalieren mit uns oder Sie werden erneut mit den Faschisten zusammenarbeiten wie einst Stalin mit Hitler. Mit den gleichen Folgen.«
Hauser verwahrte sich gegen diese Unterstellung: »Die Deutschen Demokratischen Real-Sozialisten treten für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit ein. Wir sind bereit, mit allen zu koalieren, die diese Werte anerkennen.«
Die Kanzlerin begriff, Hauser wollte damit publik machen, dass ihr alle Optionen offen waren. Linken und Populisten fehlten nur eine Handvoll Abgeordnete zur absoluten Mehrheit. Wenn es ihnen gelang, einige Unzufriedene oder Spinner einzufangen, dann konnten sie einen Kanzler nach ihrem Belieben wählen.
DIE SIEGESREDE URBAN Hansens hatte Paul Levite zunächst bewogen, sich an diesem Abend nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Als sein Zorn abgeklungen war, gewann er seine Denkfähigkeit zurück. Trotz ihres Wahlerfolgs hatte die DNMP nur einen Schuss im Lauf. Sie musste jetzt die Regierung übernehmen, koste es, was es wolle – und sei es die Hälfte der Ministerämter. Hauptsache, man eroberte die Regierungsspitze. Das hatte der Nazi Hitler einst verstanden, als er Papen plus den deutschnationalen Idioten fast alle Ministerien überließ, um Reichskanzler zu werden. Hitler nutzte sein Amt zur Gleichschaltung aller politischen Gruppen und damit zur totalen Machtübernahme. Hansen dagegen gefiel es, alle vor den Kopf zu stoßen. Jetzt oder nie! Die Chuzpe der DDRlerin Hauser im TV bewies Levite, die Kommis hatten verstanden, dass nun der richtige Augenblick war, die Demokraten kaputt zu machen. Nur jetzt!
Paul Levite war versessen aufs Gewinnen, seit er denken konnte. Dennoch hatte er immer verloren. Die Weißen boten Levite eine einzigartige Chance. Und ausgerechnet jetzt blockierte Hansens Dummheit sein Masl.
Wenn Levite im Moment des Siegestaumels der Bewegung einen Putsch inszenierte, würden die Nazis ihn als jüdischen Verräter ans Kreuz schlagen. Den Niedergang seiner Partei durfte er dennoch nicht hinnehmen. Zumindest musste er in der Öffentlichkeit seinen Anteil am Sieg reklamieren. Dazu war er durch das hervorragende Abschneiden der Bewegung in Hessen legitimiert. Doch er fühlte sich auf seinem Weg blockiert. Durch seine Erziehung? Aufgrund der jüdischen Ethik, die Würde der Mitmenschen ebenso wie die eigene zu achten? Unsinn! Er hatte sich auf den Pakt mit dem Teufel eingelassen. Nun musste er die Höllenhitze aushalten! Paul Levite kam ein Vers aus Heinrich Heines Gedicht »Guter Rat« in den Sinn:
Lass dein Grämen und dein Schämen!
Werbe keck und fordre laut,
Und man wird sich dir bequemen,
Und du führest heim die Braut.
Nur wenn er laut forderte, gehörte ihm die deutsche Braut. Er lebte freiwillig in Hitlerland. Heine hatte in jungen Jahren dem Glauben der Väter abgeschworen und sich evangelisch taufen lassen, um das Entréebillet zur europäischen Gesellschaft zu erlangen. Vergeblich: In den Augen der Gojim war er ein Jud geblieben – und er selbst hatte nie aufgehört, sich als Jud zu fühlen. Paul Levite riss sich aus seinen Grübeleien. Jetzt galt es, keck für seine Person zu werben.
DER KLEINE VERSAMMLUNGSSAAL in der Frankfurter Parteizentrale in Bornheim war überfüllt. Die Parteigenossen waren von ihrem Sieg, von Bier und Schnaps berauscht. Levite tankte sich durch die Menge zum Landesgeschäftsführer und wies ihn an, einen Dauertusch erklingen zu lassen. Die Verstärkeranlage produzierte zunächst schrille Rückkopplungstöne, die selbst den Betrunkenen ins Mark fuhren. Levite wuchtete seine hundert Kilo auf die kleine Bühne. Er ergriff das Mikro und befahl, den »Dünnpfiff fix abzudrehen. Wir sind hier im siebten Himmel der Siegesfeier, nicht im Abgrund der totalen Niederlage – wie bei den Konservativen und den Freien Sozialisten.« Die kurze Stille nach Levites Satz wurde durch Jubel abgelöst.
Der Redner dankte den Wählerinnen und Wählern für ihre Zivilcourage, eine Partei gewählt zu haben, die von ihren Konkurrenten als »nazistisch oder faschistisch oder sonst was Teuflisches verunglimpft wird. Nichts ist falscher! Wir haben nur ein Ziel: Die Deutschen sollen in ihrer Heimat sicher sein und sich sicher fühlen. Sie sollen einen sicheren Arbeitsplatz haben und dafür ordentlich bezahlt werden. Wir sind nicht fremdenfeindlich! Wir bedrohen niemanden. Die Deutsch-Nationale Mehrheits-Partei will mit allen Nachbarn in Frieden leben. Dass die Wähler unsere friedlichen Ziele verstanden haben und teilen, ist vor allem euer Verdienst! Ihr als Wahlhelfer habt die Bürger überzeugt, dass an den Vorwürfen des Rassismus, der Fremdenfeindlichkeit und des aggressiven Nationalismus gegen die DNMP nichts, aber auch gar nichts dran ist. Wir sind Demokraten. Deshalb sind wir jederzeit bereit, mit allen anderen demokratischen Parteien und Kräften zum Wohle Deutschlands zusammen zu arbeiten…«
Levite spürte Verzagtheit bei seinen letzten Worten. Er hob die Stimme: »Vor allem eurem ehrlichen, unermüdlichen Einsatz ist es zu verdanken, dass die DNMP von null auf hundert geklettert ist. Dass sie den größten Wahlsieg einer Partei in der deutschen Geschichte hingelegt hat. Dass unsere Partei in Hessen unbestritten an erster Stelle steht, ist allein eurem Tun geschuldet!« Levite steigerte seinen Bariton zum Gebrüll. »Danke, Freunde! Danke! Am liebsten würde ich jeden von euch umarmen…« Seine letzten Worte gingen im Beifall unter. Levite sprang von der Bühne, breitete seine Arme aus und begann zur Begeisterung seiner Anhänger die nahe Stehenden zu umschlingen, wobei er sich vor allem an schöne Frauenzimmer hielt.
BEWUSST STELLTE SICH Levite in Gegensatz zu Hansen. Der Parteichef hatte alle Brücken zu den Systemparteien verbrannt. Levite dagegen betonte den demokratischen Charakter seiner populistischen Gruppierung und ihre Bereitschaft, auf die übrigen demokratischen Kräfte zuzugehen.
Sollte sich der Obernazi die Platze ärgern! Levite wollte die anwesenden Journalisten, vor allem die TV-Fritzen, dazu bewegen, seine Worte zu registrieren und weiter zu geben. Tatsächlich drang ein Fernseh-Team zu ihm durch. Der sichtlich aufgeregte Reporter sprach Levite darauf an, sein Hinweis, die DNMP sei eine demokratische Partei und bereit, mit allen anderen Demokraten zusammen zu arbeiten, widerspreche diametral der Aussage seines Vorsitzenden, der verkündet hatte, alle Gegner der Deutschnationalen zu vernichten. Levite zwang sich zu einem vollen Lachen. Das verschaffte ihm einen Moment Bedenkzeit. Werbe keck und fordre laut!
»Wir wollen niemanden auslöschen.«
»Aber Ihr Parteiführer hat dies wortwörtlich gefordert. Und einige Parteigenossen haben Sieg Heil gerufen.«
»Idioten.«
»Meinen Sie damit Ihren Parteiführer Hansen?«
»Hansen hat nicht Heil Hitler gerufen… Ob er ein Idiot ist, muss jeder für sich selbst beantworten.«
Levite konnte seine Worte nicht mehr einfangen. Sich für seine Aussage zu entschuldigen, wäre umsonst. Hansen würde dennoch seinen Parteiausschluss verlangen. Na und?
Der Reporter war von Levites Worten konsterniert. Derweil strömten Kollegen herbei und bildeten einen Kreis um den Politiker und den Journalisten, der nach einer Schrecksekunde seine Sprache wiederfand.
»Herr Levite, habe ich Sie recht verstanden? Behaupten Sie, dass Ihr Parteiführer…«
»Lassen Sie den ›Führer‹ ruhen!«, wies ihn Levite an.
»Einige Ihrer Parteigenossen wollen ihn nicht ruhen lassen.«
»Einige Reporter erzählen auch Unsinn! Urban Hansen ist Parteivorsitzender. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Führer ist er nicht. Das kann er nicht.«
»Ist er ein Idiot?«
»Nochmal: Darauf muss jeder selbst eine Antwort finden.«
»Und was denken Sie über Ihren Füh…« Levite hob mahnend seinen Finger, »… über Ihren Parteichef?«
»Urban ist ein Mann mit Talenten… Jetzt muss er Farbe bekennen. Das darf nur Schwarz-Rot-Gold sein – nicht schwarz-weiß-rot und schon gar nicht braun.« Angriff ist die beste Verteidigung, zumal, wenn der Rückzug abgeschnitten ist. »Hansens Bemerkung, die Feinde unschädlich zu machen, war unklug.«
»War sie idiotisch?«
»Sie war nicht zielführend. Denn unser Ziel als DNMP ist, Deutschland gemeinsam mit anderen Demokraten zum Wohl aller Bürger zu regieren.«
»Unter der Führung Urban Hansens?«
»Ich habe Ihnen bereits erklärt, die Zeit des Führers ist unwiederbringlich vorbei!«
»Und wenn Herr Hansen auf seinem Führungsanspruch besteht?« Levite brachte sich erneut zum Lachen. Danach sprach er mit klarer Stimme: »Urban Hansen hat auf gar nichts zu bestehen! Wir haben eine Parteiführung, der auch ich angehöre. Wir werden beraten, was zu tun ist und dann gemeinsam entscheiden.«
»Heißt das, Sie fordern Urban Hansens Führungsanspruch heraus?«
»Das ist unnötig. Die Gremien der Partei werden über unser weiteres Vorgehen souverän entscheiden. Dort – nicht hier bei Ihnen – werde ich meinen Standpunkt kundtun. Nur so viel: Wir müssen im Interesse unseres Landes und unserer Partei handeln. Die DNMP ist keine Bühne für Selbstdarsteller.« Levite lehnte es ab, weitere Fragen zu beantworten.
DIE MASSE DER Menschen, die Levite umdrängten, ihm gratulierten, auf die Schulter klopften, und einzelne, die den Politiker ermahnten, er solle sein »Maul halten!«, wurde nach seinem Empfinden immer größer, ihr körperlicher Druck immer stärker. Levite brach der Schweiß aus. Er fühlte sich zunehmend beklommen. Raus! Nur raus hier! Es würgte ihn. Am liebsten hätte er in die Visagen der Umstehenden gekotzt. Er wollte seinen deutschen Landsleuten jenen Schwall braunen Drecks zurück geben, mit dem sie ihn während seiner Zeit bei den Deutschnationalen, ja im Grunde sein ganzes Leben lang, begossen hatten. Die einen unbewusst, die anderen kühl gezielt, vor allem die Schweine seiner Partei. Dank seiner Chuzpe – und weil sie ihn als Musterjuden brauchten – hatte er in dem Verein eine Blitzkarriere hingelegt. Aufgrund seines famosen Wahlergebnisses war er nun unbestritten zweiter Mann der Partei. Hansen konnte ihn nicht abschütteln. Zumindest nicht bis vor zehn Minuten! Bis sich Levites Zunge selbstständig gemacht hatte.
Er hatte sich ebenso dumm und unbeherrscht benommen wie Hansen. Der Druckabfall nach dem Wahlsieg war zu groß gewesen. Das Adrenalin hatte bei beiden die Kontrolle außer Kraft gesetzt. Aber im Gegensatz zu Levite konnte sich Hansen den Aussetzer leisten. Zwar hatte er mit seinem Nazi-Bekenntnis die Regierungsbeteiligung ausgeschlossen – zumindest vorläufig. Doch ihm blieb noch seine Partei. Um die Treue seiner Gefolgschaft musste er sich keine Sorgen machen. Die Bande war Fleisch aus seinem Fleische – Nazis wie ihr Führer. Levite dagegen war ein Jud und damit ihr Todfeind, den sie jetzt nicht mehr brauchten. Sie würden ihn schlachten. Niemals! Alles in Levite schrie auf: Er würde kämpfen – bis zum letzten Atemzug. Levite bahnte sich einen Weg durch die Menge.
Auf der Dachterrasse atmete er tief durch. Die frische Luft kühlte seinen Kopf. Seine Verzweiflung steigerte sich zur Panik. Es drängte ihn, über das Geländer zu flanken in die unendliche Freiheit. Nein! Sechs Millionen hatten sich abschlachten lassen, unter ihnen fast die ganze Familie seines Vaters Herschl. Das war genug! Auch die Israelis zählten nur sechs Millionen Juden. Doch anders als die europäischen Hebräer ergaben sie sich nicht den Antisemiten. Sie kämpften gegen 300 Millionen Araber. Gegen die brutalsten Terroristen. Sie gewannen alle Kriege und gaben ihren Feinden ständig ordentlich eins auf die Nase. Weil der Tod der europäischen Juden ihnen vor Augen stand. Die Diasporajuden schaufelten sich ihre Gräber, bevor die SS sie niedermähte. Die Israelis dagegen hatten ihren Stolz. Sie waren brutale Hunde. Nur so konnten sie überleben.
Vor dieser Alternative sah sich jetzt auch Paul Levite: Kapitulieren und sich auslöschen lassen oder aufrecht und mit letztem Einsatz zu fechten, bis zur Vernichtung Hansens. Trotz seiner selbst suggerierten Entschlossenheit brachte es Levite nicht fertig, seine Fäuste zu ballen. Er versuchte, zumindest ruhig durchzuatmen. Mit tippelnden Rückwärtsschritten entfernte er sich vom Eisengeländer.
Dabei stieß er gegen einen Mann. Robert Kriener war lautlos hinter ihm auf die Dachterrasse getreten.
»Was machen wir jetzt, Paul?«, fragte er unaufgeregt. Levite mochte die Stimme, ja das ganze Wesen seines rothaarigen Stellvertreters. Er hätte nie vermutet, unter der Nazidrecksbande einen anständigen Menschen anzutreffen. Der ehemalige Kriminalhauptkommissar besaß eine solide Persönlichkeit. Kurz nach seiner Ernennung zum hessischen Gauvorsitzenden hatte Levite getreu Machiavellis Devise, Grausamkeiten sofort zu begehen, den gesamten Landesvorstand geschasst und mit Männern besetzt, von denen er ein Mindestmaß an Loyalität erwarten durfte. Dabei hatte Levite Kriener zu seinem Stellvertreter bestimmt und ihm das Ressort Sicherheit übertragen. Zunächst herrschte Aufregung. Widerstand erhob sich gegen das selbstherrliche Gebaren des Juden, der sich anmaßte, die durch Wahlen zum Landesvorstand bestimmten Kameraden aus ihren Ämtern zu werfen.
Doch bereits nach wenigen Wochen mussten die Burschen anerkennen, dass Juden-Paule, wie man ihn in seiner Abwesenheit nannte, mit bislang ungekannter Dynamik aus ihrer Rasselbande eine kampagnenfähige Truppe geformt hatte, die die anderen Parteien das Fürchten lehrte. Levite selbst hielt Reden in Äppelwoi-Wirtschaften und auf Marktplätzen, die wegen ihres Witzes beim Publikum gut ankamen. Bald ging den Kameraden die Bedeutung des Begriffs Chuzpe auf. Sie verstanden darunter dreistes, zielstrebiges Handeln.
Entscheidend für Levites Erfolg war, dass er eine neue Mediendivision aus dem Boden stampfen und von einem Hightech-Nerd steuern ließ, der Robert Kriener direkt unterstellt war. Mit Hilfe der sozialen Medien erfasste die Truppe jeden Computer- und Smartphone-User, ganz zu schweigen von Facebook, Twitter und Instagram. Die Partei nahm sich aller an: Alte und Junge, Frauen wie Männer, Gebildete und Hohlköpfe. Die User wurden Tag und Nacht mit spezifisch auf ihre Person zugeschnittenen Contents gefüttert – unterbrochen nur von Gewinnspielen, Einkaufs- und Gesundheitstipps. Mit Hilfe dieser Reklame finanzierte die DNMP ihre politischen Botschaften. Ehe sich die anderen Parteien versahen, übernahmen die Deutschnationalen die elektronische Führung und bauten ihren Vorsprung trotz knapper Mittel stetig aus. Derweil kontrollierte Krieners Team unentwegt die Inhalte der Blogs, Websites, YouTube-Clips, Podcasts, Facebook-Einträge und Twitter messages auf ihre politische Unbedenklichkeit. Hassvideos wurden, anders als in NRW und in Meck-Pom, unverzüglich erfasst und gelöscht.
Auf diese Weise erlangte die Partei den Ruf, interaktiv mit den Menschen, vor allem den jüngeren, zu kommunizieren. Zugleich streiften die Deutschnationalen in Hessen ihren Ruf als Neonazis ab. Sie gewannen stattdessen das Image einer bürgernahen Bewegung. Dazu trug nicht zuletzt der Special Monitoring Report SMR bei, der zweimal täglich Levite und den übrigen Landesvorstandsmitglieder vorgelegt wurde. So war die Landesführung ständig über die Stimmung in Hessen up to date und konnte ihre Taktik permanent den Wünschen der Bevölkerung anpassen. Dies machte sich im Wahlkampf bezahlt, in dem Levite ausschließlich für seinen eigenen Gebrauch morgens um 6 Uhr und mittags um 13 Uhr jeweils einen zusätzlichen speziellen Report beanspruchte, der die Gemütslage der Internetuser nach spezifischen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Kriterien aufschlüsselte. Auf diese Weise war der Landesvorsitzende der am besten informierte Hesse, was Gefühle, Begehren und politische Neigungen seiner Landsleute anging. Levite begnügte sich nicht damit, den SBL, den Sonderbericht Levite, von einer Assistentin entgegen zu nehmen. Stattdessen erbat er sich stets die persönliche Übergabe des Rapports durch Kriener. Nachdem er die Zahlen und Bemerkungen sorgfältig studiert hatte, forderte Levite seinen Sicherheitsbeauftragten auf, seine Einschätzung kundzutun. Kriener verstand, dass dies keine Schikane war. Levite war tatsächlich neugierig auf seine Meinung und unterzog ihn jedes Mal einer gezielten Befragung, deren Gründlichkeit und Sinnesschärfe den einstigen Kriminalbeamten beeindruckte. Levite mochte während seiner Wahlkampfauftritte platte Parolen verbreiten wie jeder Politiker. Bei ihrer gemeinsamen Analyse war er konzentriert, nüchtern und abwägend.
Während ihrer Zwiegespräche entwickelte Levite Gedanken und Parolen, die er kurz darauf den Mitgliedern des Landesvorstandes und den übrigen Parteifunktionären oktroyierte. Kriener bemerkte, dass er auf diese Weise zum wichtigsten Berater und Sparringspartner des Chefs aufgestiegen war und diese Position stetig festigte. In der Parteiführung erntete er den Spitznamen »Levites Schatten«. Die dabei unterstellte blinde Gefolgschaft war unrichtig. Levite schätzte die Geradlinigkeit Krieners, die Zuverlässigkeit seiner Arbeit und die Offenheit seines Urteils, vor allem aber dessen Loyalität. Kriener wiederum imponierte die rastlose Energie Levites und sein innovatives Denken, das sich nie auf dem Erreichten ausruhte, vielmehr stets nach optimierten Wegen suchte. Trotz des damit verbundenen Aufwandes genossen beide Männer ihre fortwährenden Besprechungen, mit denen sie systematisch den Aufstieg der Landespartei vorbereiteten.
»Warum hat du uns im Augenblick unseres größten Erfolges aus dem Rennen geworfen?«, fragte Kriener Levite auf der Dachterrasse in ruhigem Ton.
»Es war stärker als ich. Ich konnte nicht länger zum Dummdreck Hansens den Mund halten, durch den er alles kaputt macht, was wir in zwei Jahren mit letzter Kraft aufgebaut haben…«
Levites vibrierende Aufgeregtheit kippte in Niedergeschlagenheit zurück. Es kostete ihn Kraft, weiter zu sprechen. »Meinst du … ich habe mit meinem Statement alles kaputt gemacht? Gibt es keinen Weg zurück … selbst wenn ich meine Worte bedauere?«
»Ich fürchte nein, Paul…« Kriener hielt kurz inne, ehe er fortfuhr. »Das Spiel ist aus. Hansen hasst dich. Auch, weil du Jude bist. Alle anderen im Vorstand hassen dich nicht minder. Jetzt, nach dem Wahlsieg, hast du deine Schuldigkeit getan. Sie brauchen dich nicht mehr. Und durch dein TV-Statement hast du ihnen im richtigen Moment das Alibi geliefert, dich zu entsorgen. Das ist für die perfekt gelaufen.«
»Was wird Klein-Adolf jetzt tun?«
»Er wird dich vom Reichsvorstand einstimmig rauskegeln lassen.« »Was soll ich deiner Meinung nach machen?«»Augenblicklich aus dem Reichsvorstand zurücktreten und versuchen, den Vorsitz in Hessen zu halten. Das dürfte nicht leicht sein – eher: fast unmöglich!« Kriener sah Levite gewollt aufmunternd an. »Aber dir fällt immer etwas ein. Vielleicht schaffst du’s. Ich werde jedenfalls mein Möglichstes dafür tun und du hast bei uns die Männer handverlesen bestimmt. Was wenig bedeutet … aber immerhin, vielleicht kriegst du den einen oder anderen noch rum. Rainer beispielsweise gilt hundertprozentig als dein Mann…«
»Und aus dem Reichsvorstand soll ich, deiner Meinung nach, sang- und klanglos aussteigen?«
»Ja, Paul. Ich habe bis soeben die Einträge auf Facebook und die Tweets verfolgt.« Kriener schüttelte den Kopf. »Da kommt blanker Hass zum Ausdruck! Das ist tödlicher Antisemitismus, als ob es nach ’45 nie eine Aufklärung gegeben hätte.« Kriener zögerte, ehe er sich entschloss, fortzufahren. »Der Tenor besagt, sie würden dich am liebsten unschädlich machen, vergasen. Und das sind nicht alles Deutschnationale. Da kannst du dir in etwa ausmalen, wie es im Reichsvorstand aussieht.« Kriener legte seine Hand auf Levites breiten Rücken. »Trete per FB zurück, spar dir die persönliche Begegnung mit diesem Pack.«
»Kommt nicht in Frage!«
Der scharfe Ton Levites überraschte Robert Kriener. Er sah ihn fragend an. »Die Zeiten, in denen wir Juden aus Angst vor einer Drohung in die Hosen gemacht haben, ist vorbei! Endgültig!«
»Paul, du vermeidest schlicht die Begegnung mit dem Nazi-Haufen.«
»Nenne es, wie du willst. Es bleibt ein Kneifen.«
»Man muss doch nicht in jeden Strudel springen, nur um sich zu beweisen, dass man keine Angst vor dem Ertrinken hat…«
Levites Züge verzogen sich zu einem schiefen Grinsen. »Wir Juden scheinbar doch. Zumindest nach Auschwitz. Wenn die Israelis den Mumm haben, den Terroristen zu trotzen, dann muss ich das hier auch fertig bringen.«
»Du bist doch kein Zionist, Paul?«
»Nein! Aber auch kein Feigling!« Levite stierte in die Dunkelheit. Das Bedürfnis, sich in den Tod zu stürzen, war gewichen. Er fühlte die Kraft in seinen Körper zurückkehren. Paul Levite war entschlossen, seinen Parteifeinden entgegen zu treten und sie das Fürchten zu lehren. Er ballte seine Fäuste.
PAUL LEVITE UND Robert Kriener flogen mit der Frühmaschine um 6 Uhr von Frankfurt am Main nach Berlin-Tegel – der Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg International in Schönefeld hatte noch immer keine Betriebsgenehmigung erhalten. Sie nahmen ein Taxi ins Ernst-Jünger-Haus in der Indira-Gandhi-Straße in Hohenschönhausen. Kriener begleitete Levite trotz seiner Bedenken, an der Sitzung des Reichsvorstandes überhaupt teilzunehmen. Er wollte seinen Freund nicht allein seinen Feinden überlassen. Entgegen Krieners Drängen bestand Levite darauf, das Gebäude nicht durch den Hintereingang zu betreten. Dort hatte die Parteileitung einige Dutzend Aktivisten mit Schildern postiert. Auch Fernsehteams waren unterrichtet worden, sie sollten den sich ins Haus Schleichenden filmen. Doch Levite fuhr vor dem Hauptportal vor. Sobald seine bullige Gestalt von den vorne Stehenden erkannt wurde, brachen diese in Geschrei aus, das sich in die Reihen der etwa tausend Schlachtenbummler ausbreitete. Die Wartenden riefen »Verräter«, »Schweine«, »Haut ab!«, »Raus!« Manche brüllten trotz Verbots durch den Ordnungsdienst »Nieder mit den Juden!« oder schlicht »Judensau!« In der Menge wurden Papp-Plakate mit den Aufschriften »Judas!«, »Weg mit Levite!«, geschwenkt.
Levite machte Anstalten, sich auf die Schreihälse zu stürzen, doch Robert Kriener zog seinen jähzornigen Weggefährten rasch zur Treppe ins Gebäude hinauf. Auch im Haus setzte sich das »Verräter!«-Geschrei fort. Kriener bugsierte Levite in ihr kleines »Vorstandsbüro Gau Hessen« im ersten Stock. Selbst durch die geschlossene Tür hörte man das Toben der aufgebrachten Parteigenossen.
»Paul, lass uns vernünftig sein! Hier haben wir nichts zu gewinnen. Es hat nichts mit Mut zu tun, sich dieser aufgehetzten Meute auszuliefern«, sprach Kriener so ruhig wie möglich.
»Was sollen wir deiner Ansicht nach machen?«
»Sofort abhauen!« In diesem Moment begann es an ihrer Tür zu trommeln, die Klinke wurde nach unten gehämmert, »Verräter!«, »Schweinejude!«-Rufe schwollen an. Ehe Kriener reagieren konnte, sprang Levite auf, entriegelte die Tür und riss sie auf. Er sah sich einer keifenden Gruppe gegenüber.
Reflexartig stürzte sich Levite auf den am nächsten stehenden Mann und drosch diesem mit den Fäusten ins Gesicht. Der riss die Hände hoch und wankte. »Wenn noch jemand eins in die Fresse will, soll er’s sagen!«, brüllte Levite. Die Männer wichen zurück. »Kommt her, feige Bande!«, schrie er und ballte erneut seine Fäuste. Da war Kriener bei ihm, packte Levite an den Schultern und stieß ihn zurück ins Büro, dessen Tür er verschloss.
Levite stand unschlüssig im Raum. »Diese feigen Nazischweine«, rief er heiser. Er ließ sich auf einen Bürosessel fallen. Levite sank in sich zusammen, dann schlug sein Kopf auf die Schreibtischplatte. Der schwere Mann schluchzte, es schüttelte seinen Oberkörper. Kriener trat neben ihn. Allmählich beruhigte sich Levite. Er zwang sich, aufrecht zu sitzen, wischte sich die Augen und sprach mit um Festigkeit bemühter Stimme zu Kriener: »Warum lebe ich ehrloser Jud in diesem Scheißland? Warum hab ich mich ausgerechnet bei dem Nazipack eingeschleimt?« Kriener zögerte: »Dich hat wohl das Risiko gereizt…«
»Nein. Die Macht. Und deshalb habe ich alles, was mir heilig ist und was anständig ist, rechts liegen gelassen. Ich hab mich dem Satan verschrieben.«
Levites gnadenlose Ehrlichkeit gegen sich selbst imponierte Kriener. Er wusste dank seiner Recherchetätigkeit, dass bei weitem nicht alle DNMP-Aktivisten, ja nicht einmal die höheren Parteifunktionäre, überzeugte Nazis waren. Kriener schätzte, dass ein Drittel, wohl gar die Hälfte, Opportunisten waren, die alles getan und gesagt hätten, um nach oben zu kommen. Doch keiner von ihnen besaß den Mut, dies zuzugeben, wie Levite soeben.