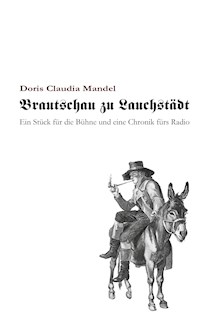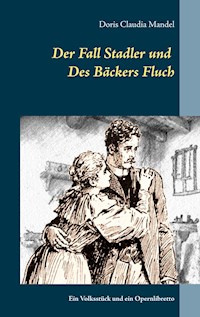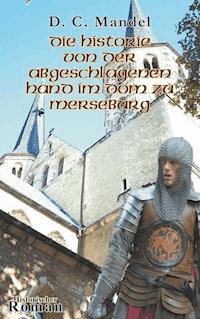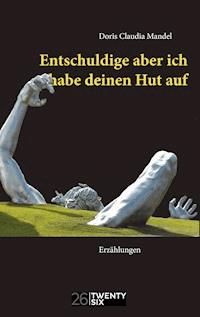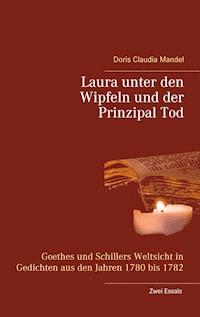
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch vereint zwei Essays, die sich beide damit befassen, inwieweit sich in ausgewählten Gedichten die jeweilige Weltsicht ihrer Autoren widerspiegelt. Im ersten wird Johann Wolfgang Goethes Gedicht "Wanderers Nachtlied II" ("Ein Gleiches") von 1780 sowohl in seiner Entstehungs-, als in seiner Wirkungsgeschichte gründlich unter die Lupe genommen, wobei auch phonologische Untersuchungen nicht ausgespart bleiben, im zweiten gilt die Aufmerksamkeit den Laura-Gedichten aus der "Anthologie auf das Jahr 1782" von Friedrich Schiller und ihrer Verzahnung mit dem philosophischen Prinzip der "Mittelkraft". Aus den unterschiedlichen denkerischen Ansätzen der beiden Dichter, aus ihren voneinander verschiedenen Lebenserfahrungen, aber auch aus der zeitlichen Nähe der behandelten Texte zueinander bezieht die Zusammenstellung der Essays ihren Reiz, nicht zuletzt, weil der "Prinzipal Tod" - das eine Mal als ein eher von außen in den Text hinein getragenes Deutungselement, das andere Mal als Bestandteil der Widmung - in beiden Fällen eine konstruktive Rolle zu spielen scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ZUM BUCH
Das vorliegende Buch vereint zwei Essays, die sich beide damit befassen, inwieweit sich in ausgewählten Gedichten die jeweilige Weltsicht ihrer Autoren widerspiegelt. Im ersten wird Johann Wolfgang Goethes Gedicht »Wanderers Nachtlied II« (»Ein Gleiches«) von 1780 sowohl in seiner Entstehungs-, als in seiner Wirkungsgeschichte gründlich unter die Lupe genommen, wobei auch phonologische Untersuchungen nicht ausgespart bleiben, im zweiten gilt die Aufmerksamkeit den Laura-Gedichten aus der »Anthologie auf das Jahr 1782« von Friedrich Schiller und ihrer Verzahnung mit dem philosophischen Prinzip der »Mittelkraft«. Aus den unterschiedlichen denkerischen Ansätzen der beiden Dichter, aus ihren voneinander verschiedenen Lebenserfahrungen, aber auch aus der zeitlichen Nähe der behandelten Texte zueinander bezieht die Zusammenstellung der Essays ihren Reiz, nicht zuletzt, weil der »Prinzipal Tod« — das eine Mal als ein eher von außen in den Text hinein getragenes Deutungselement, das andere Mal als Bestandteil der Widmung — in beiden Fällen eine konstruktive Rolle zu spielen scheint.
INHALT
Ruh‘ über allen Gipfeln?
Der kleine Vers an der Wand
Idylle oder Gemetzel?
Der letzte Versuch
Die starre Maske der Verlegenheit
Eine Sonderform der Ruhe
Am Scheideweg
Die attische Eleganz
Die Tatzeit
Sprachrohr der Ratlosigkeit
Anmerkungen
Laura oder Auf der Suche nach Sympathie, harmonie und Liebe
Auf der Suche nach der einen Frau
Schiller gegen das schwäbische Zeitalter des Minnesangs
Der zynische Tod
Die Mittelkraft oder der Nervengeist
Abel und das Genie
Männerstolz vor Fürstenthronen
Alles muss sich rechnen
Das Wesensband, das sich um Tiere und Menschen schlingt
Anmerkungen
Abbildungen
RUH‘ ÜBER ALLEN GIPFELN?
Selbstdistanzierung und Selbststilisierung in Goethes Gedicht »Wanderers Nachtlied«
Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
ruhest du auch.
Dieses Gedicht ist eines der berühmtesten, aber auch beliebtesten unter den Deutschen, und nicht nur unter denen. Für die Goethe-Forscherin Sigrid Damm ist es sogar Goethes »vielleicht vollendetster Roman über das Weltall«, weil die »Verse ... in einem einzigen Bild- und Sprachklang gewordenen Gedanken den ganzen Kosmos« durchwandern.1 »Eine Umfrage während des Goethejahres 1982 ergab, dass dieses Lied bei den Bürgern der Bundesrepublik Deutschland zum beliebteste Gedicht Goethes gewählt wurde. Dies geschah ganz unerwartet, da man in Fachkreisen eher geglaubt hatte, das ›Heidenröslein‹ als Volkslied oder die Ballade ›Erlkönig‹ stünden höher in der Gunst der Leser.«1a Auch nach der Jahrtausendwende scheint der Zuspruch ungebrochen. Bei einem Rezitationswettbewerb des Mitteldeutschen Rundfunks für Laien aus Anlass der Leipziger Buchmesse im März 2007, bei dem zehn Gedichte Goethes zur Auswahl standen, entschieden sich von zweihundertsechsundsiebzig Teilnehmern immerhin achtundzwanzig für das schwierig vorzutragende »WANDERERS NACHTLIED«. Mehr als hundert Vertonungen gibt es von diesem Text. Sie stammen von Schubert (das berühmte Opus 96 Nr. 3 [D 768]), Schumann, Rubinstein und Hauptmann, von Wolf, Zillich, Reger, Löwe, Weber, Steinbach, Zelter (der es als »RUHELIED« bezeichnet), Weigl, sogar von Charles Ives ... Eine der neuesten steuerten der damals achtzehnjähjrige Christian Dieck im Jahre 2000 bei und der US-Amerikaner John Ottmans, der im Jahr 2008 für Bryan Singers Film »Valkyrie« (»Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat«) unter dem Titel »They‘ll Remember You« ein Klagelied für Sopran und Chor auf Goethes Text verfasste, mit dem er der Trauer um die Opfer des missglückten Attentats auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 Ausdruck verleihen wollte. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass Friedrich Kuhlau ursprünglich einen Text von Johann Daniel Falk vertonte, den dieser 1817 unter dem Titel »ABENDLIED« in Anlehnung an Goethes »WANDERERS NACHTLIED« verfasst hatte, weswegen man dem Komponisten ungerechterweise vorwarf, den Text verstümmelt zu haben; erst später unterlegte man seinem Lied den goetheschen Originaltext:
Unter allen Wipfeln ist Ruh;
In allen Zweigen hörest du
Keinen Laut;
Die Vöglein schlafen im
Walde; Warte nur, balde, balde
Schläfst auch du.
Unter allen Monden ist Plag‘:
Und alle Jahr und alle Tag‘
Jammerlaut!
Das Laub verwelkt in dem Walde;
Warte nur, balde, balde
Welkst auch du!
Unter allen Sternen ist Ruh‘;
In allen Himmeln hörest du
Harfenlaut;
Die Englein spielen, das schallte:
Warte nur, balde, balde
Spielst auch du!
Falk war immerhin anständig genug, in seinen »Auserlesenen Werken« darauf hinzuweisen, dass der erste Vers »von Göthe« stamme. Freilich zitiert er ihn falsch, wohl aus dem Gedächtnis, das ihn kurzfristig verlassen haben musste. Zwar verfasste er ein Werk mit dem Titel »Goethe aus näherem Umgange dargestellt«, doch lernte er den Großmeister erst im Jahre 1797 kennen, als er, frisch verheiratet, nach Weimar zog. Aber noch im März 1801 beklagt er sich bei seinem Freund Körte in einem Brief, dass es zwischen dem »Herrn Geheimen Rat« und ihm »noch zu keinem rechten Verhältnis kommen wollte.« Er ahnt den Grund, denn er gehöre »nicht zu den jungen Leuten, die mit eingezogenem Atem den Worten des Meisters lauschen, als ob er wie die delphische Pythia Orakelsprüche von sich gäbe. Ich bin ein vorwitziges Danziger Kind und widerspreche offen, falls ich anderer Meinung bin. Auch einem Goethe.«2
Heinrich von Kleist steuerte ebenfalls eine Variante zur schier abenteuerlichen Rezeptionsgeschichte dieses Gedichts bei, die aber wohl nur als Autograph vorliegt und wohl auch nicht für die Veröffentlichung bestimmt war:
Unter allen Zweigen ist Ruh,
In allen Wipfeln hörest du
Keinen Laut.
Die Vögelein schlafen im Walde,
Warte nur, balde
Schläfest du auch!
Aufgrund graphologischer Besonderheiten geht man heute davon aus, dass diese Zeilen nicht vor 1805 entstanden sein können. Wann genau und warum sie auf Kleists Zettel gelangten, ist ungewiss.3
DER KLEINE VERS AN DER WAND
Wahrscheinlich wurde kein Gedicht auf der Welt öfter tradiert, als eben Goethes »WANDERERS NACHTLIED« von 1780. Karl Kraus nannte es das »Reichskleinod deutscher Lyrik«, den »tiefsten Hauch eines Dichters«. Und während auch Theodor Wiesengrund Adorno in seiner »REDE ÜBER LYRIK« referiert, dies sei »das reinste lyrische Gebilde«, nannte Goethe, also der »Dichter selbst ... es in seiner ›Frankforterischen Diktion‹: ›der kleine Vers an der Wand‹«.4 — Da sind wir inmitten der ersten Widersprüche, die sich rund um den Text entwickeln, nämlich dem zwischen den dithyrambischen Lobessängern hie und dem coolen Autoren da. Ein zweiter Widerspruch tut sich unversehens auf: Von Liebhabern ebenso wie von Literaturwissenschaftlern wird immer wieder behauptet, dieses Gedicht wirke besonders besänftigend, weil »bei dem langen U des Wortes ›Ruh‹ und der nachfolgenden Pause schier die schweigende Dämmerung im Walde hörbar würde und ... das langsame Tempo sowohl auf melodischem wie auf rhythmischem Gebiete ausgleichend auf die vorhandenen dynamischen Gegensätze wirke, indem es den Eindruck des Starken mildere, hingegen den des Schwachen steigere«, man käme also nicht umhin festzustellen, »Goethe entlasse sein Gedicht auf eine überaus beschwichtigende Weise in unser Leben«.5
In dieselbe Kerbe haut der durch seine Forschung zur Geschichte und Soziologie der Anrede bekannte Armin Kohz: »In der ersten Zeile ›über allen Gipfeln‹ dominieren die vorderen Vokale [ü] und [i] und erzeugen eine hohe, schnelle Tonlage. Die Glottalverschlüsse [¿] vor den Anfangsvokalen und der stimmhafte velare Plosiv [g] unterstützen dies. Die zweite Zeile ›Ist Ruh‹führt die hohe Tonlage zunächst fort, aber endet in einem markanten Kontrast. Das uvulare [r] und der hintere Vokal [u] bedeuten einen klanglichen Bruch und zeichnen die später eingeschlagene Richtung vor. In der dritten und vierten Zeile ›In allen Wipfeln / Spürest du‹ überwiegen die hohen Vordervokale und führen die bisherige Klangqualität zwar fort. Sie ist aber bereits abgeschwächt durch [a] und [u] sowie durch die stimmhaften reibenden Frikative [w] und [_]. Die fünfte Zeile ›Kaum einen Hauch‹ enthält keine hohen Vokale mehr, die Diphthonge [au] und [ai] tragen eine deutlich tiefere Tonlage und korrespondieren mit dem Abstieg. Die sechste Zeile ›Die Vögelein schweigen im Walde‹ ist phonetisch betrachtet am uneinheitlichsten, aber inhaltlich die einzige in sich abgeschlossene Zeile. Der hohe Vokal [i] tritt nur in unbetonten Silben auf. Das [ö] ist tiefer als die Vordervokale, das [a] ist ein tiefer Zentralvokal. Die hellen Vokale interpretiere ich als ein nochmaliges Atemholen des Dichters vor dem Ende, die labialen Frikative [f] und [w] evozieren den Eindruck der Beengtheit. Die siebte Zeile ›Warte nur, balde‹ macht mit [a] und [u] in der Vokalhöhe einen weiteren Schritt nach unten. Die achte Zeile ›Ruhest du auch‹ vollendet den Abstieg. Der hintere Vokal [u] und der dumpfe Diphthong [au] verstärken auch phonetisch den Eindruck der Ruhe. Inhaltlich löst ›Ruhest du auch‹ den phonetischen Kontrast in der ersten Zeile auf. Der letzte Laut, der velare Frikativ [x], ist im Grunde genommen kein Laut, da er stimmlos ist. Er symbolisiert für mich das immer schwächer werdende Aushauchen vor der endgültigen Stille.«6
Solche phonetischen Überlegungen werden möglich, weil wir den Vokalen — Monophtongen wie Diphtongen — bestimmte Klangfarben und Tonhöhen zuordnen, die sich (ausgehend von der gesprochenen Sprache) aus den nachfolgend genannten Formantlagen und den zugehörigen Frequenzen ergeben6a:
Daraus leiten wir eine (freilich vereinfachte) Klassifikation von Klangfarbe und Tonhöhe der Vokale ab:
i
hoch
ü
e
ö
mittelhoch
ä
a
e
a
erhoben tief
a
o
o
e
o
tief
u
(Die Diphtonge notieren wir entsprechend ihrer Umsetzung in der gesprochenen Rede: ei [ai[ als ae, au als ao und eu [äu] als oe.)
Aus dieser Übersicht erhellt, warum das U, sobald es in betonten Silben auftaucht, gewöhnlich als dunkel bezeichnet (und wohl auch so empfunden) wird und das E als hell. Wenn dann noch Assoziationen zu allgemeinmenschlichen Befindlichkeiten hinzutreten, indem z. B. alles Dunkle für unangenehm gehalten wird und alles Helle für angenehm, vollzieht sich auch beim »stillen« Leser eine Wertung der Klangfarben so gut wie von selbst. Allerdings muss diese Wertung nicht mit den dichterischen Intensionen übereinstimmen, zumal sie in den meisten Fällen eben nicht textimmanent ist.
Eine solche textlinguistische Herangehensweise ermutigt etliche Forscher, munter tabellarische Übersichten über Tonhöhenverlauf und Klangfarbe der Vokale in Goethes »NACHTLIED« samt vermeintlicher Wirkungsstratgie der Laute zusammenzustellen, wie es zum Beispiel durch K. H. Weiers geschehen ist (siehe nächste Seite)7
In einer eher ingenieur-technisch bionischen Variante gibt es bei Kerber einen heimlichen Rückgriff auf das so genannte Vokaldreieck (bzw. Vokaltrapez — untere Grafik):8
Die Vokale
Die im Hintergrund gefärbten Kästchen markieren die Wiederholungen von Lautkombinationen in den Versen.
Wirkung der Laute insgesamt
Wirkung der Vokale und Konsonanten
Die oben angeführten Laute haben nicht an allen Stellen des Gedichts die gleiche Wirkung. Dies hängt u. a. vom Wortinhalt des betreffenden Wortes und vom Rhythmus des Verses ab, in dem das Wort mit dem betreffenden Laut steht.
Im Gegensatz zu Stauff und früheren Autoren sieht Kerber also durchaus eine gewisse metrische Regelung in Goethes Text, wobei uns nicht ganz klar ist, wie er sie zum »Vokalismus« (»Vom Hellen zum Dunklen«) in Beziehung setzt. Andere Interpreten entdecken im Vers fünf (»kaum einen Hauch«) sogar noch ein weiteres Metrum: den Choriambus (— v v —). So spricht Leopold Liegler vom Choriambus als dem »Baustein der Struktureinheit«8a, wobei Theodor Lipps im Choriambus »zugleich auch die beiden Momente der Bewegung, das Hervorgehen aus dem Anfangspunkt, und das Fortgehen zum Endpunkt, durch einen Wortabsatz geschieden« sieht.8b Weiers fügt dem Ganzen bei der Textstelle »Warte nur« noch einen Kretikus (— v —) hinzu, wodurch der »Einschnitt zwischen dem ›Warte nur‹ und dem ›balde‹« »besonders groß« sei. Auf diese Weise werde »der Vers sehr deutlich in zwei Kola gegliedert«.8c
Abenteuerlich! Natürlich kann man jedem beliebigen Text, auch jeder Prosa, ein metrisches Schema unterschieben, wenn man nur will und die zu untersuchenden Perioden klein genug hält. Folglich sei uns erlaubt, Zweifel an derartigen Auslegungen zu hegen, die immer auch stark voluntativ daherkommen. Statistisch gesehen, verwerten Gedichte die Laute nämlich so, wie es für die Sprache, in der sie geschrieben sind, typisch ist. Auch dann, wenn onomatopoetisch eingegriffen worden ist, was sich naturgemäß besonders anhand von Vokalhäufungen, Alliterationen u. ä. bemerkbar macht, erhält die dadurch erzielte Klangfärbung ihre Bedeutung nicht aus den phonetischen Aspekten des Textes, sondern aus semantischen, meist außertextlichen. Wenn wir einen Klang auf einem langen ›U‹ als kongenial für die Darstellung der ›Ruhe‹ deuten, hat das zu allererst etwas damit zu tun, dass das Phonem ›u‹ im Lexem ›Ruhe‹ semantisch verortet ist. Indem wir dies feststellen, haben wir bereits eine Selektion vorgenommen, denn in unseren Assoziationsketten lassen wir einen Begriff wie ›Stille‹ wohlweislich außer Acht, obwohl er zum selben Bedeutungsumfeld wie ›Ruhe‹ gezählt werden muss, aber im Gegensatz zu seinem Bruderbegriff — offensichtlich ganz unpassend — einen hohen, sogar den höchsten deutschen Vokal, nämlich ›i‹, beinhaltet, nach herkömmlicher Deutung also für die Darstellung von Seelenfrieden, Lautlosigkeit, Entspannung usw. nicht prädestiniert sein dürfte, umso weniger als das ›I‹ landläufig als schrill verschrien ist und gern in Interjektionen Verwendung findet, mit denen dem Ekel (»igittigitt«) oder der Selbstdarstellung (»kikeriki)« Ausdruck verliehen werden soll.
Welch hohen Rang ein einzelnes Phonem in klanglicher und semanticher Hinsicht für einen Dichter einnehmen kann, ohne dass es durch Spekulationen von außen desavouiert wird, beweist mehr als ein Jahrhundert später Rainer Maria Rilke mit einem Brief, den er am 8. November 1908 aus Paris an seinen Verleger, den »verehrten und lieben Herrn Doktor« Anton Kippenberg, schrieb, als er die Herausgabe von »Der neuen Gedichte anderer Teil« vorbereitete und beim Korrekturlesen stutzte: »Mir sind gleich bei der ersten Durchsicht ein paar Fehler aufgefallen, davon einer mir so schmerzlich ist, daß ich Sie fast bitten würde, ihn auf einem einzulegenden Streifen zu verbessern. (...) Der Zufall hat mir nämlich in der ›Klage um Jonathan‹ (Seite →, →. Zeile der 3. Strophe) das schöne alte Wort löhren in ›röhren‹ verwandelt. Es mag übertrieben sein, wenn ich diese Abänderung als wesentlich störend empfinde, aber es ist so: ›löhren‹ enthält so viel von Tierklage, auch wilder Tiere, hat einen etwas anderen ö-Laut und das l ist an dieser Stelle ebenso korrespondierend mit ›Lagern‹ und dem ›legen‹ der kommenden Zeile, wie das r schwierig und widerstrebend und nach ›Lagern‹ geradezu unmöglich ist; überdies: röhren ist ein Fachausdruck, nur für bestimmte Wildarten gültig: Sie sehen, ich habe lauter Gründe dagegen, so wie ich sie aufrichtig aufzähle. Läßt sich da etwas tun? (In der Korrektur stand richtig: löhren.)« Dieser Fehler »hebt für mein Gefühl den harmonischen Verlauf des Gedichtes auf und frißt von seiner Stelle aus in die gesunden Zeilen hinein.«8d
Zurück zu Goethe. Oft wird vergessen, dass Reim, Assonanz, Alliteration gleichermaßen dem Rhythmus angehören, denn wie er unterliegen sie dem Prinzip der Wiederholung. Nun geschieht im »NACHTLIED« aber etwas Merkwürdiges. So wenig Probleme den Germanisten der vokalische Sprachklang des Gedichts und seine Deutung zu bereiten scheint, so viel Kopfzerbrechen macht ihnen die rhythmische Konfiguration, zumal sie alles andere als »ruhig« verläuft. Woldemar Masing stöhnt: »Schon die rhythmische Gliederung ist so mannigfaltig, daß eine Einteilung der Verse in bestimmte Versfüße unmöglich durchzuführen ist, ja daß man nicht einmal mit Bestimmtheit entscheiden kann, ob der für das Ganze charakteristische Rhythmus ein steigender oder ein sinkender ist.« Er sieht sogar den »altgermanischen Vers der Willkür des Dichters anheimgestellt«, was ihn aber, nach abenteuerlichen arithmetischen Übungen im Zusammenzählen von Hebungen und Senkungen, nicht an der Feststellung hindert, »daß die rhythmische Gliederung des Ruheliedes trotz ihrer scheinbaren Unregelmäßigkeit nach nicht weniger festen Gesetzen geordnet ist, als die melodische, und daß sie gleich dieser und der plastischen Gliederung dem Inhalt nicht nur zum Ausdruck, sondern auch zur Schönheit verhilft«.8e Ein Lehrer für Deutsch und Mathematik, Heiner Stauff, schürt die Bedenken gegenüber solcher Harmoniesucht: »Das Gedicht hat für seine Zeit eine keineswegs gewöhnliche FORM. (...) Der Zweck ..., aber allemal der Effekt scheint klar: es soll (im Leser) die Ruhe HERGESTELLT werden, von der im Folgenden die REDE ist: das Gedicht TUT genau das, wovon es auch SPRICHT. Doch plötzlich scheint es, als sei dieses Gedicht KEINESWEGS so ruhig und regelmäßig, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Vielmehr scheint das Versmaß von völliger UNORDNUNG oder ... bloß ›freier ... Rhythmik‹ zu zeugen. Erstaunlicherweise ist also das Versmaß erheblich LEBHAFTER oder auch IRRITIERENDER als die Ruhe, von der das Gedicht SPRICHT/zu sprechen SCHEINT (...) Insbesondere scheint ... zwischen der 4. und 5. Zeile ... ein BRUCH zu liegen. (...) Da ist nicht von ›KEINEM Hauch‹, sondern von ›[...] KAUM EIN[EM] Hauch [...]‹ die Rede. Erst HIER ... wird klar, WAS eigentlich über den Gipfeln und in den Wipfeln fehlt: WINDBEWEGUNG. Und entsprechend könnte NACH dieser Zeile (in ihrem besonders statischen Versmaß) auch schon der SCHLUSS des Gedichts sein. Die Vögel ... schweigen als FOLGE. Man könne auf die Vermutung kommen, dass die Ruhe vielleicht GAR NICHT SO SCHÖN, sondern eher BEDRÜCKEND ist: sogar die Vögel haben vor Angst ihr Tirili eingestellt. PLÖTZLICH ahnt man, dass es — wortwörtlich oder im übertragenen Sinne — die ›Ruhe vor dem Sturm‹ sein könnte.«9
Auf die Vögel kommen wir im Kapitel DIE TATZEIT noch zu sprechen. Vorerst bleiben wir bei Stauff. Nach ausführlicher Interpretation zweier von ihm entdeckter Ebenen der Beruhigung und der Beunruhigung, stellt er fest, die letzte Zeile ließe sich lesen
»· einmal im DROHENDEN Sinne von ›dich erwischt es auch nochmal‹,
· das andere Mal als VERHEISSUNG, wie die anderen auch, also fast schon solidarisch zu ruhen ...
Der Doppelsinn wird insbesondere dann klar, wenn man mit der verheißenen Ruhe die ›LETZTE Ruhe‹, also den Tod, assoziiert. So gesehen wird dem ›du‹ hier ein baldiger (sanfter) Tod versprochen — nach dem es sich so sehnt. (...) Und von da aus gewinnt auch noch der ›Hauch‹ einen neuen Hintersinn: nicht mehr üblicher WIND, sondern der ›Hauch des Todes‹ bzw. der letzte Atemstoß könnte gemeint sein. Das scheint sich auch durch den Reim ›Hauch/[ruhest] auch‹ anzudeuten. (...) Interessant ist auch die RICHTUNG des Gedichts: von OBEN (1. Zeile) nach UNTEN (8. Zeile) geht es auch tatsächlich immer weiter VON OBEN NACH UNTEN:
· ›Über allen Gipfeln [...]‹, also dem denkbar Höchsten, liegt nur noch der freie Himmel (den man ja durchaus geographisch-astronomisch statt schon theologisch denken mag).
· Es folgt, schon tiefer, ›[...] In allen Wipfeln [...]‹.
· Und sieht man die Wipfel als Spitzen des darunterliegenden Waldes, so sitzen die Vögel nochmals eine ›Etage‹ tiefer.
· Der Endpunkt der Bewegung, nämlich der Erdboden (das Grab?), wird immerhin angedeutet, wenn auch nicht platt ausposaunt.
Und ist da nicht eben DOCH eine RELIGIÖSE Metaphorik heraushörbar: Himmel oben, Hölle oder Totenreich unten? Und noch ein wenig weiter gedacht: erst ist der Himmel (über den Gipfeln) leer und tot, am Ende verheißt eine himmlische Stimme einen sanften Tod?«10
Aus diesem Furor gehen wir ein wenig atemlos hervor. Wir dürfen konstatieren, dass Stauffs Auffassung der unseren nahe kommt, wenngleich nur in dem Maße, wie sie das Unbehagen an der RUHE als einem zentralen Begriff des Textes und mit ihm die mannigfaltigen Brechungen auf den verschiedensten Ebenen reflektiert. Nicht anschließen können wir uns Stauffs Meinung, es handele sich bei dem Achtzeiler um den sanften Trost für einen Lebensmüden, um die Beschreibung der Sehnsucht nach dem Tode. Aber dazu kommen wir später.
Die Missverständnisse mit dem Text beginnen zumeist schon beim Titel. »WANDERERS NACHTLIED« von 1780 erscheint in den einschlägigen Ausgaben gewöhnlich als »EIN GLEICHES«. Im Lyrik-Kalender des Deutchlandradios Berlin vom 22. 08. 2006 wird deswegen räsoniert, die »spätere nüchterne Titelgebung in der Werkausgabe« wolle »die emotionelle Ergriffenheit, die den Leser angesichts der Todesahnung des Ich in der verstummenden Natur erfasst, etwas objektivieren. Ein Seelenfrieden, so eine Lesart des Gedichts, kann sich erst einstellen, sobald der Mensch seine eigene Position erkennt, die ihm in der Evolutionsgeschichte zugemessen ist.«11
In Wirklichkeit verhält es sich so, dass Goethe besagtes Gedicht im ersten Band der autorisierten Gesamtausgabe seiner Werke von 1815 bei Cotta dem 1776 entstandenen Gedicht »WANDERERS NACHTLIED« beigesellte (»Der du von den Himmeln bist, / alles Leid und Schmerzen stillst ...«), dem es thematisch entsprach, und bei dieser Gelegenheit anordnete, dass beide Gedichte fortan stets gemeinsam abgedruckt werden sollten, und zwar unter den sie unterscheidenden Titeln. Weiter nichts. Das ist alles. Kein Objektivierungsversuch. Kein Bemühen um einen aus der Evolutionsgeschichte begründeten Seelenfrieden. Obendrein war Goethe 1780, als dieses zweite, darum oft »WANDRERS NACHTLIED II« genannte, Gedicht entstand, von ärgsten Skrupeln über seine dichterischen, wissenschaftlichen und schriftstellerischen Fähigkeiten gepeinigt, und er hatte mit der Weimarer Hofkamarilla härteste Kämpfe auszufechten, während derer er sich ohnmächtig an sich selbst und als Erzieher des Herzogs fühlte, was uns auch angesichts der übrigen Eigenheiten des Textes stutzig macht, vor allem aber wegen jener Interpretationsversuche, die sich immer wieder an der »Ruhe« delektieren. Woher soll sie kommen, diese »Ruh«? Auch ließe sich naiv fragen, warum wir uns beschwichtigt fühlen sollen, wenn uns von einem Provinzpolitiker prophezeit wird, dass auch wir bald sterben werden? — Goethe war, als er der Welt dergleichen mitteilte, einunddreißig Jahre alt. Wir können ihm zugutehalten, dass er in jungen Jahren bereits einen Blutsturz hinter sich hatte und von daher ein gespaltenes Verhältnis zum Tod entwickelte, dessen Nähe er künftig zu meiden verstand. Es scheint mehr als berechtigt, wenn Wulf Segebrecht bemerkt, seiner Meinung nach repräsentiere der Wortlaut des 1815 publizierten Gedichts den »Willen des 66jährigen Goethe, der das Gedicht in eine Sammlung seiner Lyrik einfügte, er repräsentiert aber möglicherweise nicht den Willen des 31-jährigen Goethe, der es schrieb«11a, zumal es der Allgemeinheit erst 35 Jahre nach seinem Entstehen zugänglich gemacht wurde. Durchaus merkwürdig ist auch, dass Goethe an jenem 27. August 1831 von eigener Hand die Niederschrift eines Gedichts »renovirt«, die er in der Nacht zum 7. September 1780 mit Bleistift, also wohl auch provisorisch, vorgenommen hat, statt den Text, der für ihn in der »Kickelhahn-Fassung« (mit »Vögel« statt »Vögelein« und einem Ausrufezeichen nach »Hauch«) keine Berechtigung mehr gehabt haben dürfte, zumal die neuere, autorisierte Fassung inzwischen im Druck erschienen war, zu tilgen oder noch einmal ganz neu aufzuschreiben, ganz zu schweigen davon, dass unzählige die Wände beschmierende Narrenhände anderer Wanderer mittlerweile ihre verheerenden Spuren hinterlassen hatten (oder gehen nur wir Nachgeborenen dermaßen pingelich mit Goethes gültigen Gedichtfassungen um?).
Auch mit der vielbeschworenen zarten Zerbrechlichkeit dieses Gedichtes kann es nicht weit her sein, denn seit mehr als zweihundert Jahren übersteht es alle Versuche, es zu sezieren und zu vermanschen oder es ins Bajowarische und Sächsische und Schwäbische zu transferieren in weitgehend guter Konstitution. Es handelt sich bei ihm um eines der am häufigsten in fremde Sprachen übersetzten Gedichte. Alleine für das Bulgarische hat Ljuben Ljubenov achtundzwanzig Nachdichtungen ermittelt. Der Germanist Wulf Segebrecht berichtet von einer Übersetzung des Gedichts ins Japanische, die im Jahre 1902 vor sich gegangen ist und zehn Jahre später einem Franzosen, der sich geschäftlich in Japan aufhielt, so gut gefiel, dass dieser sie, indem er sie für ein fernöstliches Original hielt, in seine Muttersprache übersetzte. Dann kam ein Deutscher daher und verdolmetschte die französische Version des vermeintlichen japanischen Originals ins Germanische, so dass ein »JAPANISCHES NACHTLIED« daraus wurde:
Stille ist im Pavillon aus Jade.
Krähen fliegen stumm zu beschneiten Kirschbäumen im Mondlicht.
Ich sitze
Und weine.12
Niemand wird behaupten dürfen, dies wäre ein schlechtes Gedicht. Bloß: Mit Goethes »WANDERERS NACHTLIED« hat es nur mehr die STILLE, sprich: RUHE, gemeinsam. Allerdings heißt es dazu in der Wikipedia: »Eine Primärquelle, die sogenannte deutsche ›Literaturzeitschrift‹, wird ... nie namhaft gemacht. Es dürfte sich mithin um eine parodistische Mystifikation handeln, die inzwischen ... wie eine moderne Sage vielfach für bare Münze genommen wird.«13
Auch in Daniel Kehlmanns Roman »DIE VERMESSUNG DER WELT« gibt es so etwas wie ein »Lost in Translation«, als Alexander von Humboldt seinen Begleitern Goethes »NACHTLIED« in der spanischen Übersetzung zum Besten gibt:
Oberhalb aller Bergspitzen sei es still,
in den Bäumen kein Wind zu fühlen,
auch die Vögel seien ruhig,
und bald werde man tot sein.
Woraufhin alle Beteiligten auf eine Fortsetzung warteten, weil sie sich wunderten, dass das schon alles gewesen sein soll.14
Bis zum heutigen Tage folgten unzählige andere Varianten. Während des Ersten Weltkriegs wurde Goethes Gedicht 1917 sogar zur Marine einberufen, als ausgerechnet der Generalanzeiger seiner Geburtsstadt ein Unterseeboot-Lied druckte unter dem Titel:
ENGLISCHER KAPITÄN AN SEINEN KOLLEGEN
Unter allen Wassern ist - ›U‹.
Von Englands Flotte spürest du
Kaum einen Rauch ...
Mein Schiff versank, daß es knallte;
Warte nur, balde,
R-U-hst du auch!15
Mit leichten textlichen Varianten erschien das Meisterwerk auch auf einer Bildpostkarte (Abbildung 1, unten):
In einem Sonderheft seiner berühmten »FACKEL« sieht Karl Kraus angesichts dessen »das heiligste Gedicht der Nation, ein Reichskleinod, dessen sechs erhabene Zeilen vor jedem Windhauch der Lebensgemeinheit bewahrt werden müssten, ... der Kanaille« preisgegeben, »den letzten, tiefsten Atemzug des Dichters zu diesem entsetzlichen Rasseln« umgehöhnt.16 Für diese Schändung des heiligsten Gedichts der Nation wäre ein verlorener Weltkrieg wahrlich die gerechte Strafe. Geholfen hat’s nichts. Der »Dichter« erhielt die Ehrendoktorwürde.
Kraus konterte in seinem berühmten Stück »DIE LETZTEN TAGE DER MENSCHHEIT« mit einer Parodie auf die vielen Parodien. In der 13. Szene des II. Akts lässt er einen seiner Protagonisten ein »WANDERERS SCHLACHTLIED« vortragen:17
»DLAUHOBETZKY V. DLAUHOBETZ:
Bin neugierig, ob morgen in der Mittagszeitung — du, das is mein Lieblingsblatt, ob morgen also mein Gedicht erscheint, gestern hab ich ihr’s eingschickt. Willst es hören? Wart — (Zieht ein Papier hervor.)
TIBETANZL:
Hast wieder ein Gedicht gemacht? Worauf denn?
DLAUHOBETZKY V. DLAUHOBETZ:
Wirst gleich merken, worauf. Wanderers Schlachtlied. Das is nämlich statt Wanderers Nachtlied, verstehst —
Über allen Gipfeln ist Ruh,
Über allen Wipfeln spürest du
Kaum einen Hauch —
TIBETANZL:
Aber du — das is klassisch — das is ja von mir!
DLAUHOBETZKY V. DLAUHOBETZ:
Was? Von dir? Das ist klassisch, das is von Goethe! Aber pass auf, wirst gleich den Unterschied merken. Jetzt muss ich noch einmal anfangen. Also:
Über allen Gipfeln ist Ruh.
Über allen Wipfeln spürest du
Kaum einen Hauch.
Der Hindenburg schlafet im Walde,
Warte nur balde
Fällt Warschau auch.
Ist das nicht klassisch, alles passt ganz genau, ich hab nur statt Vöglein Hindenburg gesetzt und dann also natürlich den Schluss auf Warschau. Wenn’s erscheint, lass ich mir das nicht nehmen, ich schick’s dem Hindenburg, ich bin ein spezieller Verehrer von ihm.
TIBETANZL:
Du, das is klassisch. Gestern hab ich nämlich ganz dasselbe Gedicht gemacht. Ich habs der Muskete einschicken wollen, aber —
DLAUHOBETZKY V. DLAUHOBETZ:
Du hast dasselbe Gedicht gemacht? Gehst denn nicht —
TIBETANZL:
Ich hab aber viel mehr wie du verändert. Es heißt: Beim Bäcken.
Über allen Kipfeln ist Ruh,
Beim Weißbäcken spürest du kaum einen Rauch.
DLAUHOBETZKY V. DLAUHOBETZ:
Das is ja ganz anders, das is mehr g’spassig!
TIBETANZL:
Die Bäcker schlafen im Walde
Warte nur balde
Hast nix im Bauch.
DLAUHOBETZKY V. DLAUHOBETZ:
Du, das is förmlich Gedankenübertragung!
TIBETANZL:
Ja, aber jetzt hab ich mich umsonst geplagt. Jetzt muss ich warten, ob deins erscheint. Wenn deins erscheint, kann ich meins nicht der Muskete schicken. Sonst glaubt man am End, ich hab dich paradiert!«
Auch Christian Morgenstern schien die Nase voll zu haben von dem unerträglichen Kult, der um Goethes Gedicht veranstaltet wurde, vor allem aber von den gnadenlos unbegabten Nachäffereien. Sein »FISCHES NACHTGESANG«, von dem er 1905 behauptet, es sei das »tiefste deutsche Gedicht«, kann als eine direkte Parodie auf Goethes »WANDERERS NACHTLIED« gelten:18
Wenig später schließt sich ihm Joachim Ringelnatz an, der in seinem Gedichtband »KUTTEL DADDELDU« »DAS ABENDGEBET EINER ERKÄLTETEN NEGERIN« (Pardon, aber so heißt es nun mal) mit folgenden Versen ausklingen lässt:
»Drüben am Walde
Kängt ein Guruh – –
Warte nur balde
Kängurst auch du.«19
In der »LITURGIE VOM HAUCH« aus seiner »HAUSPOSTILLE« parodiert im Jahre 1924 ein anderes Genie, Bert Brecht, Goethes RUHE, die ihm wohl verdächtig bourgeois erschien. Brecht schlägt in den Versen 37 bis 40 seiner Liturgie zu — und wenigstens wir Ostdeutschen wissen, was wir von dem ROTEN BÄREN zu halten haben:20
Da kam einmal ein großer roter Bär einher,
der wusste nichts von den Bräuchen hier, das brauchte er nicht als Bär.
Doch er war nicht von gestern und ging nicht auf jeden Teer,
und er fraß die Vögeleien im Walde.
Da schwiegen die Vögelein nicht mehr.
Über allen Wipfeln ist Unruh.
In allen Gipfeln spürest du
Jetzt einen Hauch.
Wir werden bald wissen, dass Brecht Goethes Nachtlied nicht im Mindesten verstanden hat. Außerdem nimmt der Augsburger krasse Fehler in Kauf, die ihm jede linientreue Deutschlehrerin rot angestrichen hätte und die als Verfremdungseffekt wohl kaum durchgehen können: Die ‚Ruh‘ bzw. ‚Unruh‘ »verlegt er in die ‚Wipfel‘ und den ‚Hauch‘ in die ‚Gipfel‘. Dazu vertauscht er die Zeilen miteinander, insgesamt siebenmal. Wer einmal auf dem Kickelhahn stand an einem stillen Tag ..., der weiß, dass die Ruhe über den fernen Gipfeln liegt und der Hauch durch die nahen Wipfel geht; umgekehrt ist es ein lyrischer Unsinn“, meint der Radio-Redakteur H. Fritz.21
»Walter Moers’ Fantasy-Roman Die Stadt der Träumenden Bücher präsentiert Goethes Gedicht als Der Nurnenwald des zamonischen Dichters Ojahnn Golgo van Fontheweg, bei dem Goethes ›Vögelein‹ durch ›Nurnen‹ ersetzt sind, meterhohe, blutrünstige Tiere mit acht Beinen, die Bäumen ähneln und deshalb im Wald kaum zu erkennen sind.«22
Wir fragen noch einmal: Wie zerbrechlich ist ein Gedicht, das dergleichen aushält, zweihundert und mehr Jahre lang? Was also hat es mit diesem »WANDERERS NACHTLIED« Besonderes auf sich, so dass es nicht kaputtzukriegen ist?
IDYLLE ODER GEMETZEL?
Das Gedicht tritt erstmals am 6. September 1780 nach Sonnenuntergang in die Literaturgeschichte ein, als Goethe es, einunddreißigjährig, mit Bleistift auf die Bretterwand einer Jagdhütte auf dem Kickelhahn bei Ilmenau, dem »höchsten Berg des Reviers«, kritzelt. Ein Indiz dafür, dass dies wirklich geschehen ist, liefert ein Tagebucheintrag Karl Ludwig von Knebels vom 7. Oktober 1780, in dem es heißt: »Morgens schön. Mond. Goethens Verse. Mit dem Herzog auf die Pürsch [...] Die Nacht wieder auf dem Gickelhahn.«23 Ob jener Text mit dem auf uns überlieferten identisch war, wissen wir nicht, da die Originalhandschrift zerstört wurde. »Zwei frühe Abschriften (oder Mitschriften) von Herder und Luise von Göchhausen haben in Vers 1: Über allen Gefilden und in Vers 6: Die Vögel. Dies wird allgemein als authentische Früh- oder Erstfassung angesehen. Die 1869 fotografierte Handschrift auf der Bretterwand hat ebenfalls Vögel und nicht Vögelein, andererseits bereits Gipfeln in Vers 1. Das mag jedoch erst bei späteren Erneuerungen und Übermalungen, die Goethe selbst oder wohlmeinende Besucher im Lauf der Jahrzehnte an der verblassenden Handschrift in der Hütte vorgenommen haben, ein ursprüngliches Gefilden ersetzt haben.«24