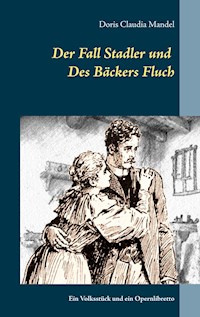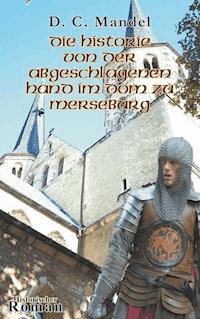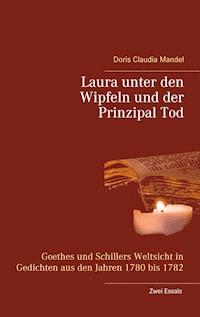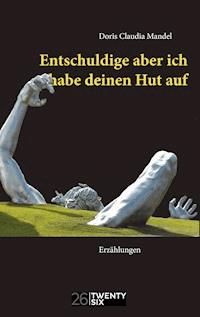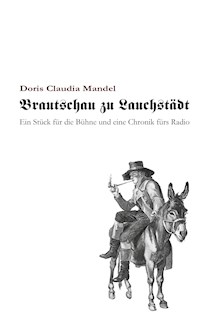
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im vorliegenden Band sind zwei Stücke um Episoden aus dem Leben des deutschen Schriftstellers Friedrich Schiller vereinigt. Das erste, »Der Knaster oder Das Göttliche auf Erden«, hat die längste Entstehungsgeschichte. Es war ursprünglich als Vorlage für ein Musical gedacht, das zu Beginn der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts am damaligen Landestheater von Halle an der Saale entstehen sollte, hat aber nach der Absage des Vorhabens im Verlaufe der Zeit begonnen, ein Eigenleben zu führen. Der Text konzentriert sich auf jenen Tag, an dem der Eleve Schiller aus der Stuttgarter Karlsakademie flieht und stellt neben dem Konflikt mit dem aufklärerisch despotischen Herzog jenen mit Schillers Kameraden in den Mittelpunkt. Das zweite Stück unter dem Titel »Brautschau zu Lauchstädt« ist für den Hörfunk oder vergleichbare Medien gedacht und weit nach dem ersten entstanden. Es hat die ménage à trois zwischen Schiller und den Schwestern Lengefeld zum Gegenstand, von der ersten Begegnung der drei bis ins Jahr nach der Hochzeit Schillers. Beide Texte orientieren sich stark an den Tatsachen, soweit sie uns zugänglich sind, verhehlen aber auch nicht die literarische Tradition, die hier und da zu Zitaten führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
ZUM BUCH:
Im vorliegenden Band sind zwei Stücke um Episoden aus dem Leben des deutschen Schriftstellers Friedrich Schiller vereinigt. Das erste, »Der Knaster oder Das Göttliche auf Erden«, hat die längste Entstehungsgeschichte. Es war ursprünglich als Vorlage für ein Musical gedacht, das zu Beginn der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts am damaligen Landestheater von Halle an der Saale entstehen sollte, hat aber nach der Absage des Vorhabens im Verlaufe der Zeit begonnen, ein Eigenleben zu führen. Der Text konzentriert sich auf jenen Tag, an dem der Eleve Schiller aus der Stuttgarter Karlsakademie flieht und stellt neben dem Konflikt mit dem aufklärerisch despotischen Herzog jenen mit Schillers Kameraden in den Mittelpunkt. Das zweite Stück unter dem Titel »Brautschau zu Lauchstädt« ist für den Hörfunk oder vergleichbare Medien gedacht und weit nach dem ersten entstanden. Es hat die ménage à trois zwischen Schiller und den Schwestern Lengefeld zum Gegenstand, von der ersten Begegnung der drei bis ins Jahr nach der Hochzeit Schillers. Beide Texte orientieren sich stark an den Tatsachen, soweit sie uns zugänglich sind, verhehlen aber auch nicht die literarische Tradition, die hier und da zu Zitaten führt.
Ein Theaterbühnenstück
für zwei Schauspielerinnen und sechs Schauspieler
Eine Radiochronik
für drei Sprecherinnen und zwei Sprecher
Inhaltsverzeichnis
Der Knaster oder Das Göttliche auf Erden: Ein Stück für die Bühne in XXVIII Bildern
Personen
Präludium Kasernenhof
Lazarett
Park
Hofwinkel bei den Kasernen
Schillers Zimmer im Haugschen Haus
Lazarett
Ankleidezimmer des Herzogs
Schillers Stube im Haugschen Haus
Park
Lazarett
Marstall
Schillers Wohnstube und die Diele davor
Schloss. Boudoir der Gräfin
Hofwinkel neben den Kasernen
Schloss. Eingangshalle
Marstall
Schloss. Privatraum
Lazarett
Arreststube
Schloss. Privat-Appartement
Vor dem Haugschen Hause
Lazarett
Vor dem Haugschen Hause
Lazarett
Arreststube
Vor dem Haugschen Hause
Außerhalb der Szene (im Off)
Schloss. Großer Festsaal
Lazarett
Anmerkungen
Brautschau zu Lauchstädt: Eine Radiochronik für drei Sprecherinnen und zwei Sprecher in XCII Szenen
Personen
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Anmerkungen
Der Knaster oder Das Göttliche auf Erden
Ein Stück für die Bühne in XXVIII Bildern
PERSONEN:
Schiller Der Dichter Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759 bis 1805). Von 1773 bis 1780 Eleve der Herzoglichen Militärakademie. Nach dem Abschluss seines Medizinstudiums Regimentsmedicus beim Grenadierregiment des Generalfeldzeugmeisters Augé. Wegen eines Schreibverbots und weil ihm untersagt war, Verkehr mit dem Ausland zu pflegen, floh er in der Nacht vom 21. zum 22. September 1782 zunächst nach Mannheim.
Herzog Herzog Carl Eugen v. Württemberg (1728 bis 1793). Am Hofe des Königs Friedrich II. von Preußen in Berlin erzogen. Regentschaft ab 1744, nachdem er vorzeitig mündig gesprochen worden war. Verschwenderischer Bauherr, kunstsinnig, rabiat und aufgeklärt. In erster Ehe acht Jahre mit Prinzessin Elisabeth Friederike Charlotte von Brandenburg-Bayreuth, einer Nichte des preußischen Königs, verheiratet. Hielt sich danach ein Dutzend Mätressen. Gründete die Herzogliche Militärakademie, um militärischen, politischen, künstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchs heranzubilden. Duldete dort bedeutende Wissenschaftler und Philosophen unterschiedlichster Weltanschauungen. Gleichzeitig kerkerte er Freigeister wie Christian Friedrich Daniel Schubart auf der Festung Hohenasperg ein und drohte Schiller mit einem gleichen Schicksal.
Gräfin Franziska von Leutrum, geborene von Bernerdin (1748 bis 1811). Zwanzig Jahre jünger als der Herzog. Ursprünglich mit einem begüterten Baron von Leutrum verheiratet, wird sie 1772 geschieden, nachdem der damals vierzigjährige Herzog sie entführt hatte. Da die legitime Gemahlin des Herzogs, wenn auch in getrennter Ehe, noch lebt, eine Verheiratung der beiden also unmöglich ist, lässt Carl Eugen durch ein Patent des Kaisers Joseph II. Franziska zur Reichsgräfin erheben, wobei sie das alte Wappen der Bombaste von Hohenheim erhält. Man sagt Franziska einen positiven erzieherischen Einfluss auf den Herzog nach. 1785, nach dem Tod der Herzogin, heiraten die beiden morganatisch (zu einer nicht standesgemäßen »Ehe zur linken Hand«). Während aus einer Ehe und sieben Beziehungen des Herzogs mit Mätressen insgesamt zwölf Kinder entstanden sind, bleibt Franziska kinderlos.
Charlotte Bürgerliche Tochter aus einer Liaison des Herzogs (nach seiner Liebschaft mit Franziska Theresia von Bernerdin zum Pernthurm und vor seiner Liaison mit Teresa Bonafoni). Wird als Nichte des Herzogs ausgegeben.
Ludwig Sohn des auf dem Hohenasperg inhaftierten Schriftstellers und Journalisten Christian Friedrich Daniel Schubart. Im Januar 1777 als Zwölfjähriger durch die »Gnade des Herzogs« in der Militärakademie untergekommen. Gegenstand der »fürstlichen Erziehung an Vaters Statt«. Nach Hafterleichterungen für seinen Vater so etwas wie ein Kammerjunge des Herzogs. Genießt eine gewisse Narrenfreiheit oder nimmt sie sich.
Frauenlob Pseudonym von Johann Christoph Friedrich Haug (der Jüngere). Studierte mit seinem Freund Schiller Rechtswissenschaft, Philologie und Philosophie. Sekretär des herzoglichen Kabinetts. Verfasser von Epigrammen und 300 »Hyperbeln auf Wahls ungeheure Nase«.
Grammont Joseph Friedrich. Eleve der Hohen Karlsschule, stammt aus Mömpelgard, ist wegen »Hypochondrie« in ärztlicher Behandlung. Ein Freund Schillers und später Pestalozzis.
Kronenbitter Furierschütze. Bursche Schillers. Als baumlang und von »groteskem Aussehen« geschildert. Stumme Rolle.
Eleven, Volk Stimmen aus dem Off
ZEIT DER HANDLUNG:
21. September 1782 im württembergischen Stuttgart.
ORTE DER HANDLUNG:
In und vor Schillers Wohnung im Haugschen Hause
Schloss. Eingangshalle sowie Privatzimmer
Lazarett (Bettensaal)
Park und Hofwinkel zwischen den Kasernen
Arrestraum
Marstall
BÜHNENBILD
Überall auf der Szene stehen Schilder mit der Aufschrift: »Das Toback Rauchen ist verboten. Wer sich dabei betreten lässt, wird unter Abnahme der Tabackspfeife ausgewiesen und mit einer Strafe von 1 fl belegt.«
KOSTÜME
Charlotte und die Gräfin tragen die ganze Zeit über knallblaue Schuhe, unabhängig davon, ob sie farblich zur übrigen Kleidung passen.
Präludium Kasernenhof
Frauenlob, Schiller, Kronenbitter.
Frauenlob schaut zu, wie die Soldaten, die nicht zu sehen, nur zu hören sind, zur Trommel Paradieren üben. Man bereitet die militärische Zeremonie für die Ankunft des russischen Großfürsten Paul vor. Schiller eilt, die Arzttasche in der Hand, ins Lazarett. Frauenlob studiert ihn.
Frauenlob: Was unterscheidet uns von dir?
Kurz, ohne jede Phrase:
Aus Geist und Leib bestehen wir,
Du, Freund, aus Geist und Nase.
Unterdessen hastet Schillers Bursche, der Furierschütze Kronenbitter, durch die Szene, immer quer über den Hof und zurück, schleppt mürrisch Bücherstapel von hier nach da, riesige Weinflaschen, Holzkegel samt Kugeln usw.
I Lazarett
Grammont. Später Schiller. Wachhabender (aus dem Off)
Zur Zeit mit Ausnahme eines Mannes unbelegt. Grammont rückt einen Stuhl. Er will sich erhängen. Er lässt ein Seil über einen Haken an der Zimmerdecke schwirren, zurrt es fest. Von draußen Pfiffe, Befehle, Marschtritte. Schiller stürmt herzu.
Schiller: Halt! Grammont! Haaalt!!
Er reißt Grammont vom Stuhl. Bei dem Gerangel verliert er eine Dose Kautabak, die er versehentlich mit dem Fuß unter eines der Betten stößt.
Ich hab nicht zugelassen, dass du den Schlaftrunk nimmst. Glaubst du, mit dem Strick ist es was anderes?
Grammont: (Weint.) Was pfuschst du mir immer dazwischen?!
Schiller: Ich bin dein Arzt.
Grammont: Ein Stümper bist du!
Schiller: Und dein Freund.
Grammont: Auch da ein Stümper!
Schiller: Geh aufs Krankenrevier!
Grammont: Was soll ich dort?
Schiller: Du bist ... unpässlich.
Grammont: Wen interessiert das?
Schiller: Mich. Ich hab eine Diagnose.
Grammont: Welche diesmal?
Schiller: Was dich quält, ist die Melancholie, sie rührt vom Unterleib her.
Grammont: Nicht von der – Nase?
Schiller: Das ließe sich justieren. Freilich nur im Krankenrevier. Geh hin! Schreib ihnen auf, dass es vom Unterleib kommt! Sag ihnen, dass ich dir gesagt habe, dass es vom Unterleib kommt.
Grammont: Brauchst du wieder mal einen Avis an deinen herzoglichen Vater?
Von fern draußen ein Pfiff.
Wachhabender (Aus dem Off):
Schiller, zum Rapport!
Grammont: Wenn ich wenigstens Tabak hätte. Warum hast du mir alles weggenommen?
Schiller: Weil es deine Melancholie noch viel schlimmer machen würde. Hier, trink, das wird dir guttun.
Er entstöpselt eine Taschenflasche.
Grammont: Vorgestern hast du behauptet, Tabak wäre Medizin!
Schiller: Nicht für dich.
Grammont: Du rauchst doch auch. Und schnupfst. Und kaust. (Trinkt. Ekelt sich.)
Schiller: Das ist was anderes. Ich bin ein gefestigter Charakter.
Grammont: Wenn ich hier rauskäme, wäre ich auch einer. Dann ginge es mir besser. Schlechter als hier drinnen kann es mir nicht gehen, nirgendwo auf der Welt.
Vom Flur draußen erneut der Pfiff.
Grammont: (Wirft sich aufs Bett.) Ich muss kotzen.
Schiller: Das kommt vom Brechsteinwein.
Grammont: Vom was?
Schiller: Drei Gran in vier Unzen heißen Wassers aufgelöst. Wenn du schon nicht aufs Krankenrevier willst, dann probier ein Letztes. Das Teinacher Bad! (Grammont übergibt sich.) Das erfrischendste Klima, die sattesten Mineralien, die pläsierlichste Gesellschaft ... (Grammont übergibt sich.) Ich verspreche dir: Wenn auch das nicht anschlagen sollte, dann, dann ...
Energischer Pfiff vom Flur draußen.
Wachhabender (Aus dem Off):
Schiller! Sofort!
Schiller: Ich muss los!
II Park
Charlotte, Gräfin. Später Frauenlob.
Die beiden Frauen beim Spazierengehen, Zeitung lesend und das Gedicht zitierend. Frauenlob beobachtet und kommentiert die Szene.
Charlotte: »Deine Blicke, wenn sie Liebe lächeln, ...
Gräfin: ... Könnten Leben durch den Marmor fächeln, ...
Charlotte: ... Felsenadern Pulse leih’n; ...
Gräfin: ... Träume werden um mich her zu Wesen, ...
Charlotte: ... Kann ich nur in deinen Augen lesen: ...
Beide: ... Laura, Laura mein!« -
Charlotte: Die NACHRICHTEN ZUM NUTZEN UND VERGNÜGEN steigen empor aus den Niederungen. Mit schlüpfrigen Oden.
Gräfin: Der Herzog schimpft die Gazette »deutsche Suppe«. Er liest sie nicht. Eine der wenigen Gescheitheiten, die er sich leistet.
Charlotte: Kennt Ihr den Dichter?
Gräfin: Flüchtig – ein ehemaliger Zögling unserer Akademie.
Charlotte: Aus dem theologischen Kurs?
Gräfin: Regimentsarzt.
Charlotte: (begeisert) Arzt?
Gräfin: Echauffiere dich nicht! Er ist kein Ibn Sina.
Charlotte: Kein wer?
Gräfin: Avicenna.
Charlotte: (Guckt.)
Gräfin: Schon gut. Man munkelt, sein medizinisches Wissen stamme aus einem einzigen Apothekeralmanach, und der sei zwanzig Jahre alt. Wahrscheinlich ein Lehrbuch für Viehärzte. Er mache Pferdekuren mit den Grenadieren, heißt es. Vorige Woche erst soll der Flügelmann meines Gemahls einen Esslöffel voll Ipekakuanha heruntergewürgt haben müssen. Der arme Kerl habe sich hinterher gekrümmt wie ein Regenwurm. Zwar sei er am nächsten Tag wieder hergestellt gewesen, aber nur, weil er nichts bei sich behalten konnte außer seiner Muskete.
Charlotte: Was, um Gottes Willen, ist das: I-pe-kak-uan-ha?
Gräfin: Das Pulver der Brechwurz. Schillers Lieblingsarznei. Er streut sie nach dem Prinzip Zufall.
Charlotte: Und das Mädchen?
Gräfin: Welches Mädchen?
Charlotte: Das aus dem Gedicht. Laura.
Gräfin: Schiller bewohnt ein Zimmer im Erdgeschoss des Haugschen Hauses, Hauptstätter Gasse, neben dem Glockengießer. Zur Untermiete bei der Witwe eines Regimentsquartiermeisters, der Vischerin.
Charlotte: Laura Vischer?
Gräfin: Ach was, Kind! »Laura», das ist doch nur der Tarnname, den ihr der Dichter verpasst hat. Er nenne sie nach den Sonetten Petrarcas so, lässt er verbreiten. Ich denke eher, er tobt eine fatale Vorliebe fürs Bürgerliche aus. Die Lauras kommen in Mode. Die Arismenen haben ausgedient.
Charlotte: Wo ist der Unterschied?
Gräfin: Im Blickwinkel. Heutzutage glauben die Herren, ein schönes Weibsbild müsse das Gesicht einer Engländerin haben, die Brüste einer Deutschen und den Hintern einer Italienerin. Die Vischerin allerdings hat weder das eine, noch das andere. Sie ist seit zweieinhalb Jahren Witwe. Man rühmt ihr blaue Augen und gewisse Kenntnisse im Klavierspiel nach. Sie sei wohl auch ein gutmütiges Seelchen. Was das bedeutet, kannst du dir denken.
Charlotte: Nein, woher?
Gräfin: Ach, Kind! Wenn uns die Männer gutmütig nennen, dann halten sie uns weder für geistreich, noch für hübsch. Aber ohne wenigstens eines von beidem zu sein, kommen wir schlecht durch. Unter diesem Aspekt ist die Vischerin keine Frau von Welt. Außerdem soll sie die dreißig längst überschritten haben.
Charlotte: Da schlag eine lang hin!
Gräfin: Gemach, gemach. Für Urteile über die Abträglichkeit des Alters bist du noch nicht beritten genug.
Charlotte: Und dennoch: Diese Frau ist geadelt: eine Ode nur für sie ..., von so trauriger Kraft ...
Gräfin: Weil sie überspannt ist. Alles, was überspannt ist, hat Kraft. Wie ein Bogen, von dem der Pfeil noch nicht abgefeuert. Und weil der Pfeil noch nicht abgefeuert, wirkt die Kraft der Überspanntheit so traurig.
Charlotte: Bitte?
Gräfin: Versuchen wir’s mal so: Auf deinen Dichter hat die Be-schreibung einer Landschaft stets mehr Eindruck gemacht, als ihr Anblick in der Natur selbst. Den Gesang der Nachtigall lernte er zuerst aus den Büchern lieben. (Charlotte guckt.) Schon gut. Ich meine – Kind, sieh mal: Diese handgeschnitzte Sinnlichkeit, in platonischen Schwulst eingewickelt, das ist … Begreifst du?
Charlotte: Doch, doch.
Gräfin: Lassen wir’s.
Charlotte: Muss er nicht ein großartiger Mensch sein?
Gräfin: Der Bibliothekarius Petersen findet, Schiller sei ein wenig verbogen. Hätte eine seltsame Vorliebe für kratzende Weine, stinkenden Schnupftabak und garstige Weiber. Oder für kratzenden Schnupftabak, garstige Weine und stinkende Weiber? – Gleichwohl.
Charlotte: Aber doch wohl Seelentiefe?
Gräfin: Vor allem ein leeres Geldsäckel.
Charlotte: Ihr wollt ihn mir mies machen!
Gräfin: Seine Schulden sind ein Faktum. Sehshundert Gulden.
Frauenlob: Schwer drückt ein voller Beutel, schwerer – ein leerer.
Gräfin: Die Eleven loben, Schillers Sprache sei affektvoll. Ich finde, der Affekt ist von der Natur, dass seine Stimme durch sämtliche Register kreischt wie eine verrostete Gartentür. Die Eleven loben, seine Mimik sei beweglich. Ich finde, die Beweglichkeit ist von der Natur, dass er seine Visage verrenkt wie ein Kutschwagen den Bock, wenn ihm die Deichsel bricht. Und so ’ne Nase! Die Eleven sagen, sie sei adlergleich. In Wirklichkeit ist sie der reinste Papageienschnabel.
Frauenlob: Von der Geburt hat mir die Base
Des Accoucheurs erzählt:
Zwei Tage lang kam seine Nase,
Am dritten er zur Welt.
Gräfin: Dazu die kleinen Augen, rot umrändert, die Haare, genau so rot, als wie beim Leibhaftigen leibhaftig. Dieser Schlaks misst sechs Fuß, drei Zoll in der Höhe! Und denk dir nur, was er in der Paradeuniform für Figur macht: eingepresst in diesen engen, preußischen Schnitt. Der Hut ist so winzig, dass er kaum den Kopfwirbel bedeckt. Dann der lange, dicke Zopf. Sein Hals, nicht weniger lang als der Zopf, in eine rosshärene Binde gezwängt wie in eine Garotte. Die Gamaschen fortwährend mit Schuhwichse bekleckert, weil ihm, wie er selber sagt, diese vulgären Mätzchen der Putzerei am … am … na, du weißt schon … Der Filz, den sie unter den Gamaschen tragen, macht seine Waden so stramm, dass sie dicker sind als die Oberschenkel.
Charlotte: Nein!
Gräfin: Wenn ich’s doch sage. Oben sind die knappen Hosen, die pressen …, die pressen alles zusammen. Wenn Schiller sich in seiner Uniform fortbewegen soll, so vermag er nicht, die Knie bis zum Anschlag durchzubiegen und stakst herum wie ein Storch. Wie ein Storch. So:
Sie ahmt ihn nach.
Charlotte: So viel Kenntnis des Details?
Gräfin Wie, wenn es der Gegenstand verdiente? Immerhin ist diese Ode fehlerfrei!
Charlotte: Aber, sagtet Ihr nicht, überspannt?
Gräfin: Nichtsdestotrotz fehlerfrei.
Charlotte: Dann wäre der Dichter also doch ein großartiger Mensch?
Gräfin: Ein Mensch, mein Gott, ja, sicher. Aber auch ein Mann? Oder doch gerade. Oder, wenn man so will ..., tja, Kind, weißt du ... Was hat das eine eigentlich mit dem anderen zu tun?
III Hofwinkel bei den Kasernen
Schiller, Ludwig.
Abends. Schiller mit Büchern unterm Arm.
Schiller: (Er kramt in seinen Taschen und verliert dabei ein Buch ums andere.) Ludwig? Bist du’s?
Ludwig: Wer sonst?
Schiller: Hast du wenigstens Tabak dabei? Meinen muss ich irgendwo verschludert haben.
Ludwig: Nimm Staub!
Schiller (Schnupft widerwillig Staub vom Fußboden):
Ludwig: Ich hatte gehofft, du wärst längst fertig.
Schiller: Womit?
Ludwig: (empört) Womit? Mit Packen, Alter! Heut früh Schlag zehn sollte alles parat stehn. Vorhin, als ich sie holen will, deine Koffer, was seh’ ich?, die blanke Diele, nichts ist gerichtet, Kronenbitter hat keine Ahnung von nichts. Müssen wir dir diese Arbeit auch noch abnehmen?
Schiller: Ich war beschäftigt.
Ludwig: Wegen des Idioten im Lazarett, der vor lauter Wichserei trübsinnig geworden ist?
Schiller: Ich wollte gerade anfangen mit packen, da sind mir die »Physiognomischen Fragmente« von Lavater unter die … na, Nase … gekommen, die mussten erst beantwortet sein.
Ludwig: (Er zieht eines der Bücher hervor.) Diese hier? (Liest, während er blättert.) »Ohne zarte Beugungen, kleine Brüche, merkbare Schweifungen, gibt es keine geistig-große Nase – Sehr abwärts sinkende Nasen sind nie wahrhaft gut, oder edel. Immer sinnen sie erdwärts, sind verschlossen, kalt. – Hast du eine lange, hohe Stirn, so mache nie Freundschaft mit einem beynahe kugelrunden Kopf.« – Verstehe. Das musste natürlich erst beantwortet sein. Mann, eine Chance wie heute kriegen wir nie wieder. Das Fest. Die Menschenmassen. Der Trubel. Am Abend die Hirschhatz. Die Fluchtlinie wäre ideal gedeckt. Aber du – abwärts sinkende Nasen. Wir können dir einen Vorsprung verschaffen. Das Gelage zieht sich fünf Stunden hin. Bevor es zu Ende ist, bist du in Sicherheit.
Schiller: Fünf Stunden sind ein Witz. Bis zur Grenze brauchen wir zehn oder zwölf.
Ludwig: Das haben wir doch schon hundertmal durchgekaut …
Schiller: Die Sache ist mir zu kitzlig.
Ludwig: Aha. Weißt du, was man sich erzählt? Freund Schiller, das zweite Jahr an der Akademie unter Oberaufseher Nieß aus der Klasse der Chargierten. Nieß mit seinem besonderen esprit de detail, einer Betriebsamkeit ohnegleichen. Jedes Fältchen, jedes Fleckchen musste vor ihm kapitulieren und sich zu erkennen geben. Schiller bekannt für seine Unreinlichkeit. Und nun dieser ungelockte Kopf voll Papilloten, mit diesem enorm langen, falschen Zopf. Nieß rotzt ihn an: Schweinepelz (hat er vom Herzog), Schlamperei schlimmste Sabotage im Heer. Wehe, Durchlaucht kriegt spitz! Eines Tages Defilee. Parade von geringem Grade, zwar mit gewöhnlichem Anzug, aber vier Papilloten an jeder Seite in zwei Etagen. In Höhe des Herzogs scheißt sich Schiller in die Hosen!
Schiller: Hundsfott! (Tobt, außer sich vor Wut.) Ich bin von feinerem Stoff als Ihr alle zusammen!
IV Schillers Zimmer im Haugschen Haus
Frauenlob und Kronenbitter
Ein großer Tisch, zwei Bänke, an der Wand eine schmale Garderobe mit Hosen. Kronenbitter ordnet in einer Ecke einen Stapel mit Büchern des »Räuber«-Drucks. In einer anderen Ecke räumt er Kartoffeln, schmutzige Teller und Weinflaschen, darunter etliche Dreibätzner, beiseite. Zwischendurch trinkt er aus den Flaschen und übt mit den Kartoffeln Zielwerfen.
Frauenlob: (Er nimmt eines der Bücher, hält es hoch, liest den Titel.) DIE RÄUBER. (Er schiebt sich das Buch unters Wams.) Wenn ich jemanden für eine gute Kopfarbeit brauche, Kronenbitter, dann wähle ich, so seltsam das klingen mag, immer einen Mann mit einer langen Nase – vorausgesetzt, er besitzt die nötige Bildung. Natürlich kein Weib, so lang dessen Nase auch sein möge. Ein Weib mit einer langen Nase erweist sich zumeist als jähzornig und wankelmütig. Hingegen ist der Atem eines Mannes mit einer langen Nase kühn und frei, und sein Hirn wie sein Herz und seine Lunge sind kalt und klar wie ein Gebirgssee. In meiner jahrelang währenden Menschenbeobachtung habe ich herausgefunden – und zwar in allen Konstellationen so gut wie unveränderlich –, dass eine lange Nase und ein guter Kopf untrennbar miteinander verbunden sind. Vorausgesetzt, es handelt sich nicht um ein trichorhino-phalangeales Syndrom. Problematisch wird es allerdings, wenn es gilt, eine gute Kopfarbeit zu vermeiden, sich aber ein Mann mit einer langen Nase in meiner Nähe bewegt. Wie verfahre ich in einem solchen Fall? Es dürfte kaum praktikabel sein, ihm die Nase abzuschneiden, so dass eine Stumpfnase daraus wird wie bei einem Affen und sich derselbe Mann, eben noch brillant, zum Dumpfen, Ungestümen und Verlogenen wandelt. Weniger auffällig wäre, gleich den ganzen Mann zu beseitigen, samt Nase. Das aber verbietet der Katechismus. Weißt du übrigens, Kronenbitter, was der Herzog deinem Regimentsmedicus angedroht hat? Noch ein Misserfolg, und er könne sehen, wo er bleibt.
V Lazarett
Schiller, Gramont.
Schiller sucht Grammont, findet ihn aber nicht.
Schiller: Grammont? (Er irrt umher, sucht seine Dose Tabak, wirft dabei allerlei Krimskrams von Betten und Konsolen.) Mach keinen Quatsch! Wir können über alles reden. Aber jetzt. Morgen ist es zu spät. (Setzt sich erschöpft auf eine Pritsche.) Ich flehe dich an! Du musst unbedingt ins Krankenrevier. Oder beim Herzog den Aufenthalt im Teinacher Bad beantragen. Oder, noch besser, beides. Erst ins Krankenrevier, danach zur Kur. (Er sucht unter den Pritschen.) Melde dich unbedingt heute noch! Morgen bin ich vielleicht schon fort.
Ein Geräusch. Schiller entdeckt Grammont. Er zieht ihn hervor. Die beiden balgen sich.
Grammont: Feine Beichte! Erst holst du mich zurück in dieses Scheißleben und dann lässt du mich sitzen.
Schiller: Hast du nicht meinen Tabak gesehen?
Grammont: Das Maul reißt du auf wie ein Löwe, aber in Wirklichkeit bist du feige wie ein Quakfrosch im Tümpel.
Schiller: Die Lage hat sich geändert.
Grammont: Für mich nicht.
Schiller: Alle meine Freunde warnen mich. Wenn ich hierbleibe, sperrt man mich ein, auf der Festung. Ich glaub’s zwar nicht. Aber wer weiß. Zumindest sind das keine rosigen Aussichten.
Grammont: Quak, quak! Weswegen sollte man so was tun?
Schiller: Wegen meines ... den Tabak hast du nicht gesehen? Wegen meines Stücks. (Grammont lacht.) Lach nicht! Ich kenne einen, mit dem hat man’s genauso gemacht, ein Journalist.
Grammont: Schubart? Noch so einer. Quak, quak.
Schiller: Früher sei er ein Kerl wie ein Baum gewesen, heißt es. Nichts und niemandem als der Wahrheit verpflichtet. Ein deutscher Voltaire. Er hat unsere Akademie eine Sklavenplantage genannt und als der Herzog zu diplomatischen Gesprächen nach London reiste in seiner Zeitung spekuliert, der Regent von Württemberg wolle England Truppen überlassen, in einer Stärke von dreitausend Mann. Damit war ein streng gehütetes Staatsgeheimnis gelüftet. (Grammont lacht.) Carl Eugen ließ ihn im Alten Turm in den Kerker werfen, ohne Anklage, ohne Prozess. Der Herzog stand mit seiner Konkubine an einem der Fenster im Hauptgebäude, um sich an dem Anblick zu ergötzen. Schubart ging gleich für dreihundertsiebenundsiebzig Tage in Isolation. Am Anfang lag die arme Sau auf Stroh, das feucht war wie der Fels ringsum. Sein Schlafrock verfaulte ihm am Leib. Erst im zweiten Jahr durfte er den Gottesdienst besuchen. Dann dauerte es ein weiteres Vierteljahr, bis man ihm gnädigst gestattete, wieder mit Menschen zu sprechen – und zwar mit seinen Bewachern. Die größte Gunstbezeigung war, als man ihm zuletzt neben der Bibel ein zweites Buch zu lesen gab, die »Klagen oder Nachtgedanken über Leben, Tod und Unsterblichkeit«, das, wie drücke ich mich aus?, Erbauungsbuch eines Engländers. »Wem man mit eiskalter Hand ins Herz greift, und es ihm quetscht, dass blutige Tropfen in beiden Augenwinkeln hängen, dem ist’s nicht banger, als mir war«, das sagte mir Schubart einmal.
Grammont: Sagte dir Schubart? Er? Wann?
Schiller: Einmal. Als ich bei ihm war.
Grammont: Du? Nicht mal seine Frau darf zu ihm. Aber du?
Schiller: Warum nicht? Vor fast einem Jahr, im November.
Grammont: Wie bist du da hinein gekommen?
Schiller: Er hatte mich eingeladen.
Grammont: Zum Kaffeeklatsch, quak, quak!
Schiller: Er hatte von meiner Tragödie Wind bekommen und davon, dass mir eine Erzählung von ihm als Vorlage dazu gedient hat, aus der »Geschichte des menschlichen Herzens«. Ich steige also hinauf zur Festung, der neue Kommandant lässt sich schmieren. Nun rate mal, wen ich antreffe! Schubart schon, das stimmt. Aber denselben Haudegen und Schürzenjäger, der mir die gesetzlosen Tatmenschen so schmackhaft machte? Jenen unvergleichlichen Federfuchser? Nein. Stattdessen steht mir ein versteinertes Fossil vis-a-vis, das mir unter einem Sturzbach heißer Tränen um den Hals sinkt. Mit erhobener Schwurhand beteuert er: Alltäglich danke er Gott auf Knien für die Gnade, die seine Durchlaucht, der Herzog, ihm hat angedeihen lassen, als er ihn einsperrte. In der Einsamkeit seines Verlieses wäre er zur Ruhe gelangt und zu höherer Einsicht. Der Oberst Rieger seligen Angedenkens und der Dekan Zilling haben ganze Arbeit geleistet. »Meine Zeit«, so ließ sich Schubart herab, zu mir zu sprechen, »neigt sich dem Ende entgegen. Mein Werk, unvollendet und«, sprach er huldvoll, »durch Maßlosigkeit verdorben, geht in den Besitz der Jüngeren über«. Ja – wie, frag ich dich, Grammont, geht ein Werk in Besitz über? Muss es alleine bei dem Versuch nicht zwangsläufig zertrümmert werden? (Grammont lacht.) In die Zellenwand ist ein Eisenring eingelassen, an den soll der Delinquent gekettet werden im Fall der Fälle. Tagein, tagaus die Bedrohung. Einer seiner Mitgefangenen sitzt schon seit achtundzwanzig Jahren im Turm. Der vermeintliche Missetäter, zwischen Efeu, Fledermäusen und Käuzchen, zählt seine Pulsschläge, seine Atemzüge, ununterbrochen memoriert er alles, was er je gelernt hat. Ein kleiner Eisenring, unscheinbar, in einer Zellenwand. Das reicht. Vielleicht hast du Recht, Grammont, und wir sind feige Frösche im Tümpel.
Grammont: Nicht wir. Du! Quak, quak! Und ein ganz verlogenes Individuum! Quak, quak! Und kein Tabak, dass du’s weißt, hier nicht, er ist nämlich verboten, und ich tue nichts Verbotenes, quak, quak!
VI Ankleidezimmer des Herzogs
Herzog, Ludwig.
Ludwig: Das Parfüm, Eure Durchlaucht. (Er verspritzt es aus einem Flakon.) Moschus. Direkt aus Frankreich. Gehört zu den Odores hircini. (Der Herzog unverständig.) Zu den Bocksgerüchen.
Herzog: Um des Himmels Willen! Geh sparsam damit um!
Ludwig: Stimmt, zu viel davon stinkt. Im Gegensatz zum Geld.
Herzog: Schon wieder so eine Anspielung?
Ludwig: Würd’ ich mir nie erlauben.
Herzog: Also, raus damit, was tuschelt man?
Ludwig: Es geht um die fünfzigtausend.
Herzog: Jeder Depp weiß, dass immer alles teurer wird.
Ludwig: Gleich um fünfzigtausend Gulden im Jahr?
Herzog: Die steigenden Kosten.
Ludwig: Welche, wenn mir die Frage gestattet ist?
Herzog: Was geht dich das an?!
Ludwig: Ich bin Steuerzahler.
Herzog: Das wüsst‘ ich. – Es ist für wohltätige Zwecke.
Ludwig: Genau daran erhitzen sich die Gemüter.
Herzog: Wie denn, jetzt auch schon, wenn sich ein Fürst großmütig zeigt? Was für eine Welt!
Ludwig: Man stößt sich an dem Zufall.
Herzog: Der wäre?
Ludwig: Dass das Feuerwerk von heute Abend justament fünfzigtausend Gulden kostet.
Herzog: Ich kann nichts für die Preise, die machen andere. Im übrigen wird es bei diesem Zuschuss nicht bleiben, insgesamt gesehen. Zusätzlich muss ich, so in etwa, hunderttausend beschaffen, am besten noch mehr.
Ludwig: Ich weiß, es geht mich nichts an. Aber wofür?
Herzog: Zum Kauf von Gütern bei Hohenheim.
Ludwig: Aha, für die Frau Gräfin.
Herzog: Das ist doch nun eine wirklich unbedeutende Summe, findest du nicht? Trotzdem wollte sie mir der Ausschuss beim besten Willen nicht zubilligen.
Ludwig: Beim schlechtesten Willen.
Herzog: Ich drohe also, nun doch diese österreichische Prinzessin zu heiraten, diese ..., diese Dingsda. Ich denk mir so, spekulativ, dass dem Ausschuss deren Nase nicht passen könnte. Weil sie katholisch ist. Prompt bewilligt man mir vierzigtausend Gulden Leibrente. Aber, ich bitte dich: vierzigtausend! War davon je die Rede gewesen? Ich erhöhe meine Forderung postwendend auf fünfzigtausend nebst einem Vorschuss von hundertfünfzigtausend. Da ningelt der Ausschuss schon wieder rum. Zu meinem größten Bedauern kann ich nun nicht mehr warten mit dem Heiraten. Mich saugt’s förmlich hinab ins eheliche Bett der Katholikin. Da kommt der Ausschuss gehörig ins Schwitzen.
Ludwig: Das verriecht sich.
Herzog: Qu’est-ce qu’il y a?
Ludwig: Ich meine: das Parfüm. Ihr habt mit einer Hand gewedelt, als wär’s euch lästig.
Herzog: So. Jedenfalls wird meine Forderung endlich erfüllt. Nicht auszudenken, wenn ich hätte Ernst machen müssen. Noch bevor sie Luft schnappen und sich besinnen können, eröffne ich diesen Kleinkrämern, dass ich mir meine liebe Franziska zur linken Hand antrauen lassen will. Ich verlange sechzigtausend Gulden für die Versicherungsurkunde. Was nun? Einerseits kann keiner meine Fränzel leiden, andererseits sind alle froh, um den Katholizismus herumgekommen zu sein. Jene Opfer, die man der eigenen Religion in den verflossenen Jahren gebracht zu haben würde glauben dürfen ..., also: das alles wäre nicht vergebens gewesen. Man überschreibt mir die läppischen fünfzigtausend per anno, also die Leibrente, und das Restliche noch dazu und verrechnet alles unter der Rubrik AUF BESONDERE DEKRETE. Stimmt ja auch. Sollte bei der nächsten Rechnungsabhör oder überhaupt jemals jemandem aufstoßen, wer der wirkliche Empfänger des Geldes gewesen ist, so kann man ihm doch zumindest Patriotismus nicht absprechen.
Ludwig: Hurra!
Herzog: Da! Sag ich’s nicht? Immer das letzte Wort!
VII Schillers Stube im Haugschen Haus
Schiller, Charlotte.
Draußen vor der Tür auf dem Stiegenabsatz. Schiller, Pfeife im Mund, fluchend, weil er den Schlüssel nicht findet. Kurzentschlossen tritt er die Tür ein. Krachend zerspringt das Schloss, die Tür schlägt auf und gegen die Wand. Drinnen Charlotte, die erschreckt aufschreit. Am Boden Dutzende leere Weinlaschen.
Schiller: Alte Drecksau! (Bemerkt Charlotte) Und Ihr?
Charlotte: Was »Und ich«?
Schiller: Wie seid Ihr hereingekommen?
Charlotte: (Hält sich die Nase zu) Durchs Fenster jedenfalls nicht. Das stand mindestens schon zwei Jahre nicht offen.
Schiller: Auch das noch! Eine Ulknudel!
Charlotte: (Sie ist nicht in der Lage, den Blick von ihm zu wenden) Seine Wirtin war so freundlich.
Schiller: Da kann man geteilter Meinung sein.
Charlotte: Sie ist doch wohl Seine Wirtin?
Schiller: Wenn Ihr die Vischerin meint, ja.
Charlotte: Wieso dann geteilter Meinung?
Schiller: Sie ist nicht freundlich.
Charlotte: Sie sagte, ich dürfe hier warten.
Schiller: So ganz ohne Begleitung? Auf wen?
Charlotte: Auf Ihn.
Schiller: (sieht sich um) Auf mich? Warum?
Charlotte: Ich wollt’ Ihn sehn.
Schiller: Starrt Ihr mich deshalb an wie eine römische Statue? (Er kramt nach dem Schlüssel.)
Charlotte: Mein Gott, was hat Er für eine riesige Nase! (Hält sich nun auch noch den Mund zu)
Schiller: Die hab ich mir selber zurechtgebogen. Erst war sie klitzeklein. Dann habe ich so lange an ihr gezupft und gezogen, bis sie einen Sattel bekam.
Charlotte: Hat Er wegen der ewigen Zupferei keine Hand frei, dass Er seine Tür mit den Füßen öffnen muss?
Schiller: Mein Schlüssel ist weg. Habt Ihr ihn gefunden?
Charlotte: Aber es war doch verriegelt.
Schiller: Na und?
Charlotte: Von außen. Hier drinnen kann der Schlüssel also nicht sein.
Schiller: Wie das?
Charlotte: Ha! Weil verriegelt war, von außen. Dazu braucht’s den Schlüssel. Und zwar von außen.
Schiller: Ei Blitz! Habt Ihr ihn draußen gefunden?
Charlotte: Ich habe nicht danach gesucht.
Schiller: Warum nicht?
Charlotte: Weil ich nicht ... Ist das die Möglichkeit?!
Schiller: Man kann einen Schlüssel draußen fallen lassen und dann aus Versehen mit dem Fuß durch den Türschlitz stupsen. Oder mit Absicht. Mit einer Tabakdose geht das nicht, das weiß ich.
Charlotte: (verstört) Eigentlich bin ich zu was ganz anderem hier.
Schiller: Nämlich?
Charlotte: Ihn zu sprechen. (Sie nimmt sich nebenbei wie zufällig eines der »Räuber«-Bücher .)
Schiller: Das habt Ihr soeben getan. Adieu!
Charlotte: Wie?
Schiller: Hört Ihr schwer? (Will Charlotte das Buch abjagen.)
Charlotte: Er schickt mich fort?
Schiller: Hierbehalten darf ich Euch nicht.
Charlotte: Aber ich bin Sein Gast.
Schiller: Ein ungebetener.
Charlotte: Und ein Frauenzimmer von Stand.
Schiller: Wer alleine in der Stube eines fremden Mannes auf einen fremden Mann wartet, ist womöglich ein Frauenzimmer, aber ganz bestimmt keines von Stand. Wie dem auch sei – die Pflicht beruft mich ab.
Charlotte: Gerad’ erst ist Er vom Dienst heimgekehrt.
Schiller: Der Herzog will Visite machen. Einen Selbstmörder inspizieren, außer der Zeit. Ich also nichts wie her, meine Bücher einsacken. Ohne die bin ich blind. Da – der Schlüssel weg. Dies Hindernis war am leichtesten zu beseitigen. Jetzt harrt ein höheres meiner. Ich hab’s eilig. Und wenn ich’s eilig habe, blick ich durch die Dinge wie durch Thüringer Glas. (Er entwendet Charlotte das Buch, wirft es in die Ecke und schiebt das Mädchen zur Tür hinaus.)
VIII Park
Volk. Später Charlotte, Frauenlob.
Unsichtbare Spaziergänger singen leise ein Lied:
Knaster ist mein Element!
Dieser kann an trüben Tagen
Meine Feinde niederschlagen,
Die man Gram und Sorgen nennt.
Knaster ist mein Morgenstern,
Der mich aus den Federn treibet
Und mein erstes Frühstück bleibet.
Nüchtern rauch ich gar zu gern.
Knaster ist mein Medikus.
Ich darf keine Pillen brauchen,
Wenn ich von dem vielen Rauchen
In die Hosen niesen muss.
Charlotte mit Frauenlob bei einem konspirativen Treff.
Charlotte: Haben Sie’s mit?
Frauenlob: (Holt das Buch hervor.) Mir ist nicht wohl dabei.
Charlotte: So geht’s den meisten Verrätern. Sie sind doch selbst ein Dichter. Was meinen Sie, lohnt sich das Risiko?
Frauenlob: Sagen wir mal so:
Gelingt’s, die irre Maus zu fah’n,
So kostet es ihr Leben.
Kühn fraß sie meinen Klopstock an,
Und Schiller stand daneben.
Charlotte: Da haben Sie aber keine sehr hohe Meinung.
Frauenlob: (Reicht ihr das Buch) Kein Verleger wollte das Manuskript freiwillig haben. Schiller sah sich genötigt nachzuhelfen. Das macht selten einen guten Eindruck unter den Kollegen.
Charlotte: Nachzuhelfen? Womit?
Frauenlob: Dreimal dürfen Sie raten.
Charlotte: Mit Geld?
Frauenlob: Mit Glasperlen nicht!
Charlotte: Von seinem Gehalt kann er sich kaum seine tägliche Flasche Wein leisten.
Frauenlob: Also gut: Ich war’s, der geblecht hat. Ein Freundschaftsdienst.