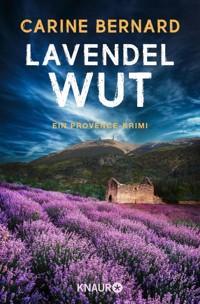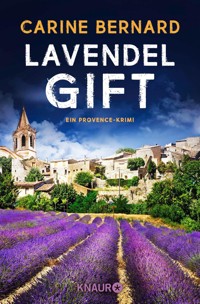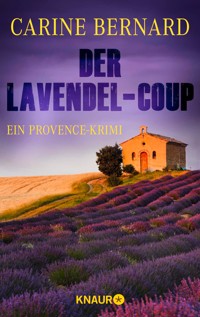9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Lavendel-Morde
- Sprache: Deutsch
Der Duft von Blut liegt über den Lavendelfeldern der Provence ... »Lavendel-Tod« ist ein unterhaltsamer Frankreich-Krimi mit der außergewöhnlichen Ermittlerin Molly Preston, der uns mitten in die atmosphärische Provence entführt. Der Cosy-Krimi ist die noch einmal vollkommen überarbeitete Neuausgabe des bereits unter dem Titel »Der Lavendel-Coup« erschienenen Werkes der Autorin Carine Bernard. »Lavendel-Tod« ist der erste Band der Reihe »Die Lavendel-Morde«, eine Cosy-Crime Reihe im malerischen Setting der Provence. Ein Fall von Wirtschaftskriminalität führt EU-Ermittlerin Molly Preston nach Südfrankreich, in ein beschauliches Dorf zwischen alten Olivenbäumen und den ewig singenden Zikaden. Bei ihren Ermittlungen stößt sie auf geheimnisvolle Zeichen an der Wand einer kleinen Kapelle. Mit der Unterstützung ihres Freundes Charles – seines Zeichens erfolgreicher Krimi-Autor – entschlüsselt sie die Botschaft und erfährt von einem nie geklärten Bankraub. Doch dann gibt es einen Toten, und auf einmal entwickelt sich die Jagd nach dem verschollenen Goldschatz zum Schlüssel für die Lösung ihres aktuellen Falls … Die Autorin Carine Bernard hat ein Faible für Frankreich und erkundet Land und Leute am liebsten entlang kleiner Nebenstraßen mit dem Campingbus. In ihrem Regional-Krimi »Lavendel-Tod« nimmt sie ihre Leser mit in ihr liebstes Reiseziel: die Provence mit ihren malerischen Dörfern und der vorzüglichen Küche. Die so spannenden wie entspannenden Provence-Krimis von Carine Bernard sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Lavendel-Tod - Lavendel-Gift - Lavendel-Fluch - Lavendel-Grab - Lavendel-Zorn - Lavendel-Sturm - Lavendel-Wut
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Carine Bernard
Lavendel-Tod
Ein Provence-Krimi
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Blaue Lavendelfelder und der Duft von frischem Blut – ein unterhaltsamer Frankreich-Krimi mit einer außergewöhnlichen Ermittlerin, der uns mitten in die atmosphärische Provence entführt.
Ein Fall von Wirtschaftskriminalität führt EU-Ermittlerin Molly Preston nach Südfrankreich, in ein beschauliches Dorf zwischen alten Olivenbäumen und den ewig singenden Zikaden. Bei ihren Ermittlungen stößt sie auf geheimnisvolle Zeichen an der Wand einer kleinen Kapelle. Mit der Unterstützung ihres Freundes Charles – seines Zeichens erfolgreicher Krimi-Autor – entschlüsselt sie die Botschaft und erfährt von einem nie geklärten Bankraub. Doch dann gibt es einen Toten, und auf einmal entwickelt sich die Jagd nach dem verschollenen Goldschatz zum Schlüssel für die Lösung ihres aktuellen Falls …
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Danksagung
Für Volker.
Ich wünschte, du hättest es noch erleben dürfen.
Kapitel 1
Molly Preston kniete auf den kühlen Steinfliesen der Kapelle und schabte geduldig mit einem Spachtel die weiße Farbe von der Wand. Sehr weit war sie heute nicht gekommen. Nach unten hin schienen die Schichten immer dicker zu werden, ganz so, als ob die Farbe über die Jahre nach unten geflossen wäre, wie das Glas einer alten Fensterscheibe.
Im mittleren Drittel der Wand war es Molly bereits gelungen, die darunter liegenden Fresken freizulegen. Schemenhaft ließen sich schon Gestalten und eine Bordüre erahnen. Das war der spannendere Teil ihrer Aufgabe, dennoch unterdrückte sie ihre Ungeduld und arbeitete sich systematisch nach unten vor.
Unter dem Druck ihres Spachtels löste sich ein größeres Stück Kalkfarbe im Ganzen von seinem Untergrund und fiel zu Boden. Molly stutzte und nahm die darunterliegende Stelle genauer in Augenschein. Eigentlich erwartete sie hier noch keine Wandmalereien, die Farbschicht war noch zu dick, trotzdem konnte sie deutlich dunkle Zeichen im hellen Kalk erkennen. Vorsichtig entfernte sie die Reste von Weiß und legte ein Muster aus Schlangenlinien und Strichen frei. Sie ließ sich auf die Fersen zurückfallen und betrachtete ihren Fund.
Mit den alten Fresken von weiter oben hatten diese Zeichen mit Sicherheit nichts zu tun, das konnte sogar sie als Laie sehen. Die Schicht, in der sie ihren Fund gemacht hatte, war viel oberflächlicher und jünger als die bunten Bilder, die im Laufe der Jahrhunderte mehrfach überstrichen worden waren. Doch was hatte das zu bedeuten?
Molly beugte sich vor und untersuchte das schuppenförmige Stück weißer Farbe, das vor ihr auf dem Boden lag. Vorsichtig setzte sie das Werkzeug an und spaltete die oberste Schicht ab. Noch mehr Striche. Wie ein Puzzle passte das lose Teil zum Rest, der noch an der Wand haftete, und bildete eine Pfeilspitze, die nach rechts wies.
Sie legte es beiseite und begann, das Muster in der Wand mit ihrem Spachtel zu verfolgen. Zweimal löste sie dabei weitere große Farbbrocken ab, die sie sorgfältig zu dem ersten legte. Am Ende hatte sie eine Fläche von vielleicht zehn Zentimetern in der Höhe und vierzig Zentimetern in der Breite freigelegt. Hätte man zuvor noch eine zufällige Musterung oder die Reste einer Schmuckkante vermuten können, so war es jetzt eindeutig, dass hier jemand eine Botschaft hinterlassen hatte, denn am linken Ende des Zeichens waren einige Zahlen zu erkennen. Eine Zwei, eine Drei, eine Fünf konnte sie entziffern.
Doch was war das für eine geheime Schrift? Sie fotografierte die Stelle und die drei losen Teile mit der Kamera ihres Smartphones und verschob genauere Nachforschungen auf später. Schließlich war es ihre Aufgabe, die alten Farbschichten abzutragen, die das mittelalterliche Wandgemälde bedeckten. Die Feinarbeit und die professionelle Restaurierung der Fresken würden anschließend Spezialisten übernehmen. Sie sollte nur die grobe Vorarbeit leisten, dafür wurde sie bezahlt. Es war beileibe nicht die Art von Arbeit, die sie normalerweise verrichtete, doch vor zwei Wochen war ihr die Restaurierung der kleinen Kapelle als die einzige Möglichkeit erschienen, in angemessener Zeit Zutritt zur Groupe BFC zu bekommen und ihren eigentlichen Auftrag zu erfüllen.
Die Groupe BFC war ein privat geführtes Bankhaus, das ein weitverzweigtes Imperium von kleinen Privatbanken kontrollierte. Sehr konservativ und gediegen war der äußere Eindruck, das Vertrauen der Kunden war ihr größtes Kapital.
Und ausgerechnet diese renommierte Bank stand in Verdacht, sich durch einen florierenden Handel mit illegal erworbenem Wissen zu bereichern. Offenbar hatte die Groupe BFC Zugang zu Insiderwissen, das es ihr ermöglichte, im richtigen Moment Anlagen zu tätigen oder riskante Papiere zum bestmöglichen Zeitpunkt abzustoßen. Die investierten Beträge waren nicht hoch genug, um besonders aufzufallen, aber in der Summe waren die so erzielten Gewinne enorm. Die vielfach verflochtenen Strukturen innerhalb der Bankengruppe machten es jedoch unmöglich, die genaue Größenordnung der dunklen Geschäfte nachzuvollziehen.
Molly arbeitete für eine streng geheime Abteilung der EU zur Aufklärung von Finanz- und Wirtschaftsspionage, und ihr Auftrag lautete, sich in das Firmennetzwerk der Groupe BFC einzuschleusen. Von dieser Position aus sollte sie nach Anhaltspunkten für diesen ungeheuerlichen Verdacht suchen und in Abstimmung mit ihrem Team die nötigen Beweise finden, um die Hintermänner der Bank zu überführen. Aber die Groupe BFC erwies sich als uneinnehmbares Bollwerk. Die Angestellten waren handverlesen, und erst nach Jahren bestand die Chance, in die höhere Führungsebene aufzusteigen. So viel Zeit hatte Molly nicht, und so hatte sie sich ein gemeinnütziges Projekt der Bank zunutze gemacht, auf das sie bei ihren Recherchen gestoßen war: die Restaurierung einer winzigen Kapelle mitten in den provenzalischen Bergen, ein paar Kilometer außerhalb eines kleinen Dorfes namens Mirocène. Wie viele Firmen in Frankreich unterhielt auch die Groupe BFC eine Stiftung zur Förderung der lokalen Kultur, und über diese Hintertür hoffte Molly auf einen Zugang.
Ausgestattet mit einem wasserdichten Lebenslauf als Marie Bonnieux, Studentin der Kunstgeschichte, hatte sich Molly um einen Praktikumsplatz bei der Groupe BFC beworben. Nach einem eingehenden Vorgespräch mit einer Vertreterin der Personalabteilung war sie angenommen worden, und wie erwartet hatte man sie zur Restaurierung der Kapelle abgestellt. Sie hatte sich in Mirocène einquartiert und mit Feuereifer auf die neue Aufgabe gestürzt.
Doch leider stellte sich diese Idee mit jedem Tag mehr als Sackgasse heraus – sie war in den letzten zwei Wochen um keinen Schritt weitergekommen.
Zwar war vor einigen Tagen tatsächlich ein Mitarbeiter der Groupe BFC hier gewesen, um sich über den Fortschritt der Arbeiten zu informieren: ein hochgewachsener Mann mit eisengrauem Haar, in grauem Nadelstreif und auf Hochglanz polierten Schuhen, der ihr jovial die Hand schüttelte und ihr versicherte, dass diese Tätigkeit für ihr Studium von großem Nutzen sein werde. Darüber hinaus schien er sich jedoch nicht weiter für sie zu interessieren. Er hatte eine Runde durch das Kirchenschiff gedreht, wohlwollend mit dem Kopf genickt und war wieder gefahren. Seitdem war niemand mehr aufgetaucht, und inzwischen bezweifelte Molly, auf diesem Weg etwas über die dunklen Machenschaften der Groupe BFC herausfinden zu können.
Dabei machte sie diese Art von verdeckter Ermittlung nicht zum ersten Mal. Ihre vielfältigen Fähigkeiten, ihre rasche Auffassungsgabe und ihr sicheres Auftreten ermöglichten es ihr, fast jede Stelle in einem Unternehmen zu besetzen und sich schnell genug hochzuarbeiten, um an verdächtige Informationen heranzukommen. Sie war in Deutschland groß geworden, doch ihre Vorfahren kamen aus England, Frankreich und Japan, weshalb sie auch Französisch und Englisch wie ihre Muttersprache beherrschte und sogar mit asiatischen Sprachen zurechtkam. Ihr japanischer Großvater hatte ihr darüber hinaus eine Art von unaufdringlicher Höflichkeit mitgegeben, mit der sie normalerweise sehr rasch das Vertrauen wildfremder Menschen gewann.
Aber hier hatte ihr all das nichts genutzt. Der feine Herr von der Bank hatte Marie Bonnieux noch nicht einmal als Person wahrgenommen. In ihren staubigen Jeans und mit dem Tuch über dem zurückgebundenen Haar, ungeschminkt, die Fingernägel schmutzig und abgebrochen, war es aber auch kein Wunder: Die Frauen, mit denen ein Mann wie er normalerweise zu tun hatte, sahen bestimmt anders aus. Langsam musste sie sich eingestehen, dass ihre Tarnung zu gut funktionierte – sie verhinderte sogar die Kontaktaufnahme mit den Vertretern der Bank. Molly war hier nur ein weiteres Paar Hände, das sich dem gemeinnützigen Projekt der Groupe BFC widmete, so wie die drei einheimischen Hilfsarbeiter, die in der Hauptkapelle den Fußboden freilegten, oder die Zimmerleute, die letzte Woche die Balken unter dem Steindach erneuert hatten.
Sie seufzte, nahm den Spachtel und kratzte weiter die Farbe von der Wand. Wenn sie ehrlich war, langweilte sie sich inzwischen zu Tode.
Molly fuhr zusammen, als ihr Matthieu auf die Schulter tippte und in seinem breitesten Provenzalisch »finido« sagte. Nichts und niemand hatte sie auf die Sprache vorbereitet, die die Menschen hier sprachen. Molly hatte zwar einige Jahre bei ihren Großeltern in Paris gelebt, doch das Provenzalische war eine eigene Sprache und es zu verstehen eine Kunst für sich.
Dem Verhältnis zu den drei Männern tat das keinen Abbruch. Matthieu und seine beiden Freunde behandelten sie mit der ausgesuchten Höflichkeit der älteren Landbevölkerung, und gleichzeitig war sie so etwas wie ihr Schützling, auf den es aufzupassen galt. Sie verbrachten die Pausen zusammen und teilten ihre Brotzeit mit ihr, die üblicherweise aus frischem Baguette, aromatischem Käse und rosafarbenem Wein bestand.
Und so wie eben machte Matthieu sie immer auf das Ende des Arbeitstages aufmerksam. Molly erhob sich und lächelte ihn an. Er war kaum größer als sie, hatte aber breite Schultern und kräftige Arme.
»Merci, Matthieu! Seid ihr heute gut vorangekommen?«
Er rückte die Mütze zurecht, unter der graue Strähnen hervorlugten. »Ja, wir haben die hintere Ecke fertig gemacht«, antwortete er. »Der Monsieur wird zufrieden sein.«
Molly nickte zustimmend. Sie konnte inzwischen immer besser erraten, was er sagte.
Sie folgte Matthieu nach draußen und bewegte ihre verspannten Schultern. Offenbar hatte sie länger auf dem Boden gekauert und über den geheimnisvollen Zeichen sinniert, als ihr guttat, und nun protestierten die schmerzenden Muskeln. Sie nahm einen tiefen Atemzug und roch das dürre staubige Gras, das in der spätsommerlichen Hitze verdorrte.
Die Sonne stand tief über den umgebenden Berghängen und tauchte die Natursteinwand der Kapelle in goldenes Licht. Molly schloss einen Moment die Augen und genoss die Wärme des Sonnenlichts auf ihrem Gesicht.
Neben dem trutzigen Gebäude befand sich eine kleine ebene Fläche, die an zwei Seiten von einer niedrigen Steinmauer umgeben war. Hinter der Mauer ging es steil in die Tiefe, in der Ecke führten grob gemauerte Stufen drei Meter nach unten in einen Olivenhain. In der Mitte der so entstandenen Terrasse wuchs ein windschiefer Olivenbaum, dessen gewundener Stamm sicherlich auch eine interessante Geschichte erzählen könnte. Einige niedrige Buchsbäume vervollständigten das Rund, und in ihrem Schatten stand eine gusseiserne Pumpe, die frisches Quellwasser spendete. Matthieu betätigte den Schwengel, und Molly wusch sich die Hände und das Gesicht mit dem klaren Wasser.
Direkt an der Wand der Kapelle befand sich ein Mauervorsprung, fast schon eine kleine Bank. Darauf saßen Pierre und Colombin, Matthieus Freunde und Arbeitskollegen, und warteten auf sie. Pierre hatte ein langes melancholisches Gesicht, und Molly hatte ihn noch nie lächeln gesehen. Colombin war das genaue Gegenteil, er war klein und drahtig, und seine listigen kleinen Augen zwinkerten ständig.
Alle drei waren sie Bauern aus der Umgebung, mit wettergegerbten Gesichtern und knorrig wie alte Bäume. Normalerweise verdienten sie ihr Geld mit dem Anbau von Oliven, Feigen und Lavendel. Aber die Lavendelernte war schon lange vorbei, die Haupterntezeit der Feigen kam erst im Herbst, und die Oliven wuchsen ebenfalls von allein und brauchten außer zur Ernte im November nicht viel Aufmerksamkeit. So waren sie froh über jede Gelegenheitsarbeit, die ihnen zwischendurch angeboten wurde.
Pierre und Colombin erhoben sich und folgten ihr zu dem alten Land Rover, der im Schatten unter ein paar Bäumen parkte. Am Vortag hatte es kurz geregnet, und auf dem geschotterten Zufahrtsweg stand noch eine große flache Pfütze. Als Molly daran vorbeiging, erhob sich ein Meer von kleinen lilafarbenen Schmetterlingen, die sich hier am seichten Wasser versammelt hatten. Sie legte die letzten Meter zum Geländewagen in einer Schmetterlingswolke zurück und setzte sich auf den Beifahrersitz. Colombin schloss schwungvoll die Tür, die er für sie aufgehalten hatte, und stieg mit Pierre hinten ein, während Matthieu den Motor anließ.
Kapitel 2
Zwanzig Minuten und einige Serpentinen später erreichten sie das Dorf Mirocène. Unterwegs hatten sie am Hof von Colombin angehalten, um ihn dort abzusetzen, und als der Wagen auf den Marktplatz einbog, verschwand die Sonne gerade hinter dem Bergrücken.
Matthieu parkte den Landrover vor der Bar Lavande, die Hotel, Restaurant und Café in einem war. Gemeinsam bahnten sie sich einen Weg durch die Tische und Stühle auf dem breiten Bürgersteig und betraten den eigentlichen Gastraum. Während Matthieu und Pierre winkend und grüßend zu Jacques, dem Wirt, hinübergingen, der hinter der Theke stand, eilte Molly die dunkle Holztreppe nach oben. Vier Gästezimmer hatte Jacques zu bieten, nur für den Fall, dass sich doch einmal ein Tourist hierher verirren und ein Bett für die Nacht suchen sollte, und eines davon hatte sie für die Dauer ihres »Praktikums« belegt.
Trotz der Nähe zum Mont Ventoux war Mirocène noch nicht vom Tourismus vereinnahmt. Es lag zu weit entfernt von den größeren Städten der Region wie Carpentras oder Vaison la Romaine, und die schmale Straße nach Sault war zwar fast ebenso kurvenreich wie die Strecke durch die Gorges de la Nesque auf der anderen Seite des Tals, bot aber nicht die grandiosen Ausblicke und dramatischen Felsabstürze, für die diese berühmt war. Der Anfahrtsweg zum Mont Ventoux war selbst für motivierte Fahrradfahrer zu weit, und für einen Campingplatz schien es gar nicht genügend ebene Fläche zu geben.
Doch Molly war das ganz recht. Hier, unter den Einheimischen fühlte sie sich wohl, es gefiel ihr hier besser als in den großen touristischen Zentren der Provence.
Sie warf ihre Leinentasche aufs Bett, zog sich das staubige T-Shirt über den Kopf und verschwand unter der Dusche. Als sie fünfzehn Minuten später in eine karierte Bluse und frische Jeans schlüpfte, fühlte sie sich wie ein neuer Mensch. Sie musterte ihr Gesicht im Spiegel und zog die Nase kraus. Die zwei Wochen unter der südfranzösischen Sonne hatten tatsächlich ein paar Sommersprossen auf ihre Nase gezaubert, und ihr normalerweise tiefschwarzes Haar zeigte einen deutlichen rotbraunen Schimmer.
Molly hängte sich die Tasche um und lief wieder nach unten. Anstatt in den Gastraum zu gehen, der sich inzwischen mit den Männern aus dem Dorf gefüllt hatte, wollte sie lieber an die frische Luft. Der laue Sommerabend und das abendliche Treiben auf dem Hauptplatz des Dorfes luden zum Sitzen im Freien ein. Abgesehen davon waren die Tische vor der Bar Lavande einer der wenigen Punkte in Mirocène, an denen man mit dem Handy genügend Empfang für eine stabile Internetverbindung hatte.
Jacques’ Frau Margot brachte ihr unaufgefordert eine Karaffe mit gekühltem Rosé und eine Flasche Wasser.
»Bonsoir, Marie«, begrüßte sie sie. »Wir haben heute Soupe au Pistou, ist das in Ordnung?«
Molly begrüßte die Wirtin und nickte zustimmend. Es blieb ihr auch nicht viel anderes übrig; die Alternative wären Brot und Käse gewesen, was allerdings auch nicht zu verachten war. Doch Margot war eine hervorragende Köchin, und ihre Suppen waren im weiten Umkreis berühmt.
Molly zog ihr Smartphone aus der Tasche und schaltete es ein. Sie hielt ihr Gesicht in die Erfassung der Kamera und wartete auf die Verbindung zur Außenwelt. Ohne Netzverbindung machte es keinen Sinn, das Telefon tagsüber eingeschaltet zu lassen, und nun vibrierte es in ihrer Hand, als die verpassten Nachrichten eintrafen. Schnell ging sie die Liste durch, doch außer einer E-Mail von ihrem Freund Charles fand sie nichts Dringendes oder Wichtiges. Solange sie ihren Kollegen in Brüssel keine neuen Erkenntnisse mitteilen konnte, herrschte Funkstille.
Charles’ Nachricht begann mit »Ma chère Marie«, und Molly musste lächeln, während sie seine Zeilen las. Er schrieb so gut wie nie Privates oder Persönliches in seinen Mails oder Briefen, nur nichtssagende Floskeln, die zwischen ihnen so etwas wie einen nicht abgesprochenen Code darstellten. Übersetzt hieß das wohl, dass er sie vermisste, dass er sie liebte und dass er sich auf ein Wiedersehen freute.
Sie pflegten diese Art des Umgangs schon seit Mollys allererstem Auftrag, denn ein Abhören oder Ausspionieren ihrer Post war nie ganz auszuschließen. Zwar war ihr Telefon mit einem Custom-ROM ausgestattet, das von den Computerleuten ihrer Abteilung entwickelt worden war und das dafür sorgte, dass alle Daten nur verschlüsselt weitergeleitet wurden, doch schon die Mailadresse, an die Charles seine täglichen E-Mails schickte, war eine Schwachstelle. Die Domain gehörte der Universität von Paris, wo Marie Bonnieux ihrer Legende nach studierte, und der E-Mail-Verkehr konnte theoretisch von dort aus ausspioniert werden. Absolute Geheimhaltung war jedoch entscheidend für ihren Erfolg, deshalb war Molly dankbar für das Spiel.
Lilou, Margots Nichte, stellte einen Korb mit frischem Weißbrot sowie einen Teller mit Butter vor Molly ab und lächelte ihr zu. Sie war etwa im gleichen Alter wie Molly, und manchmal unterhielten sie sich über Paris, wo Lilou studierte. Doch heute nicht, Margot winkte energisch, und Lilou hob entschuldigend die Schultern, bevor sie zu ihr hinüberlief. Wenig später brachte Margot die duftende Suppe und ein Schälchen mit dem grünen Pesto.
Beim Essen war Molly trotz der vorzüglichen Soupe au Pistou nur halb bei der Sache. Immer wieder kehrten ihre Gedanken zurück zu ihrem Fund, zu den krausen Zeichen, die sie unter oder eher in der weißen Wandfarbe gefunden hatte. Sie legte den Löffel zur Seite, öffnete den Browser ihres Handys und lud das Foto der geheimnisvollen Kritzelei in die Bildersuche von Google hoch. Es dauerte ziemlich lange, denn die Netzverbindung war zwar vorhanden, aber nicht sehr schnell. Das Ergebnis war enttäuschend, moderne Kunst, Tuschezeichnungen, Fotos von Schriftstücken, aber nichts, was ihr weiterhalf. Dabei kamen ihr die Symbole des Zeichens irgendwie bekannt vor, sie konnte sie nur nicht zuordnen. Vielleicht lag es auch einfach an ihrer Müdigkeit und dem Glas Wein, das sie in der Zwischenzeit getrunken hatte, jedenfalls spürte sie, dass sie so nicht weiterkam.
Aber wozu hatte sie ihren Freund? Charles war ein unerschöpflicher Quell unnützen Wissens und hatte großen Spaß an solchen Rätseln. Sie öffnete ihren Messenger, wählte Charles’ Avatar und schickte ihm das Foto.
»Fällt dir dazu etwas ein? Das habe ich heute in der Kapelle gefunden«, schrieb sie darunter.
Der Versand des Bildes über die App dauerte noch länger, denn jede Kommunikation lief über den Server ihrer Abteilung in Brüssel, wo die Nachricht entschlüsselt und dann erst dem Empfänger zugestellt wurde.
Molly schob den leer gegessenen Teller von sich. Sie war satt, aber mit dem letzten Stück Brot wischte sie noch den Rest vom Pesto aus dem Schälchen. Müßig beobachtete sie das Treiben auf dem Platz. Es war erstaunlich, wie viele Menschen hier abends unterwegs waren, vor allem, wenn man berücksichtigte, wie klein das Dorf war. Am Brunnen hatten sich die Jugendlichen versammelt, schlaksige Jungen und schlanke Mädchen mit gebräunten Beinen, die auf der steinernen Brüstung hockten wie die Spatzen auf einem Dach und sich angeregt unterhielten.
Die Mitte des Platzes wurde von einem Boulodrome eingenommen, dem die umstehenden Platanen auch in der schlimmsten Mittagshitze ausreichend Schatten spendeten. Hier trafen sich jeden Abend und manchmal auch schon nachmittags die älteren Männer des Dorfes. Auch heute schallte das Klacken und Knallen der Metallkugeln durch die Dämmerung. Molly verfolgte mit müßigem Interesse den Fortgang des Pétanque-Spiels, der provenzalischen Variante des bekannteren Boule, bei der die Kugeln nicht mit Anlauf, sondern aus dem Stand gespielt wurden. Der alte Jules lag wie fast immer in Führung; er hatte in seiner Jugend quasi professionell gespielt und es immerhin bis in die Landesliga geschafft.
Ein Brummen des Telefons riss sie aus ihren Gedanken. Es war die Antwort von Charles, der das geheimnisvolle Zeichen, das sie ihm zuvor geschickt hatte, offenbar besser zuordnen konnte: »Das sieht aus wie ein Gaunerzinken, links steht ein Datum, den Rest muss ich noch recherchieren!«
Molly studierte erneut das Foto. Wenn es stimmte, was Charles schrieb, dann musste das Zeichen am 23. Mai 1912 an die Wand gemalt worden sein. Was es wohl bedeutete?
Sie trank ihren Wein aus und beschloss, gleich zu Bett zu gehen. Morgen früh um acht würde sie Matthieu abholen, sie würden wieder zur Kapelle fahren und ihre Arbeit fortsetzen. Mit dem Gedanken an Charles, der gerade an einem Strand am Mittelmeer saß, und einem leisen Anflug von Neid schlief sie ein.
Am nächsten Morgen wurde Molly von den melodischen Klängen der Alarmfunktion ihres Smartphones geweckt. Sie wusch sich das Gesicht und band ihre Haare zu einem hohen Pferdeschwanz zusammen, der sie sofort um fünf Jahre jünger aussehen ließ. Ein buntes Schaltuch darüber, um sie vor dem schlimmsten Staub zu schützen, alte Jeans und eine bunte Bluse vervollständigten ihre Arbeitskleidung.
Im Hauptraum der Bar grüßte sie Jacques und nahm an einem Tisch am Fenster Platz. Margot brachte eine große Schale Café au Lait, zwei Croissants in einem Körbchen und einen kleinen Extra-Teller mit Butter und stellte alles vor ihr ab. Ein Glas Feigenmarmelade und ein Töpfchen mit Lavendelhonig standen schon auf dem Tisch.
Molly tunkte gerade das letzte Stück Croissant in den Kaffee, als Matthieu draußen hupte. Sie trank aus, winkte Margot und Jacques im Hinausgehen zu und stieg in den Wagen. Auf der Rückbank saß schon Pierre, sein langes Gesicht verzog sich zur Begrüßung. Hinten im Kofferraum rumpelten Werkzeug und Wasserflaschen, während sie die schmale Straße hoch zur Kapelle fuhren. Colombin kam heute nicht mit, so dauerte die Fahrt nicht einmal zehn Minuten.
Mollys Plan für heute war, den Bereich um ihren gestern gefundenen Gaunerzinken großflächig von Farbe zu befreien. Sie hoffte, weitere ähnlich geartete Zeichen zu entdecken, die das Entschlüsseln erleichtern würden. Die Arbeit erforderte noch mehr Sorgfalt als sonst, denn diese Zeichen befanden sich mitten zwischen den weißen Farbschichten. Wäre die Farbe gestern nicht in einem Stück abgeblättert, hätte sie das Gekritzel wahrscheinlich übersehen. Aber wenn sie schon mit ihrem eigentlichen Fall nicht weiterkam, konnte sie sich genauso gut mit ihrem Zufallsfund befassen.
Drei Stunden später hatte Molly den gesamten unteren Bereich bis auf den Verputz freigelegt und sah bereits die farbigen Fresken, die vor sechshundert Jahren direkt in den feuchten Kalkputz gemalt worden waren. Nur die Stelle mit »ihrem« Gaunerzinken war noch von weißer Farbe bedeckt. In der angrenzenden Fläche hatte sie keine weiteren Zeichen mehr gefunden, obwohl sie sich akribisch durch die einzelnen Schichten gearbeitet hatte.
Als nächster Schritt blieb ihr nur noch, auch den Gaunerzinken zu entfernen, denn ihre Aufgabe bestand natürlich immer noch darin, die Fresken freizulegen.
Vorsichtig klopfte sie also die restlichen Bruchstücke ab und legte sie zusammen mit den Teilen von gestern wie ein Puzzle auf dem Boden aus. Die Symbole waren nun besser zu erkennen, die Ziffern auf der linken Seite, ein lang gezogener Pfeil mit einer Schlangenlinie, dessen Spitze nach rechts in die Ecke der Seitenkapelle wies, unterbrochen von zwei diagonalen Strichen und darum herum angeordnete kleine Kreise.
Molly machte noch weitere Fotos von der kompletten Darstellung; sie wollte sie später genauer in Augenschein nehmen. Dann schaltete sie das Telefon wieder aus, steckte es weg und ging vor der Ecke, in die der Pfeil wies, auf die Knie. Auch dort trug sie die Farbschichten bis in den Winkel hinein ab. Doch falls der Pfeil eine Richtungsangabe darstellen sollte, konnte sie zumindest an dieser Stelle nichts entdecken. Die Farbe wurde zum Rand hin auch immer dünner, so als ob die Maler in den Ecken nachlässig gearbeitet hätten; dementsprechend stieß sie schnell auf die Schicht aus Feinkalk, die hier zum Rand der Wand hin aber keine Bemalung mehr aufwies.
Mollys Knie schmerzten von dem kalten Steinboden, sie stand auf und streckte sich. Das allgegenwärtige Zirpen der Zikaden war selbst hier drinnen zu hören. Aber die Geräusche aus dem Hauptschiff der Kapelle waren schon seit einiger Zeit verstummt, demnach hatten Matthieu und Pierre ihre Arbeit beendet. Es war Freitag, da machten sie bereits mittags Schluss, und die beiden waren wohl schon dabei, das Werkzeug zu reinigen, aufzuräumen und den Raum sauber zu machen.
Molly stand auf und suchte ihre Spachtel zusammen. Sie brachte sie nach draußen, wo die Sonne hoch und brennend am Himmel stand, und säuberte sie in dem kleinen Steintrog, der von der gusseisernen Pumpe gespeist wurde. Anschließend legte sie sie zum Trocknen auf die Steinbank und flüchtete schnell wieder in die dämmrige Kühle der Kapelle.
Sie nahm den Besen, der neben der Tür stand, und fegte die Farbreste in ihrem Arbeitsbereich auf einen Haufen. Sie war gerade fertig, als sie Matthieu und Pierre zurückkommen hörte. Pierre betrat das Seitenschiff mit einer Schaufel in der Hand, und sie half ihm, die Farbe und den Schmutz auf das Blech zu kehren.
Pierre nickte in Richtung der Bruchstücke des Gaunerzinkens, die noch dort lagen, wo Molly sie aufgereiht hatte. »Qu’est-ce que c’est?«, fragte er.
»Je ne sais pas«, antwortete Molly, »ich weiß es nicht. Das habe ich in der Wand unter der Farbe entdeckt.«
Pierre stellte die Schaufel zur Seite, hockte sich hin und betrachtete das Zeichen genauer. Mit dem Finger fuhr er den Pfeil und die Schlangenlinie entlang.
»Wo genau hast du das gefunden?«, wollte er wissen.
Molly deutete mit dem Finger auf den Wandabschnitt. Pierre zog die Brauen hoch, sein Blick folgte der Wand in die Richtung des Pfeils, dann zuckte er mit den Schultern.
»Weißt du, was das ist?«, fragte Molly.
»Nein.« Pierre schüttelte den Kopf. »Es sieht aus, als hätte jemand etwas an die Wand gemalt. Vielleicht ein Maler oder ein Maurer?«
»Ja, vielleicht«, meinte Molly.
Pierre hatte offenbar das Interesse verloren. Er erhob sich und trug die Schaufel hinaus, Molly stellte den Besen zurück hinter die Tür. Pierre kippte den Schmutz in den großen Schuttsack, der hinten an der Wand stand, und folgte ihr nach draußen. Matthieu wartete schon auf sie. Er schloss die Tür mit einem großen altmodischen Bartschlüssel ab, den er hinter einen losen Stein in der Kirchenwand schob.
Gemeinsam gingen sie zum Auto. Molly holte noch eine Flasche Wasser aus dem Kofferraum, dann nahm sie auf dem Beifahrersitz Platz und trank die halbe Flasche in einem Zug leer. Matthieu grinste ihr zu, startete den Motor und ließ den Wagen über den steilen Weg zur Straße rollen.
»Was hast du am Wochenende vor?«, fragte er, als er in die Straße Richtung Mirocène einbog.
»Ich werde nach Avignon fahren, ich möchte mal wieder in die Stadt!«, antwortete Molly mit einem Augenzwinkern.
»Das ist gut«, stimmte Matthieu ihr zu. »Ein junges Mädchen wie du langweilt sich bestimmt in unserem Dorf.«
Molly musste lachen. In ihrer Rolle war sie dreiundzwanzig Jahre alt, in Wahrheit jedoch vier Jahre älter, aber für Matthieu, der aussah, als hätte er noch den letzten Weltkrieg miterlebt, mochte jeder unter dreißig so jung erscheinen.
Molly freute sich schon auf das Wochenende in Avignon. Zwei Nächte in einem Hotel, ein Bummel durch die Altstadt, Straßenmusikanten und vielleicht ein Besuch im Theater – das hatte sie sich nach der staubigen Arbeit in der Kapelle verdient.
Vor der Bar Lavande stieg Molly aus dem Auto. Matthieu wendete schwungvoll und fuhr wieder in die Richtung davon, aus der sie gekommen waren. Sie winkte noch hinterher, dann betrat sie das Bar-Restaurant-Hotel-Café und lief die Treppe hoch zu ihrem Zimmer. Eine schnelle Dusche, um den Staub loszuwerden, umziehen, ein paar Sachen packen, und schon eine halbe Stunde später saß sie in ihrem kleinen Peugeot und war auf dem Weg nach Avignon.
Kapitel 3
Der Feierabendverkehr wurde um Avignon herum immer dichter, und Molly brauchte geschlagene zwei Stunden für die knapp fünfzig Kilometer. Es war noch immer sehr heiß, als sie vor dem Hotel Le Corbert parkte und aus dem Auto stieg. Sie nahm ihre Reisetasche vom Beifahrersitz und betrat den klimatisierten Empfangsraum. Eine rundliche Dame kam aus dem hinteren Bereich des Hotels und begrüßte sie freundlich.
»Mademoiselle Henriche, n’est-ce pas?«
Molly lächelte zurück und holte ihren deutschen Pass aus der Handtasche. Er lautete auf Maria Heinrich, wohnhaft in Düsseldorf.
Das kleine Hotel direkt in der Altstadt war nicht gerade billig. In ihren Augen hätte es nicht zu ihrer Rolle als Studentin gepasst, weswegen sie auf die Identität von Maria Heinrich zurückgegriffen hatte, einer deutschen Touristin, die sich das leisten konnte.
Dabei hatte sie noch Glück gehabt, überhaupt ein Zimmer zu bekommen, als sie vor drei Tagen hier reserviert hatte – in der Hauptsaison war das Le Corbert normalerweise auf Monate hinaus ausgebucht, besonders zur Zeit des berühmten Theaterfestivals, das Avignon jedes Jahr mit Touristen überschwemmte.
Molly nahm den Zimmerschlüssel in Empfang und stieg die Treppe hinauf. Das Zimmer war nicht groß, aber sehr gemütlich eingerichtet. Die Teppiche, Vorhänge und der Bettüberwurf waren im Rot und Gelb der Occitanie gehalten und gaben dem Raum ein südliches Flair.
Molly streckte sich kurz auf dem breiten Bett aus und genoss die weiche Matratze, doch es hielt sie nicht lange. Sie hatte noch etwas vor, und das duldete keinen Aufschub. Sie schulterte ihre Tasche, setzte die Sonnenbrille auf und verließ das Hotel.
Auf der Fahrt nach Avignon hatte Molly beschlossen, eine der dortigen Stadtbibliotheken aufzusuchen. Die Médiathèque Ceccano war nur ein paar Straßen vom Hotel entfernt – der perfekte Ort, um ohne die Einschränkungen einer miserablen Netzverbindung zu dem Datum zu recherchieren, das sie auf dem Zeichen in der Kapelle gefunden hatte.
Am Eingang zur Médiathèque zeigte sie ihren französischen Studentenausweis und bekam einen Computerarbeitsplatz zugewiesen. Die Verbindung zum Internet erforderte keine weiteren Zugangsdaten und war wahrscheinlich nicht verschlüsselt; das war Molly aber egal, sie hatte hierbei nichts zu verbergen.
Gespannt gab sie das Datum bei Google ein: »23 mai 1912«, zusammen mit »Carpentras«, dem Namen der Hauptstadt des gleichnamigen Arrondissements. In einer Sammlung von alten Zeitungsausschnitten wurde sie tatsächlich fündig. Hier gab es einen Hinweis auf einen Banküberfall, der an diesem Tag in Carpentras stattgefunden hatte, gerade einmal vierundzwanzig Kilometer von Mirocène entfernt.
Die winzigen Vorschaubilder der Zeitung Le Petit Journal waren im Internet jedoch nicht zu entziffern. Für achtzehn Euro hätte Molly zwar eine lesbare Version bestellen können, aber sie hatte eine bessere Idee. Sie notierte sich das Datum der Ausgabe und die Schlagzeile »Braquage de la Banque du Fondette«, fuhr den Rechner herunter und ging zurück in den großen Eingangsbereich.
»Où est l’archive du journal?«, fragte sie die Dame am Informationstresen nach dem Zeitungsarchiv.
»Là-bas, la porte à droite«, antwortete diese und deutete zu einer Tür auf der rechten Seite.
Molly betrat einen langen dunklen Saal mit zahllosen Schränken und Schubfächern. Kurz musste sie sich orientieren, dann folgte sie dem Gang nach hinten, bis sie zu der Beschriftung »1912« kam. Am richtigen Regal angekommen, zog sie das Fach vom 24. Mai auf. Auf Mikrofilm lagen hier die Ausgaben mehrerer Zeitungen, und sie nahm die zwei obersten an sich. Sie schloss das Schubfach wieder, ging zurück in den vorderen Bereich und setzte sich an eines der Lesegeräte.
Schon die erste Zeitung war ein Treffer. »Verwegener Überfall auf das Bankhaus Fondette« lautete die etwas reißerische Überschrift, in dicken altmodischen Lettern gesetzt.
Der Artikel berichtete von einem einzelnen maskierten Täter, der am späten Nachmittag des Vortages kurz vor der Schließung der Bank den Schalterraum betreten hatte. Mit vorgehaltener Waffe zwang er den Direktor der Bank, Jerôme du Fondette, ihn in sein Büro zu führen. Er drohte, ihn auf der Stelle zu erschießen, wenn er nicht den Wandtresor öffnete. So konnte der Räuber ungefähr zweihunderttausend Franc in Münzen erbeuten, die er in einer großen Rückentrage davontrug.
Molly zog die Brauen hoch. Zweihunderttausend Franc in Münzen in einer Rückentrage, wer kam denn auf so eine Idee?
Die andere Zeitung erwähnte den Überfall nur kurz und vertiefte sich mehr in die Geschichte des privaten Bankhauses Fondette, das im Jahr 1872 von Jerôme du Fondette gegründet worden war. Fondette war ein angesehener Bürger von Carpentras, und die einfachen Leute aus der Umgebung vertrauten ihr Geld lieber ihm als den staatlichen Geldinstituten an. Der Autor spekulierte wortreich über das untergrabene Vertrauen in Banken im Allgemeinen und das Bankhaus Fondette im Besonderen, falls das Geld nicht wieder auftauchen sollte.
Molly druckte die beiden Artikel aus, brachte die Mikrofilme zurück und sah auf die Uhr. Es war kurz vor sechs, für weitere Recherchen war keine Zeit, die Médiathèque würde gleich schließen. Sie schob die Ausdrucke in ihre Tasche und verließ die Bibliothek.
Molly trat auf die Straße hinaus und atmete tief durch. Die grauen Fassaden der Häuser strahlten die Hitze des Tages ab, es roch nach abgestandenem Wasser und warmem Asphalt. Sie wandte sich nach rechts in Richtung Altstadt und bog in eine schmale Gasse ein. Zwei Häuserblocks weiter verbreiterte sich die Straße zu einem kleinen Platz, und sie fand, was sie suchte: ein kleines Bistro mit Tischen und Stühlen unter bunten Sonnenschirmen. Sie ergatterte einen freien Platz direkt an der Hauswand und ließ sich dankbar nieder, denn sie hatte kein Mittagessen gehabt und während der Fahrt lediglich einen Apfel gegessen.
Die Menüauswahl war übersichtlich, aber trotzdem vielfältig genug, um vor allem den Touristen gerecht zu werden. Molly bestellte Moules frites, in Gemüsebrühe gegarte Miesmuscheln mit Pommes frites, die nach zwanzig Minuten in einem dunkelblau emaillierten Topf serviert wurden. Die Pommes frites waren aus frischen Kartoffeln gemacht und schmeckten himmlisch, doch bald wandte sie sich dem Hauptgericht zu. Sie pulte die erste Muschel mit der Gabel aus ihrer Schale, dann legte sie das Besteck zur Seite und verwendete für die weiteren die Schale der ersten als Werkzeug, so wie die Franzosen es machten. Bald war sie auf dem Grund des Topfes angekommen. Sie nahm den Löffel zur Hand und aß den Rest der Suppe mit den Fenchel- und Möhrenstreifen. Mit einem Stück Baguette tunkte sie den würzigen Bodensatz auf und lehnte sich danach satt und zufrieden zurück. Sie war wirklich hungrig gewesen!
Während Molly an ihrem Weißwein nippte, beobachtete sie die Menschen, die an ihrem Tisch vorbeiflanierten. Die Gassen waren eng und belebt, aber wohl lange nicht so überfüllt wie im Juli zur Festivalzeit. Sie konnte Besucher aus aller Welt erkennen, blasse Briten, beschwipste Skandinavier, Studenten aus Japan mit Kameras um den Hals, amerikanische See-Europe-in-two-weeks-Touristen und immer wieder Franzosen, sowohl Einheimische als auch Touristen aus dem Norden.
Das Handy vibrierte in ihrer Tasche, und sie zog es heraus. Eine Messenger-Nachricht von Charles, eine von der Sorte: »Mir geht es gut, ich lebe noch«. Sie lächelte und dachte einen wehmütigen Augenblick lang, wie schön es wäre, hier mit ihm zusammenzusitzen. Sie sahen sich viel zu selten!
Charles Muller war ein höchst erfolgreicher Autor von Kriminalromanen, und seine Geschichten spielten an immer neuen Schauplätzen irgendwo in Europa. Zurzeit war er in Italien und steckte mitten in den Recherchen zu seinem nächsten Buch.
Molly gestattete sich einen Seufzer des Bedauerns, dann verdrängte sie den Gedanken. Stattdessen nahm sie die Ausdrucke von der Bibliothek aus ihrer Umhängetasche und las sich die Ergebnisse ihrer Recherche nochmals durch.
Ohne viel Hoffnung öffnete sie den Browser ihres Handys und gab »Banque du Fondette« in das Suchfeld ein. Fehlanzeige. Sie hatte nichts anderes erwartet, immerhin hatte der Überfall vor über hundert Jahren stattgefunden, und es wäre höchst erstaunlich gewesen, wenn die Bank noch existierte.