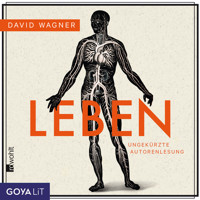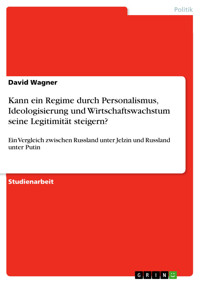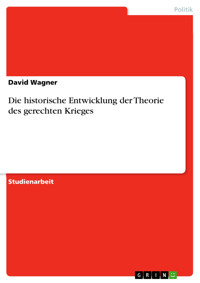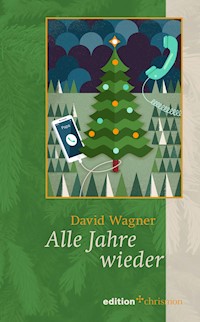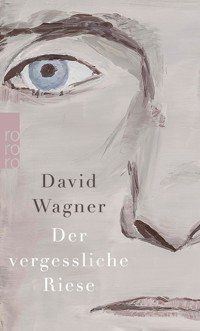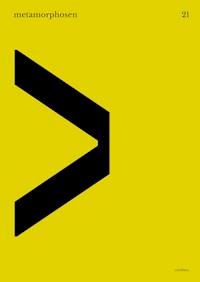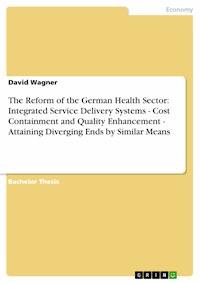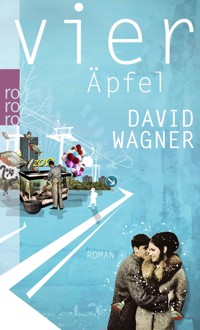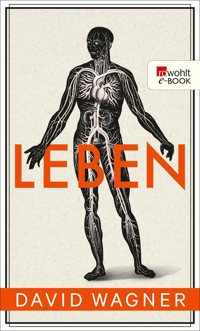
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Wann passiert es schon, daß einem die Verlängerung des eigenen Lebens angeboten wird?» Der Anruf kommt um kurz nach zwei. Ein junger, sterbenskranker Mann geht ans Telefon, und eine Stimme sagt: Wir haben ein passendes Spenderorgan für Sie. Auf diesen Anruf hat er gewartet, diesen Anruf hat er gefürchtet. Soll er es wagen, damit er weiter da ist für sein Kind? Er nimmt seine Tasche und läßt sich ins Berliner Virchow-Klinikum fahren. Von der Geschichte und Vorgeschichte dieser Organtransplantation handelt «Leben»: von den langen Tagen und Nächten im Kosmos Krankenhaus neben den wechselnden Bettnachbarn mit ihren Schicksalen und Beichten – einem Getränkehändler etwa, der heimlich seine Geliebte besucht, oder einem libanesischen Fleischer, der im Bürgerkrieg beide Brüder verlor. Beim Zuhören bemerkt er zum ersten Mal, daß auch er schon ein Leben hinter sich hat. Und da, in seinem weißen Raumschiff Krankenbett, unterwegs auf einer Reise durch Erinnerungs- und Sehnsuchtsräume, kreisen die Gedanken: Wen hat er geliebt? Für wen lohnt es sich zu leben? Und welcher Mensch ist gestorben, so daß er weiter leben kann, möglicherweise als ein anderer als zuvor? David Wagner hat ein berührendes, nachdenklich stimmendes, lebenskluges Buch über einen existentiellen Drahtseilakt geschrieben. Ohne Pathos und mit stilistischer Brillanz erzählt er vom Lieben und Sterben, von Verantwortung und Glück – vom Leben, das der Derwisch eine Reise nennt. «David Wagner berührt die ganz großen Fragen. Was heißt es, auf der Welt zu sein? Was ist das Leben?» Dirk Knipphals, die tageszeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
David Wagner
Leben
Über dieses Buch
«Wann passiert es schon, daß einem die Verlängerung des eigenen Lebens angeboten wird?»
Der Anruf kommt um kurz nach zwei. Ein junger, sterbenskranker Mann geht ans Telefon, und eine Stimme sagt: Wir haben ein passendes Spenderorgan für Sie. Auf diesen Anruf hat er gewartet, diesen Anruf hat er gefürchtet. Soll er es wagen, damit er weiter da ist für sein Kind? Er nimmt seine Tasche und läßt sich ins Berliner Virchow-Klinikum fahren.
Von der Geschichte und Vorgeschichte dieser Organtransplantation handelt «Leben»: von den langen Tagen und Nächten im Kosmos Krankenhaus neben den wechselnden Bettnachbarn mit ihren Schicksalen und Beichten – einem Getränkehändler etwa, der heimlich seine Geliebte besucht, oder einem libanesischen Fleischer, der im Bürgerkrieg beide Brüder verlor. Beim Zuhören bemerkt er zum ersten Mal, daß auch er schon ein Leben hinter sich hat. Und da, in seinem weißen Raumschiff Krankenbett, unterwegs auf einer Reise durch Erinnerungs- und Sehnsuchtsräume, kreisen die Gedanken: Wen hat er geliebt? Für wen lohnt es sich zu leben? Und welcher Mensch ist gestorben, so daß er weiter leben kann, möglicherweise als ein anderer als zuvor?
David Wagner hat ein berührendes, nachdenklich stimmendes, lebenskluges Buch über einen existentiellen Drahtseilakt geschrieben. Ohne Pathos und mit stilistischer Brillanz erzählt er vom Lieben und Sterben, von Verantwortung und Glück – vom Leben, das der Derwisch eine Reise nennt.
«David Wagner berührt die ganz großen Fragen. Was heißt es, auf der Welt zu sein? Was ist das Leben?»
Dirk Knipphals, die tageszeitung
Impressum
Die Arbeit des Autors am vorliegenden Buch wurde durch den Deutschen Literaturfonds e.V. gefördert.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2014
Copyright © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München
Umschlagabbildung Bettmann/Corbis
ISBN 978-3-644-02811-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Motto
Blut
Indikation: Anamnestisch bekannte ...
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Mein weißer Wal
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
Als die Kinder schliefen
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
Incipit vita nova
Leere Seite
Schwarze Seite
Die ausführliche Anamnese ...
Und so ist ...
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
Die Transplantatfunktion war ...
104. Kapitel
105. Kapitel
106. Kapitel
107. Kapitel
108. Kapitel
109. Kapitel
110. Kapitel
111. Kapitel
112. Kapitel
113. Kapitel
114. Kapitel
115. Kapitel
116. Kapitel
117. Kapitel
118. Kapitel
119. Kapitel
120. Kapitel
121. Kapitel
122. Kapitel
123. Kapitel
124. Kapitel
125. Kapitel
126. Kapitel
127. Kapitel
128. Kapitel
129. Kapitel
130. Kapitel
131. Kapitel
132. Kapitel
133. Kapitel
134. Kapitel
135. Kapitel
136. Kapitel
137. Kapitel
138. Kapitel
139. Kapitel
140. Kapitel
141. Kapitel
142. Kapitel
143. Kapitel
144. Kapitel
145. Kapitel
146. Kapitel
147. Kapitel
148. Kapitel
149. Kapitel
150. Kapitel
151. Kapitel
152. Kapitel
153. Kapitel
154. Kapitel
155. Kapitel
156. Kapitel
157. Kapitel
158. Kapitel
159. Kapitel
160. Kapitel
161. Kapitel
162. Kapitel
163. Kapitel
164. Kapitel
165. Kapitel
166. Kapitel
167. Kapitel
168. Kapitel
169. Kapitel
170. Kapitel
171. Kapitel
172. Kapitel
173. Kapitel
174. Kapitel
175. Kapitel
176. Kapitel
177. Kapitel
178. Kapitel
179. Kapitel
180. Kapitel
181. Kapitel
182. Kapitel
183. Kapitel
184. Kapitel
185. Kapitel
186. Kapitel
187. Kapitel
188. Kapitel
189. Kapitel
190. Kapitel
191. Kapitel
192. Kapitel
193. Kapitel
194. Kapitel
195. Kapitel
196. Kapitel
197. Kapitel
198. Kapitel
199. Kapitel
200. Kapitel
201. Kapitel
202. Kapitel
203. Kapitel
204. Kapitel
205. Kapitel
206. Kapitel
207. Kapitel
208. Kapitel
209. Kapitel
210. Kapitel
211. Kapitel
212. Kapitel
213. Kapitel
214. Kapitel
215. Kapitel
216. Kapitel
217. Kapitel
218. Kapitel
219. Kapitel
220. Kapitel
221. Kapitel
222. Kapitel
223. Kapitel
224. Kapitel
Die müde Giraffe
Normosome Konstitution in ...
Ich darf packen ...
225. Kapitel
226. Kapitel
227. Kapitel
228. Kapitel
229. Kapitel
230. Kapitel
231. Kapitel
Schnee
232. Kapitel
233. Kapitel
234. Kapitel
235. Kapitel
236. Kapitel
237. Kapitel
238. Kapitel
239. Kapitel
240. Kapitel
241. Kapitel
242. Kapitel
243. Kapitel
244. Kapitel
245. Kapitel
246. Kapitel
247. Kapitel
248. Kapitel
249. Kapitel
250. Kapitel
251. Kapitel
252. Kapitel
253. Kapitel
254. Kapitel
255. Kapitel
256. Kapitel
257. Kapitel
258. Kapitel
259. Kapitel
260. Kapitel
261. Kapitel
262. Kapitel
263. Kapitel
264. Kapitel
265. Kapitel
266. Kapitel
267. Kapitel
268. Kapitel
269. Kapitel
270. Kapitel
271. Kapitel
272. Kapitel
273. Kapitel
274. Kapitel
275. Kapitel
276. Kapitel
277. Kapitel
Epilog
Alles war genau so
und auch ganz anders
Blut
Kurz nach Mitternacht komme ich nach Hause. Das Kind ist bei seiner Mutter, die Freundin nicht da, ich bin allein in der Wohnung. Im Kühlschrank finde ich ein angebrochenes Glas Apfelmus, beginne zu löffeln und schaue dabei in die Zeitung, die noch auf dem Küchentisch liegt, ich lese etwas über Mücken und die Frage, warum sie bei Regen nicht von den fallenden Tropfen erschlagen werden. Noch bevor ich genau verstanden habe, wie sie überleben, kratzt mich etwas im Hals. Habe ich mich verschluckt? An Apfelmus?
Ich stehe auf, gehe ins Bad, sehe in den Spiegel und finde nichts Besonderes, alles wie immer, ich bin ein wenig blaß vielleicht. Weil ich nun aber schon im Badezimmer bin, will ich mir auch die Zähne putzen, ich will ja bald ins Bett – spüre im selben Augenblick aber, daß ich mich gleich übergeben muß. Ich drehe mich um, beuge mich über die Badewanne, da schwappt es schon aus mir heraus. Als ich die Augen öffne, wundere ich mich über das viele Blut in der Wanne. Langsam läuft es Richtung Abfluß.
Ich weiß, was das bedeutet. B., mein Arzt, der mich seit meinem zwölften Lebensjahr behandelt, hat mich oft genug, seit Jahren schon, gewarnt. Ich weiß, daß die Ösophagusvarizen, die Krampfadern in meiner Speiseröhre, geplatzt sind, ich weiß, daß ich nun nach innen blute und nicht ohnmächtig werden darf, ich muß den Notarzt rufen. Trotzdem überlege ich, ich überlege sehr langsam, mit einem Taxi in die Klinik zu fahren, entscheide mich dann aber doch für den Notarzt. Im Spiegel sehe ich, daß ich noch bleicher geworden bin, gehe das Telefon suchen und finde es im Arbeitszimmer auf dem Schreibtisch. Es gelingt mir tatsächlich, den falschen Notruf zu wählen, ich wähle eins-eins-null und höre eine Stimme sagen: Für einen Rettungswagen müßten Sie schon die eins-eins-zwei anrufen. Ich lege auf und frage mich, ob das ein Zeichen war. Soll ich lieber zu Hause bleiben? Ist es vielleicht übertrieben, einen Krankenwagen zu rufen? Ich warte eine Minute, das Telefon in der Hand, und sage mir dann, daß ich hier besser nicht verbluten sollte, nächste Woche, noch sind Osterferien, ist das Kind ja wieder da. Also wähle ich, das geht ganz leicht, die Tasten liegen nebeneinander, eins-eins-zwei. Eine freundlichere Stimme meldet sich und sagt, ich solle die Wohnungstür öffnen und offen lassen – ich entschließe mich jedoch dazu, Schuhe und Mantel wieder anzuziehen und dem Arzt entgegenzugehen. Ich weiß ja, hier kann er nichts für mich tun, ich muß ins Krankenhaus.
Ich begegne dem Notarzt und den beiden Rettungssanitätern im Treppenhaus, grüße und sage: Ich bin’s, ich muß in die Klinik, und merke gleich, sie halten mich für einen Simulanten, sie haben die Badewanne nicht gesehen. Im Krankenwagen, ich sitze auf dem Transportstuhl, Rücken in Fahrtrichtung, weiß der Arzt nichts mit mir anzufangen, er sieht sich meinen Notfall- und den Organspendeausweis an. Ich sage, ich muß ins Virchow, Charité Campus Virchow, berichte von meiner Autoimmunhepatitis, der Zirrhose, den Ösophagusvarizen und dem Überdruck in den Gefäßen vor meiner kranken Leber, ich spreche und spreche, da spüre ich wieder etwas im Hals. Eine Hand bekomme ich noch vor den Mund, doch das Blut schießt schon mit solcher Gewalt aus mir heraus, daß ich den halben Wagen vollspritze. Eine Szene wie in einem Splatterfilm, über die ich lachen könnte, nur daß hier leider kein Kunstblut spritzt. Der Notarzt, mein Blut läuft ihm über beide Brillengläser, wirkt erschrocken. Er legt mir einen Zugang und gibt Kochsalzlösung, der Wagen fährt endlich an. Kurze Zeit später, ich sehe die Wipfel der Straßenbäume und die Sterne über mir – warum, wundere ich mich, hat dieser Rettungswagen nun kein Dach mehr –, muß ich mich wieder übergeben. Im Liegen treffe ich nur halb in die durchsichtige Tüte, die mir hingehalten wird, das meiste geht daneben, schwappt auf den Boden, und ich weiß, wird diese Blutung nicht schnell gestoppt, bin ich bald tot.
Indikation: Anamnestisch bekannte gastrointestinale Blutung. Anamnestisch bekannte Varizenerkrankung.
Medikation: 100 mg i.v. Propofol.
Befund: Im unteren Drittel des Ösophagus sind vier Varizenstränge von mehr als 5 mm Durchmesser zu sehen (Varizen ragen 50% des Lumendurchmessers vor bzw. berühren sich, Grad III). An der Minorseite reichen die Varizen bis unterhalb der Kardia. Auf den Varizen red colour signs. Es liegt eine aktive Blutung vor. Der Magen ist mit Koageln gefüllt, unzureichende Beurteilung.
Therapie: In einer Höhe von 34 cm bis 39 cm von der Zahnreihe werden sechs Gummibandligaturen gesetzt, die Blutung kommt unter endoskopischer Therapie zum Stillstand.
1
Ich wache auf und weiß nicht, wo ich bin. Ein Schlauch steckt in meiner Nase, frische, kühle Luft, Bergluft mit Beigeschmack, strömt in mich herein. Ein halbvereister Waldbach gluckert zwischen hohen Tannen, weißgefrorene Gräser glitzern in der Sonne – offenbar male ich mir ein Kalenderbild aus. Ich höre Gestöhne und ein Stimmendurcheinander, höre es tropfen und rauschen und spüre eine Hand an meinem linken Oberarm, sie packt zu, ja, halt mich, halt mich fest – und läßt dann doch wieder los. Es ist keine Hand, merke ich bald, es ist ein automatisches Blutdruckmeßgerät mit einer Manschette, die sich jede Viertelstunde aufbläst, den Blutdruck mißt, ihn aufzeichnet und dann wieder erschlafft. Hört sich an, als puste jemand in eine Luftmatratze. Auf dieser Luftmatratze treibe ich aufs Meer.
2
Sie stehen am Ufer und winken. Sie warten auf mich, sie haben sich eingefunden, meine Mutter, meine Großmutter, Rebecca, Alexandra, mein Großvater in Uniform und meine Urgroßeltern, die ich nicht auf den ersten Blick erkenne, weil ich sie nie zuvor gesehen habe. Sie sind gekommen, um mich zu begrüßen, sie stehen am Strand und winken, ja, tatsächlich, ich höre sie schon rufen, sie rufen: Willkommen, da bist du ja – dann aber bricht eine größere Welle und wirft mich nicht auf den Strand, wie ich es erwartet hatte, nein, eine Unterströmung zieht mich wieder hinaus aufs Meer, weit hinaus, rasch verliere ich das Ufer aus den Augen.
3
Ich öffne die verkrusteten Augen, alles ist verschwommen. Ein Raum voller Farbflecken – das aber, fällt mir ein, könnte daran liegen, daß ich meine Brille nicht trage. Keine Ahnung, wo die geblieben ist. Einige Dinge kann ich trotzdem erkennen, ich muß die Augen nur leicht zusammenkneifen: Rechts befindet sich ein Fenster, links eine Tür, die Tür steht offen. Sehr viele Apparate um mich herum, Kabel, drei oder vier Monitore, ich höre ein Piepen. Kommandozentrale? Mir gefällt mein Raumschiff, ich bin so leicht, schwerelos, ich kann fliegen.
4
Hell ist es oben über der Stadt, ich schwebe und schaue hinab. Ich sehe und weiß auf einmal alles wieder, ich habe nichts vergessen. Die Flachdächer der Klinik, die weißen Kiesel, der Kanal, das Kraftwerk und die Gleise, all das kann ich sehen, ich liege, ich fliege über der Stadt – erst nach Minuten, Stunden oder Tagen muß ich zurück in meine Haut, in dieses Bett.
5
Ach was, ich liege nicht auf dem Friedhof, ich liege nicht in der Erde. Es wird hell und dann wieder dunkel. Ich liege in einem Bett im Krankenhaus, in einem Bett auf Rädern, ich kann hinausgeschoben werden. Drehe ich meinen Kopf, sehe ich den Himmel. Heute ist er weiß, kahle Birkenzweige hängen in den Vordergrund. Das Fenster ist gekippt, die kalte Luft riecht frisch und süß, ich höre Vögel, sie tschilpen vielversprechende Geräusche. Ein Sonnenstrahl bricht durch die Wolkendecke, auf der anderen Seite des Geländes, hinter der roten Ziegelmauer, jenseits der Seestraße, liegt, ich war schon dort, ein Friedhof.
6
Mir wird der Rücken gewaschen, mir werden die Zähne geputzt. Ich muß nichts tun, ich muß nur liegen. Ich muß nicht einmal essen, eine Schwester bringt mir Astronautennahrung, Flüssigmahlzeiten, die alles enthalten, was ein Körper braucht. Der Astronautentrunk schmeckt nach Banane. Und nun weiß ich es, weiß ich es ganz genau: Dieses Zimmer ist wirklich mein Raumschiff, und ich bin unterwegs zum Mars. Mindestens bis zum Mars. Das müßte selbst bei einer günstigen Konstellation der Umlaufbahnen fast ein Jahr dauern. Oder länger. Ich stelle mich darauf ein, ich bleibe.
7
Meine Brille ist wieder da. Ich setze sie auf, schaue mich um und setze sie wieder ab. Ich glaube, ich möchte das alles nicht so genau sehen.
8
Ich frage nach B. und höre, er sei nicht da, er habe Urlaub. Ein Gastroenterologe kommt ins Zimmer und berichtet, wie es gelungen ist, die Varizenblutung zu stoppen. Es wurde endoskopisch ligiert, das heißt, mir wurde ein Schlauch in die blutende Speiseröhre geschoben, in dem Schlauch befand sich eine Apparatur, durch die sich Gummiclips auf die geplatzten Krampfadern setzen ließen, so wurden die blutenden Krampfadern abgeklemmt. Ich hatte Glück, es gibt diese Technik noch nicht lange. Noch vor zwanzig Jahren war bei solchen Blutungen nicht viel zu machen. Ich habe ein paar Liter Blut verloren, mein Hämoglobinwert ist schlecht, und die Leberwerte, das liegt auch an dem Eiweißschock nach so viel Blut im Magen, sind noch schlechter. Aber ich lebe.
9
Ein Patient, ich kann ihn nicht sehen, höre ihn aber durch die offene Tür, beschwert sich, daß in den Zimmern keine Uhren hängen. Er will beobachten, wie schnell oder wie langsam die Zeit vergeht. Ob sie überhaupt noch vergeht? Und wenn ja, in welche Richtung? Ich bin mir da nicht mehr so sicher.
10
Von der Intensivstation werde ich auf die Gastro, die gastroenterologische Normalstation, verlegt. Hier liegen, ich muß bald darüber lachen, die Gastronomen. Einen Vormittag lang, dann wird er entlassen, liegt ein Koch mit mir im Zimmer, ihm folgt ein Kellner. Der Kellner zählt mir alle Ost-Berliner Schütten auf: Truxa Bierbar, Bornholmer Hütte, Metzer Eck, Oderkahn und Trümmerkutte – die war damals in der Kastanienallee Ecke Oderberger Straße, in dem Haus, in dem sich heute der Kopierladen befindet, seiner Erzählung nach eine Absturzkneipe. Er war Ober im Operncafé, und als Ober des Operncafés, in der DDR waren Kellner mächtige Menschen, konnte er überall saufen. Umsonst. Na ja, das rächt sich heute, sagt er.
Der Kellner darf nach Hause, nun liegt ein Fleischer neben mir. Der Fleischer ist fünfundvierzig Jahre Fleischer gewesen, ganz schön lange, ganz schön viel Wurst. Ja, wir hatten immer gut zu essen, sagt er, gehungert haben wir nie. Die letzten zehn Jahre habe die Arbeit ihm allerdings nicht mehr viel Spaß gemacht, die Fleischerei, in der er vierundzwanzig Jahre beschäftigt gewesen sei, habe schließen müssen, danach habe er in einer Wurstfabrik gearbeitet. Das Zeug, das er da hergestellt habe, also, privat habe er das nicht essen wollen. Letztes Jahr sei er sechzehn Wochen auf Station gewesen. Er hat es schon mit vielen ausgehalten, wir lassen uns in Ruhe.
11
Eine der Schwestern kommt ins Zimmer und sagt, der Transport sei da. Ich muß zur Sonographie, darf aber liegenbleiben. Wie weitläufig die Klinik ist. Kilometerlange Korridore, fast alle Gebäude sind miteinander verbunden, unter der Erde gibt es Bettenautobahnen. Das Krankenhausbett ist eigentlich ein Fahrzeug, es hat vier Räder, es ist ein Krankenwagen, ich liege und gleite dahin, werde über lange Flure gefahren und in einen Aufzug geschoben. Ich denke an einen Einkaufswagen, dann an einen Kinderwagen, heute schiebt mich ein Afrikaner. Im Aufzug und im Durchgang unter der Mittelallee, über uns die Wurzeln der Kastanien, singt er vor sich hin. Ich frage ihn, was er singe und was es für eine Sprache sei. Eine Sprache der Elfenbeinküste, sagt er, und als ich weiter nachfrage, erzählt er, er sei in Paris geboren, im 19. Arrondissement, Frankreich und die Franzosen könne er aber, obwohl er selbst Franzose sei, nicht leiden. Er habe achtzehn Jahre dort gelebt, das reiche ihm, für immer, sagt das alles auf Französisch.
Habe ich nicht einmal in Paris gewohnt, in Barbès, rechts des Boulevard Rochechouart, und bin jeden Tag über den Markt der Goutte d’Or gegangen? Ich liege, er schiebt. Ich würde ihn gern fragen, traue mich allerdings nicht, ob ihm schon mal ein Patient gestorben ist, unterwegs.
12
Bin ich vielleicht doch schon tot? Geht mich das alles gar nichts an? Schaue ich nur noch zu? Vielleicht träume ich diese Gegenwart bloß, und Jenseits heißt, in einem Bett zu liegen und sich an Episoden seines Lebens erinnern zu müssen, ob ich will oder nicht. Gestern oder vorgestern war meine Beerdigung, vielleicht ist sie aber auch erst heute. Oder morgen.
13
Im Zimmer komme ich wieder an den Tropf, ich höre ihn nicht, sehe ihn bloß tropfen und schaue ihm dabei zu.
14
Der Fleischer erzählt, er habe früher hundertfünfundfünfzig Kilo gewogen, habe halt immer gern gegessen, immer schön Haxe, schön Bierchen, das habe er jetzt davon, eine Fettleber, nu warte ick uff eene neue. Er hat Aszites, schleppt immer zwei Bierkästen Flüssigkeit in seinem Bauch herum, ächzt sich aus dem Bett, immerhin, er kann noch aufstehen. Na ja, sagt er, braucht man sich och keene Langspielplatte mehr koofen.
Der Satz geht mir im Kopf herum. Soll ich mir noch eine Langspielplatte kaufen? Lohnt sich das noch? Wie lange dauert es, bis das Kind alt genug ist? Und wie lange, ich verstehe Langspielplatte auf einmal ganz wörtlich, habe ich mir eigentlich schon keine Platte, keine LP mehr gekauft? LP war einmal eine wichtige, sehr vertraute Abkürzung, wer sich LPs kaufte, damals, als Musik noch gekauft wurde, war fast schon erwachsen, LP-Käufer verstanden etwas von Musik, hatten die Phase, in der sie sich bloß für einzelne Hits begeisterten und Singles kauften, schon hinter sich. Eine LP kostete Geld, viel Geld, fast einen Monat Taschengeld.
15
Besucher bringen Blumen mit, bald sieht es aus wie in einem Blumenladen. Oder wie auf einer Beerdigung. Nach draußen, auf den Flur vor die Tür, werden die Sträuße zur Nacht nicht mehr gestellt, als Kind habe ich das im Krankenhaus noch erlebt. Die Schwester, die ich danach frage, antwortet, sie hätten genug zu tun, außerdem sei es gar nicht nötig. Solange, was viel wichtiger sei, hin und wieder gelüftet werde, bekomme jeder Patient genug Sauerstoff.
16
Das Kind kommt mich nicht besuchen, seine Mutter meint, es solle mich nicht so sehen. Sie hat nicht unrecht, ich möchte mich so auch nicht sehen.
17
Ich mag das frische Bettzeug. Die Bezüge und das Laken fühlen sich hart und zugleich weich und immer sauber an. Ich werde versorgt, ich werde gepflegt, alles wird für mich getan, mir wird geholfen, es geht mir gut, es geht mir immer besser, ich bin gerettet.
18
Schaut mein Bettnachbar fern, er hat seine Kopfhörer eingestöpselt, schaue ich manchmal mit und sehe sonderbare Menschen, die sonderbare Dinge tun, ich genieße das stumme Fernsehen. Der Bildschirm hängt unter der Decke, steuern läßt er sich über die Tasten der altertümlichen elfenbeinfarbenen Telefonapparate, die auf unseren Nachttischen stehen. Fernsehen ist hier allerdings kein Vergnügen, der Monitor, ein schwerer, quadratischer Röhrenmonitor, ist viel zu weit oben montiert, zudem ist das Umschalten mühsam, für jeden Programmwechsel muß eine neue, nicht unkomplizierte Tastenkombination gedrückt werden, woraufhin der Bildschirm sich verdunkelt und dunkel bleibt, bis vier Sekunden später das gewünschte Programm aufflackert. Manchmal jedoch auch nicht. Vier Sekunden können sogar im Krankenhaus sehr lang sein, so macht Zappen keinen Spaß.
19
Als ich dreizehn war und einige Wochen im Krankenhaus lag, schleppte mein Vater unseren kleinen Sony an. Damals gab es noch keine Fernseher auf den Zimmern, wenigstens nicht in dem Krankenhaus, in dem ich Patient war, und schon gar nicht auf der Kinderstation. Wer ein kleines, transportables Gerät hatte, brachte es mit oder ließ sich eines bringen. Meines, aus dem Arbeitszimmer meiner Mutter, eigentlich viel zu groß für den Nachtschrank, zeigte mir, wie die Raumfähre Challenger explodierte. Ich sah sie immer wieder explodieren, wieder und wieder flog sie auseinander, ein Feuerwerk, meine erste große Fernsehkatastrophe – deren Bilder sich nun in meinem Kopf mit denen der nächsten großen Fernsehkatastrophe, der einstürzenden Twin Towers, vermischen. Die Türme fallen, die Raumfähre explodiert, und mir ist auf einmal so, als hätte ich schon damals, auf der Kinderstation, als die Challenger verunglückte, gewußt, daß die Sache mit der Raumfahrt damit vorbei war. Raumfahrt war eine Zukunft der sechziger Jahre, eine Zukunft von gestern, die sich nicht realisierte. Niemand flog mehr auf den Mond, niemand brach auf zum Mars.
20
Das Bett läßt sich verstellen. Ich kann die Liegefläche anheben und senken und Kopf- und Fußteil anwinkeln, aber ich darf es mir, denke ich, nicht zu bequem machen. Sonst will ich am Ende nicht mehr aufstehen.
21
Samstags gibt es nur Eintopf, sonntags keine Visite. Montags weht Geschäftigkeit über den Flur, als ob für die beiden betriebsärmeren Tage davor nachgearbeitet werden müßte. Sonst unterscheiden die Tage sich nicht besonders. Eintopf gab es auch in meiner Kindheit, samstags, Erbsen oder Linsen, die einfache Küche, weil meine Mutter unterwegs war oder keine Lust zu kochen hatte.
Ich darf wieder essen, bin dabei allerdings sehr vorsichtig. Erst einmal esse ich nur Püriertes, ich habe Angst, mich beim Schlucken zu verletzen. Könnte nicht irgend etwas, was nicht ausreichend gekaut wurde, ein scharfkantiger, zu hastig geschluckter Bissen, wieder ein Gefäß zum Platzen bringen? An das Blut in der Speiseröhre erinnere ich mich lieber nicht.
22
Ich spüre die Armbanduhr an meinem Handgelenk, die Uhr meines Vaters, die sich selbst aufzieht, sie ist, bemerke ich, stehengeblieben. Auf dem Uhrenglas sind zwei winzige rote Flecken, Blutspritzer, zu sehen, ich kratze sie ab und bewege meinen Arm ein paarmal hin und her, bis der Sekundenzeiger wieder anspringt. Die Uhr geht, zeigt aber nicht die richtige Zeit. Manchmal, wenn ich ein wenig Kraft übrig habe, bewege ich den Arm, damit sie nicht so bald wieder stehenbleibt. Dann komme ich mir vor, als winkte ich jemandem, der gar nicht da ist, zu.
23
Ich schlafe in einer Außenkabine, in der Bordwand ein Bullauge, ich sehe Wasser, viel Wasser, manchmal zieht eine Insel vorbei, ein U-Boot taucht auf, ein Eisberg treibt dahin oder ein einsamer Schwimmer, der fast schon aufgegeben hat. Das muß die Vergangenheit sein.
Ich habe mich eingeschifft, ich bin an Bord, es geht einmal durch mein Krankenzimmer, vom Kissen zum Nachtschrank, vom Nachtschrank zum Wandschrank, vom Wandschrank zum Tisch, auf den Stuhl, ans Fenster, ins Bad, zum Fernseher an der Wand und weiter. Ich bin unterwegs, im Bett geht es hinaus, der Transport schiebt, die Krankheit ist die große Reise, le grand tour, einmal in die Unterwelt und vielleicht zurück. Krankheit ist vakante Zeit, ist, habe ich das nicht irgendwo gelesen, die Reise der Armen.
24
Eine blaue Ecke Himmel oben im Fenster, ich rieche die Rosen auf dem Nachttisch und die frische, noch steife Bettwäsche, mir gefallen die eingewirkten blaßblauen Streifen, der Stoff liegt glatt auf meiner Haut. Schöne Blumen auf Ihrem Nachttisch, sagt die Schwester, draußen leuchtet der Tag, was dem, der nicht hier ist, vielleicht gar nicht auffällt. Sie legt mir, wie jeden Tag, die Manschette des Blutdruckmeßgeräts um den Oberarm, schließt den Klettverschluß – Blutdruckmeßgeräte, das habe ich schon bemerkt, haben sehr laute Klettverschlüsse, ich freue mich schon auf das Geräusch, wenn sie den Verschluß gleich wieder öffnet –, pumpt die Manschette mit dem Ball in ihrer linken Hand auf und läßt die Luft anschließend langsam ab, sie hat das Endstück des Stethoskops auf die Haut meiner Armbeuge gepreßt, horcht und behält das Manometer im Auge. Eigentlich bräuchte sie mehr Hände, eine für das Stethoskop, eine zur Regulierung des Ventils am Manometer, eine für meinen Arm. Sie hat allerdings, wie ich, nur zwei.
Mir gefällt die Berührung.
Mein weißer Wal
Nach neun Tagen darf ich nach Hause. Das Apfelmus steht noch auf dem Tisch, die Badewanne sieht nicht schön aus. Die Tochter ist zurück von ihrer Reise, kommt mit ihrer Mutter vorbei und wundert sich, sie ist ja erst drei, über diesen schwachen Vater. Geh doch richtig, sagt sie, als ich aufstehe und ein, zwei, drei, vier Schritte versuche. So mußt du gehen, sagt sie und macht es mir vor: hoch aufgerichtet, gerade, ausschreitend. Ein Vater, ich erinnere mich, soll groß, stark, unverletzlich, ja unsterblich sein.
Frau Rutschky bringt Rinderbraten, ich liege auf dem Bett, schlafe viel, schaffe es kaum bis ins Bad und schaue Serien, viele Folgen, ich habe Zeit. Ich sehe Six Feet Under und The Sopranos und Lost.
Eine Woche später blute ich wieder, fahre wieder ins Krankenhaus, diesmal, das Blut sickert nach innen, tatsächlich mit dem Taxi. In der Notaufnahme werde ich ohnmächtig, wieder OP, wieder Ligaturen, wieder Intensivstation. Ich habe nicht mehr viel Blut, bekomme zwei Beutel Plasma.
25
Als ich aufwache, sehe ich B. in meinem Zimmer. Er lacht und gratuliert mir: Daß ich noch da sei, daß ich noch lebte, sei ein kleines Wunder. Er spricht weiter, ich höre zu, ich mag seine Stimme, ich kenne sie ja schon lange, seit vierundzwanzig Jahren. Und ich weiß, was diese Stimme gleich sagen wird, ich weiß, daß ich wieder auf die Liste muß, ich muß zurück auf die Warteliste für eine neue Leber, auf der ich schon einmal, bis vor ein paar Monaten, stand. Sie müssen wieder auf die Liste. Ja, sage ich, ich weiß.
26
Die Werte sind schlecht, ich muß im Krankenhaus bleiben.
Ich liege eine Weile, langweile mich und lerne langsam wieder gehen. An der Hand einer Physiotherapeutin krieche ich über den Flur, sie ermahnt mich, die Füße zu heben, nicht zu schlurfen. Ich schlurfe weiter, weil ich sie noch einmal bitte nicht schlurfen sagen hören möchte, auch ihre Stimme gefällt mir. An ihrer Hand wanke ich bis zum Ende des Flurs und schaue, wir stehen nebeneinander, auf den Hubschrauberlandeplatz, ein großes H markiert die Landefläche. Auf einmal habe ich die Phantasie, mit ihr, der hübschen Physiotherapeutin, deren Stimme mir so gut gefällt, dort unten in einen Hubschrauber zu steigen und in den graumelierten Himmel zu fliegen, irgendwohin, ich träume die große Flucht. Die Physiotherapeutin aber sagt, wir müßten weiter, zurück über den Flur, vorbei an schief eingerahmten Kalenderbildern, die links und rechts an den Wänden hängen: dem Seljalandsfoss, einem Wasserfall auf Island, den Moai-Statuen auf der Osterinsel und zwei Tafelbergen bei Sonnenuntergang, Monument Valley, Utah, die Dinger aus der Zigarettenwerbung und den Western von John Ford. Das Blatt ist im Rahmen verrutscht.
Am anderen Ende des Flurs gelangen wir zu einer Sitzgruppe, ein Tisch aus weißem Drahtgeflecht und drei Stühle stehen dort, nur zwei von ihnen haben Polster. Eine weiße Orchidee – vielleicht aus Plastik? Nein, diese Pflanzen sehen halt so aus – blüht in einem sonst leeren Regal. Immer noch an der Hand der Physiotherapeutin, sie heißt, ihr Namensschild verrät es mir, Johanna, drehe ich mich um und wanke wieder Richtung Hubschrauberlandeplatz. An der Wand fällt mir ein weiteres Kalenderbild auf, die Trauminsel Bora Bora, Französisch-Polynesien, die Farben des Fotos ausschließlich Grün, Türkis und Blau. Und ich sage: Johanna, da möchte ich mit Ihnen hin.
27
Ich schaffe es wieder, das Leben nennt der Derwisch eine Reise, bis ins Bad. Immerhin.